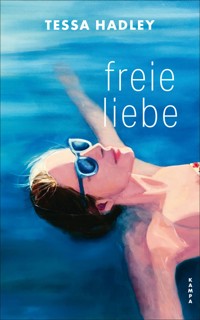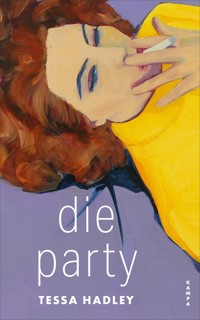
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bristol in den 1950er-Jahren. Evelyn kann ihr Glück kaum fassen: Sie, die eigentlich vor allem und jedem Angst hat und in deren Leben nie irgendetwas passiert, ist zu einer Party eingeladen. Einer echten Party in einem heruntergekommenen Pub am Hafen mit furchtbar schlechtem Ruf. Einer richtigen Party mit den Freundinnen und Freunden ihrer älteren Schwester, der schönen und mutigen Moira, die Evelyn so bewundert. Wie gern würde sie zu ihnen gehören, die Kunst oder Mode studieren. Was die jungen Leute eint, ist ihr Wunsch, auszubrechen aus den einfachen Verhältnissen, in denen sie aufgewachsen sind, und ein eigenes Leben zu führen. Mitten im Leben scheinen Paul und Sinden zu stehen, zwei Männer der Upper Class, die unverhofft in der Hafenkneipe auftauchen: weltgewandt, kultiviert, überheblich. Evelyn und Moira finden sie faszinierend und abstoßend zugleich, bewundern ihre Selbstsicherheit, hadern mit den eigenen Zweifeln und ihrem Gefühl der Unterlegenheit. Doch dann wagen sie den Schritt ins Unbekannte und steigen in den Bentley …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 124
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Tessa Hadley
Die Party
Roman
Aus dem Englischen von Marion Hertle
Kampa
Für Gilly
Und für die Happy Cranes
Tom, Tim und Jenny
1Vincents Party
Die Party war in vollem Gang. Evelyn konnte denverführerischen Jazz schon hören, als sie bei St Mary Redcliffe aus dem Bus stieg und über die Straße zum Steam Packet hinüberging, dem Pub, den Vincent – ein Freund von Evelyns älterer Schwester Moira – an diesem Abend in Beschlag genommen hatte. Er hatte beschlossen, dass alle eine Party bräuchten, um auf andere Gedanken zu kommen; der Winter war hart, und jetzt im Februar verwandelte der unablässige Regen den Schnee in Matsch. Auch an diesem Abend regnete es wieder; die Scheibenwischer des Busses waren den ganzen Weg in die Stadt über ihrem dumpfen Rhythmus gefolgt, die Bürgersteige glänzten dunkel und nass, in den Bordsteinrinnen lief das Wasser. Schmutzige, formlose Schneereste waren noch an den Straßenecken und in den tiefen Aussparungen zwischen Gebäuden festgefroren oder lagerten bedrohlich in den klaffenden Bombenlücken. Beim Überqueren der Straße musste Evelyn ihren Regenschirm aufspannen – eigentlich gehörte er ihrer Mutter, der alte grüne Schirm mit der angeknacksten Rippe und dem Entenkopfgriff, den sie sich, ohne zu fragen, beim Verlassen des Hauses ausgeliehen hatte, weil sie ihren eigenen irgendwo verloren hatte. Wahrscheinlich bekam sie deshalb morgen Ärger, aber das kümmerte sie im Augenblick nicht, sie war zu aufgeregt und voller Vorfreude. Zwischen jetzt und morgen konnte einfach alles geschehen. Evelyn konnte ihr Glück kaum fassen, sie war zu einer echten Party unterwegs – und zwar nicht zu irgendeiner normalen, langweiligen Party, sondern einer richtigen, wilden Party mit den Freunden ihrer Schwester, in einem ziemlich heruntergekommenen alten Pub mit furchtbar schlechtem Ruf gleich über dem schwarzen Wasser der Docks im Hafen. Wenn ihre Eltern gewusst hätten, wo die Party stattfindet, hätten sie sie niemals gehen lassen, aber sie hatte sie angelogen, ohne mit der Wimper zu zucken, und gesagt, Moira habe versprochen, auf sie aufzupassen, und sie würden sich in den Victoria Rooms treffen. Sie war stolz auf sich. Wer konnte schon ahnen, dass man vormittags in der Sonntagsschule unterrichten und die Kinder Bilder von Jesus mit einer Laterne in der Hand und einem verlorenen Schäfchen unter dem Arm mit Wachsmalkreiden ausmalen ließ und am Abend die eigenen Eltern mit so perfekt gespielter, zuckersüßer Unschuld anlügen konnte?
Der Regen war egal, Evelyn machte er gar nichts aus. Sie hüpfte über die kleinen Bäche auf der Straße, weil sie ihre schicken, aber völlig ungeeigneten schwarzen Ballerinas nicht ruinieren wollte, und genoss den Kontrast zwischen der desolaten Welt, die sie umgab, und dem hitzigen Leben, das in ihr brannte. Beim Bus-Center hatte sie die Linie wechseln müssen und war in einer Kabine der Damentoilette aus ihren Gummistiefeln und auch aus dem braven Wollkleid geschlüpft, das sie über ihr eigentliches Party-Outfit angezogen hatte, damit ihre Eltern nicht sahen, was sie wirklich trug: Hautenge schwarze Hosen, mit Reißverschluss an der Innenseite der Unterschenkel, schwarzer Pulli mit Polo-Kragen, breiter roten Ledergürtel mit schwarzer Schnalle. Evelyn war sehr schlank, hatte einen langen Hals – einen Schwanenhals, wie sie fand –, einen flachen Bauch und hervorstehende Hüftknochen; sie hoffte, sie würde spektakulär aussehen, die Haare aus dem Gesicht frisiert wie eine Tänzerin, die Brüste in einem neuen Büstenhalter in Form gerückt. Sie sehnte sich so sehr nach dem Augenblick, wenn sie ihren dicken Wintermantel ausziehen und sich enthüllen würde, wie sie ihn fürchtete. Zugegebenermaßen fürchtete sie sich vor allem: Ein Teil von ihr wollte direkt wieder in den 28er-Bus steigen und nach Hause fahren. Sie hatte sich in dem Stahlblech über dem Waschbecken der Damentoilette, das als Spiegel dienen sollte, angesehen und sich große falsche Perlen an die Ohren geklippt – ebenfalls von ihrer Mutter – und klebrigen roten Lippenstift aufgetragen. Die Stiefel und das Kleid steckten jetzt in einer Einkaufstüte, die sie irgendwo deponieren und später zusammen mit Mantel und Schirm wieder abholen musste.
Die karge, breite Silhouette des Steam Packet, drei Stockwerke hoch, zeichnete sich deutlich ab vor den Lücken, die die Bomben in die Häuserzeilen gerissen hatten: Ganze Fensterreihen in den oberen Stöcken der Fassade waren unbeleuchtet oder vernagelt, aber aus dem Erdgeschoss drang verlockend ein gelbliches Licht. Der Lärm lauter Stimmen zog Evelyn an, schon jetzt begann sich ihr Körper im Takt der Musik zu bewegen. In ihren Augen hätte dieses alte Bristoler Pub auch irgendwo an den Docks von New Orleans liegen können, wovon sie keine genauen, aber gewaltige Vorstellungen hatte. Moira hatte nicht versprochen, auf sie aufzupassen. Genau genommen wusste Moira noch nicht mal, dass sie zur Party kam, und würde sie dort wahrscheinlich auch nicht haben wollen, aber Evelyn sehnte sich danach, zu den Freunden ihrer Schwester zu gehören. Die Mädchen waren zwei Jahre auseinander; Moira beschwerte sich darüber, dass ihre kleine Schwester immer ihren Freunden hinterherrannte, genau wie sie es schon als Kind getan hatte. Evelyn war ihnen dennoch fast immer hinterhergetrottet, wenn sie aus dem Haus geschoben wurden, um den Tag allein durchzustehen. Moira zerrte ihren kleinen Bruder im Kinderwagen ruckelnd hinter sich her, immer auf irgendeiner Mission mit ihrer Gang, drehte Blätter zu Zigaretten und rauchte sie, stieg auf das Dach des Glashauses im Park oder spionierte ihren Nachbarn aus, der nicht mehr alle Tassen im Schrank hatte und nackt im Garten herumlief.
Vincent war es gewesen, der Evelyn zu der Party eingeladen hatte, letzte Woche, als sie ihn zufällig auf dem Weg zu einer Vorlesung in der Queens Road getroffen und er ihr erzählt hatte, dass er den Besitzer des Steam Packet überredet habe, ihm den Laden für einen Abend zu überlassen. Vincent studierte genau wie Moira Kunst, aber er kannte alle: nicht nur die Kunst-Meute, sondern auch die Taxifahrer, die Buchmacher und die Pommesbudenbesitzer, die Wirte und Veteranen, denen seit dem Ersten Weltkrieg ein Arm oder Bein fehlte; er sprach stundenlang mit diesen Gestalten, ließ sich ihre Geschichte erzählen und hielt sie in cleveren Kohlezeichnungen in seinem Skizzenheft fest. Er hofierte eine zahnlose alte Frau, die einen Secondhand-Laden führte, wo Klamotten in einem moderigen dunklen Mulch hinter einem Glasfenster lagen; man könne die Motten und Flöhe schon zwischen den Kleiderschichten hüpfen sehen, kommentierte Moira. Diese Frau behielt bestimmte Dinge für Vincent zurück, sodass er in einer ledernen Fliegerjacke oder einem Abendmantel mit Futter aus rotem Satin zum Unterricht erschien; Moira weigerte sich, neben ihm zu sitzen, wegen der Flöhe, und weil die alten Klamotten nach dem Naphthalin von Mottenkugeln stanken. Vincent war groß, mit ungeduldigen, feuchten braunen Augen, einer dröhnenden Stimme und vielen walnussbraunen Locken. Er trug einen weichen schwarzen Filzhut mit weiter Krempe wie Augustus John und spielte in einer Jug-Band.
»Vincent sieht sehr gut aus«, hatte Evelyn mal probeweise zu Moira gesagt, die gerade zu Hause auf dem Esstisch einen Rock nach einem Papiermuster zuschnitt. Selbstbewusst fuhr sie mit ihrer Schere durch den Stoff, der sich sauber dahinter trennte. Sie studierte Mode am College und konnte nähen wie eine Schneiderin.
»Jaja.«
»Was meinst du mit jaja?«
»Still, Evelyn, ich muss mich konzentrieren. Ich weiß nicht: Er hat alle Zutaten, aber irgendwie ist er nicht attraktiv. Zumindest nicht für mich.«
Moiras Kritik war klug, schlicht und absolut.
Evelyn senkte die Stimme, damit ihre Mutter in der Küche sie nicht hören konnte. »Ist er schwul?«
»Liebe Güte, nein. Sei nicht idiotisch.«
»Woher soll ich das denn wissen? Ich habe noch nie einen Homosexuellen getroffen.«
»Du hast schon viele getroffen, hast es nur nie gemerkt. Die Hälfte der schrecklichen alten Jungfern, die an unserer Schule unterrichtet haben, zum Beispiel. Aber Vince nicht. Vince versucht bei allen zu landen. Er versucht es wahrscheinlich auch bei dir. Pass lieber auf. Außer natürlich, du findest ihn attraktiv.«
»Nein, ich glaube nicht«, sagte Evelyn.
Wie konnte sie ihn jetzt noch attraktiv finden, nachdem Moira gesagt hatte, dass er es nicht sei? »Ich weiß, was du meinst, irgendwie ist er zerzaust.«
Moira lachte fast gegen ihren Willen. »Zerzaust?«
»Ja, wie ein struppiges Lieblingskuscheltier oder so. Ein Teddy mit großen glasigen Augen.«
»Also, mein Lieblingskuscheltier ist er nicht.«
»Meines auch nicht«, sagte Evelyn nachdenklich.
Die Bar im Steam Packet war schon voll, die Band in der Ecke posaunte ihre Musik hinaus, alle mussten schreien, um sich verständlich zu machen. Die schummrige Beleuchtung kam von nackten Glühbirnen, die mit Drahtschlaufen an den alten Deckenbalken befestigt waren; Vincent erklärte begeistert, dass das Pub seit dem Krieg nicht mehr an die Hauptstromleitungen angeschlossen war, sondern einfach bei irgendjemandem Strom abzapfte. Mehrere Paare tanzten bereits auf einem engen Fleck, an dem die Tische beiseitegeschoben waren; der gepflasterte Boden war mit Sägemehl bedeckt, die groben Bänke, Tische und dreibeinigen Hocker zerschrammt und angeschlagen, die verputzten Wände – schmutzig braun vom Tabakrauch – waren übersät mit Werbeplakaten für Biersorten, Rum und Pfeifentabak, die es seit Jahrzehnten nicht mehr gab, dazwischen Gemälde und Fotos von Schiffen und auch Modellschiffe auf blauem, unruhig-eingefrorenem Meer in dick verstaubten Glasflaschen. Ein Stück von einem Baumstamm verkokelte in einem schmutzigen offenen Kamin am anderen Ende des Raumes kümmerlich zu Asche. Die jungen Leute sorgten zu dieser Uhrzeit selbst für Wärme.
Vincent thronte hinter der Bar, wo sich ein paar klebrige Flaschen im verzierten Spiegelglas spiegelten; er schöpfte Cider aus einem offenen Zinneimer, und der Wirt des Pubs – wettergegerbt und klein wie ein Jockey, mit Augen so klar und blau wie Eiskristalle und einem Gesicht so faltig, dass es einer Walnuss glich – saß auf einem Barhocker davor und betrachtete alles skeptisch. Er selbst trank den Cider nicht, sondern hielt sich an puren Gin – Hollands, so nannte er ihn. Vincent meinte, der Wirt sei praktisch darin eingelegt. Die grobschlächtigen Männer an der Bar gehörten wohl zu seinen Stammkunden: Es war ein Pub für Hafenarbeiter, in dem sich Prostituierte ihre Kunden suchten. Evelyn hatte noch nie Prostituierte gesehen, nur in Romanen über sie gelesen. Kunststudenten machten viel Wirbel darum, sich aus den festen Kreisen ihrer gesellschaftlichen Klasse herauszubegeben, auf die ihre Eltern so sehr achteten: Ihre Mütter legten Zierdeckchen auf die Kuchenplatten, als hinge ihr guter Ruf davon ab, weigerten sich, Milch- oder Ketchup-Flaschen auf den Tisch zu stellen, und bügelten Taschentücher, Socken und Wischlappen. Viele der Studenten waren selbst mehr oder weniger in der Arbeiterklasse aufgewachsen. Vincents Vater war Klempner in Ashley Down, Moiras und Evelyns Großvater mütterlicherseits war Bergarbeiter – und trotzdem bewarb sich ihr Vater um Aufnahme bei den Freimaurern. Nach dem Krieg hatte er einen Job bei der Hafenbehörde von Bristol bekommen, sie waren vom Nordosten Englands runter nach Avonmouth gezogen und hatten ihre Vergangenheit hinter sich gelassen, genau wie die ganze Sippe aus Onkeln, Tanten und Cousins mütterlicherseits.
»O, du bist hier«, bemerkte Moira ohne viel Enthusiasmus, als Evelyn ihren Mantel und die Tasche mit ihren Stiefeln und dem Schirm unter einem Tisch in einer Ecke, der als behelfsmäßige Garderobe diente, verstaut hatte. Moira erfasste das Outfit ihrer Schwester mit einem schnellen, taxierenden Blick: »Sieht gut aus«, sagte sie, grummelig, aber fair. Evelyn jedoch fragte sich jetzt, ob ihre schwarzen Klamotten wirklich die richtige Wahl für das Packet waren. Moira trug ihren gestreiften weiten Rock und eine cremefarbene Bluse; jemand hatte ihr mal gesagt, sie solle versuchen, die anderen Frauen im Raum overdressed aussehen zu lassen. Das war der Unterschied zwischen ihnen, dachte Evelyn. Sie selbst wählte etwas Auffälliges, leicht Verrücktes, das vielleicht funktionierte, vielleicht auch nicht, wogegen Moira niemals so dumm wäre, dieses Risiko einzugehen. Evelyn schwankte zwischen zwei Extremen – entweder verwendete sie Stunden darauf, sich extravagant anzuziehen, oder sie lümmelte zu Hause in ihrem ältesten abgetragenen Rock, mit Strickjacke und Schlappen herum. Die schlabberige Variante war ihr Lese-Ich. Um sich komplett in einem Buch zu verlieren, musste sie ungebügelt und gemütlich gekleidet sein, ihr Aussehen vergessen, sich in einem Sessel zusammenrollen, ohne Schuhe, die Beine hochgezogen. Wenn sie wirklich und wahrhaftig las, vergaß sie, wer sie war. Doch wenn sie Vorlesungen oder Seminare besuchte – sie studierte im ersten Jahr Französisch an der Universität –, zog sie sich sorgfältig vor dem Spiegel an, um mehr wie eine Studentin und Intellektuelle auszusehen: das béret auf eine Seite geschoben, den Seidenschal lässig um den Hals geschlungen. Insouciant, murmelte sie mit französischem Akzent, sah sich selbst bewundernd an und vollendete ihr Outfit mit ein paar Büchern unter dem Arm.
Die beiden Schwestern waren sich in ihrem Äußeren gar nicht so unähnlich. Beide stammten eindeutig aus derselben Familie, genau wie ihr kleiner Bruder: Alle hatten ausgeprägte Gesichtszüge, volle Lippen, dunkle Brauen und eine lange traurig wirkende Nase, die die Mädchen hassten, obwohl sie ihre Gesichter tatsächlich interessanter machte. Die Nase kam vom gut aussehenden strengen Vater: Sie passte zu einem Mann, einem Kriegshelden, Oberleutnant auf einem Flugzeugträger, der Handelsschiffe über den Atlantik geleitet hatte. Beide Schwestern waren hübsch, obwohl Moira behauptete, dass es nicht stimmte und sie sich einfach nur darauf verstehe, das Beste aus sich zu machen.
»Ich sehe ihm ähnlicher«, sagte Moira. »Du hattest mehr Glück.«
Ihre Mutter war eine hübsche, dunkle Irin, obwohl sie sich hatte gehen lassen und etwas aus dem Leim war, weil sie in ihrer Ehe und hier im Süden nicht glücklich war. Moira schimpfte immer mit ihr wegen ihrer Körperhaltung und wenn sie zu viele Mehlspeisen aß; gleichzeitig war Moira aber auch bei ihren eigenen Defiziten sehr kritisch und diskutierte sie mit sich, berechnend und resigniert. »Ich hasse diese Fettwülste unter meinen Armen. Die habe ich von Mam.«
Wenn Evelyn und sie miteinander ausgingen, war es Moira, die die Blicke der Männer auf sich zog mit ihrer beherrschten, feinsinnigen Attraktivität; neben ihr fühlte sich Evelyn mädchenhaft und linkisch, wie sehr sie sich auch anstrengte. »Du solltest nicht so viel reden«, riet Moira ihr nicht gerade hilfreich. »Schau den Leuten beim Sprechen nicht direkt ins Gesicht.«
»Welche Fettwülste?«, fragte Evelyn, hob ihre Arme und verrenkte sich den Hals auf der Suche nach Wülsten.
»Die hier. Du hast sie einfach nicht, sie sind grässlich. Wenn ich Geld hätte, würde ich sie wegschneiden lassen. Und mir die Nase kürzer machen lassen. So wie Filmstars.«
Bei Vincents Party jedoch hatte Moira diesen verträumt lächelnden, selbstsicheren Blick, den sie in der Öffentlichkeit benutzte, und ließ so ihre Aufmerksamkeit nur leicht über das Geschehen um sie herum streifen. Und sie hatte es geschafft, einen Tisch genau an der richtigen Stelle zu ergattern – nicht so nah bei der Band, dass man sich nicht mehr unterhalten konnte, aber trotzdem mit gutem Blick. Bei ihr saßen Josephine LaPalma und zwei Männer, die Evelyn noch nie gesehen hatte. Josephine war Modell an der Kunstschule und gehörte zu Vincents Sammlung von Originalen, glamourös und gefährlich, mit breitem Bristoler Akzent – eine Glanzleistung, dass er es geschafft hatte, sie zu der Party zu überreden. Angeblich hatte sie Gypsy-Blut, und ihre schwarzen Haare reichten ihr bis zur Hüfte, wenn sie sie offen trug; heute Abend waren sie in einem dicken Zopf um ihren Kopf geschlungen. Alles an Josephine passte zu den romantischen Vorstellungen der Studenten von einem Bohemien-Leben. Sie hatte sogar eine Affäre mit einem verheirateten Mann, einem der Lehrer am College und sehr talentierten Maler.