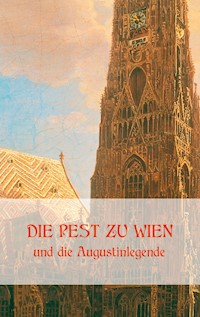
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Dieses Büchlein enthält zwei der wichtigsten Werke zur Geschichte der Pest in Wien: "Zur Geschichte der Pest in Wien" von Richard Krafft-Ebing und "Die Pest in Wien 1679 und die Augustinlegende" von Josef Schwerdfeger.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 88
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Von
Richard Krafft-Ebing, Matthias Fuhrmann,
Josef Schwerdfeger
Inhalt.
1. Teil.
Zur Geschichte der Pest in Wien.
Von
Richard Krafft-Ebing. 1899.
2. Teil.
Die Pest in Wien 1679 (nach Matthias Fuhrmann) und die Augustinlegende.
Von
Professor Dr. Josef Schwerdfeger. 1907.
1. Teil.
Zur Geschichte der Pest in Wien,
von
Richard Krafft-Ebing
Vorwort.
DAS Leben des einzelnen Menschen oder das einer Generation stellt einen unendlich kleinen Zeitabschnitt des Bestehens der Menschheit als Ganzes dar. Die Naturwissenschaft hat den Erfahrungssatz aufgestellt, daß die Möglichkeit der Lebensdauer der Menschen wie der Tiere sich nach der Zeitdauer richtet, welche sie zur Erreichung ihrer Wachstumsreife benötigen. Da dieser Zeitraum beim Menschen ungefähr 20 Jahre beträgt und da die Lebensfähigkeit das Vier- bis Fünffache der Entwickelungszeit ausmacht, ergibt sich die Möglichkeit der Dauer eines Einzellebens von der Wiege bis zum Grabe von 80 bis zu 100 Jahren. Wie wenig Menschen diese ihnen von der Natur gesteckte Lebensgrenze erreichen, ist genugsam bekannt. Zu jeder Zeit auf unserem Lebensweg umlauern uns Todesgefahren – die tückischsten und gefährlichsten Feinde des Menschen sind jedenfalls kleine Lebewesen, die unsichtbar in den Körper eindringen, sogenannte Infektionskrankheiten hervorrufen und mit Vernichtung bedrohen. Für einige dieser Krankheiten, wie z. B. Tuberkulose, Diphtherie, Typhus u. a. sind die Keime zu denselben fast überall und beständig zugegen; manche andere Krankheitserzeuger finden, wie z. B. die der Cholera, in Europa nicht ihre Entstehung und es bedarf einer Einschleppung derselben aus fernen Ländern, um sie den Europäern verderblich werden zu lassen. Vermöge ihrer äußerst großen Ansteckungsfähigkeit und Übertragbarkeit sind sie aber dann meist im Stande, in Gestalt von Epidemien gleich Massen von Menschen dahin zu raffen. Ein Triumph der medizinischen Wissenschaft ist es, die Ursachen solcher Infektionskrankheiten erforscht und damit Mittel zu ihrer Abwehr ausfindig gemacht zu haben. Der Lehre von den Ursachen der Krankheiten und ihrem neuesten Wissenszweige, der sogenannten Bakteriologie, der Gesundheitspflege und der aus ihr hervorgehenden Sanitätsgesetzgebung und Sanitätspolizei kommt der Ruhm zu, Krankheiten erfolgreich zu bekämpfen und zu verhüten, gegen welche vergangene Jahrhunderte machtlos waren. Aus Irrtum und Aberglauben heraus hat die fortschreitende Zivilisation und Wissenschaft die Erkenntnis und Fähigkeit gefunden, der furchtbarsten Feinde menschlicher Existenz sich zu erwehren, das Sterblichkeitsprozent erheblich zu vermindern und die mittlere Lebensdauer bedeutend zu erhöhen. Einer der schrecklichsten Bedränger der Menschheit in vergangenen Jahrhunderten war eine der „schwarze Tod“ im Norden Europas, in Italien „das große Sterben” („la mortalega grande“) genannte Seuche, welche anläßlich ihres Wütens in Europa im 14. Jahrhundert, obwohl sie nicht überall hindrang, 75 Millionen Menschenleben vernichtete, indem Ende dieses Jahrhunderts von 100 Millionen nur noch 25 übrig waren. Der tiefe Stand der Gesundheitspflege, das Zusammengedrängtsein der Menschen in festen Plätzen, die Unkenntnis der Ursachen dieser Seuche und damit die Hilflosigkeit der Bevölkerungen dieser Gefahr gegenüber, mögen schuld an dieser entsetzlichen Sterblichkeit gewesen sein, durch welche das öffentliche Leben außer Rand und Band geriet, Familien und Staaten sich aufzulösen drohten, Geistesepidemien (Geissler) entstanden und schreckliche Verfolgungen der Juden, als der vermeintlichen Urheber dieser Seuche, die Menschheit schändeten. Man glaubte nämlich allen Ernstes, die Juden hätten die Brunnen vergiftet auf Geheiß geheimer Vorsteher in Toledo, welche das Gift des schwarzen Todes aus dem Orient bezögen, oder es auch selbst aus Spinnen, Eulen u. a. giftigen Tieren bereiteten. Daß die Juden, z. B. in Wien und Goslar, noch mehr unter der Seuche litten als die Christen, konnte diesen Irrwahn nicht erschüttern. Die Folter erpreßte gewünschte Geständnisse, gelegentlich fand man auch angebliche Giftbeutel in Brunnen, von Christen hineingetan, um Mord und Plünderung herbeizuführen. Vergebens eiferte Papst Clemens in Bullen gegen diesen Wahn und bemühte sich Kaiser Karl IV. die unglücklichen Juden zu schützen. Sie wurden ersäuft, verbrannt, in Straßburg z. B. allein und auf einmal 2000 auf ihrem Begräbnisplatz. In Städten, wo keine Juden waren, beschuldigte man die Totengräber der Brunnenvergiftung! Nur eine befriedigende Kunde enthalten die Chroniken aus jenen schrecklichen Zeiten – die aufopfernde Pflege der Erkrankten durch barmherzige Schwestern und durch geistliche Orden, unter welchen sich besonders die Franziskaner hervortaten. Auch die Hauptstadt des Habsburgischen Reiches, unser schönes Wien, war von der Pestepidemie besonders schwer heimgesucht, so schwer, daß man allenthalben vom „wienerischen Tod“ sprach und im 15. Jahrhundert das Sprichwort aufkam: „Vienna ventosa aut venenosa” (in Wien herrscht Wind oder die Pest). Es gewährt ein nicht geringes kulturgeschichtliches wie auch rein menschliches Interesse, an der Hand von Chroniken und Pestordnungen die Geschichte der einzelnen Wiener Pestepidemien miteinander zu vergleichen. Es sei mir gestattet, in kurzen Zügen die Heimsuchungen früherer Generationen der Wiener Bevölkerung durch die furchtbarste aller Seuchen zu beleuchten und aufzuzeigen, wie es in der sogenannten guten alten Zeit den Vorfahren ergangen ist. Den Unterschied zwischen einst und jetzt möge der geneigte Leser sich selbst am Schlusse dieser Zeilen vergegenwärtigen.
1. Kapitel.
Geschichte der ersten großen Pest in Wien von Ostern bis Michaeli 1349.1
DIE Seuche kam vom Mittelmeer, aus dem längst infizierten Ägypten und Italien, welch letzteres Land über die Hälfte seiner Bewohner verlor. Sie verbreitete sich über Dalmatien, Triest, Udine, Villach über Österreich. Gegen Ostern 1349 brach die Pest in Wien aus. Sie traf Obrigkeit und Bürger ganz unvorbereitet, breitete sich ungeheuer rasch in der von hohen Festungsmauern umgebenen, in ihren Gesundheitsvorkehrungen höchst primitiven und von Menschen überfüllten Stadt aus. Ich folge den Worten einer Chronik, indem ich berichte: -
„Da wurde das Sterben in allem Österreich gar groß, ganz besonders zu Wien, also daß man alle Leut, arm und reich, mußte legen in den Gottesacker zu St. Coloman. Und starben soviel Leut, an einem Tag 1200 Leichen, so da gelegt wurden in den Gottesacker; und waren daselbst 6 Gruben gegraben bis auf das Wasser, und man legte in die eine Grube 14.000 Leichen, ohne die, die heimlich begraben wurden in den Klöstern und den anderen Kirchen. Der Herzog (Albrecht) floh aus der Stadt gen Purkersdorf und verbot, daß man Niemand durfte legen auf die Freithöf überall in der Stadt. Und auch viel Leut' flohen aus der Stadt, deren viel auf dem Land starben. Und auch zeigte sich die Sterblichkeit an den Leuten also: an welchen Leuten sich rothe Sprinkel oder schwarze erhoben, die starben alle an dem 3. Tag, und auch entsprangen den Leuten Drüsen unter den Achseln, die starben nahe alle an dem 3. Tag. Es war auch der Jammer so groß, daß die Leute barfuß kirchfahrten gingen und thaten große Gebet. Das half alles nichts. Auch war manches Haus dort zu Wien, wo siebzig Menschen aussturben und auch mehr, also daß manches Haus öd stund, daß die Leute alle todt daraus waren. Und wie viel Gut und Erbe ward so erblos, daß Niemand war, der sich sein unterwand; die Leute sagten, sie hätten gar genug, sollten sie nur leben. Und wie groß die Sterblichkeit war, konnte man die Wahrheit nie erfahren. Der Lai-Pfaffen (Weltpriester) starben soviel, daß zu St. Stephan allein ihrer starben 54.“
Nach anderen Quellen betrug die Zahl der Toten in dieser ersten Wiener Pestepidemie täglich 480 bis 720, vorübergehend bis zu 900. Die Gesamtsumme der Opfer der Epidemie von Ostern bis Michaeli wird auf 40.000 berechnet (vgl. Pertz XI, 829).
Daraus läßt sich der Schluß ziehen, daß Wien damals rund 80.000 Einwohner gehabt haben mag, wenigstens weiß man, daß überall, wo diese Seuche wütete, die Hälfte der Bevölkerung ihr erlag. So starben z. B. in Florenz 90.000 Menschen an der Pest (Boccaccio).
Die Not in Wien muß damals groß gewesen sein. Jeglicher Handel und Wandel stockte. Eine schwere Teuerung entstand. Es fehlte allenthalben an Arbeitskräften. Man hatte nicht einmal Siechknechte genug, um die Toten zu begraben, weshalb diese wichtige sanitäre Maßregel eine Verzögerung erfuhr und tagelang die Toten in den Häusern und Straßen dalagen. Aus Mangel an Geistlichen konnte nur in wenig Kirchen noch die heilige Messe gelesen werden. Auf den Feldern und in den Weinbergen bot die Natur eine gesegnete Ernte, aber es fehlte an Händen, sie einzubringen, so daß der größte Teil der Früchte zugrunde ging.
Die Ärzte standen dieser fürchterlichen Seuche ebenso unerfahren und machtlos gegenüber wie anderwärts. Geschah es doch erst von 1390 ab, daß an der Wiener Universität ein eigentlicher Unterricht in der Heilkunde begann und erst von 1404 ab, daß Zergliederungen menschlicher Leichen vorgenommen wurden.
Man schrieb das Entstehen des „schwarzen Todes“ dem Zorn Gottes über die Sünden der Menschen zu und suchte die Erklärung für das Entstehen der Seuche in ungünstigen Konjunktionen der Gestirne. Was sollte da menschliche Kunst dagegen ausrichten? Der Trieb der Selbsterhaltung führte zur Anwendung von Amuletten, Tränklein und Latwergen aus allen möglichen Kräutern. Man vermeinte in kostbaren Mineralien, z. B. Perlen und Edelsteinen Heilkräfte zu finden und verwendete solche zu Arzneien, deren Heilwert man nach ihrem hohen Preise taxierte, gerade wie noch heutzutage Ungebildeten eine recht teure Arznei zu imponieren vermag.
Da man die Ursache des Übels in den Gestirnen suchte, unterließ man die allerwichtigsten und nächstliegenden Maßregeln, um desselben Herr zu werden. Statt Gassen und Gossen zu reinigen, Luft in den engen Straßen zu schaffen, die Kranken von den noch Gesunden zu trennen, die Toten aus der Stadt so rasch als möglich zu entfernen, zu begraben oder noch besser samt Betten, Kleidern und sonstiger Habe zu verbrennen, geschah von dem allem nichts. Die Behörden waren ebenso ratlos wie die Ärzte und das Publikum. Von Pestspitälern gab es damals noch keine Spur. Sterbende und Tote lagen auf den Straßen umher, oft tagelang, bis die Siechknechte sie auf Wagen luden und vor die Stadttore in die Pestgruben schafften. Daß da mancher noch lebend aufgeladen wurde, ist durch die Chroniken verbürgt. Man machte nicht viel Federlesens mit solchen, denn sie waren ja sowieso dem Tode verfallen. Selbst Reichtum war keine Gewähr für Trost und Hilfe auf dem Krankenlager. Da wo die Pest in einem Hause eingezogen war, flohen Familienangehörige und Diener. Geschah es doch im Laufe der Epidemie, daß die Obrigkeit, um der weiteren Ausbreitung der Seuche Einhalt zu tun, das verpestete Haus schloß, Türen und Fenster vernageln ließ, so daß Kranke und Gesunde darin umkamen. wobei man nicht bedachte, daß mit der späteren Wiedereröffnung ein neuer Seuchenherd vorhanden war.





























