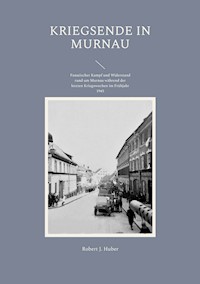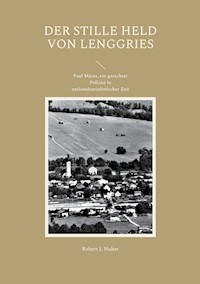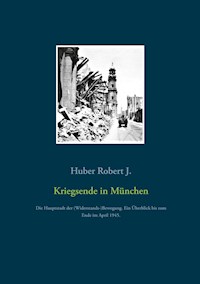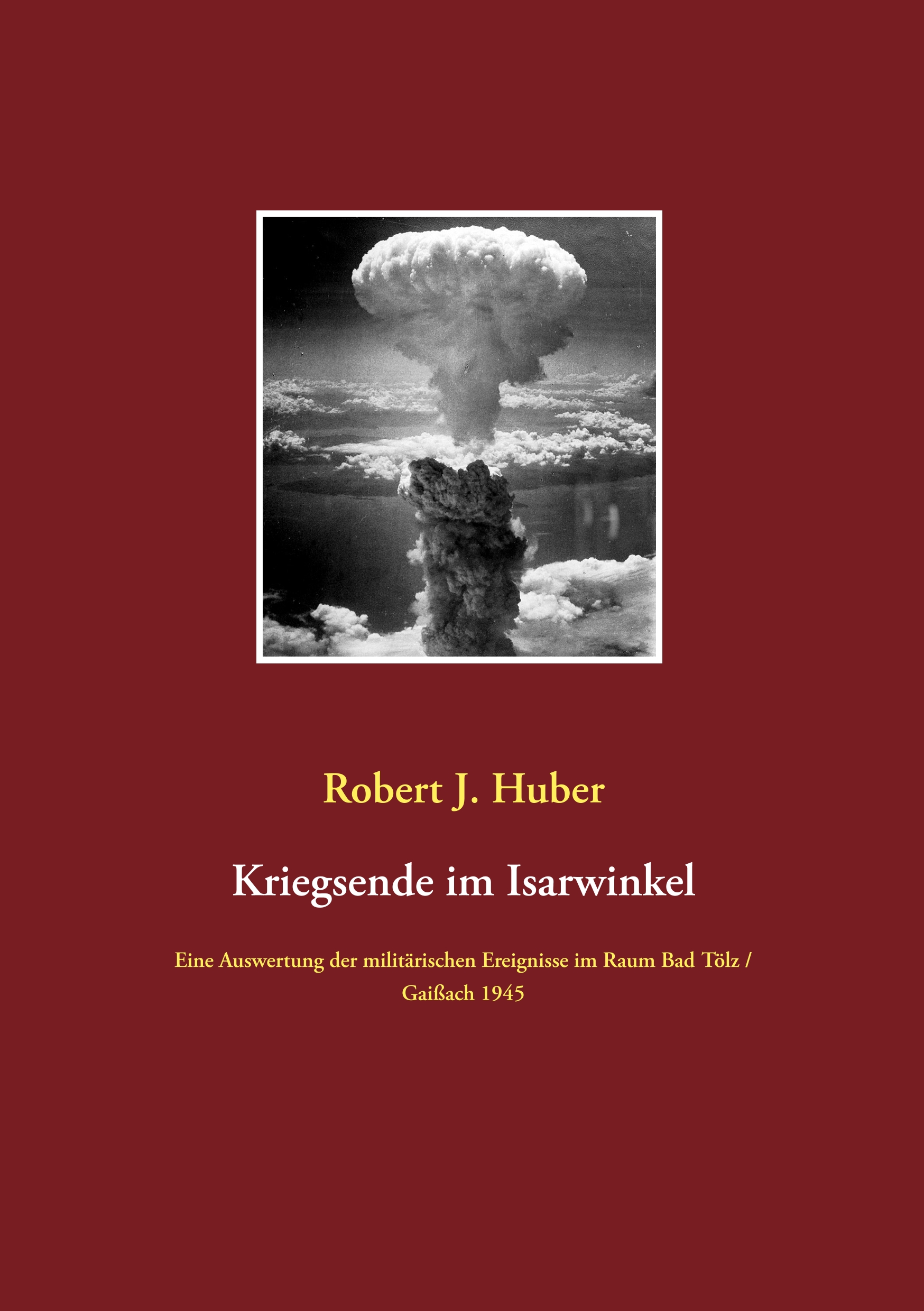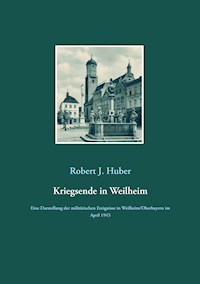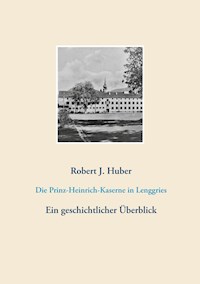
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Am Ortsrand von Lenggries, oberhalb der Isar, entsteht 1935 eine neue Kaserne für Gebirgsjäger. Die Nationalsozialisten rüsten auf und bereiten sich auf den Krieg vor. Im Mai 1945 verteidigt die SS verbissen den Isarwinkel, trotzdem fällt die Anlage unzerstört in US-amerikanische Hände. Fortan nutzen Elitesoldaten der US-Army diese Liegenschaft bis schließlich 1973 Einheiten der Bundeswehr einziehen. Ende 2003 müssen die Luftwaffensoldaten schweren Herzens den Standort verlassen. Seitdem ringen die Verantwortlichen um eine geeignete Nutzung des Areals. Dieses reich bebilderte Buch beschreibt erstmals zusammenhängend die wechselvolle Geschichte der Prinz-Heinrich-Kaserne und zeigt dabei bisher unbekannte historische Details. Auf den letzten Seiten erleichtern QR-Codes das Auffinden der zitierten Quellen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 61
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Danksagung
Das Lenggrieser Waldkirchenforum
hat mich auf die Idee zu diesem Buch gebracht.
Herzlichen Dank dafür!
Inhalt
Prolog
Vorgeschichte
Die Kaserne wird gebaut
Gebirgsjäger beziehen die Kaserne
Die Prinz-Heinrich-Kaserne im 2. Weltkrieg
US-Truppen in der Prinz-Heinrich-Kaserne
Die Nutzung durch die Bundeswehr
Folgenutzungen des Kasernenareals
Fazit
Literaturverzeichnis
Linkverzeichnis
PROLOG
In diesem Beitrag geht es um die 85jährige Geschichte der Lenggrieser Kaserne. Gebaut 1935/36 in der heißen Phase der nationalsozialistischen Aufrüstung beherbergte sie bis zum Kriegsende 1945 viele verschiedene Wehrmachtstruppenteile. Unzerstört in US-amerikanische Hände gefallen, folgte nahtlos eine vielfältige Nutzung durch die US-Army. Nach kurzer Unterbrechung war sie dann ab 1973 bis Ende 2003 eine Kaserne der Bundeswehr; der Standort Lenggries galt als einer der schönsten Deutschlands. Seitdem ringen die Verantwortlichen um eine geeignete zivile Verwendung dieser Liegenschaft.
Eine zusammenhängende Beschreibung der wechselvollen Geschichte existiert bislang nicht, deshalb fasst diese Abhandlung erstmals die historischen Ereignisse zusammen. Dabei fließen auch Informationen ein, die lange Zeit nur Militärpersonen zugänglich waren.
Das (unvermeidliche) Kleingedruckte:
Der Text enthält in Fußnoten zahlreiche Links zu nach Meinung des Verfassers interessanten Webseiten mit weiterführenden Informationen. Das ist zwar in der E-Book –Version praktisch, zwingt aber den Autor, sich ausdrücklich von Werbeinhalten auf diesen Seiten zu distanzieren und keine Haftung für die Inhalte und das Funktionieren der Links zu übernehmen! Am Ende des Buches sind – nach Fußnoten sortiert – die Links als Text und auch als QR-Code nochmals aufgeführt. Damit kann die interessierte Leserschaft auch mit dem Smartphone und einem QR-Code-Reader direkt die Webseiten aufrufen.
1. Vorgeschichte
Die nationalsozialistische Bewegung lehnte von Anfang an die durch den Versailler Friedensvertrag von 1919 vorgesehenen militärischen Beschränkungen rundweg ab. Hatte das deutsche Heer 1914 noch knapp 800.000 Mann, so sollten es jetzt nur noch 100.000 sein. Das wurde von vielen als „tiefste Erniedrigung“ empfunden. Dazu sprach ein gewisser „Herr Hittler“ (man beachte die Schreibweise!) bereits 1919 in einer seiner ersten Reden vor großer Zuhörerschaft:
Abbildung 1: Damals in München verteilte Einladungszettel zum Vortrag „Deutschland vor seiner tiefsten Erniedrigung“. Reproduktion des Originals durch den Autor.
So verwundert es nicht, dass nach der Machtergreifung 1933 alsbald ein großes Aufrüstungsprogramm entstand. Deutschland sollte durch Beschluss des Reichskanzlers und „Führers“ mit dem „Gesetz über den Aufbau der Wehrmacht und Wiederherstellung der Wehrhoheit” vom 16. März 19351 militärisch erstarken. Ab 1936 gab es für die Aufrüstung dann einen eigenen „Vierjahresplan“2 unter der Leitung des Hitler-Vertrauten Herman Göring. Vorgesehen waren 700.000 Mann, beim Heer in 36 Divisionen gegliedert. Mindestens eine davon war als „Gebirgsdivision“ geplant. Das sind überwiegend zu Fuß marschierende Soldaten, die ihre Waffen und das Gerät mit Hilfe von Lasttieren auch abseits fester Wege ins vorgesehene schwierige Gelände bringen können.
Die bisherigen Standorte reichten für so viele Soldaten nicht aus, schließlich waren jetzt auch wieder
Abbildung 2: Adolf Hitler um 1928 in Lederhose. Den Vertrieb dieser Aufnahme untersagte er später. US-National Archives (NARA), 111-222, public domain.
Wehrpflichtige auszubilden.3 Deshalb entstanden in Deutschland während der Jahre 1936 bis 1939 über 500 neue Kasernen.
Abbildung 3: Die Heeresgliederung im Jahr 1935. Der Divisionsstab der „Gebirgler“ befand sich zu dieser Zeit noch in München, beim Generalkommando. In dieser ersten Ausbaustufe waren 24 neue Divisionen vorgesehen, zwölf weitere in der nächsten Ausbaustufe bis 1939. Foto: Eigene Bearbeitung aus Abdruck im Weilheimer Tagblatt vom 2. Nov. 1935, public domain.
Der in Österreich geborene „Führer“ Adolf Hitler zeigte von Anfang an eine gewisse Vorliebe für München und Oberbayern. Der Baustil der hier neu entstehenden Kasernen interessierte ihn besonders.
Am Anfang war Lenggries nicht als Standort vorgesehen, doch die Planungen änderten sich mehrfach. Zunächst sollte im Alpenraum eine „Gebirgsjägerbrigade“, also ein militärischer Großverband mit gut 6.000 Soldaten entstehen. Bald darauf sprach man von einer „Gebirgsdivision“ mit über 25.000 Mann, gegliedert in drei Gebirgsjäger-Regimenter zu je drei Bataillonen, vier Bataillone Artillerie, je eines für die Pioniere, die Nachrichtentruppe, die Sanitäter usw. Um diese angemessen unterbringen zu können, mussten also mindestens sechzehn neue Kasernen im Alpenraum gebaut werden, hatte doch ein einziges dieser Gebirgsjäger-Bataillone schon knapp 900 Mann und dazu gut 250 Tragtiere, meist Mulis, Haflinger und Esel.
Gleich nach der Machtübernahme 1933 erfolgte auf Weisung des „Führers“ die Standortsuche. Die detaillierten Planungen fanden unter der Leitung des Hitler-Vertrauten Hermann Göring statt. „Baurecht“ in unserem heutigen Sinne benötigte die nationalsozialistische Führung nicht, der Bau war ja befohlen. Zwar wurden die Kasernengrundstücke, mindestens 12 Hektar groß, vom „Reich“ gekauft, allerdings zu billigsten Preisen. Nur selten gab es mehr als eine Mark für den Quadratmeter. Widerstand seitens der Grundeigentümer oder der Gemeinden konnte gefährlich sein – das Konzentrationslager Dachau war schon seit 1933 in Betrieb. Vielleicht auch deshalb übertrug so manche Gemeinde den Baugrund unentgeltlich an das „Reich“ und sorgte auf eigene Kosten für den Bau von Zufahrtsstraßen und Infrastruktur. Idealerweise hatte ein Standort nicht nur bebaubare Flächen, sondern auch einen leistungsfähigen Bahnanschluss, gerne elektrifiziert. War das gegeben, setzte man den (Vor-)Alpenbewohnern auch mal gleich zwei neue Kasernen in den Ort, so z. B. geschehen in Garmisch, Murnau und Sonthofen.
Trotzdem war es nicht einfach, alle Gebirgsjäger unterzubringen. Kurz dachte der Planungsstab dabei auch an Bad Tölz, doch die Kreisstadt schied aus. Dort hatten die Funktionäre der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei (NSDAP) den Bau einer „Junker-Schule“ für den Führungsnachwuchs der SS vorgesehen – mitten im Badviertel. Sie argumentierten „Die Angehörigen der Reichs-Führerschule bedeuten eine lebendige Reklame für den Badeort".4 Ein großer Irrtum, die Besucherzahlen gingen zurück, denn die SS verlangte von ihrem Führer-Nachwuchs keinen besonderen Schulabschluss, dafür aber das „schlagkräftige“ und lautstarke Eintreten für die Ziele der Partei. Im Jahr 1934, bei ihrer Gründung, hatte die Schule in der Schützenstraße nur etwa hundert Lehrgangsteilnehmer, sie wuchs aber beständig.5 Dem Kurbetrieb war das laute, rassistische Verhalten der SS nicht zuträglich, zumal immer mehr Gebäude im Kurviertel zu günstigsten Konditionen von den Nationalsozialisten angemietet wurden. Adolf Hitler muss jedoch das Wachstum der SS in der Kurstadt sehr gefallen haben, denn Roderich Fick aus Herrsching, einer der wenigen Lieblingsarchitekten des „Führers“ erhielt den Auftrag, eine neue repräsentative Isarbrücke zu errichten.6
Abbildung 4: Die 1935/36 entstandene neue Isarbrücke in Bad Tölz. Entnommen aus „Das Bauen im neuen Reich“, Gauverlag Bayer. Ostmark, Bayreuth, 1941, US-National Archives (NARA), public domain.
Es war wohl der Tölzer Stadtbaumeister Peter Freisl, ein Schüler des berühmten bayerischen Baumeisters Gabriel von Seidl, der die Verantwortlichen davon überzeugen konnte, an der Sachsenkamer Straße eine komplett neue und sehr geräumige SS-Junkerschule mit über 900 Räumen zu bauen.7 Damit schied Bad Tölz für die Wehrmacht aus, es gab kein zweites geeignetes Gelände im direkten Umfeld der Kreisstadt.
Abbildung 5: Adolf Hitler zwischen zwei "Lieblingsarchitekten". Links, ohne Hut, Albert Speer, rechts, mit Hut, Roderich Fick. Ausschnitt aus Foto: Institut für Kunstgeschichte, Universität Wien, CC-SA-BY 3.0
So geriet die nächstgrößere Gemeinde isaraufwärts, Lenggries, in den Fokus der Nationalsozialisten. Ganz genau lässt sich der Planungsprozess nicht mehr rekonstruieren – viele Unterlagen dazu gingen in München bei kriegsbedingten Bränden verloren – jedoch gibt es mehrere Zeitzeugenberichte darüber, dass es im Dorf erheblichen Widerstand gab, kostbare landwirtschaftliche Nutzfläche für eine Kaserne zu opfern. Zwar konnte die Gemeinde die mit einer Kaserne verbundenen Arbeitsplätze gut gebrauchen – die Flößerei war mit der Inbetriebnahme des Walchenseekraftwerks im Jahr 1924 praktisch weggefallen8 – doch befürchteten viele Einheimische durch die übenden Soldaten eine weitere Schwächung der noch einigermaßen rentablen Landwirtschaft. Den Lenggriesern hatte man damals seitens „der Obrigkeit“ viel versprochen, z. B. die Elektrifizierung der Bahnverbindung,9