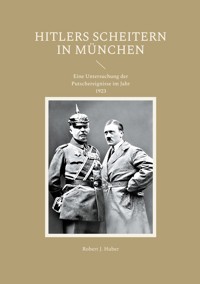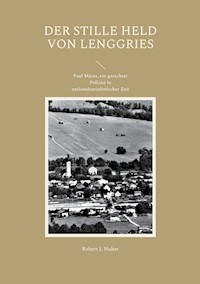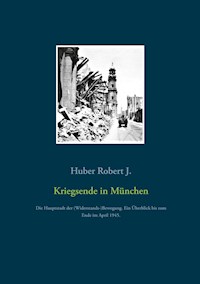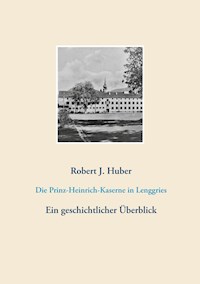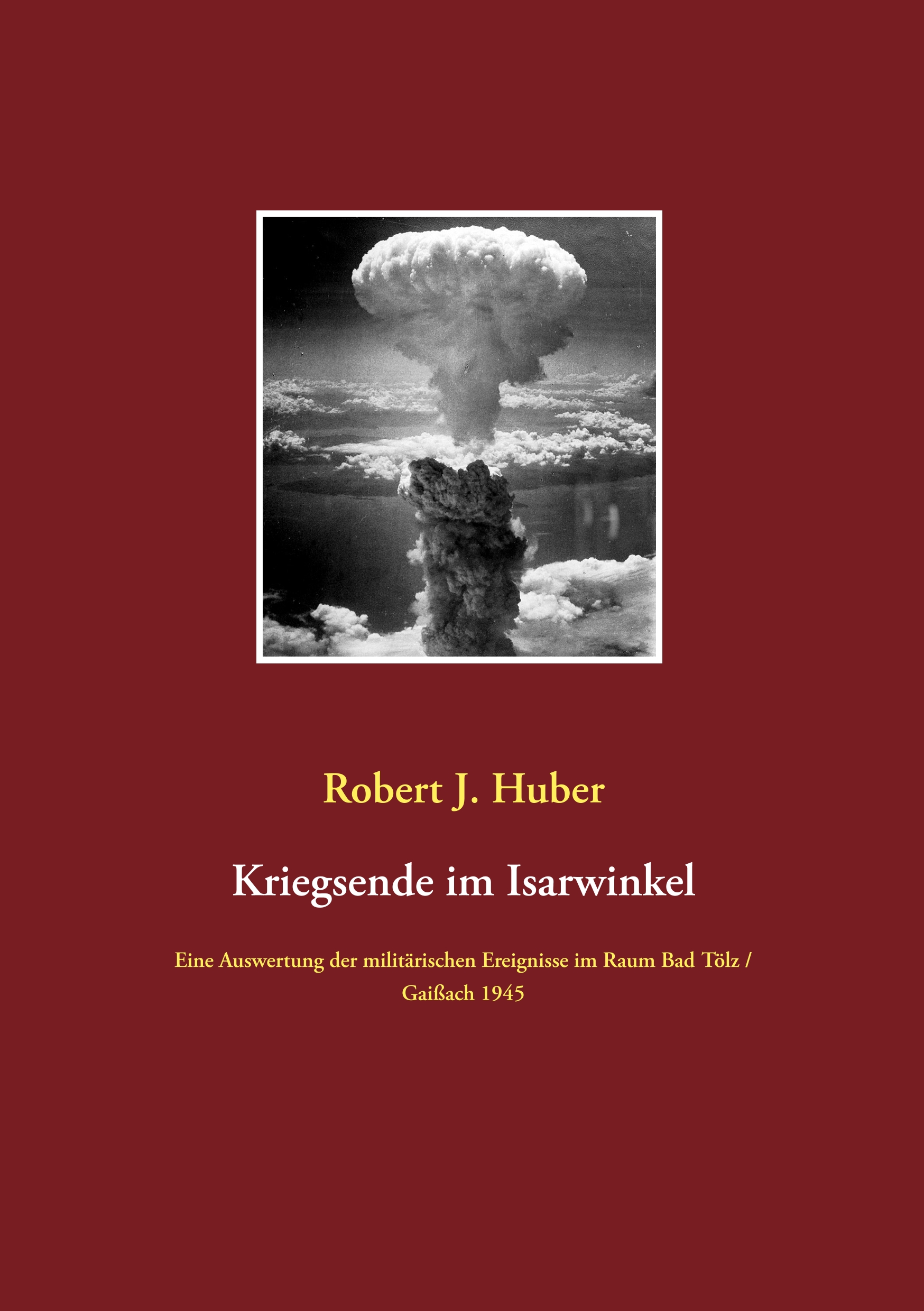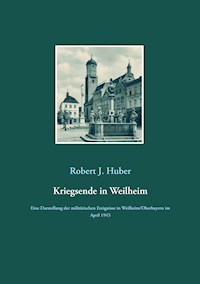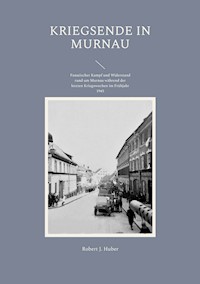
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Im April 1945 stehen die Zeichen für Murnau endgültig auf Sturm. Hitler umrandet nach langem Zögern auf einer Alpenkarte mit dickem Stift das Rückzugsgebiet für den Endkampf seiner Nationalsozialisten. Er markiert die von den Alliierten schon lange vermutete Alpenfestung. An der Nordgrenze liegt Murnau. Eine schier unglaubliche Kette von Zufällen verhindert dann ein größeres Gefecht im Murnauer Land, es kommt zu einem überraschend friedlichen Einmarsch der US-amerikanischen Kampftruppen. Die dramatischen Ereignisse jener Tage fasst dieses Buch zusammen und bietet dazu neue Erkenntnisse und Hintergrundinformationen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 112
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Herzlichen Dank an:
Frau Dr. Marion Hruschka, Murnau,
Herrn Dr. Joachim Heberlein, Weilheim,
und Herrn Karl Wolf, Aidling,
ohne deren fachkundige Beratung
dieses Buch nicht entstanden wäre .
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Die Kasernen in Murnau
Erste Kriegsjahre
Rüstungsbetriebe rund um Murnau
Feindflugzeuge im Murnauer Land
Lokaler Widerstand
Endkampf im totalen Krieg
Schutzbereich Murnau
Das Lagebild der US-Soldaten
Die Freiheitsaktion Bayern
US-Truppen erreichen das Oberland
Murnau im Fadenkreuz
Murnau in US-amerikanischer Hand
Schlussbemerkungen
Literaturverzeichnis
QR-Code-Verzeichnis
Einleitung
Hitlers grausamer Krieg neigt sich im Frühjahr 1945 erkennbar dem Ende entgegen. Die Westfront kommt dem bayerischen Oberland immer näher. In der kleinen Marktgemeinde Murnau schwindet die anfänglich recht große Begeisterung für den Nationalsozialismus aber nur langsam – trotz der herrschenden großen Not. Viele Ehemänner, Söhne und Familienväter sind bereits für den „Führer“ in der Ferne den „Heldentod“ gestorben. Es fehlt an vielen Dingen des täglichen Bedarfs. Der Wohnraum ist knapp, die zahlreich zwangseinquartierten Bombenflüchtlinge aus dem Norden belegen praktisch jede freie Kammer. Zudem stillen die nur mit Lebensmittelmarken zu bekommenden kleinen Rationen lediglich den größten Hunger.
Im April 1945 stehen die Zeichen für Murnau endgültig auf Sturm. Hitler umrandet nach langem Zögern auf einer Alpenkarte mit dickem Stift das Rückzugsgebiet für den Endkampf seiner Nationalsozialisten. Er markiert die von den Alliierten schon lange vermutete „Alpenfestung“. An der Nordgrenze liegt Murnau. Die Einwohner wissen davon nichts, ahnen aber wohl etwas. Gar zu viele Fahrzeuge der Wehrmacht und SS durchqueren auf der Reichsstraße 2, der „Olympiastraße“, den beschaulichen Ort. Es droht hier eine genauso heftige Schlacht mit fürchterlichen Zerstörungen wie in so vielen anderen Städten des Reiches. Denn die SS-Männer kämpfen brutal, fanatisch und regelmäßig bis zur letzten Patrone. Für sie gibt es nur Sieg oder Tod.
Eine schier unglaubliche Kette von Zufällen verhindert dann ein größeres Gefecht im Murnauer Land, es kommt zu einem überraschend friedlichen Einmarsch der US-amerikanischen Kampftruppen. Die dramatischen Ereignisse jener Tage fasst dieses Buch zusammen und bietet dazu neue Erkenntnisse, Bildmaterial und Hintergrundinformationen.
Das (unvermeidliche) Kleingedruckte:
Der Text enthält als Fußnoten zahlreiche aktive Links zu nach Meinung des Verfassers interessanten Webseiten mit weiterführenden Informationen. In Klammern steht dahinter das Datum des Aufrufs der Seiten im Internet. Das ist zwar in der E-Book–Version praktisch, zwingt aber den Autor, sich ausdrücklich von Werbeinhalten auf diesen Seiten zu distanzieren und keine Haftung für die Inhalte und das Funktionieren der Links zu übernehmen!
Für die Leser der Print-Ausgabe werden am Ende des Buches, nach Seitenzahlen sortiert, die Internet-Quellen als Text und als QR-Code wiederholt. Mit dem Smartphone ist damit schnell die betreffende Website erreicht.
Die wissenschaftlich geübte Leserschaft wird um Verständnis dafür gebeten, dass zugunsten der Möglichkeit, sich einen ersten Überblick zu verschaffen, des Öfteren Wikipedia-Artikel verlinkt sind.
Bild auf der Umschlagvorderseite: 12th Armored Division Museum, Abilene, Texas, public domain. Eigene Bearbeitung.
1. Die Kasernen in Murnau
Bereits vor dem ersten Weltkrieg übten bayerische Infanteristen gerne im Murnauer Land. Die damals übliche Begeisterung für alles Militärische teilten auch die Bewohner der Marktgemeinde. Der verlorene Krieg 1914/18 änderte daran wenig. Als es dann Ende der 1920er Jahre um Murnaus Finanzen nicht zum Besten stand, bewarb sich die Gemeinde um eine Garnison.1 Man dachte wohl an die damit verbundenen zusätzlichen Umsätze für die örtlichen Gewerbetreibenden und Gastwirte. Jedoch schrieb die Münchner Wehrkreisverwaltung zunächst eine höfliche Absage.2 Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten im Jahr 1933 änderte sich die Lage. Es begann eine gigantische Aufrüstung. Zunächst allerdings geheim, da das Vorhaben den Versailler Friedensvertrag verletzte. Aus der kleinen Reichswehr der Weimarer Republik sollte eine große „Wehrmacht“ werden, das erforderte viele neue Kasernen. Auch diesmal, so schien es zunächst, würde Murnau leer ausgehen. Aus bereits bestehenden Teilverbänden3 entstand ab 1934 unter dem Kommando von Oberst Ludwig Kübler die einzige deutsche Gebirgsjägerbrigade mit neuen Kasernen in Bad Reichenhall, Füssen und Garmisch.4
Die Murnauer Nationalsozialisten wollten aber unbedingt auch einen eigenen Standort, notfalls ohne Soldaten. So beschlossen sie, für eine „Geländesportschule“ der SA in Grafenaschau (heute Murnau-Westried) ein sehr großes Grundstück samt Erschließung kostenlos (!) zur Verfügung zu stellen.5 Die SA nahm dankbar an, nutzte das Areal aber nur kurz und übergab es dann 1935 an den neu geschaffenen „Reichsarbeitsdienst“ weiter, der hier die einzige „Feldmeisterschule“ Süddeutschlands einrichtete.6
Abbildung 1: Haupteingangstor der Feldmeisterschule 4 in Murnau-Westried (Abkürzung „FS 4“ am Scheitelpunkt des Torbogens). Die Lehrgangsteilnehmer wohnten in sogenannten „Feldhäusern", einfachen aber beheizbaren Baracken in Holzständerbauweise. © Privat.
Abbildung 2: Dienstgradabzeichen des „Reichsarbeitsdienstes", einer ideologisch geprägten Organisation der Nationalsozialisten. Die Schulterklappen der „Feldmeister“ entsprechen denen der Wehrmachtsoffiziere. Foto: © privat.
Selbstbewusst betrieben die Nationalsozialisten ihre massive Aufrüstung. Im Zeitraum von 1937 bis 1940 verdoppelten sich die Rekrutenjahrgänge. Um alle einberufen zu können, mussten reichsweit hunderte neuer Kasernen entstehen.
Abbildung 3: Schaubild zur zahlenmäßigen Entwicklung der Rekrutenjahrgänge. Während des Ersten Weltkriegs reduzierte sich die Zahl der Geburten deutlich, deshalb gab es 18 Jahre später, ab 1934, entsprechend weniger Rekruten. Ab 1919 wurden bis zum Maximum 1922 wieder mehr Kinder geboren. Dieser stärkste Jahrgang sollte dann 1940 in die Wehrmacht. Vor diesem Hintergrund empfahlen die Militärstrategen Hitler einen Angriffskrieg nicht vor 1941. Grafik entnommen aus „Weilheimer Tagblatt“ vom 3.6.1936, S. 3, public domain.
Damit war Murnau nun wieder im Rennen. Es mag sein, dass sich die alle noch zu Kaisers Zeiten ausgebildeten höheren Offiziere dabei an die durchaus angenehmen Manöver im Großraum Murnau erinnerten. Vielleicht waren aber auch die Alternativen in der Umgebung einfach schon besetzt – in Bad Tölz gab es die „Junkerschule“ der SS, in Schongau eine Ausbildungseinheit der Luftwaffe samt Flugfeld. Die verkehrsgünstig gelegene Bezirksstadt Weilheim bewarb sich nicht, der überregionale Einfluss der dortigen lokalen nationalsozialistischen Partei-Funktionäre war anfangs eher gering. Murnau jedoch hatte sich in der NSDAP früh einen Namen gemacht.7 Jedenfalls erhielt die Marktgemeinde trotz der bereits existierenden Feldmeisterschule den Zuschlag für gleich zwei Kasernenneubauten. Eine sollte die IV. Abteilung des Gebirgs-Artillerie-Regiments 79 aus Landsberg aufnehmen, die andere eine neu aufgestellte Gebirgs-Panzerabwehr-Abteilung mit modernem Gerät.
Abbildung 4: Lage der beiden Kasernen am nördlichen Ortsrand der Marktgemeinde Murnau. Eigene Darstellung.
Gauleiter Adolf Wagner, zugleich bayerischer Innenminister, steuerte in München die Baumaßnahmen. Da es viele gleichzeitig zu errichtende Kasernenbauten gab, wies er den wenigen zur Verfügung stehenden Architekten bestimmte Projekte zu. So eine
Zuweisung konnte praktisch nur ablehnen, wer sich mit dem Gedanken an eine Auswanderung trug. Die Kasernenbauten in Murnau gingen dann auch an ein Nicht-NSDAP-Mitglied, den erst 30-jährigen Architekten Sep Ruf, einen der bedeutendsten Architekten des letzten Jahrhunderts.8 Ruf musste Prioritäten setzen, mit den wenigen bereits überlasteten Baufirmen war ein synchrones Bauen beider Kasernen nicht möglich. Das Münchner Generalkommando priorisierte die Artilleriekaserne, so hatten die Panzerjäger zu warten.
Abbildung 5: Ein seltenes „Sonder-Kraftfahrzeug 7“. Der mittlere Zugkraftwagen (Halbkettenfahrzeug; 8 Tonnen) mit Maybach-6-Zylinder-Benzin-Reihenmotor des Gebirgs-Artillerie-Regiments 79 bot Platz für bis zu 12 Soldaten und konnte mittlere Geschütze ziehen. Foto: ©Stadtarchiv Weilheim.
Schon im November 1938 bezogen die Soldaten der IV. Abteilung des Gebirgs-Artillerie-Regiments 79 feierlich ihre moderne neue Unterkunft am Nordrand Murnaus und zeigten stolz ihr neues motorisiertes Gerät. Die Liegenschaft hatte eine Kapazität von rund 1.000 Mann und hieß dann ab 1939 „Kemmel-Kaserne“.9
Erst Mitte 1939 gelang die Fertigstellung der zweiten, der „Panzerjägerkaserne“. Der ohnehin erst in Teilen neu aufgestellte Panzerabwehrverband verblieb bis dahin in München.
Die beiden militärischen Liegenschaften sollten für die kleine Marktgemeinde einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor darstellen. Man erwartete dauerhafte zivile Arbeitsplätze und von der laufenden Versorgung der hier stationierten Soldaten und ihrer vielen Zugtiere10 sollten die ortsansässigen Betriebe profitieren. Die Hoffnungen erfüllten sich nicht, nach Fertigstellung zogen die ortsfremden Bauarbeiter ab und die Soldaten in den Krieg.
Genauso wenig zahlte sich die überdurchschnittlich hohe Quote früher Nationalsozialisten im Ort aus. Zwar wurde 1934 ein Murnauer Bürger „Kreisleiter“, dieser zog aber umgehend nach Weilheim 11 und erwies sich aber bald als Fehlbesetzung.12
1 Im Jahr 1928 schlug Bürgermeister Utzschneider dem Münchner Militärkommando Murnau als günstigen Standort für Gebirgstruppen vor. Vgl. (Raim 2021), S. 511
2 Der Bedarf an neuen Standorten für das Militär war 1928 noch nicht gegeben, der Friedensvertrag von Versailles erlaubte Deutschland höchstens 100.000 Soldaten. Die dafür erforderlichen Kasernen gab es schon. Siehe dazu Art. 160 des Friedensvertrages vom 28. Juni 1919 (Versailler Vertrag) documentArchiv.de - Versailler Vertrag, Art. 159-213 (28.06.1919) (24.04.2021)
3 In Kempten und Lindau befanden sich die Kasernen der Gebirgsjäger-Bataillone. Die Gebirgs-Artillerie- und eine Gebirgs-Fahr-Abteilung lagen in Landsberg, die Nachrichten-, Minenwerfer- und Pionierkompanie der Gebirgsjäger in München.
4 Das Bataillon aus Kempten sollte die neue Kaserne in Garmisch beziehen und zusammen mit den Soldaten in Füssen zum Gebirgsjäger-Regiment 99 aufwachsen. Für die Gebirgsjäger in Bad Reichenhall mit der Regimentsnummer 100 war Murnau zu weit entfernt.
5 Siehe (Hruschka 2002), S. 110. Einen freien Gemeinderat gab es inzwischen nicht mehr, es entschieden die Funktionäre der nationalsozialistischen Partei.
6 „Feldmeister“ waren Offiziere des nationalsozialistischen „Reichsarbeitsdienstes“. Es gab im ganzen Reich zur Ausbildung dieser Führungskräfte nur fünf solcher Schulen. Alle bayerischen Führer dieser nationalsozialistischen Organisation hatten anfangs deshalb in Murnau ihren 9-monatigen Grundlehrgang abzuleisten.
7 Hier feierte die NSDAP schon früh große Erfolge, so erhielt sie z. B. bei einer der letzten freien Reichstagswahlen am 31. Juli 1932 43,92 % der Stimmen, in ganz Oberbayern lediglich 25,8 %. Siehe dazu: https://www.wahlen-in-deutschland.de/wuuboberbayern.htm (14.08.2022) und (Raim 2021), S. 335 f. (Am Tag nach dieser Wahl verheerte ein fürchterliches Hagelunwetter das Murnauer Land; viele der tief katholischen Einwohner sahen darin ein himmlisches Zeichen.)
8 Vgl. dazu: (Raim 2021), S. 514
9 Der Name bezieht sich auf die Schlachten am Kemmelberg in Flandern (April 1918). Bayerische Truppen beteiligten sich damals unter hohen Verlusten am siegreichen Angriff. Siehe: Vierte Flandernschlacht – Wikipedia (02.01.2022)
10 Auch wenn es die Propaganda zu verheimlichen suchte – nur ein sehr kleiner Teil der Wehrmacht war motorisiert. In über 80 % der Fälle zogen Pferde die Geschütze, die Besatzungen folgten – ebenso wie die Infanteristen – meist zu Fuß.
11 Das Murnauer Land zählte damals zum Bezirk Weilheim. Die auf dieser Ebene ranghöchsten Parteifunktionäre der NSDAP hießen aber „Kreisleiter“. Wohl deshalb gliederte Hitler die Ebenen in der Verwaltung des gesamten Reiches um. Aus den Bezirken wurden „Landkreise“, so mutierte Weilheim von einer Bezirksstadt zur „Kreisstadt“. Die Verwaltungsarbeit übernahm eine neue Behörde „Der Landrat“.
12 Der Murnauer Volksschullehrer Ludwig Siegerstetter, früher Nationalsozialist und als Hitlerputsch-Teilnehmer (1923) „Blutordensträger“, war zuerst in dieser Funktion. Aus Sicht der Partei mit dem hohen Amt eines „Kreisleiters“ überfordert, ersetzte ihn am 29. Januar 1938 der 20 Jahre jüngere und eloquentere „Parteigenosse“ Anton Dennerl aus Garmisch; dieser blieb bis zum Kriegsende im Amt.
2. Erste Kriegsjahre
Nur langsam schob sich der Krieg in den Murnauer Alltag. Zuerst leerten sich die beiden Kasernen, nur ein kleines Nachkommando blieb zurück. Die Lehrgänge an der Feldmeisterschule endeten bald,13 Hitler benötigte die „Bausoldaten“ an der Front. Anfangs schien es, als wäre Hitlers erfolgreicher Feldzug im September
Abbildung 6: Murnau zu Beginn des zweiten Weltkriegs - ein beschaulicher Ort. Foto: © Stadtarchiv Weilheim.
1939 gegen Polen ein militärischer „Spaziergang“, zumindest stellte das die Propaganda so dar. Die Wirklichkeit sah anders aus. Zwar kapitulierten die letzten polnischen Soldaten bereits nach fünf Wochen,14 doch kostete die Operation über 10.000 deutschen Soldaten das Leben. Die Gebirgsdivision, dazu gehörte auch der Murnauer Artillerie-Verband, erlitt schwere Verluste.15 Respekt vor diesem Gegner mag auch dazu beigetragen haben, dass die Wehrmacht die mehr als 3.000 gefangenen polnischen Offiziere ehrenvoll nach den Grundsätzen der Haager Landkriegsordnung von 1907 behandelte.16 Praktisch alle kamen ab Mitte September 1939 nach Murnau in die leerstehende Panzerjägerkaserne, dort entstand das „Oflag VII-A“.17
Abbildung 7: In der Murnauer Panzerjäger-Kaserne internierte polnische Offiziere. Noch hielten sich die Bewacher an das Kriegsvölkerrecht. Foto: public domain.
Die nagelneue Unterkunft bot für damalige Verhältnisse einigen Luxus, z. B. geräumige Duschen und eine Zentralheizung. Viele dieser Vorteile ließen sich aufgrund der dreifachen Überbelegung der Kaserne allerdings nur für die höchsten Dienstgrade realisieren.18 Immerhin durften Emissäre des Internationalen Roten Kreuzes aus Genf regelmäßig die Situation der Gefangenen vor Ort überprüfen und Versorgungsgüter bereitstellen. Das erleichterte das Los der Inhaftierten erheblich und sollte sich bei Kriegsende noch als Glücksfall erweisen.
Abbildung 8: Ein Konvoi des internationalen Roten Kreuzes bringt Versorgungsgüter für die in Murnau internierten polnischen Offiziere. Die Marktgemeinde wäre ohne die Lieferungen aus der Schweiz nicht im Stande gewesen, die bald über 4.000 Personen angemessen zu ernähren. Foto: Sammlung Rempfer, eigene Bearbeitung.
Für die Murnauer Bevölkerung fand der Krieg zunächst vor allem in der Ferne statt. Die Propaganda der Nationalsozialisten versuchte, militärische Auseinandersetzungen als unvermeidlich darzustellen. Sie stimmte die Menschen wie selbstverständlich auf feindliche Waffenwirkungen gegen die Zivilbevölkerung ein.
Alle Bewohner mussten an Luftschutzübungen teilnehmen und Vorkehrungen zur verpflichtenden nächtlichen Verdunkelung treffen. Die Maßnahmen begannen schon 1935 und nahmen im Krieg natürlich an Häufigkeit zu.19 Für heutige Betrachter ist es erstaunlich, mit welcher Selbstverständlichkeit man damals davon ausging, dass mit chemischen Kampfstoffen gefüllte Bomben zum Einsatz kommen. In diesem Zusammenhang ist der hohe Bedarf an Schutzausrüstungen20 und Schulungen zur Gefahrenabwehr bei Gasangriffen zu sehen. Auf Kreisebene gab es dazu eine eigene Organisation mit ortsansässigen Spezialisten im Nebenamt, den „Entgiftungs-Zug“. Als Leiter fungierte Theobald Wirth, hauptberuflich Straßenmeister der Kreisstadt Weilheim. Diesem entschiedenen Gegner des Regimes gelang es im Laufe des Krieges, immer mehr Gleichgesinnte in seinen Zug zu berufen. Die von der Partei gewünschten und im ganzen Kreisgebiet regelmäßig abzuhaltenden Schulungen für den Fall eines Gasangriffs nutzte er, um Gegenpropaganda zu betreiben. Ein mutiges und zugleich hochgefährliches Unterfangen.21