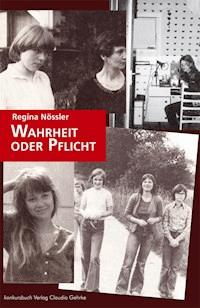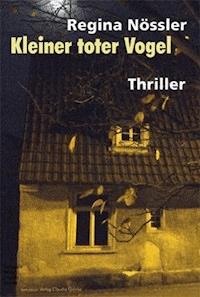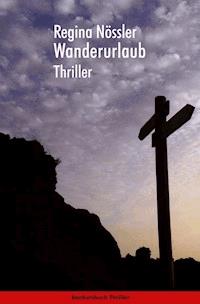9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: konkursbuch
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Deutscher Krimipreis (Pl. 2) und Stuttgarter Krimipreis 2020. An einem Tag im November verlässt Franziska Oswald ihr Zuhause, setzt sich in den Zug und fährt nach Berlin, wo sie niemanden kennt. Franziska lässt ihr Leben zurück, eine vielversprechende Karriere als junge Akademikerin, ein hübsches Einfamilienhaus im Münsterland, das sie zusammen mit ihrem Partner Johannes bewohnt hat. In Berlin kommt sie in einem verwahrlosten Parterreloch unter. Den Mietvertrag hat sie mit falschem Namen unterschrieben. Sie irrt ziellos in der Stadt umher. Niemand darf wissen, wo sie ist. Dann lernt sie Henny Mangold kennen. Henny Mangold bietet ihr an, bei ihr zu putzen. Eine Putzstelle ist das Letzte, was Franziska sich wünscht, aber sie sagt zu. Und erkennt bald, dass nicht nur sie etwas zu verbergen hat, sondern auch Henny Mangold. Und dann gibt es noch Sina, eine herumstreunende Jugendliche aus Neukölln, die aus Langeweile beginnt, Franziska zu verfolgen ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 432
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Regina Nössler
Die Putzhilfe
Thriller
Konkursbuch Verlag Claudia Gehrke
Zum Buch
An einem Tag im November verlässt Franziska Oswald ihr Zuhause, setzt sich in den Zug und fährt nach Berlin, wo sie niemanden kennt. Franziska lässt ihr ganzes Leben zurück, eine vielversprechende Karriere als junge Akademikerin, ein Einfamilienhaus in einer hübschen Siedlung im Münsterland, das sie zusammen mit ihrem Partner Johannes bewohnt hat. In Berlin kriecht sie in einem dunklen, verwahrlosten Parterreloch im Hinterhof unter. Den Mietvertrag hat sie mit falschem Namen unterschrieben. Sie irrt ziellos in der Stadt umher. Ihre Geldreserven schrumpfen. Niemand weiß, wo sie ist. Und das aus gutem Grund, denn zu Hause ist etwas Furchtbares geschehen. Dann lernt sie bei einem Museumsbesuch unfreiwillig Henny Mangold kennen. Sie kommen ins Gespräch, und Henny Mangold bietet ihr an, bei ihr zu putzen. Eine Putzstelle ist das Letzte, was Franziska sich wünscht, aber sie sagt zu. Und erkennt bald, dass nicht nur sie etwas zu verbergen hat, sondern auch Henny Mangold. Und es gibt noch Sina, eine herumstreunende Jugendliche aus Neukölln, die aus Langeweile beginnt, Franziska zu verfolgen ...
Regina Nössler schreibt seit Jahren ungewöhnliche Thriller, die aus den »brutalen blutigen Thrillerwelten herausragen«, denn »sie korrespondiert mit unser aller Erfahrung, vermutlich deswegen erkennen wir uns so oft in ihren Konstellationen und Konflikten.« (Thomas Wörtche)
Ihr zuletzt erschienener Krimi »Schleierwolken« (2017, 3. Auflage 2019) war auf der Krimibestenliste von DLF und F.A.S.
»Selten wurde subtiler Horror so leise und so gekonnt erzählt.«
(Thomas Wörtche, Deutschlandfunk Kultur)
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
Zum Buch
1 Tag null
2
3 Tag sechzig
4
5
6
7
8
9 Vier Jahre zuvor
10
11 Tag einundsiebzig
12
13
14
15 Drei Jahre zuvor
16 Tag hundertfünfzehn
17
18
19
20 Zwei Jahre zuvor
21
22 Die Scheißwelt
23
24 Ein Jahr zuvor
25
26
27
28
29 Heute
30
31 Tag hundertsechsundachtzig
32
33
34 Tag minus eins
35
Zur Autorin
Impressum
1 Tag null
Als sie losging, unbeholfen wegen des Gepäcks und ihrer schmerzenden Hüfte, setzte der Regen ein. Ein hässlicher kalter Dauerregen, der so bald nicht wieder aufhören würde. Sie hatte erst einen Bruchteil der vor ihr liegenden Strecke bewältigt und war schon jetzt völlig durchnässt.Was für ein Abschied. Bei ihrem überstürzten Aufbruch hatte sie so vieles nicht bedacht – am allerwenigsten die Wettervorhersage. Aber es gab kein Zurück. Sie käme auch gar nicht mehr ins Haus. Sie hatte ihren Schlüssel dort gelassen, damit sie es sich im letzten Moment nicht anders überlegte. Wenn sie ins Haus gelangen wollte, müsste sie auf seine Heimkehr warten, und genau das durfte sie auf gar keinen Fall riskieren.
Die Straße war schlecht beleuchtet, und jetzt in der Dunkelheit, die an diesem Novembertag besonders früh eingesetzt hatte, konnte sie kaum etwas erkennen, aber die Frau mit Schirm, die ihr auf dem Gehweg entgegenkam, sah von Weitem so aus wie Petra, ihre Nachbarin von gegenüber.
Sie wandte schnell den Blick ab und wechselte die Straßenseite, mit dem Rollkoffer, dem Rucksack und der Reisetasche über der Schulter. Bloß nicht Petra begegnen. Petra würde natürlich das Gepäck bemerken und fragen, ob sie verreise, davon habe sie ja gar nichts erzählt, wohin die Reise denn gehe und für wie lange. Und warum sie bei diesem scheußlichen Wetter nicht das Auto nahm.
Hätte sie dann sagen sollen: Ich weiß nicht, wohin? Und: Für sehr lange, ich komme nicht mehr zurück? Und: Leb wohl, ich konnte dich übrigens noch nie leiden, du blöde Kuh? Und: Ich kann nicht das Auto nehmen, weil ich den Schlüssel weggeworfen habe?
Petra war eine Person aus der anderen Welt, aus der Wirklichkeit, zu der sie nicht mehr gehörte. Seit ungefähr zwei Stunden nicht mehr. Erstaunlich, es hatte nur zwei Stunden gebraucht, um sich von dreiunddreißig Jahren Leben zu verabschieden. Als sie begonnen hatte, Koffer, Reisetasche und Rucksack zu füllen, wahllos und ohne richtiges System, was gar nicht zu ihr passte, war ihr die Wirklichkeit bereits entglitten, mit jedem T-Shirt und jedem Pullover ein kleines bisschen mehr. Würde sie sich von nun an immer so fühlen? So falsch? Wie in einer Art Zwischenwelt? Der Regen allerdings, der ihr ins Gesicht peitschte, wirkte sehr echt.
Ihren Wagen hatte sie zuerst vor dem Haus stehen lassen wollen, dort, wo sie immer parkte. Ihr Auto stand draußen auf der Straße, seins in der Garage. Ungeschriebenes Gesetz, nie in Frage gestellt. Aber hätte ihr Wagen vor dem Haus gestanden, wäre er verwundert über ihre Abwesenheit gewesen. Er sollte sie im Institut vermuten. Und zum Institut fuhr sie immer mit dem Auto. Er sollte ahnungslos sein. Nichts ungewöhnlich finden und vor allem nicht alarmiert sein. Zumindest nicht sofort. Sie brauchte ein paar Stunden Vorsprung.
Also musste das Auto verschwinden. An Bequemlichkeit gewöhnt, war sie versucht, damit zum Bahnhof zu fahren, hatte davon aber bald wieder Abstand genommen. Am Ende würde irgendeine Kamera ihr Kennzeichen aufnehmen. Gab es am Bahnhof Kameras? Bestimmt. Und wenn der Wagen länger als ein paar Stunden dort stand und die Parkzeit abgelaufen war, fiele es auf. Die Halterin würde ermittelt, die ganze Maschinerie in Gang gesetzt, Post an ihre Adresse geschickt, die nicht länger ihre Adresse war.
Nach dem Institut war sie zwar nach Hause gefahren, aber nicht zu ihrer Siedlung, sondern in einen anderen Ortsteil, in dem sie sich nie aufhielt. Er auch nicht. Den Wagen hatte sie auf dem Parkplatz des Friedhofs abgestellt. Hier würde ihn so schnell keiner bemerken. Sie hatte den Schlüssel in einen Abfalleimer geworfen, gut verpackt in einer Plastiktüte, und war zu Fuß nach Hause gegangen. Zu Hause hatte sie den Koffer und die Reisetasche aus der Abstellkammer geholt und sofort zu packen begonnen, während es draußen dunkel wurde.
Der Bus fuhr tagsüber alle dreißig Minuten, später dann, gegen Abend, nur noch alle sechzig Minuten und nach einundzwanzig Uhr gar nicht mehr. Sie hätte natürlich ein Taxi nehmen können, aber sie durfte nicht gleich am Tag null ihr Geld verschwenden. Außerdem musste man in dem kleinen Ort erst eins bestellen und anschließend lange darauf warten. Sie konnte nicht eine halbe Stunde auf ein Taxi warten. Und wo auch? Etwa zu Hause? Wo sie jederzeit mit seiner Rückkehr rechnen musste?
Ihre Hüfte tat noch immer höllisch weh, und das Gehen fiel ihr schwer. Hoffentlich war es nichts Schlimmes, nichts, wofür sie zum Arzt musste. Sie hatte keinen Arzt mehr. Sie hatte ja nicht einmal mehr ein Leben. Die Hämatome auf ihren Oberarmen, blau-lila, würden sich in ein paar Tagen verändern und eine hässliche gelbe Farbe annehmen. Dann wäre sie längst an einem anderen Ort.
Zuerst wollte sie es vermeiden, direkt an der Bushaltestelle unter dem Dach im Licht der Straßenlaterne zu warten, aber der Regen war zu stark. Also stellte sie sich dicht vor den Fahrplan, mit dem Rücken zur Straße, und tat so, als müsste sie ihn gründlich studieren, obwohl sie ihn inzwischen fast auswendig kannte. Die Feuchtigkeit und die Kälte, die sie erst jetzt richtig spürte, krochen ihr unter die Kleidung. Der Bus kam in zehn Minuten, was ihr unendlich lang erschien. In zehn Minuten konnte so viel passieren. Petra könnte auf die Idee kommen umzukehren, um sich zu vergewissern, ob es sich bei der bepackten Frau draußen im Regen, die so eilig die Straßenseite gewechselt hatte, tatsächlich um sie handelte. »Das sah ja fast so aus, als wolltest du mir aus dem Weg gehen«, würde sie sagen, begleitet von ihrem unpassenden, affigen Lachen, und sie würde sich eine glaubhafte Erklärung einfallen lassen müssen. Petra war schon immer unerträglich neugierig gewesen. Warum fiel ihr das erst jetzt auf? Petra würde nicht lockerlassen, bis sie eine Antwort auf die Frage erhielt, wohin sie denn mit dem ganzen Gepäck wolle. Im Grunde konnte ihr das natürlich egal sein. Sie würde Petra niemals wiedersehen.
Oder noch schlimmer, er könnte inzwischen nach Hause gekommen sein, sich wundern, wo sie um diese Zeit war – nein, er würde sich nicht wundern, er würde sofort wütend werden, vor allem, wenn er merkte, dass ihr Handy ausgeschaltet war, sie sollte doch immer erreichbar sein –, und nach ihr suchen.
Doch nichts dergleichen geschah. Dass er sie ausgerechnet hier suchen würde, war ohnehin sehr unwahrscheinlich. Sie fuhr nie mit dem Bus, und er wusste vermutlich nicht einmal, dass es eine Busverbindung gab.
Als der Bus endlich kam, eilte sie mit ihrem Gepäck zur vorderen Tür, wuchtete es nach oben und kaufte sich beim Fahrer ein Ticket. Der Fahrer sah sie nicht an, als er ihr das Wechselgeld reichte, was sicher an dem erbarmenswerten Anblick lag, den sie bot, durchgefroren und mit nassen Haaren.
Sie suchte sich einen Platz und versammelte ihr Gepäck um sich herum. Die drei Gepäckstücke waren nun alles, was sie noch besaß. Sie zitterte und wusste nicht, ob vor Angst oder Kälte oder wegen beidem. Von ihrer Jacke und ihren Haaren tropfte es auf den Sitz und den Boden. Was für ein Abschied. Der Bus setzte sich in Bewegung, sie verließen rasch das Ortszentrum, machten einige Biegungen und fuhren kurz darauf dicht an der Siedlung vorbei. Ihrer Siedlung. Sie wollte sich zwingen, die Augen zu schließen oder zur anderen Seite zu sehen, aber dann warf sie doch einen Blick – den letzten – auf die adretten Einfamilienhäuser mit den kleinen Gärten. Sehr kleine Gärten, genau betrachtet. Die Neubausiedlung war erst in den vergangenen Jahren hochgezogen worden, vorher war hier Münsterländer Acker gewesen. Ihre Eltern waren der Ansicht, sie habe es geschafft, wenn sie mit dreiunddreißig in einem so properen Haus vor den Toren der Stadt lebte. Mit einem so netten Mann. Eigentlich war für ihre Eltern das Haus immer bedeutsamer gewesen als ihr Beruf. Warum fiel ihr das erst jetzt auf? Es war der letzte, der wirklich allerletzte Blick auf ihr Zuhause. Wie gebannt sah sie hin und duckte sich gleichzeitig weg, wäre am liebsten unter den Sitz vor sich gekrochen, damit sie ja keiner in dem beleuchteten Bus erkannte. Als würden die Leute aus der Siedlung jetzt im November draußen stehen, im Dunkeln und im Regen, und mit einem Fernglas beobachten, wer im Bus saß. Ihr Haus sah man von der Straße nicht, es lag zu weit in der Mitte, was sie für ein gutes Omen hielt. Sie hätte automatisch nach erleuchteten Fenstern Ausschau gehalten. Als sie ging, hatte sie alle Lichter gelöscht und die Tür hinter sich zugezogen. Den Hausschlüssel hatte sie vorher hinter der losen Fliese an der Badewanne versteckt, wo der Abfluss lag, damit er ihn nicht so schnell fand. Vielleicht fand er ihn auch nie, es sei denn, der Abfluss war verstopft oder das Rohr gebrochen. Diese Fliese entfernte normalerweise nur der Handwerker. Er wusste gar nicht, wie man den Zugang zum Rohr aufbekam. Er wusste bemerkenswert viel nicht.
Im Institut hatte sie, kurz bevor sie ging, ihren E-Mail-Account gelöscht. Ihren privaten. Wie man ihren beruflichen löschte und ob das überhaupt möglich war, wusste sie nicht. Irgendwann würde ihm das Fehlen des Koffers und der Reisetasche und der Kleidungsstücke auffallen. Wahrscheinlich schon heute Abend.
An den nächsten Haltestellen wartete niemand, und der Bus fuhr daran vorbei. Der Regen prasselte jetzt unaufhörlich aufs Dach. Sie fuhren durch ein kleines, sehr dunkles Waldstück. Aus dem Fenster des Busses wirkte die Gegend ganz anders als sonst und bereits jetzt fremd. Sie gehörte nicht mehr dazu. Erst jetzt sah sie sich ängstlich um, obwohl es sehr unwahrscheinlich war, dass hier jemand saß, den sie kannte. Außer ihr und dem Fahrer befanden sich nur zwei weitere Personen im Bus, ein Jugendlicher und eine alte Frau, die ihre Handtasche fest umklammert hielt, als befürchtete sie, jemand könnte sie ihr entreißen. Der Jugendliche war sicher auf dem Weg in die Stadt und verfluchte es, noch keinen Führerschein zu haben. Und die alte Frau? Hatte sie jemanden besucht und fuhr jetzt nach Hause? Sie würde keinen der beiden je wiedersehen und wusste auch nicht, ob es sie wirklich interessierte, aus welchem Grund sie hier saßen, oder ob solche Gedanken nur von sich selbst ablenken sollten, von dem, was sie zu tun im Begriff war.
Ein gelbes Schild am Straßenrand zeigte an, dass sie die Ortsgrenze passierten. Sie hatte erst wenige Kilometer hinter sich gebracht, aber wenn alles gut ging, würde sie an diesem Abend in ein schnelleres Beförderungsmittel wechseln und sich immer weiter von zu Hause entfernen.
Es hatte zwar keine Bedeutung, so wie von nun an alles Vergangene ohne Bedeutung war, aber sie würde wahrscheinlich immer im Gedächtnis behalten, dass es an einem Mittwoch geschah, dass sie an einem Mittwoch im November in diesem Bus saß, mit dem sie zum ersten und zugleich letzten Mal fuhr. Ausgerechnet ein Mittwoch. In dem Leben, das sie zurückließ, war Mittwoch immer ihr liebster Wochentag gewesen. Sie hatte ihn meistens komplett im Institut verbracht. Und nun stieg sie an einem Mittwoch aus ihrem Leben aus. Sie trauerte schon jetzt, wenige Stunden nach dem letzten Mal im Institut, um das, was sie verlor. So viele letzte Male. Sie hatte sich nichts anmerken lassen. Bei ihrem Chef nicht, den sie nur flüchtig auf dem Gang gesehen hatte, bei ihrem Kollegen Sebastian nicht und auch nicht bei den Studierenden in ihrer Sprechstunde. Sie hatte sie wegen ihrer Bachelor-Arbeiten beraten, die sie nun niemals lesen würde, hatte ihnen angeboten, sich bei Fragen jederzeit an sie zu wenden. Dieses Versprechen würde sie nicht halten. Den Schlüssel zu ihrem Büro hatte sie weder draußen weggeworfen noch hinter der Badewannenfliese versteckt, das hätte sie einfach nicht über sich gebracht. Sie hatte ihn unten in ihrem Rucksack verstaut, auch wenn er jetzt ganz nutzlos für sie war.
In dem überheizten Bus mit seinem dumpfen, beruhigenden Motorengeräusch trockneten ihre Haare allmählich, und sie fror nicht mehr. Nicht nur ihre Hüfte, auch ihr Gesicht tat weh. Vorsichtig tastete sie daran herum. Ob der blaue Fleck an ihrem Kinn inzwischen wohl größer geworden war? Größer als heute Morgen? Sie hatte so übereilt das Haus verlassen, dass für einen letzten Blick in den Spiegel keine Zeit mehr geblieben war. Hatte der Busfahrer sie beim Bezahlen deshalb nicht angesehen, weil sie peinlich war und er davor lieber die Augen verschloss? Tagsüber im Institut hatte sie bei Gesprächen immer den Kopf zur Seite gedreht.
Die alte Frau und der Jugendliche waren mit ihrer eigenen Welt beschäftigt, beachteten sie nicht und saßen weit von ihr entfernt, aber nachher im Zug wäre es sicher anders. Falls überhaupt noch ein Zug fuhr. Ein Fernzug. Egal, wohin. Hauptsache, in eine andere Stadt, eine möglichst große, in einem anderen Bundesland. Bislang hatte sie in ihrem geordneten Leben stets gewusst, was als Nächstes passieren würde, hatte jeden weiteren Schritt gekannt oder ihn zumindest geplant. Jetzt wusste sie gar nichts mehr. Nur, dass sie die Wirklichkeit, und damit sich selbst, an einem feuchten Novemberabend am Busbahnhof zurückließ, auf der großen Straße, die direkt an der Siedlung vorbeiführte, in dem dunklen Waldstück. Wer war sie dann noch, wenn sie sich selbst zurückließ?
2
Vielleicht war die Frau ja ein Psycho. Ein bisschen wirkte sie so. Reichlich gestört, aber bemüht, es sich nicht anmerken zu lassen. Trugen Psychos so gute Klamotten? Sina lief ihr jetzt zum dritten Mal innerhalb kurzer Zeit über den Weg, sie hatte mitgezählt. Sie beschloss, ihr zu folgen. Sie hatte gerade nichts Besseres vor, und es reizte sie, ohne dass sie hätte sagen können, warum. Warum ausgerechnet diese Frau. Vielleicht hatte es auch gar nichts mit ihr zu tun, sondern lag an der elenden Langeweile. Oder an der Scheißwelt. Oder ihrer Mutter. Um diese Zeit war Sinas Mutter ganz sicher zu Hause.
Ihre Mutter kümmerte es sowieso nicht, wann sie kam. Sina war das nur recht. Manchmal stellte sie sich vor, wie es wohl wäre, die Sorte Mutter zu haben, der es nicht gleichgültig war, wann sie kam und wann sie ging, ob sie überhaupt nach Hause kam, eine Mutter, die sich um sie sorgte, die den Tagesablauf ihrer Tochter auswendig kannte – ihre hatte ja schon Probleme mit ihrem eigenen Tagesablauf – und ihren Stundenplan an den Kühlschrank gehängt hatte. Was? Deine Mutter hat deinen Stundenplan am Kühlschrank? Das ist ja das Letzte! Voll die Kontrolle!, sagte sie zu Schulfreundinnen. In Wahrheit beneidete Sina sie ein bisschen. In Wahrheit hatte sie gar keine richtigen Schulfreundinnen. Manchmal stellte sie sich eine Mutter vor, die nicht herumbrüllte, wegen Kleinigkeiten völlig ausrastete, sich wahlweise stundenlang ins Bett verzog, ohne ansprechbar zu sein, oder in hysterische Tränen ausbrach, sodass man sie auch noch trösten musste. Bäh, kotz. Eine Mutter, die nicht in ausgeleierten Joggingklamotten mit Kaffee- und Joghurt- und sonstigen Flecken darauf herumlief wie die letzte Schlampe.
Das erste Mal bemerkte Sina die Frau im November. Sie fiel ihr auf, weil sie so verloren aussah. Erwachsene sahen eigentlich nie so aus, abgesehen natürlich von den ganz schlimmen Fällen. Und ihrer Mutter. Die Frau war kein ganz schlimmer Fall, diagnostizierte sie. Zu gepflegt und zu gut angezogen. Sie gehörte nicht hierher, das erkannte Sina sofort. Unsichere Schritte, als würde der Boden unter ihren Füßen schwanken. Krampfhaft darum bemüht, Selbstsicherheit auszustrahlen und gleichzeitig unauffällig zu bleiben. Je mehr sie sich mit der Unauffälligkeit anstrengte, umso stärker fiel sie Sina auf. Sie blickte sich dauernd hektisch um und hatte diese Angst in den Augen, die Sina bestens aus der Schule kannte. Es sah doch bei allen gleich erbärmlich aus, egal, wie alt sie waren.
Wäre es bei dem einen Mal geblieben, hätte Sina die Frau wieder vergessen, doch wenige Tage später begegnete sie ihr an fast derselben Stelle erneut. Wie so oft war sie mit Bobby unterwegs, was sie ein wenig in ihrer Bewegungsfreiheit einschränkte. Bobby war zwei Jahre älter als sie. Allerdings merkte man ihm das nicht unbedingt an. Sina hatte ihn häufig am Hals. Meistens freiwillig, denn sie liebte ihn, aber manchmal ging er ihr auch gehörig auf die Nerven. Bobby fand entweder alles restlos schön und neu und aufregend – wie beneidenswert –, oder er blieb draußen stehen, weil ihn irgendetwas oder irgendwer empörte. Bobby konnte, je nach Tageslaune, über alles und jeden empört sein, die Gründe dafür kannte nur er selbst. Falls er sie kannte. Und genauso konnte ihn etwas vollkommen Banales so entzücken, dass er sich minutenlang nicht von der Stelle rührte und sie sanft schieben musste, los, Bobby, komm, na los, wir müssen nach Hause.
Als Sina der verlorenen Frau das zweite Mal über den Weg lief, hatte sie Bobby gerade geduldig erklärt, dass es ganz schön kalt sei, zumindest zu kalt zum Herumstehen, und ob er denn nicht friere. Diese Geduld brachte sie nur bei ihm auf. Bei jedem anderen wäre sie nach kurzer Zeit ausgeflippt und hätte ihn dann stehen lassen. Nicht bei Bobby. Bobby konnte sie auch nicht einfach stehen lassen, er hätte nie wieder nach Hause zurückgefunden. Sie hatte ihm mal gesagt, nur ein einziges Mal, dass ein Leben ohne ihn viel leichter wäre. Im selben Moment war sie entsetzt über sich selbst gewesen. Bobby jedoch hatte sie nicht etwa erschrocken angesehen, sondern so wie immer, als hätte Sina, seine Königin, sein Alles, ihm etwas Wundervolles eröffnet. Daraufhin hatte sie sich geschämt. Aber nur ein bisschen. Dann hatte sie ihn gefragt, ob er denn keinen Hunger habe, hatte er natürlich, und das Ganze war vergessen, auch für Sina.
Beim dritten Mal, inzwischen war es Dezember, und in den Schaufenstern und Läden hing der ganze blinkende Weihnachtskrempel – bei Sina zu Hause hing natürlich gar nichts, weil ihre Mutter sich um so etwas wie Dekoration nicht kümmerte, es auch nicht wollte, oder schlicht vergaß, Schlampe, vermutlich würde es auch wieder keinen Weihnachtsbaum geben –, sah sie die verlorene Frau in den Arcaden am Rathaus Neukölln. Sina hielt sich gern dort auf, um von lauter Dingen zu träumen, die sie nicht haben konnte. Klamotten. Elektronische Geräte, natürlich die neusten und teuersten. Freiheit. Davon träumte sie am meisten. Diese Gegend hinter sich lassen. Und ihre Familie. Sie war ohne Bobby losgezogen, weil ihn solche Läden ganz wuschig machten. Klauen, die naheliegendste Möglichkeit, wenn man sich etwas nicht leisten konnte, hatte Sina sich vorerst abgewöhnt, seit sie im vergangenen Sommer dabei erwischt worden war. Peinlich. Und schon zum zweiten Mal. Beim zweiten Mal war es ernster geworden als beim ersten. Sina war eine »Jugendliche mit Verantwortungsreife«, was bedeutete, dass sie nicht zurückgeblieben war. An sich ja erfreulich, aber in diesem Fall ungünstig, denn übersetzt hieß es, dass sie für ihre Taten verantwortlich war. Ihre Mutter hatte sich tatsächlich jedes Mal bestimmt einen ganzen Tag lang für sie interessiert. Oder so getan. Oder wenigstens einen halben Tag? Auch, als Sina dieser Kuh aus ihrer Klasse eine reingehauen hatte – ein bisschen geschubst traf es besser – und ein Schulverweis drohte. Insofern sollte Sina sich das Klauen vielleicht wieder angewöhnen. Oder das Reinhauen. Schubsen. Nein, besser doch nicht. Es war gut, wenn ihre Mutter sie in Ruhe ließ. Sina wollte weg. Sie wollte nicht mehr mit ansehen, wie die alte Schlampe nichts auf die Reihe bekam. Ihre Mutter schaffte es ja nicht mal, die Wohnung einigermaßen in Ordnung zu halten. Sina müsste bald schon wieder putzen, damit es bei ihnen zu Hause nicht so aussah wie im letzten Drecksloch, in das man niemanden einladen konnte, doch in Wahrheit war es genau das, ein widerliches Drecksloch. Sie hasste Putzen. Toni war dafür noch zu klein, fünf Jahre jünger als Sina, sieben Jahre jünger als Bobby. Den zehnjährigen Toni behelligte man mit so etwas wie Putzen nicht.
Ihre Mutter konnte auch nicht kochen. Sie brachte nicht das einfachste Essen zustande. Vielleicht hatte sie es früher mal beherrscht, aber daran erinnerte Sina sich nicht. Zu lange her. Sie ernährten sich von Tiefkühlpizza, Lieferpizza, scheußlichen Fertiggerichten aus der Mikrowelle, Essen aus Dosen oder Fast Food. Eine Weile hatte ihre Mutter das Haute Cuisine genannt und ihnen den Begriff erklärt, damit alle dachten, sie bekämen etwas ganz Besonderes vorgesetzt. Toni hatte es anfangs nicht aussprechen können, bei ihm hieß es lange Cousine. »Was gibt’s denn heute zu essen?«, fragte er, und Sina antwortete: »Wir essen mal wieder Cousinen.«
Sina liebte den Elektronikmarkt in den Neuköllner Arcaden. Die abgefucktesten Leute standen dort immer vor den größten Flatscreen-Fernsehern und den teuersten Smartphones. Wovon bezahlten sie das? Sina hätte auch gern einen so großen Fernseher gehabt. Zu Hause stand nur ein alter, ziemlich kleiner, der demnächst wahrscheinlich auch noch den Geist aufgab.
In der Nähe der Notebooks und Tablets, auch begehrenswerte Objekte, ging die die verlorene Frau an ihr vorbei, ohne sie wahrzunehmen. Ihr Zustand hatte sich seit dem letzten Mal nicht gebessert, im Gegenteil. Wie ein blasses Gespenst mit riesigen Augen huschte sie gehetzt durch die Gänge. Sina folgte ihr, ohne sich dabei groß etwas zu denken – einfach nur, weil es möglich war. An diesem Tag wirkte die Frau zusätzlich weggetreten. Drogen? – Dafür war sie immer noch zu gepflegt und zu sauber. Psycho halt. Interessant. Das konnte ein vielversprechendes Programm gegen die elende Langeweile werden. Oder ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Mal sehen, was sich daraus ergab.
Sina folgte ihr. Ein wenig kränkte es sie, dass die Frau sie nicht wiedererkannt hatte. Sie erkannte sie doch auch, warum dann nicht umgekehrt? Es kränkte sie sogar sehr. Vom einen auf den anderen Moment wurde Sina heiß. So heiß, als wäre sie in den Wechseljahren wie die alten vertrockneten Weiber. Ihr Kopf dröhnte. Etwas drückte von innen dagegen. Sie kannte das schon: Gekränktsein schlug um in Wut. Schlecht zu kontrollierende Wut. Sina bekam nie mit, wie sich das eine in das andere verwandelte, dazu ging es viel zu schnell, offenbar ganz ohne ihr Zutun, und ob noch Gekränktsein darin steckte oder ob es am Ende dieses Prozesses reine, unverdünnte, hochkonzentrierte Wut war.
Sie hatte Mühe zu atmen. Gleich platzte ihr Kopf, hier neben den Kühlschränken und Waschmaschinen und Trocknern. Würde hässlich aussehen auf der weißen Ware. Sie presste sich die Handflächen fest gegen die Schläfen, damit die Wut wieder verschwand, der Druck. Manchmal funktionierte das. Dabei verlor sie die Frau aus den Augen. Aber nur kurz. Die Frau war schon bei den Kassen angelangt und gerade im Begriff, den Elektronikmarkt zu verlassen.
Langsam klang die Wut ab, und an ihre Stelle trat die Lust, jemanden zu quälen. Prickelnd. Verlockend. Die verlorene Frau wäre dafür das geeignete Objekt, Sina hatte es in ihren Angstaugen gesehen. Normalerweise war die Scheißwelt gegen sie, immer, aber jetzt schien endlich eine gute Zeit anzubrechen.
3 Tag sechzig
Franziska begegnete der Frau das erste Mal direkt nach Caspar David Friedrich. Ein Zufall. Oder vielleicht war es auch Schicksal, wie die Frau später oft behauptete: Das muss Schicksal sein! Wie soll man das denn sonst nennen? Das Schicksal hat uns zusammengeführt! Daran glaubte Franziska allerdings nicht. Es war kein Schicksal, sondern Glück. Oder Pech, je nachdem. Bald darauf sollte sie ihre Wohnung kennenlernen – bis in die hintersten, ekelhaften Winkel, die Fremden gewöhnlich verborgen bleiben.
Franziska kam aus dem dritten Stock und wollte die Alte Nationalgalerie gerade verlassen, um im Café des Bode-Museums Schokoladenkuchen zu essen. Sie freute sich darauf. Seit zwei Monaten stellte der Kuchen den Höhepunkt ihrer Woche dar. Ein Stück Schokoladenkuchen als Höhepunkt der Woche. Wie traurig. Wie erbärmlich. Was war nur aus ihr geworden? Anschließend erwartete sie das dunkle, deprimierende Loch im Parterre mit Blick auf die Mülltonnen und halb tote Sträucher. Ihr neues Zuhause. Doch den Gedanken daran schob sie beiseite. Sie wollte sich noch eine Weile kultiviert fühlen.
Und in diesem Moment, als sie das Treppenpodest vor den Ausstellungsräumen im zweiten Stock fast erreicht hatte, geschah es. Eine Frau mit unsicherem, schwankendem Gang taumelte aus der Flügeltür, suchte Halt, fand keinen, sackte zusammen und sank vor Franziskas Augen zu Boden.
Ein Schwächeanfall, dachte Franziska. Kreislauf. Unterzuckerung. Etwas mit dem Herzen. Was auch immer es war, sie wollte damit nichts zu tun haben.
Sie sah sich um. Niemand in der Nähe, kein Museumsaufseher, keine Besucher. Es war ein Nachmittag im Januar und die Alte Nationalgalerie auf der Museumsinsel nicht besonders gut besucht. Ein Grund, warum Franziska sie mochte. Die Silvestertouristen, zu denen sie nicht zählte, waren längst wieder fort, die Einheimischen, zu denen sie noch weniger gehörte, mussten arbeiten, und diejenigen, die nicht arbeiten mussten, gingen nicht ins Museum.
Sonst lungerten die Aufseher doch überall herum, kamen um die Ecken geschlichen und wiesen unablässig darauf hin, dass die Handtasche vor dem Bauch zu tragen sei, nicht seitlich oder am Rücken – wo steckten sie jetzt alle? Die Frau lag vor den beiden Bänken, die am Rand des Treppenabsatzes standen, und rührte sich nicht. Ob sie tot war? Plötzlicher Herztod? Um zum Ausgang zu gelangen, musste Franziska direkt an ihr vorbeigehen, es gab keinen anderen Weg. Noch immer stand sie mitten auf der Treppe und wollte nichts damit zu tun haben. Seit zwei Monaten lebte sie heimlich, still, in völliger Abgeschiedenheit. Sie wollte mit niemandem reden. Und hilfsbereit wollte sie erst recht nicht sein. Sie wartete darauf, dass endlich jemand kam, der sich an ihrer Stelle des Problems annehmen würde. Jemand mit Verantwortungsgefühl, jemand, der wusste, was zu tun war. Hätte sie in ihrem früheren Leben auch so lange gezögert?
Doch es kam niemand. Nicht von unten, nicht von oben und auch nicht durch die offene Tür aus den Ausstellungsräumen im zweiten Stock. Für einen Moment wirkte die Alte Nationalgalerie vollkommen menschenleer. Nur sie und die Frau auf dem Boden. Sollte Franziska vielleicht rufen? Hilfe, Hilfe? Hallo? Eine Aufsicht suchen?
Sie konnte das Ganze ignorieren und einfach gehen, als hätte sie nichts davon mitbekommen. Entweder nach unten zum Ausgang oder zurück in den dritten Stock zu Caspar David Friedrich. Niemand würde davon etwas bemerken. Auch die Frau nicht.
Krankenwagen. Aber um einen zu benachrichtigen, hätte Franziska ein Handy gebraucht, und darüber verfügte sie seit zwei Monaten nicht mehr. Und die ganzen Komplikationen, die sich möglicherweise daraus ergaben. Vielleicht müsste sie ihre Personalien angeben. Ihren richtigen Namen, den sie in Berlin noch nie benutzt hatte und auch niemals benutzen würde. Ihre Adresse, unter der sie gar nicht gemeldet war.
Kuchen oder Nächstenliebe?
Bis vor zwei Monaten hatte Franziska noch nie allein ein Museum besucht. Als Kind mit ihren Eltern oder in der Schule bei Klassenfahrten, später mit Kommilitonen und hin und wieder mit Johannes, ein paar Mal mit Evi. Nie allein. Bisher hatte sie sich nicht allzu viel aus Kunst gemacht. Sie war Soziologin. Affektierte angehende Kunsthistorikerinnen an der Uni waren ihr immer ein Gräuel gewesen. Doch es gab kein Bisher mehr, kein früheres Leben, an das sie nahtlos hätte anschließen können. Es gab nur das traurige Jetzt.
Bald nach ihrer Ankunft in Berlin hatte sie sich regelmäßige Fahrten zur Museumsinsel angewöhnt. Für den Eintritt konnte sie sich stundenlang in einem der Museen aufhalten, wenn sie wollte, bis es schloss. Schnell hatte sie eine Vorliebe für die Alte Nationalgalerie entwickelt. Für Caspar David Friedrich, Die Toteninsel von Arnold Böcklin und ein kleines Stillleben mit Rotweinkelch, das außer ihr keiner je zu beachten schien. Museum war viel angenehmer, als den halben Tag sinnlos in der U-Bahn oder der S-Bahn zu sitzen, ohne Ziel, womit sie sich auch die Zeit vertrieb. Museum war kultiviert, und sie wollte nicht ganz vergessen, wie sich das anfühlte. Manchmal saß sie auf einer der Bänke und schrieb in ein elegantes Notizbuch mit schwarzem Einband, das sie sich extra zu diesem Zweck gekauft hatte. Schrei-ben kam einer Existenzberechtigung gleich. Und tatsächlich, es funktionierte, hin und wieder lächelte ein vorbeigehender Besucher sie wohlwollend an. Franziska saß im Museum und schrieb. Es sah wichtig aus. Vielleicht sogar wie die Beschäftigung einer Wissenschaftlerin. Im zweiten Stock traf sie manchmal auf eine Frau, etwas jünger als sie, die auf einem mitgebrachten Klapphocker Stunden vor einem Bild verbrachte. Auch sie schrieb in ein Buch, allerdings viel emsiger als Franziska und nicht so zögerlich. Wahrscheinlich eine Kunstgeschichte-Promovendin. Sie wirkte gar nicht affektiert.
Irgendwann, bei der zweiten oder dritten Begegnung, nickten Franziska und sie sich zu. Sie redeten nie miteinander, kein einziges Wort. Nur dieses kurze Nicken als Zeichen, dass sie sich kannten. Das fühlte sich gut an. Als gehörte Franziska noch zum selben Club.
Sie schrieb jedoch nichts Geistreiches über Gemälde und auch nichts anderes von hohem Geist. Sie hatte sich vorgenommen, in ihrem Notizbuch die letzten Monate ihres Lebens zu schildern, und tat dies in ungewohnt holperigen und ungelenken Sätzen, die gar nicht von ihr zu stammen schienen. Franziska hatte immer mit großer Leichtigkeit schreiben können, elaboriert, flüssig, elegant.
Bevor sie wieder nach Hause fuhr, aß sie jedes Mal Schokoladenkuchen im Bode-Museum. Nach Hause, was für ein unpassender Ausdruck. Sie hatte schnell herausgefunden, dass man das Café des Bode-Museums auch betreten konnte, ohne Eintritt zu zahlen. Solche Dinge – Eintrittskarten fürs Museum, Tickets für die U-Bahn –, an die sie bis vor Kurzem keinen Gedanken verschwendet hätte, waren plötzlich teurer Luxus geworden. Es war nicht zu leugnen: Franziska musste ihr Geld zusammenhalten.
Was sollte sie jetzt tun? Am liebsten gar nichts. Doch wenn sie gar nichts tat, wäre sie am Ende noch schuld, falls die Frau starb. Das war mit Sicherheit eine viel zu dramatische Fantasie. So schnell starb man nicht. Franziska konnte die Frau nicht dort liegen lassen und einfach gehen, so verhielt sich keine erwachsene Person. Andererseits spürte sie die fortschreitende Veränderung in sich, die langsam von ihr Besitz ergriff, seit sie so verwildert und isoliert existierte. Inzwischen wäre sie durchaus in der Lage, das Museum zu verlassen, ohne etwas zu unternehmen. Sogar ohne jemandem Bescheid zu sagen. Vielleicht würde sie danach eine Weile grübeln, ob die Frau möglicherweise gestorben war, weil sie keine Hilfe geholt hatte, aber damit würde sie leben können. Es wäre nicht das Schlimmste gewesen, womit sie leben musste.
Widerwillig und sehr langsam setzte Franziska sich in Bewegung, ging die letzten Treppenstufen nach unten und näherte sich der Frau. Sie war auf ihre Handtasche gefallen und hatte die Augen geschlossen. Ende fünfzig oder Anfang sechzig. Auf dezente Art sehr gut gekleidet. Teure Materialien. Guter Haarschnitt, noch ganz frisch. Ging wohl oft zum Friseur. Sich um eine hilflose Person mit sauberer Kleidung und gewaschenen Haaren zu kümmern, fiel nicht ganz so schwer. Franziska kniete sich neben sie. Und nun? Stabile Seitenlage vielleicht. Wie ging die stabile Seitenlage noch gleich? Und war sie überhaupt in jeder Situation das Richtige?
Sie hielt sich seit knapp zwei Monaten in Berlin auf und versuchte meistens, sich wie eine Touristin zu benehmen und auch genauso zu denken und fühlen. Ich bin nur vorübergehend hier. Ich bleibe nicht lange. Bald fahre ich wieder nach Hause. – Aber sie fühlte sich kein bisschen wie eine Touristin. Eher wie ein getriebenes Tier, das sich in einer Erdhöhle verkroch und nur gelegentlich an die Oberfläche kam, und wenn, dann voller Angst. Franziska fühlte sich in der viel zu großen und zu lauten Stadt verloren, was allerdings genau das war, was sie jetzt brauchte. Wenn sie sich selbst verloren hatte, galt das doch auch für alle anderen? Andere Leute zogen nach Berlin, damit ihr Leben endlich begann. Franziska Oswald war hierhergekommen, um zu verschwinden.
Sie musste auf der Hut sein. Keine Kontakte zu Fremden. Sie sprach nur das Nötigste – Hallo, danke und tschüs an der Supermarktkasse. Man kam, wenn es sein musste, mit erstaunlich wenig Sprache aus. Nachbarn begegnete sie so gut wie nie, und der schmierige Hausverwalter, der ihr das dunkle, viel zu teure Parterreloch im Hinterhof in Neukölln vermietet hatte, mit Blick auf die Mülltonnen und Sträucher voller Plastiktüten, Hundescheiße und alter Pizzaschachteln, wahrscheinlich auch jeder Menge Ratten, hatte nicht das geringste Interesse an ihr gezeigt. Franziska hatte ihr Glück kaum fassen können.
Die Frau schlug die Augen auf und blickte leicht irritiert um sich. Sie sah gar nicht so krank aus wie zuerst angenommen. Sicher kein Herzinfarkt. Franziska sollte zusehen, dass sie endlich hier wegkam.
Die Frau machte einen Versuch, sich zu erheben, was ihr nicht sofort gelang.
»Warten Sie, ich helfe Ihnen.«
Franziska fasste sie um die Schulter und stützte sie, sodass sie es mit ihrer Hilfe bis zu einer der Bänke schaffte. Dort saß sie dann auf dem Boden, mit dem Rücken an die Bank gelehnt. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Aus welchen Tiefen ihres früheren Ichs waren diese Worte entstiegen? Franziska wollte ihr nicht helfen. Sie musste sich beherrschen, um nicht dem fast übermächtigen Drang nachzugeben, auf der Stelle das Museum zu verlassen.
»Ist alles in Ordnung mit Ihnen?«
»Mir ist plötzlich schwindelig geworden. Danke, dass Sie mir geholfen haben.«
Ohne Vorwarnung griff die Frau nach Franziskas Hand, hielt sie fest und drückte sie. Diese Berührung war Franziska zu viel und zu nah. Sie entzog der Frau ihre Hand. Keine Kontakte. Mit niemandem. Sie saß neben einer Fremden auf dem kalten Fußboden, wenigstens auf dem Fußboden eines Museums und nicht irgendwo am Kottbusser Tor, am Hermannplatz oder ähnlich schrecklichen Orten, und fühlte sich um ihren Schokoladenkuchen betrogen.
Von unten kamen einige Besucher mit Audio-Guides auf den Ohren. Warum erst jetzt? Warum nicht schon früher? Ein Mann bemerkte Franziska und die Frau auf dem Boden, ging zu ihnen und fragte, ob er helfen könne, ob er einen Notarzt rufen solle.
»Nein, bloß kein Notarzt! Mir war nur kurz schwindelig. Eine kleine Absence, weiter nichts. Es geht mir schon wieder gut. Außerdem war diese Frau hier so nett, mir zu helfen.«
Kleine Absence. Sehr vornehm. Ein solches Wort passte zu ihrer Kleidung. Sie hatte einen ganz leichten Akzent, kaum merklich. Irgendetwas aus dem Süden, Schwaben oder Baden, das konnte Franziska nicht unterscheiden. Jedenfalls nicht aus Berlin. Gab es in Berlin überhaupt Berliner? Der Mann vergewisserte sich noch einmal, ob ihr wirklich nichts fehle, wünschte dann einen schönen Tag, setzte seine Kopfhörer wieder auf und verschwand in den Ausstellungsräumen.
»Vielleicht wäre es aber keine schlechte Idee, wenn Sie sich untersuchen lassen.«
»Nein, nein, das war nichts. Mir geht es wieder gut, wirklich. Aber danke, dass Sie sich so viele Gedanken machen. Wären Sie so freundlich, mir noch einmal zu helfen?«
Die Frau richtete sich langsam auf, und Franziska stützte sie am Arm, bis sie sicher auf der Bank saß. Franziska setzte sich neben sie. Ein Fehler, wie ihr im selben Moment klar wurde. Nun war es viel schwieriger zu gehen, was sie schon längst hätte tun sollen. Am besten, gleich zur S-Bahn, heute kein Kuchen, um der Frau nicht an anderer Stelle auf der Museumsinsel ein zweites Mal über den Weg zu laufen. Jetzt zu gehen, nachdem sie sich neben sie gesetzt hatte, was eine Art Verbindung zwischen ihnen herstellte, wäre unhöflich gewesen. Doch was kümmerte Franziska Unhöflichkeit? Sie würde die Frau nie wiedersehen. Und selbst wenn, Höflichkeit spielte in ihrem Leben längst keine Rolle mehr.
»Wenn es Ihnen wieder besser geht … ich muss jetzt auch los. Ich habe es wirklich sehr eilig. Kommen Sie zurecht?«
Franziska war egal, wie es der Frau ging und ob sie zurechtkam, und sie hatte es nicht eilig. Sie hatte sogar alle Zeit der Welt. Sie ging keiner Arbeit nach, und zu Hause wartete niemand auf sie. Kein Mensch, der selbstverständlich davon ausging, dass sie später das Abendessen zubereitete. Es wartete auch kein Haustier. Nicht einmal eine durstige Pflanze. Nur das dunkle Hinterhofloch.
»Ach, wie schade. Darf ich Sie nicht wenigstens zu einem Kaffee einladen? Das wäre das Mindeste. Bitte, tun Sie mir den Gefallen!«
Keine Kontakte. Keine Kontakte!
»Es wäre mir eine Freude. Ich bin Ihnen doch was schuldig.«
»Sie sind mir nichts schuldig. Aber gut, dann trinken wir einen Kaffee.«
Die Frau reichte ihr die Hand. »Ich heiße Henny. Henny Mangold.«
»Marie«, sagte Franziska Oswald. »Marie Weber.«
„Ich bin Franziska Oswald. Nicht Marie Weber. Ich habe noch nie Tagebuch geschrieben, nicht einmal als Jugendliche. Wozu auch. Bei mir lief immer alles glatt. Schreibt man Tagebuch nicht nur bei Problemen? Jetzt stelle ich fest, dass ich gar nicht richtig weiß, wie das geht. Aber das hier ist auch kein Tagebuch. Das hier sind meine Notate und Reflexionen. Ich bin gar nicht mehr geübt, mit der Hand zu schreiben. Meine Schrift sieht seltsam aus. Ganz anders als früher. Ich erkenne sie gar nicht.
Die Alte Nationalgalerie ist angenehm leer. Im Unterschied zu den anderen Museen ist sie das eigentlich meistens. Ich bin jetzt das achte oder neunte Mal hier, vielleicht sogar schon das zehnte. In dieser einen schrecklichen Woche Anfang Dezember, als ich DAS LOCH gar nicht ertragen konnte, bin ich zweimal hergekommen. Insgesamt macht das jetzt rund hundert Euro Eintritt. Ich darf nicht so viel Geld ausgeben. Ich darf gar kein Geld ausgeben. Wie soll man kein Geld ausgeben, wie geht das? Ich sitze wie meistens vor der Toteninsel. Passt doch. Gegenüber vom Bild steht eine Bank, auf der ich gut schreiben kann. Soll ich so den Rest meines Lebens verbringen, vor der Toteninsel sitzen und dich mit Nichtigkeiten füllen?
Was ich an Berlin hasse: Dass ich mich immer wieder verlaufe. Es ist so unübersichtlich und riesig. Ich frage mich, warum es nicht allen so geht, aber ich scheine die Einzige zu sein. Rumbrüllen auf der Straße hasse ich auch. Drogen. Verrückt. Angst, mich zu verlaufen. Angst, mich selbst nicht mehr wiederzufinden.“
4
So kam Franziska Oswald an diesem Tag doch noch zu ihrem Schokoladenkuchen. Ausgerechnet ein Mittwoch. Früher, im anderen Leben, war Mittwoch ihr Lieblingstag gewesen. Das andere Leben lag erst zwei Monate zurück.
In der Alten Nationalgalerie konnte man nur im Keller Kaffee trinken, und die Frau stimmte sofort zu, als Franziska das Café des Bode-Museums vorschlug.
»Schaffen Sie das denn auch?«
»Aber ja, es war wirklich gar nichts. Ich fühle mich gut.«
Es war das erste Mal seit zwei Monaten, dass Franziska ein längeres Gespräch führte. Den Hausverwalter zählte sie nicht mit, denn in seinem schmutzigen, vollgestopften Büro hatte sie kaum etwas gesagt. Vor dem Gespräch mit Frau Mangold fürchtete sie sich mehr als früher vor einer Prüfung. Oder vor ihrer Disputation. Sie hatte sogar die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass der Schwächeanfall vorgetäuscht war – wenn, dann allerdings sehr überzeugend – und die Einladung zum Kaffee eine Falle, dass diese harmlos wirkende Frau darauf angesetzt worden war, sie ausfindig zu machen.
Doch es ging gut und gestaltete sich viel einfacher als gedacht und, sofern Franziskas Instinkt sie nicht trog, völlig gefahrlos. Frau Mangold redete am liebsten über sich selbst. Und immer, wenn sie ihr doch eine Frage stellte, wich Franziska geschickt aus. Hatte sie das schon immer so gut beherrscht?
Franziskas einziger – folgenschwerer – Fehler bestand darin, dass ihr in einem unbedachten Moment herausrutschte, sie suche Arbeit. »Ziemlich schnell«, sagte sie auch noch. Das klang so wie: Ich mache alles. Sie hätte es am liebsten sofort wieder zurückgenommen, und im ersten Moment war sie davon überzeugt, dass Frau Mangold es überhört hatte, weil sie nicht sofort darauf reagierte, aber dem war nicht so.
»Sie suchen Arbeit? Können Sie zufällig putzen?«
Putzen?
»Kann das nicht jeder?«, sagte Franziska.
»Aber nein! Das dachte ich auch mal. Ich könnte Ihnen Geschichten erzählen …«
Franziska hatte nicht das geringste Interesse an Geschichten übers Putzen und hoffte, Frau Mangold würde das Thema nicht näher ausführen, obwohl es, zugegeben, unschuldig und unverfänglich wäre, also vielleicht genau das Richtige.
»Bitte entschuldigen Sie«, sagte Frau Mangold, »ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Wirklich, das lag überhaupt nicht in meiner Absicht. Ich meine, Putzen ist ja nicht gerade ein Traumjob, das ist mir schon klar« – an dieser Stelle lachte sie nervös –, »und ich weiß ja auch nicht, was Sie beruflich tun« – hierbei betrachtete sie Franziska eingehend, als verriete ihr das Äußere den Beruf –, »ich dachte nur, wenn Sie fremd hier sind und auf die Schnelle etwas suchen … Sabine Kessler, meine, äh, Putzhilfe …« – bei dem Wort Putzhilfe lachte sie wieder, diesmal verlegen, als wüsste sie nicht, ob es der korrekte Ausdruck war – »also, Sabine Kessler hat einfach aufgehört, von heute auf morgen, obwohl nichts vorgefallen ist, na ja, eine Kleinigkeit ist schon vorgefallen … jedenfalls habe ich jetzt ein Problem. Sie können natürlich auch nein sagen, dafür hätte ich vollstes Verständnis …«
»Ja«, sagte Franziska.
»Ja?«
»Ja, in Ordnung. Ich könnte bei Ihnen putzen.« Franziska bemühte sich, munter zu klingen, aber in Wahrheit musste sie sich überwinden, es auszusprechen. Wer putzte schon gern? Und dann noch bei fremden Leuten? Und vor allem, wenn man wie sie gewohnt war, mit dem Kopf zu arbeiten und nicht mit Lappen und Schrubber? Aber sie brauchte Geld. Bald. Ein bisschen Putzen würde auf Dauer natürlich nicht reichen, aber es wäre ein Anfang. Vor allem brauchte Franziska eine Arbeit unter der Hand, ohne Ausweis, Kontaktdaten, Vorstellungsgespräche, Zeugnisse, Referenzen. Würde Frau Mangold ihren Ausweis sehen, etwas über ihr Leben in Erfahrung bringen wollen?
»Ach, da bin ich aber froh. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie froh ich bin! Wir kennen uns ja gar nicht, und es hat sich ja nun ganz zufällig ergeben, aber Sie machen auf mich einen so vertrauenerweckenden Eindruck, und schließlich haben Sie mir auch sofort geholfen, das tut ja nicht jeder. Denken Sie nur an den Mann, der in einer Sparkasse gestorben ist, wo war das noch?, und alle sind einfach über ihn hinweggestiegen. Schrecklich. Sie hätten das nicht getan. Sie sind anders. Dafür werde ich Ihnen immer dankbar sein. Und Sie haben ja erwähnt, dass Sie neu in Berlin sind und Arbeit suchen, und da dachte ich, ich frage einfach mal.«
Immer dankbar sein – war das nicht maßlos übertrieben? Franziska hatte nichts Großartiges geleistet. Sie hatte ihr zu der Bank geholfen und ihr ihre leicht zerdrückte Handtasche gereicht. Frau Mangold klang jedoch so, als hätte Franziska ihr das Leben gerettet. Dabei wäre sie auch ohne ihre Gesellschaft wieder zu sich gekommen, und ein paar Minuten später hätte ihr der Museumsbesucher geholfen. Aber es tat unbestreitbar gut, dass jemand so freundlich zu ihr war und offenbar viel von ihr hielt. Für einen Moment gab Frau Mangold ihr das Gefühl, sie würde am Leben teilnehmen wie jeder andere auch und nicht wie ein Schattenwesen verschreckt durch die Straßen huschen, immer auf der Hut, immer in der Angst, gefunden zu werden. Vorübergehend vergaß Franziska sogar das dunkle Parterreloch, das sie erwartete, und all das davor.
Frau Mangold wühlte eine Weile in ihrer Tasche und fluchte – allerdings gesittet und leise –, weil sich darin kein Papier befand, wie sie sagte, zog schließlich einen Kalender hervor, riss ganz hinten ein leeres Blatt heraus und notierte etwas.
»Kennen Sie sich in Berlin aus?«
»Nein, nicht besonders.«
»Ich wohne in Dahlem.« Frau Mangold schob Franziska den Zettel zu. »Wir sollten einen Termin ausmachen, damit Sie sich meine Wohnung ansehen können. Ihre künftige Wirkungsstätte. Wenn Sie wollen, gleich morgen. Ich habe noch ein paar Tage Urlaub. Natürlich nur, wenn es Ihnen recht ist und wenn Sie Zeit haben, Marie. Ich darf doch Marie sagen? Ein schöner Name.«
Das fand Franziska auch. Unter anderem deshalb hatte sie sich dafür entschieden. Auch den Nachnamen hatte sie mit Bedacht gewählt. Marie Weber – Max Weber. Nicht zu vergessen, Marianne, Max Webers Ehefrau, Rechtshistorikerin und Frauenrechtlerin. Der Vorname Marianne war Franziska allerdings zu altmodisch erschienen.
All das war ihr im Zug nach Berlin eingefallen, sie hatte nicht lange darüber nachdenken müssen. Mit Max Weber hatte sie wie alle Soziologen ihr Studium begonnen. Ein wenig Hybris war sicher auch dabei, aber das fiel ja niemandem auf, weder dem Hotel-angestellten bei ihrer Ankunft spätabends in Berlin noch dem versoffenen Hausverwalter oder Frau Mangold. Die akademische Welt war ein Kosmos für sich. Franziska liebte diesen Kosmos, schon immer, und der Trennungsschmerz war unvergleichlich und kaum auszuhalten. Sie hätte es weit gebracht, davon war sie überzeugt. Trotz der brutalen Konkurrenz, die diese Welt ausmachte. Wenn ehemalige Kommilitonen plötzlich zu Feinden wurden, im Mittelbau nur noch an ihr eigenes Fortkommen dachten und die anderen wegzubeißen versuchten. Die meisten waren dafür zu weich und scheiterten. Franziska jedoch war immer gut damit zurechtgekommen.
Gleich morgen. Franziska tat so, als würde sie im Kopf ihre Termine durchgehen. Frau Mangold musste sich wundern, dass sie weder ein Smartphone noch einen Kalender zu Rate zog. Franziska fing an zu schwitzen. Sie wirkte einfach nicht wie eine vielbeschäftigte Person. Sie sah auf den Zettel. Die Straße sagte ihr natürlich nichts. Dass es von Neukölln nach Dahlem eine kleine Weltreise war, wusste allerdings sogar sie.
»Sind Sie motorisiert?«
Diese harmlose Frage bewirkte, dass Franziska ihr vor zwei Monaten auf dem Friedhofsparkplatz zurückgelassenes Auto plötzlich mehr als alles andere vermisste, mehr als ihre Familie, mehr als das saubere, ordentliche Münsterland. Sogar mehr als die akademische Welt. Kein Auto zu haben, kam in ihren Augen dem totalen Absturz gleich. Franziska Oswalds Ende als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft. Ob nach so vielen Wochen inzwischen jemandem aufgefallen war, dass der Wagen sich nicht von der Stelle bewegte? Achtete auf dem Friedhofsparkplatz überhaupt jemand darauf? Aber Senden in Westfalen war ein kleiner Ort, nicht einmal eine richtige Stadt, und Franziska konnte sich nicht vorstellen, dass es so lange unbemerkt geblieben war.
Sie wandte den Kopf, um einen Moment Frau Mangolds forschendem Blick zu entkommen. Im Café saßen an diesem Mittwochnachmittag kaum andere Gäste, es gab nichts, was Ablenkung bot. Dann bemerkte Franziska ein dunkles, ziemlich großes Krabbeltier, an die zwei, drei Zentimeter lang, mit glänzendem Panzer, das quer über den Boden huschte. Ganz sicher keine Maus. Eine Kakerlake? Bevor sie Frau Mangold darauf aufmerksam machen konnte, war das Insekt bereits verschwunden.
Aufgegrabene Erde zwischen den dicht stehenden Tannen. Nacht. Vom Schein der Taschenlampe aufgeschreckt, wimmeln unzählige kleine Lebewesen herum, wollen davonkommen, weg vom Licht. Dunkle und auch ganz helle, fast durchsichtige. Ihre tastenden Fühler sind zu erkennen, Borsten, Panzer. So viele Beine. Mittendrin ein dicker Regenwurm, seine bläulichen Ausstülpungen erinnern an Krampfadern. Eine ganz eigene Welt, unbemerkt von der großen Welt weiter oben. Und noch etwas tiefer, aber nicht wirklich tief, diese bleichen Knochen, die im Licht der Taschenlampe zu leuchten scheinen. Lange zarte Finger. Arme. Runder Schädel. Riesige Augenhöhlen. Katzen. Skelette von Katzen. Mehr als eine. Mindestens vier oder fünf. Ein kleiner Katzenfriedhof.
Frau Mangold deutete Franziskas langes Schweigen offenbar als ein Nein. Nein, nicht motorisiert. »In Berlin Auto zu fahren«, sagte sie, »ist ja auch nicht empfehlenswert. Und man kriegt nirgendwo einen Parkplatz. Ich fahre fast gar nicht mehr, ich habe sogar überlegt, den Wagen abzuschaffen. Hoffentlich sind Sie nicht mit dem Rad unterwegs. Viel zu gefährlich in Berlin. Sie können mich gut mit der U-Bahn erreichen. Wo wohnen Sie denn?«
Franziska hatte Mühe, von der dunklen Münsterländer Erde, von dem Gewimmel der kleinen Wesen und den bleichen Knochen wieder zur Berliner Museumsinsel zurückzukehren. Wo wohnte sie denn? »Schöneberg«, sagte sie, ohne einen Augenblick nachzudenken. Die Gegend, in der sie tatsächlich untergekrochen war, erschien ihr zu schäbig für Frau Mangold. Schöneberg war der erste Stadtteil, der ihr einfiel. Oder hieß es Bezirk und nicht Stadtteil? Das hatte sie noch nie verstanden, und es war ihr auch egal. Sie wusste nichts über Berlin. Die Berlinkenner aus ihrem Bekanntenkreis waren ihr schon immer auf die Nerven gegangen. Diejenigen, die mit Namen von Stadtteilen – Bezirken? – und Clubs nur so um sich warfen, welcher angesagt war und welcher nicht mehr. Franziska hatte nie richtig zugehört und ihr Desinteresse gar nicht spielen müssen. Nein, ganz sicher käme niemand auf die Idee, dass sie ausgerechnet in Berlin war.
Frau Mangold reagierte nicht sofort, sodass Franziska sich schon fragte, ob sie etwas Dummes gesagt hatte, ob es Schöneberg auch wirklich gab, oder hieß es vielleicht Schönefeld? Nein, das war in Brandenburg, und dort lag der Flughafen.
»Ach, in Schöneberg«, sagte Frau Mangold dann. »Für Berliner Verhältnisse ist das gar nicht so weit von mir entfernt. Das erreichen Sie gut.«
Als Nächstes fürchtete Franziska die Frage nach der genauen Adresse. Sie kannte keine einzige Straße in Schöneberg. Eigentlich auch keine in Neukölln, abgesehen von der, in der sie wohnte, und der großen, die sie kreuzte. Doch Frau Mangold fragte nicht. Sie strahlte Franziska an, schob ihre Hand über den Tisch, an den Tellern vorbei, der Kuchen war inzwischen gegessen, und legte sie auf ihre.
»Sagen wir, morgen um drei?«
Der Versuch, diese Hand schnell wieder loszuwerden, wäre unhöflich gewesen, eine Zurückweisung – schon wieder dieser unpassende Gedanke an Höflichkeit –, und gerade, als Franziska sich fragte, wie es auf freundliche Art zu bewerkstelligen wäre, zog Frau Mangold sie selbst zurück.
»Ja, morgen um drei passt mir.«
»Wunderbar. Ich freue mich. Ach, ich freue mich so!«
Einerseits rührte Frau Mangolds Freundlichkeit sie, andererseits fand Franziska sie schrecklich übertrieben. Es erinnerte sie an Evi, ihre Kollegin im Institut in Münster, mit der sie sich das Büro teilte. Geteilt hatte, Plusquamperfekt. Evi war auch so freundlich, mit dem Unterschied, dass es bei ihr zweifellos echt war. Bei Frau Mangold war sich Franziska nicht so sicher. Sie musste aufhören, an Evi oder an Sebastian zu denken, all das Verlorene, sonst kamen ihr die Tränen.
Es war ihr zu viel. Viel zu viel auf einmal. Sie entschuldigte sich und steuerte die Toiletten an, um für sich zu sein. Sie hatte die irrige Hoffnung, Frau Mangold wäre einfach verschwunden, wenn sie zurückkam. Im Vorraum zu den Toiletten gab eine Mutter ihrer ratlosen kleinen Tochter, die offenbar etwas brennend beschäftigte, gerade eine Erklärung: »Jesus war der Erste, der aus seinem Grab raus in’n Himmel, und seitdem können wir dit ooch.«
Frau Mangold war nicht verschwunden. Sie saß immer noch an ihrem Tisch und strahlte Franziska wieder an.
»Ich habe mir erlaubt, noch einen zweiten Kaffee zu bestellen. Das heißt, für mich besser Tee. Wo wir es doch so nett miteinander haben, dachte ich. Es ist eigentlich ein bisschen spät, um Ihnen ein frohes neues Jahr zu wünschen, aber ich tue es trotzdem. Haben Sie Weihnachten und Silvester gut verbracht? Wahrscheinlich sind Sie nach Hause gefahren.«