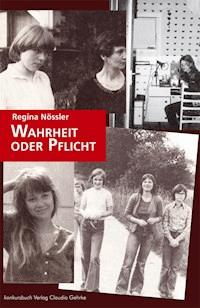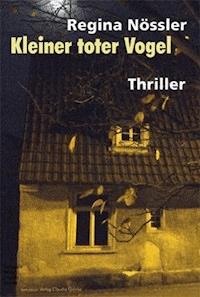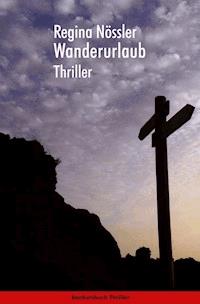9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: konkursbuch
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Auf Platz 1 der Krimibestenliste von Deutschlandfunk Dezember 2023, auch im November 2023 auf der Krimibestenliste. "Ganz sachte lässt Nössler die Geschichte eskalieren ... Das ist subtiler Noir vom Feinsten." (Hanspeter Eggenberger, Krimi der Woche, N° 43/2023) Der neue Thriller der krimipreisgekrönten Autorin. Ein unerträglich heißer Sommer in Berlin. Die Leute werden allmählich gereizt. Isabel Keppler lebt in ihrer Souterrainwohnung in der Kreuzberger Katzbachstraße. Dort lassen sich die Temperaturen einigermaßen aushalten. Als Gegenleistung für ihr Schweigen erhielt sie zwei Jahre zuvor Geld von Matthias Baumann. Inzwischen hat sie es längst ausgegeben. Sie will Nachschub. Zeitgleich will ihr neuer Arbeitskollege Oliver sie unbedingt kennenlernen. Dafür würde er alles tun. Oliver lebt über seine Verhältnisse und hat Schulden, die er verdrängt, sein Gläubiger bedroht ihn. Auch Antonia entflieht der Realität, sie will ihre ungute Vergangenheit endlich hinter sich lassen. Zufällig lernt sie Isabel im Impfzentrum kennen, sie freundet sich mit ihr an, auch mit Oliver verabredet sie sich. Isabel blendet aus, dass Erpressungen meistens schiefgehen und sie sich auf gefährliches Terrain begibt. Antonia denkt, dass Oliver ein ziemlich seltsamer, aber harmloser Typ ist. Oliver fühlt sich anderen überlegen, ist schnell gekränkt und hat eigene, spezielle Vorstellungen von der Wirklichkeit. Proportional zu den Temperaturen wird er immer zorniger. Und auch der sanftmütige Joachim, mit dem sich Isabel unregelmäßig trifft, wird überraschend aggressiv. Und noch bevor dieser Sommer zu Ende geht, spitzt sich die Lage zu – für alle Beteiligten. „…eine der spannendsten deutschsprachigen Krimiautorinnen.“ (Sonja Hartl, DLF)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 361
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Regina Nössler
Kellerassel
Thriller
Konkursbuch
Verlag Claudia Gehrke
Zum Buch
Der neue Thriller der krimipreisgekrönten Autorin. Ein unerträglich heißer Sommer in Berlin. Die Leute werden allmählich gereizt. Isabel Keppler lebt in ihrer Souterrainwohnung in der Kreuzberger Katzbachstraße. Dort lassen sich die Temperaturen einigermaßen aushalten. Als Gegenleistung für ihr Schweigen erhielt sie zwei Jahre zuvor Geld von Matthias Baumann. Inzwischen hat sie es längst ausgegeben. Sie will Nachschub. Zeitgleich will ihr neuer Arbeitskollege Oliver sie unbedingt kennenlernen. Dafür würde er alles tun. Oliver lebt über seine Verhältnisse und hat Schulden, die er verdrängt, sein Gläubiger bedroht ihn. Auch Antonia entflieht der Realität, sie will ihre ungute Vergangenheit endlich hinter sich lassen. Zufällig lernt sie Isabel im Impfzentrum kennen, sie freundet sich mit ihr an, auch mit Oliver verabredet sie sich.
Isabel blendet aus, dass Erpressungen meistens schiefgehen und sie sich auf gefährliches Terrain begibt. Antonia denkt, dass Oliver ein ziemlich seltsamer, aber harmloser Typ ist. Oliver fühlt sich anderen überlegen, ist schnell gekränkt und hat eigene, spezielle Vorstellungen von der Wirklichkeit. Proportional zu den Temperaturen wird er immer zorniger.
Und auch der sanftmütige Joachim, mit dem sich Isabel unregelmäßig trifft, wird überraschend aggressiv.
Und noch bevor dieser Sommer zu Ende geht, spitzt sich die Lage zu – für alle Beteiligten.
„…eine der spannendsten deutschsprachigen Krimiautorinnen.“ (Sonja Hartl, DLF)
Printausgabe in der 2. Auflage.
Pressestimmen zur ersten Auflage des Buchs:
„Ganz sachte lässt Nössler die Geschichte eskalieren ... Das ist subtiler Noir vom Feinsten.“ (Hanspeter Eggenberger, Krimi der Woche, N° 43/2023)
„... virtuos montierte, lakonische, komische, eiskalte und mit unheimlicher Beobachtungsgabe eingefangene und sprachlich filigran umgesetzte präzise Episode aus dem ganz gewöhnlichen Alltag einer Stadt und einer Zeit, in der Wahn- und Irrsinn völlig normal erscheinen. Weshalb man sich auch nicht wundern darf, dass die miteinander verzahnten Geschichten immer wieder Wendungen nehmen, die nicht voraussehbar sind ... Und so bestätigt ‚Kellerassel‘, was wir schon lange wussten: Regina Nössler gehört zur allerersten Garnitur der deutschsprachigen (Kriminal-)Literatur.“ (Thomas Wörtche, Deutschlandfunk, Lesart, 17.11.2023.)
„Regina Nössler hat ein unglaubliches Talent dafür, das ganz normal beschädigte Leben einzufangen. Da kommen Väter vor, die ihre erwachsenen Töchter im Internet stalken, junge, Frauen, die sich in total vermüllten Wohnungen vor der Realität verstecken, und, ganz toll gezeichnet, so verpeilte Jungs, die mit Anfang zwanzig total viele Schulden machen, weil sie glauben, das Leben sei ihnen etwas schuldig ... und ich möchte diese Rezension nutzen, um nicht nur auf Kellerassel, sondern gleich auch noch auf den Vorgänger Katzbach hinzuweisen und beide Bücher zu empfehlen.“ (Kolja Mensing, Deutschlandfunk, 1.12.2023)
„… Figuren begegnen einander in nur scheinbar alltäglichen, sehr präzise beobachteten Situationen. Dadurch zeichnet Nössler in lakonischer Sprache ein messerscharfes unwiderstehliches Portrait dieser Stadt.“ (Sonja Hartl, „Bücher“, Februar/März 2024)
Dreimal auf der Krimibestenliste von Deutschlandfunk, im Dezember 2023 auf Platz 1.
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
Zum Buch
1 Ende August
2 Anfang Mai
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42 Ende August
43 Anfang September
Zur Autorin
Impressum
1 Ende August
Auf den ersten Blick gab es nichts Bemerkenswertes in der Wohnung. Auch nichts Abstoßendes. Ganz im Gegenteil. Gepflegter Altbau. Abgeschliffene Dielen. Berliner Kastendoppelfenster, gut in Schuss, sie mussten erst in jüngster Zeit ausgebessert worden sein. Im Flur hinter der Wohnungstür stand sein Fahrrad an die Wand gelehnt. Ein Rennrad. Ziemlich teuer. Knallrote Einbauküche mit hochglänzenden Oberflächen, wie sie vor einigen Jahren modern gewesen waren. Etwas zu schrill für ihren Geschmack. Hier und da Teppiche auf den Dielen. Ein kleiner Sekretär mit Schubfächern und Laptop darauf. Bücherregale. Maßanfertigungen, wie es aussah.
Es gab an der Wohnung nichts auszusetzen. Kein herumstehendes Geschirr mit angetrockneten Essensresten, keine getragenen Socken oder Unterhosen auf dem Fußboden, nicht die kleinste Nachlässigkeit. Sogar die Fenster mussten erst kürzlich geputzt worden sein. Und trotzdem stimmte etwas nicht, ohne dass sie es sofort hätte benennen können.
Die Möbel waren eindeutig teuer und mit Bedacht ausgewählt. Alles passte zueinander. Hier hatte sich jemand ganz bewusst ein Zuhause zusammengestellt, das etwas hermachen sollte. An der Einrichtung lag es also nicht. Auch nicht am Ausblick. Bäume zur Straße, Bäume im Hof, die allerdings reichlich angegriffen von der anhaltenden Trockenheit wirkten. Himmel. Heute mit einigen wenigen, perfekt geformten Wolken. Es lag auch nicht daran, dass in der Wohnung keine Fotos zu sehen waren, Urlaub, Familie, Freunde, das Übliche, das bei nahezu allen Leuten hing, oder dass es nicht bewohnt gewirkt hätte. Zwar waren alle Zimmer penibel sauber und aufgeräumt – fast ein bisschen zwangsgestört –, auch die Küche, aber ganz offensichtlich bewohnt, denn es roch schwach nach Zwiebel und Curry.
Es war sehr still. Viel zu still. Das musste es sein. Seltsam, dass sich Stille unangenehm anfühlen konnte. Sie schaltete das Radio in der roten Küche ein. Schon besser. Sogar der Müll war erst kürzlich geleert worden, alle Sorten, Hausmüll, Plastik, Papier. Im Radio kamen Nachrichten. Die aktuellen Corona-Inzidenzen für Berlin, die jetzt im Sommer erwartungsgemäß sanken, Wetter, kein Ende der Hitze in Sicht, Verkehrsmeldungen, Stau auf dem Mehringdamm und dem Tempelhofer Damm, Stau auf der Skalitzer Straße, irgendwo in Brandenburg Tiere auf der Fahrbahn, S-Bahn-Linie wegen eines Notarzteinsatzes unterbrochen, Schienenersatzverkehr eingerichtet. Danach ein alter Song aus den Achtzigern: Fade to Grey von Visage.
Sie öffnete den Kühlschrank. Der Inhalt fremder Kühlschränke war immer aufschlussreich und bot auch einigen Unterhaltungswert. In der unteren Schale Gemüse, wie es vorgesehen war. Gurke, Paprika, Tomaten, Pilze. Weiter oben eine verschließbare Box mit Aufschnitt, eine zweite mit verschiedenen Käsesorten. Alles sehr ordentlich und sauber. Man hätte ein Foto davon machen und es als Werbebild für Kühlschränke verwenden können. Tofu »Curcuma«. Büffelmozzarella. Ein großes Glas Bio-Joghurt Natur. Neben einer Packung Milch eine Flasche Prosecco, außerdem eine angebrochene Flasche Weißwein, noch zu zwei Dritteln voll. Sicher nicht billig. Hier war nichts billig. Sie bekam sofort Lust auf ein kühles Glas Weißwein. Schöne Möbel, blauer Himmel, Bilderbuchwolken, rote Küche. Es war strahlend hell und ungefähr siebzehn Uhr. Vielleicht ein bisschen zu früh für Wein? Ach was. Nicht zu früh. Genau richtig. Jetzt und hier. Sie suchte in den Schränken und fand bald die richtigen Gläser. Stilvoll musste es schon sein, alles andere hätte nicht zu dieser Wohnung gepasst. Sehr viele Gläser, mehr als zwölf Stück beim schnellen Durchzählen, natürlich sowohl für Rot- als auch für Weißwein.
Sie schenkte sich ein und trank das Glas noch vor dem Kühlschrank zur Hälfte leer. Dazu hatte sie niemand eingeladen. Oder doch, sie selbst hatte sich eingeladen. Sie füllte nach. Trank. Füllte nach. Auch am Kühlschrank hing nichts Persönliches, mit Magneten befestigt, wie in den meisten anderen Wohnungen. Im Geschirrspüler befanden sich nur ein Teller, eine Müslischüssel, eine Tasse, ein Löffel, ein Messer. Sie wechselte von der Küche auf den Balkon, Fade to Grey noch im Ohr. Auf dem Balkon standen ein kleiner Tisch, zwei Stühle und seitlich ein Liegestuhl. Auch hier musste er tief in die Tasche gegriffen haben, denn es handelte sich garantiert nicht um Möbel aus dem nächstbesten Baumarkt. Die vielen Weingläser, der Esstisch innen mit sechs Stühlen – wozu brauchte er sechs Stühle? –, die Balkonmöbel, es wirkte so, als käme ständig Besuch in großer Zahl, der formvollendet bewirtet wurde. Das bezweifelte sie.
Sie ging mit ihrem leeren Glas zurück in die Küche, aß, ohne einen Teller zu benutzen, ein Brot mit türkischem Spinataufstrich, wozu sie auch niemand eingeladen hatte. Dabei krümelte sie den makellosen Boden voll, oh, das würde er sicher hassen, er würde Zustände kriegen und sofort zu Handfeger und Kehrschaufel greifen. Mit einem neuen Glas Wein – wie viele waren es jetzt schon gegen siebzehn Uhr? Egal – schritt sie die Wohnung ab. Genau deswegen war sie ja hergekommen. Sie wollte sich in Ruhe umschauen, die Räume auf sich wirken lassen. Im Badezimmer Waschmaschine und Trockner von Miele, was sonst. Im Schlafzimmer ein ordentlich gemachtes Bett, fast wie im Hotel. Grünpflanzen in jedem Raum. Grünpflanzen mit allen erdenklichen Blattformen, groß, klein, schmal, breit, rund, länglich, flirrend zart und sukkulentendick. Auch sie wirkten wie aus einem Einrichtungskatalog, steckten in dekorativen Übertöpfen, und augenscheinlich gab er sich große Mühe damit. Allerdings nur auf den ersten Blick. Sie interessierte sich nicht sonderlich für Zimmerpflanzen und hatte keine Ahnung von deren Pflege, aber bei näherem Hinsehen bemerkte sie, dass ihnen etwas fehlte und keins der Exemplare einen wirklich gesunden Eindruck machte. Sie kümmerten eher traurig dahin. Hier sollte unbedingt etwas am Leben erhalten werden, doch es lief nicht optimal.
Draußen war alles freundlich. Lebensbejahend. Das Licht, der Himmel, die wenigen Wolken. Die vom Sonnenlicht sanft angestrahlten Fassaden der Häuser. Fast wie im Urlaub. Sommer war keine unheimliche Jahreszeit. Auch die Wohnung war nicht unheimlich, erst recht nicht bei diesem Licht. Sie war hell. Groß. Gut aufgeteilt. Abgesehen von der roten Einbauküche, die nicht ihrem Geschmack entsprach, hätte sie viel für eine solche Wohnung gegeben. Sie hätte sogar versucht, das kränkelnde Grünzeug wieder aufzupäppeln, wenn’s sein musste. Heute wusste man, dass Pflanzen eine Menge spürten, sogar miteinander kommunizierten. Vielleicht brauchten sie ja Ansprache. Oder schlicht good vibrations. Von good vibrations konnte hier keine Rede sein. Nicht vorhanden. Etwas, irgendein Etwas, lag wie ein Film auf allem, auf den abgeschliffenen geölten Dielen, auf den sorgsam ausgewählten Möbeln, den mehr als zwölf Weingläsern im roten Küchenschrank, dem chromglänzenden Kaffeeautomaten. Die Wohnung verströmte Trostlosigkeit. Interessant, dass das nicht nur bei stinkigen kleinen dunklen Löchern mit Pressspan und Fliesen- und Holzimitat und schimmeligen Bädern und undichten Fenstern der Fall war, sondern auch hier, mit all dieser Großzügigkeit, Sauberkeit und Schönheit. Von einem Moment auf den anderen schmeckte der Wein nicht mehr. Kein Wunder, dass es den Topfpflanzen schlecht ging. Sie spürten das auch.
In der Küche wusch sie Weinglas und Messer sorgsam ab und beförderte beides zurück an seinen Platz. Die Dokumente hatte sie schon vorher auf dem Weg hierhin tief in einem öffentlichen Abfalleimer versenkt. Ein Typ hatte sie dabei misstrauisch beobachtet, und sie hatte zuerst nicht verstanden, wieso, bis ihr aufging, dass er auf der Suche nach Leergut war und sie als Konkurrenz betrachtete, weil ihr halber Arm im Abfalleimer steckte. Sie ertastete auch tatsächlich, neben einer undefinierbaren Tüte mit weichem Inhalt, uuuhhh, war das eine Hundekacketüte?, eine Pfandflasche aus Plastik, die sie herauszog und ihm dann reichte.
Aus dem Vorratsschrank nahm sie ein kleines Glas Vongole. Danach inspizierte sie das Weinregal und entschied sich für einen Roten. Sie steckte beides in ihren Rucksack. Ein Mitbringsel. Gute Idee. Schließlich noch eine versiegelte Flasche Olivenöl, die nicht so aussah wie im Supermarkt gekauft. Irgendwas mit Toskana, las sie. Dass es hier nur hochwertiges Olivenöl gab, stand außer Frage. Es war ohnehin seine Reserve und tat ihm nicht weh. Abgesehen davon war ihr völlig egal, ob es ihm wehtat. Immer genug Vorräte, alles doppelt und dreifach – seine ausgeprägte Hamsternatur war nicht zu übersehen. Gutes Olivenöl war schweineteuer. Davon konnte man zweimal zum Imbiss gehen. Und zusätzlich noch Bier kaufen.
Weshalb hatte sie sich überhaupt die Mühe gemacht herzukommen? Sie wollte unbedingt die Wohnung sehen, deshalb. Sie für einen Moment genießen, sich kurz vorstellen, es wäre ihre. Aber sie merkte schnell, dass es kein ernsthafter Wunsch war. Zu viele bad vibes. Höchste Zeit, den Ort zu verlassen. Wenn man sie nicht schon vorher hatte, bekam man in dieser Wohnung nach einer Weile schlechte Laune. Sie musste hier raus. Besser, sie beeilte sich.
Als sie unten aus dem Haus trat und in Richtung U-Bahn ging, kam sehr langsam ein Streifenwagen angefahren, gefolgt von einem dunklen Mittelklasse-Pkw. Darauf sollte sie nicht reagieren, es gar nicht zur Kenntnis nehmen. Doch das gelang ihr nicht. So unauffällig wie möglich drehte sie sich um, ohne dabei ihr schnelles, aber nicht zu schnelles Tempo zu drosseln. Beide Wagen hielten direkt vor der Tür, so viel bekam sie mit. Mitten auf der Straße in zweiter Reihe. Das konnten sich auch nur Bullen erlauben. Bevor sie hätte sehen können, wer ausstieg, und wie viele, und ob ihr Ziel wirklich genau dieses Haus war, wandte sie sich wieder ab und ging zügig weiter. Die Flaschen in ihrem Rucksack klirrten bei jedem Schritt leicht gegeneinander. Ein gutes Geräusch. Sie blickte nicht mehr zurück und freute sich über das Glas Vongole, den Rotwein und das teure Olivenöl.
2 Anfang Mai
Es war noch nicht Sommer, die Dreißig-Grad-Marke aber schon erreicht. Alles deutete auf endlose heiße Monate bis weit in den September hin, wie auch in den vergangenen Jahren. Isabel Keppler lebte im Keller und sah dem gelassen entgegen. Wenigstens ein Vorteil der Souterrainwohnung. Um eine solche Wohnung würden sich bald alle reißen.
Die Zwanzigtausend hatte sie natürlich längst ausgegeben. Zwanzigtausend, das hielt ja nicht ewig. Und das Leben kostete. Selbst in einer schäbigen Souterrainwohnung, ohne Urlaube dreimal im Jahr, ständig neue Klamotten und ohne teure Hobbys kostete das Leben. Isabel hatte sich von dem Geld ein paar Möbel geleistet, weil ihr die Sperrmülleinrichtung, in der sie hauste, zunehmend auf die Nerven gegangen war, erstens, und weil sie fand, zweitens, dass man mit Anfang vierzig langsam erwachsen war und folglich erwachsene Möbel brauchte. Außerdem hatte sie einen ihrer beiden Jobs verloren. So war es nicht nur ihr, sondern vielen ergangen. Die Zwanzigtausend waren nach und nach zusammengeschrumpft, bis nur noch ein kümmerlicher Rest übrig war.
Seit damals hatte Isabel nicht mehr versucht, ihn anzuzapfen, obwohl es sich anbot und sie außerdem eine entschiedene Befürworterin von Umverteilung war. Ein paar tausend mehr oder weniger wären ihm gar nicht aufgefallen. Das Ganze lag nun fast zwei Jahre zurück, und seither war so viel passiert. Oder auch nicht passiert, je nachdem, wie man es betrachtete. Der Verlust des einen Jobs war zu verschmerzen, da Isabel überraschend einen anderen gefunden hatte, zwar nur befristet, aber immerhin. Im Übrigen war sie erleichtert, die früheren Kollegen nicht mehr sehen zu müssen.
Natürlich hatte sie darüber nachgedacht, noch mehr aus ihm herauszupressen. Er hatte genug Geld, er prahlte damit, und nachdem Isabels anfängliche Freude einer gewissen Selbstverständlichkeit gewichen war – Das steht mir zu –, waren ihr zwanzigtausend plötzlich recht bescheiden vorgekommen. Sie hatte mehr verdient. Eindeutig. Aber das Leben ging weiter, sogar jetzt, das Leben ging immer irgendwie weiter, und schließlich vergaß sie die Angelegenheit. Oder besser gesagt, Isabel hätte sie vergessen, wären nicht seine Nachrichten gewesen, die sie in unregelmäßigen Abständen erreichten.
Er hatte das Ganze nämlich offenbar nicht vergessen. Er rief sich ihr ins Gedächtnis, nicht umgekehrt. Dabei achtete er darauf, weder zu telefonieren noch elektronische Mitteilungen zu versenden. Stattdessen verwendete er Papier und einen dicken schwarzen Filzstift. Große Buchstaben. Jeder Buchstabe wie ein schreiendes Ausrufezeichen. Wahrscheinlich trug er sogar Handschuhe, wenn er diese Botschaften verfasste, und kam sich dabei besonders clever vor. Er hielt sich sowieso für oberschlau. Für einen Macher, der alles im Griff und unter Kontrolle hatte. Isabel fragte sich, wieso er die Mühe auf sich nahm, quer durch die Stadt von Pankow zu ihr nach Kreuzberg zu fahren, und ob er nichts Besseres zu tun hatte. Er verschickte seine Nachrichten nicht mit der Post, sondern stellte sie persönlich zu und drapierte sie entweder an einem ihrer Fenster oder der Wohnungstür. Sie hatte seit damals keine weiteren Forderungen mehr gestellt, er hätte sich also keine Sorgen machen müssen. Doch er machte sich welche. Seine Angst musste groß sein. Ob er befürchtete, dass sie bei ihm zu Hause anrief, wenn seine Frau an den Apparat ging? Ob er jeden Tag zitterte? Wenn dem so war, konnte Isabel ihm diesen Gefallen eigentlich auch tun und ihn erlösen. Noch einmal zwanzigtausend wären angemessen, fand sie. Oder sollte sie diesmal höhergehen?
Sie könnte ihm eine E-Mail schicken. Nein, besser nicht, das wurde ja sonst wo und auf ewig gespeichert und wäre zurückzuverfolgen. Also ein Anruf. Hallo, wir haben ja lange nichts mehr voneinander gehört, wie ist es Ihnen denn mit Corona ergangen, alles in Ordnung mit Ihrer Frau und Ihren beiden entzückenden Töchtern? Alle wohlauf? Herr Baumann, die Sache ist die, einer meiner beiden Jobs läuft diesen Herbst aus, und dann brauche ich Geld. Sie verstehen schon.
Isabels Lust, mit Matthias Baumann zu reden, hielt sich allerdings in Grenzen. Sie hatte seit fast zwei Jahren kein Wort mehr mit ihm gewechselt. Sie war auch nicht zur Polizei gegangen, obwohl sie es sich eine Weile fest vorgenommen hatte. Doch den Weg dorthin hatte sie sich selbst verbaut. Wie hätte sie denen die Zwanzigtausend erklären sollen? Wie dumm, wie ausgesprochen dumm, dass sie sich das Geld aufs Konto hatte überweisen lassen, statt gutes, altmodisches Bargeld zu verlangen. Beim nächsten Mal würde sie es anders machen.
Es war noch nicht Sommer, die Dreißig-Grad-Marke aber schon erreicht. In Berlin und Brandenburg hatte es gefühlt seit Jahren nicht mehr geregnet. Jeder Strauch in der Stadt war verdorrt, jeder Grashalm, und die Bäume, die oft frühzeitig ihre Blätter abwarfen, manche auch ihre Rinde oder sogar einzelne Äste, ächzten. Bald wären Ventilatoren wieder überall ausverkauft, die Leute würden zunehmend gereizt, was sich bereits jetzt andeutete, und Abkühlung gäbe es nicht einmal nachts. Ein Hoch auf die Souterrainwohnung. Bei einer Flutkatastrophe hätte Isabel im Keller allerdings schlechte Karten gehabt.
Es fühlte sich an wie eine Fortsetzung. Isabel mochte eigentlich keine Fortsetzungen. Doch bis auf die gebrochene Nase vor zwei Jahren war alles gut gegangen. Und auch diesmal würde es gut gehen. Sie war auf der sicheren Seite. In den zurückliegenden Wintermonaten hatte Matthias Baumann im Abstand von wenigen Wochen zweimal vor ihrem Fenster gehockt und von dort ins Innere der Wohnung gestarrt. Zwei Male, von denen sie wusste. Vielleicht ja noch viel öfter und sie hatte davon bloß nichts mitbekommen. Er hatte nicht an der Tür geklingelt und seinen Besuch natürlich nicht vorher angekündigt. Er wollte nicht mit ihr reden. Er wollte ihr Angst machen. Sie in Schach halten. Sie kleinkriegen. Am liebsten vermutlich endgültig aus dem Weg räumen. Die vor die Fenster oder an die Tür geklebten Filzstift-Nachrichten in Versalien hielt er wohl nicht mehr für ausreichend. Er war immer erst sehr spät gekommen. Wegen der Einschränkungen waren die Straßen in den späten Abendstunden wie ausgestorben – geschlossene Bars, kein Nachtleben, gähnende Leere, vorbeifahrende Busse ohne Fahrgäste. Die Leute verließen ihre Wohnungen nicht, und niemandem fiel sein eigenartiges Treiben auf. Wie bei vielen Souterrainwohnungen waren auch bei Isabel Gitter vor den beiden zur Straße liegenden Fenstern angebracht. Ein Gefühl von Sicherheit – niemand konnte durchs Fenster in die Wohnung steigen – und zugleich das von Knast. Ging man auf dem Gehweg an ihren Fenstern vorbei, konnte man, selbst bei offenen Vorhängen und innen eingeschaltetem Licht, nur einen schmalen Streifen des unten liegenden Zimmers erkennen. Isabel hatte es ausprobiert. Um weit in die Tiefe zu blicken, musste man sich nach unten beugen und direkt am Fenstergitter kleben. So wie Baumann es getan hatte. Isabel hatte im Bett gelegen – das Schlafzimmer befand sich im rückwärtigen Teil der Wohnung –, festgestellt, dass vorne noch Licht brannte, und war aufgestanden, um es zu löschen. Kurz bevor sie das Licht ausschaltete und ihr Blick dabei in Richtung Fenster fiel, vielleicht, weil sie eine Bewegung wahrgenommen hatte, sah sie das bleiche Gesicht mit den starrenden Augen.
Isabel Keppler war nicht der ängstliche Typ. Im Gegenteil. An diesem Abend jedoch hatte sie sofort alle Lichter gelöscht und war dann fluchtartig zurück ins Schlafzimmer geeilt. Sie hatte die halbe Nacht wach gelegen. Teils, weil sie befürchtete, dass er auf irgendeine Weise versuchen würde, bei ihr einzubrechen, oder dass er am nächsten Morgen, wenn sie zur Arbeit musste, immer noch dort stand – vor allem aber aus Wut über sich selbst, weil sie sich einschüchtern ließ.
Beim zweiten Mal, einige Wochen später, hatte Isabel auf ihrem neu gekauften Sessel ferngesehen, bis sie irgendwann aus dem Augenwinkel einen Schatten bemerkte. An Schatten vor dem Fenster war sie gewöhnt. Sie verzichtete meistens darauf, die Vorhänge zu schließen. Sollten die Leute doch in ihr Zimmer glotzen, wenn sie wollten, das war ihr egal. Mit diesem Schatten verhielt es sich aber anders. Er blieb an Ort und Stelle. Schwankte nicht grölend und biertrunken weiter. Fluchte und brüllte nicht herum, beschimpfte keine realen oder eingebildeten Personen, ließ sich nicht über sein kleines Scheißleben aus und wie böse man ihm mitspielte. Statt sich zu entfernen, wurde der Schatten größer. Zuerst noch diffus, verdichtete er sich zu einer Gestalt und schließlich zu einem Gesicht. Ein Gesicht, das sie kannte. Matthias Baumann. Wie eine riesige Kröte hockte er vor Isabels Fenster, umfasste mit einer Hand das Gitter und hielt in der anderen etwas, das auf sie gerichtet war.
Baumann war nicht zimperlich, wie sie wusste. Zwei Jahre zuvor hatte er Isabel nachts im Viktoriapark die Nase gebrochen. Ihre Nase war wieder verheilt, seitdem aber leicht schief. Ein Andenken an jene Nacht bei jedem Blick in den Spiegel. Isabel war nicht der ängstliche Typ, aber jetzt hatte sie ein bisschen Angst, wie sie zugeben musste. Wer hätte keine Angst vor dieser riesigen Kröte gehabt, die spätabends vor dem Fenster kauerte, dicht ans Gitter gepresst?
Bald konnte sie auch identifizieren, was Baumann in der Hand hielt und auf sie richtete. Eine Pistole. Fast musste sie lachen. Matthias Baumann war Unternehmensberater und braver Familienvater. Seine Familie vermisste ihn so spät am Abend bestimmt schon. Woher sollte er eine Waffe haben? Bestimmt nur eine Attrappe. Schreckschusspistole oder so was. Das hässliche Geräusch, das vor zwei Jahren das Brechen ihres Nasenbeins begleitete, hatte Isabel nicht vergessen. Sie hatte sich an die Abmachung gehalten und keine neuen Forderungen gestellt. Hatte es überhaupt je eine Abmachung zwischen ihnen gegeben? Baumann hatte die Zwanzigtausend überwiesen, und damit war die Sache erledigt.
Ihre Wohnung lag sieben Stufen unterhalb der Straße. Sieben Stufen unter Normalnull, wie Isabel es nannte. Dort saß sie auf ihrem neu gekauften Sessel und konnte sich nicht rühren. Konnte den Blick nicht von dem Gesicht und der Pistole wenden. Wollte er damit durch die Fensterscheibe schießen? Die Gelegenheit wäre günstig gewesen. Niemand auf der Straße, Totenstille draußen. Sie dachte, dass sie nach oben steigen und ihn anschreien sollte. Lass mich in Ruhe, hau ab, verpiss dich, sonst rufe ich die Bullen, steck dieses lächerliche Ding weg. Doch Matthias Baumann war ein ganzes Stück größer als sie und mit Sicherheit stärker. Und er hatte diese Pistole, bei der es sich nur vielleicht um eine Attrappe handelte. Scharfe Waffen konnte man sich vermutlich an jeder Ecke besorgen. Oder über das Darknet genauso leicht bestellen wie neues Spielzeug für seine Töchter. Neues Spielzeug wurde den verwöhnten Gören, die alles im Überfluss hatten, meist schon nach einem Tag langweilig. Dass Isabel die Bullen nicht rufen würde, wusste er nur allzu gut.
Auf diese Weise vergingen etliche Minuten. Sie drinnen, er draußen. Sie auf dem Sessel, er in der Hocke, beide vollkommen reglos. Als testeten sie, wer von ihnen es länger aushielt. Es war lächerlich. Es war bedrohlich. Er hatte den Lauf der Pistole durch das Gitter geschoben und hielt sie unverändert auf Isabel gerichtet. Wurde das für ihn auf Dauer nicht unbequem? In den Knien? Er war auch keine zwanzig mehr. Und draußen war es kalt. Nicht bitterkalt, aber sicher sehr ungemütlich. Drinnen war es warm, die Heizung funktionierte. Das war nicht immer der Fall. Erst zwei Monate zuvor hatte Isabel sich neuen Ärger mit der Hausverwaltung eingehandelt, weil sie schon wieder einen Handwerker wegen der defekten Gastherme hatte kommen lassen. »Mit Ihnen haben wir ja ziemlich viel Theater, Frau Keppler«, hatte die Hausverwalterin gesagt.
Matthias Baumann hatte nicht durch die Fensterscheibe geschossen, sondern war irgendwann unverrichteter Dinge wieder gegangen.
Isabel war lange auf ihrem Sessel sitzen geblieben, bevor sie sich nach draußen wagte.
Für jede der sieben Stufen hatte sie gefühlt mindestens eine Minute gebraucht und oben vor der Tür lange gezögert. Sollte sie jetzt wirklich nach draußen gehen? Direkt hinter der Tür lag die Straße. Wenn er nun irgendwo im Dunkeln lauerte? Und nur darauf wartete, dass sie nachsah?
Keine Menschen draußen. Auch kein Matthias Baumann. Kaum Autos auf der normalerweise stark befahrenen Katzbachstraße. In Socken und ohne Jacke ging Isabel bis zum nächsten Hauseingang, ob er sich dort versteckt hielt. Anschließend suchte sie an ihren Fenstergittern nach einer Nachricht von ihm.
Er hatte nichts hinterlassen.
Am nächsten Tag rief Isabel Babs an. »Du hast doch meine Mappe noch?«, fragte sie.
»Welche Mappe?«
»Die ich dir gegeben habe. Damals, du weißt schon, vor zwei Jahren.«
»Ach so, die, ja klar«, sagte Babs. »Ich weiß noch genau, wie sie aussieht. Das war so eine blaue. Oder war die rot? Ist schon so lange her. Wieso, was ist damit?«
»Ich wollte es nur wissen. Falls mir was passiert.«
»Falls dir was passiert? Wovon redest du? Machst du jetzt einen auf Dramaqueen? Was soll dir denn passieren? Ich weiß gar nicht mehr, wo das Ding ist. Und was das überhaupt sein soll. Du hast ja so geheimnisvoll getan. Ist da dein Abiturzeugnis drin oder so? Habe ja nie reingesehen. Hätte ich da reinsehen sollen? Das hättest du mir aber sagen müssen, echt.«
»Nein, du sollst nicht reinsehen.«
Isabel war sich sicher, dass sie Babs damals erklärt hatte, was sich in der Mappe befand, zumindest ansatzweise und in groben Zügen, aber wenn sie es vergessen hatte, umso besser. Oder sollte sie Babs einweihen, für alle Fälle? Dass sie herumgeschnüffelt hatte, hielt Isabel für ausgeschlossen. In der Mappe befand sich Text, viele Seiten Text, und wenn Babs eins nicht gern tat, dann war es Lesen.
»Und warum rufst du mich dann extra deswegen an? Wirst du irgendwie schrullig, oder was?«
»Vergiss es«, sagte Isabel. »Ist nicht so wichtig. Hauptsache, die Mappe ist noch da. Sie ist übrigens blau.«
»War die nicht doch eher rot? Soll ich mal nachsehen? Wer von uns beiden recht hat?«
»Nein, muss nicht sein.«
»Passt mir auch gerade nicht so gut. Ich kriege gleich Besuch.«
»Schon wieder? Neuen oder alten Besuch?«
»Fang bloß nicht wieder mit deinen blöden Sprüchen an. Aber wenn du’s genau wissen willst, neuen Besuch. Auch vom Alter her. Noch ziemlich knackig. Diesmal ist es ernst, glaube ich.«
»Na dann, viel Spaß.«
Nach diesem Abend im Winter war plötzlich Ruhe eingekehrt. Matthias Baumann tauchte nicht mehr auf. Weder vor einem der vergitterten Fenster noch in Form weiterer Mitteilungen. Isabel vergaß ihn. Dachte auch nicht mehr an die Pistole. Sie war ja sowieso nicht echt gewesen. Im Grunde war Baumann ein Schlappschwanz. Ihr neuer Job hatte angefangen, und er war fordernd. Früh aufstehen, gut, unschön, aber vor allem rund um die Uhr freundlich sein. Nicht gerade ihre liebste Disziplin. »Denken Sie daran, Sie müssen zugewandt sein«, war ihr mehrfach eingeschärft worden. »Die Leute haben Angst, und sie wissen auch nicht so genau, was hier passiert, sind von den Abläufen eingeschüchtert. Ihre Aufgabe ist es, ihnen die Angst zu nehmen. Seien Sie also stets zugewandt und freundlich.«
Spätestens mit Beginn des Frühlings machte Isabel sich keine Gedanken mehr über Matthias Baumann. Er hatte aufgegeben. Endlich war ihm klar geworden, was für einer albernen, kindischen Beschäftigung er mit seinen Drohungen nachgegangen war. Eine neue Forderung behielt sie als Möglichkeit aber im Hinterkopf. Für den Fall, dass sie völlig klamm sein sollte, was ja nie ganz auszuschließen war. Für den Fall, dass sie nicht wusste, wovon sie am nächsten Tag einkaufen sollte. Hatte es in ihrem Leben alles schon gegeben. Herr Baumann, ich habe gerade einen kleinen Engpass, das verstehen Sie doch sicher, und ich komme Ihnen ja auch entgegen, indem ich schweige. Immer noch schweige. Ich bin Ihnen schon ganz lange entgegengekommen, meinen Sie nicht? Sie wissen ja, ich könnte jederzeit –. Die Polizei ist nicht weit für mich. Bloß ein kleiner Spaziergang. Das ist Ihnen doch klar, Herr Baumann?
3
Die Tür unten stand schon wieder auf. Das zweite Mal in dieser Woche. Entweder die Müllabfuhr oder irgendein Idiot hatte nicht daran gedacht, sie zu schließen. Vermutlich der unfähige Hauswart. Darüber hätte Oliver sich ewig aufregen können, es machte ihn wütend, doch für ausschweifende Wut hatte er keine Zeit. Er war spät dran. Sein Rad stand im Hof und war noch intakt, das war die Hauptsache. In den vergangenen Monaten hatte ein Fahrrad-Vandale die Reifen der meisten Räder aufgeschlitzt, irgendwer, der nichts in der Birne hatte und einfach nur zerstören wollte. Autos abfackeln, okay, damit war, je nach Modell, insgeheim auch Oliver einverstanden, CO2 und so weiter, aber wie konnte man friedliche, umweltfreundliche Fahrräder demolieren? Auch Olivers Rennrad war betroffen gewesen, vorne und hinten aufgeschlitzte Reifen.
Viertel vor neun. Er musste sich beeilen. Er war ein bisschen stolz darauf, sich wie die meisten anderen Menschen beeilen zu müssen, was aber natürlich niemand bemerkte. Heute war ein Tag für Helme, hatte er nach der Dusche bei einem schnellen Kaffee beschlossen. Gefahr konnte er oft im Voraus wittern. Das war schon immer so gewesen. Er wollte sich gerade den Helm aufsetzen, als er das Vibrieren des Handys in der Brusttasche spürte.
Seine Mutter. Heute rief sie sehr früh an. Normalerweise war sie rücksichtsvoller. Oder kannte sie neuerdings seine Arbeitszeiten? Das wäre ihm ein bisschen unheimlich gewesen. Regelmäßiger Kontakt zu den Eltern, schön und gut, aber allzu eng sollte er auch nicht sein. Das war ja nicht gesund. Oliver Kliem stand auf dem Gehweg der Dirschauer Straße in Friedrichshain, hielt mit einer Hand sein Rad und in der anderen das Telefon. Er führte grundsätzlich keine Videotelefonate mit seiner Mutter, Gott bewahre, damit wollte er auch gar nicht anfangen, aber jetzt, dachte er, hätte sie ihn ruhig sehen können. Er trug Draußensachen. Sehr adrette Draußensachen sogar. Gewaschen und zudem gebügelt. Kein altes T-Shirt wie sonst, sondern ein ordentliches, kurzärmeliges Hemd. Frisch geduscht. Leicht gegelte Haare. Oliver musste grinsen, weil er sich vorstellte, wie angetan seine Mutter von seinem Anblick gewesen wäre, vor allem von dem gebügelten Hemd. Eine junge Frau ging an ihm vorbei und deutete sein Grinsen falsch, bezog es auf sich. Kurz war Oliver verunsichert, was sie jetzt von ihm dachte, ob sie glaubte, er wolle sie so früh am Morgen plump anmachen. Doch sie lächelte ihn an. Ihm war schon öfter aufgefallen, dass selbst völlig unbekannte Menschen, mit denen man nur für wenige Sekunden zu tun hatte, dieses Unbeschwerte spürten, die gute Laune. Wie anziehend man dann war. Eigentlich ziemlich ungerecht, mit schlechter Laune das Gegenteil von anziehend zu sein, obwohl man dann Zuwendung und all das doch viel nötiger hätte. Das Haar der jungen Frau glänzte in einem schönen Kastanienton in der Morgensonne. Es war schon um Viertel vor neun sehr warm. Oliver würde verschwitzt sein, bevor er ankam.
Inzwischen fast zehn vor neun. »Ich muss jetzt wirklich los.«
»Wohin musst du denn?«, fragte seine Mutter und machte sich gar nicht erst die Mühe, ihre Neugier zu kaschieren.
»Diese neue Stelle. Habe ich dir doch erzählt.«
»Ach ja, stimmt«, sagte sie. »Aber übernimmst du dich damit nicht? Du bist doch jetzt im Studium in der alles entscheidenden Phase.«
»Mach dir keine Sorgen. Ich schaffe das schon. Außerdem ist diese Arbeit wichtig. Ich meine, echt wichtig. Gesellschaftlich von Bedeutung. Verstehst du?«
»Du bist immer so idealistisch, Oliver. Ich finde das ja gut, versteh mich nicht falsch, ich bewundere dich dafür, wirklich, aber du musst doch auch an dich denken. An deine Zukunft.«
»Wenigstens einer aus der Familie sollte idealistisch sein, findest du nicht?«
»Jetzt hör schon auf. Schließlich habe ich meinen Sohn erzogen. Irgendwas muss ich also richtig gemacht haben, oder?«
»Du hast alles richtig gemacht. Aber ich muss jetzt wirklich los.«
Oliver blickte nach oben. Ein wolkenloser Himmel über Friedrichshain. Es gab nichts zu beschreiben. Wie sollte er Wolken ohne Wolken beschreiben? Er setzte seinen Fahrradhelm auf. Die Variante, die von der Form her einem Stahlhelm glich, aber in heiterem Gelb. Die Farbe der Sonnenblumen. Des Löwenzahns. Der Butterblumen. Der DHL-Autos, die ihm schöne Dinge brachten. Der BVG-Busse und -Trams und -U-Bahnen. Die Farbe des Neids.
Seine Mutter meinte es gut, das wusste er. Aber das alles, ihre Fürsorge und ihre Fragen, ob er sich nicht zu viel zumutete, ständig ihre Fragen und ihre Fürsorge, Fragen Fürsorge, wurde ihm oft zu viel. Das klang fast so, als wäre er krank oder besonders schonungsbedürftig oder aus irgendeinem anderen Grund nicht leistungsfähig. Oliver wusste, dass sie es gut meinte, aber er mochte nicht, wenn sie so mit ihm sprach. Das durfte er ihr aber nicht sagen. Es hätte seine Mutter gekränkt und sie einen halben Tag, mindestens, unglücklich gemacht. Mütter und Söhne. Schwierig.
Er mochte seine Wohnung, hatte sich in letzter Zeit aber zu oft und zu lange darin aufgehalten. Über den Büchern. Das war nicht gesund, schon gar nicht in seinem Alter. Es machte ihn lahm. Weniger widerstandsfähig. Machte ihn strubbelig im Kopf. Er mochte seine Wohnung, fand sie inzwischen aber ein bisschen zu klein. Paar Quadratmeter mehr wären nicht schlecht gewesen. Größerer Balkon. Und das stand ihm eigentlich auch zu, fand er. Trotzdem genoss er es nach wie vor, gerade hier zu leben. Angesagte Gegend.
Oliver fuhr los, erst über die Warschauer Brücke, die einen breiten Fluss aus Gleisen überspannte, deren Stahl in der Sonne glitzerte, aus dem Augenwinkel bemerkte er doch eine Wolke, eine ganz kleine, runde am ansonsten reinen blauen Himmel, aber er hatte keine Zeit, um sein Smartphone hervorzukramen, die Notiz-App zu öffnen und die Wolke in ein, zwei Sätzen zu beschreiben, er musste sich beeilen. Natürlich hätte er ganz kurz anhalten können, um sie zu fotografieren. Doch das war keine richtige Herausforderung. Im Übrigen hatte er unzählige Wolkenfotos, er ertrank darin. Nach der Warschauer über die Oberbaumbrücke. Ein neuer Lebensabschnitt fing an. Mit einunddreißig. Zu spät? Nein, genau richtig. Es ging jetzt los. Nicht in dieser Sekunde, aber bald. In Olivers Kopf lief in Dauerschleife der Film namens Zukunft, wann und auf welche Weise alles gut werden würde. Der Film war schön. Total schön. Die Wolke, hatte er den Eindruck, kam ihm nach, wie ein herrenloser, anhänglicher, niedlicher Hund, sie war immer neben ihm und begleitete ihn auf seinem Weg in die Zukunft.
4
Es war so heiß, auch jetzt um achtzehn Uhr noch. Aber mit hochgelegten Beinen und einem Glas Sekt in der Hand ließ es sich aushalten. Balkon mit Blick ins Grüne, so weit draußen, dass es gar nicht mehr wie Berlin wirkte. Bis auf die ganzen Vögel ringsherum nahezu still. Isabel hatte eine anstrengende Arbeitsschicht mit lauter fordernden Leuten hinter sich. Und dann dieser Typ, der sie dauernd ins Gespräch ziehen wollte. Mittagspause mit Dr. Stephan an der Wurstbude draußen, dabei hatte sie an Babs und ihre traurigen Currywürste in der Markthalle gedacht. Babs machte sich ganz schön rar in letzter Zeit, was ihr gar nicht ähnlich sah, aber Isabel hatte keine Lust, das näher zu ergründen.
Stefanie und sie saßen auf den Balkonstühlen, die Isabel immer einen leichten Stromschlag bescherten, wenn sie die Armlehnen berührte, und tranken das zweite Glas Sekt. Ziemlich teuren Sekt. Isabel wusste nicht, ob es dem Standard entsprach und Stefanie und ihr Mann auch sonst teure Getränke bevorzugten, aber eines war klar: Sie hatten beide gute, sichere Jobs und lebten auf größerem Fuß als sie selbst. Auf viel größerem. Im Unterschied zu ihr hatte Stefanie ihr Studium abgeschlossen, fast in der Regelstudienzeit und mit guten Noten. So zielstrebig war sie auch schon in der Schule gewesen. Zu Isabels schlecht bezahlten Jobs äußerte sie sich nie abfällig, sondern fand sie, so Isabels Eindruck, eher skurril.
Stefanie erhob sich, um neuen Sekt aus der Küche zu holen. Isabel blieb allein auf dem Balkon zurück und dachte an den hinter ihr liegenden Tag. Vielleicht war es ganz gut, dass der Job zeitlich befristet war. Fürsorge war einfach nicht ihr Ding. Sie schloss die Augen. Mit ein bisschen Wind hätte man hier auch das Blätterrauschen hören können. Stefanie und ihr Mann lebten in einer relativ neuen Siedlung weit außerhalb des S-Bahn-Rings, die aus lächerlich kleinen Häusern bestand. Die Anfahrt dauerte ewig, aber diese Mühe nahm Isabel gern auf sich. Hier erwarteten sie keine allzu anstrengenden Gespräche und stets etwas Gutes zu essen und zu trinken.
Isabel Keppler war in diesem Frühjahr einundvierzig geworden. Mit neununddreißig hatte sie die Schwelle zur vierzig gefürchtet – das Ende, Leben vorbei. Als es dann so weit war, fand sie es gar nicht schlimm. Im Gegenteil, es war unspektakulär gewesen, hatte nicht wehgetan, war schnell vorbeigegangen und bald vergessen. Es hatte keine Party gegeben. War ja auch verboten. Corona. Isabel war das ganz recht gewesen. Sie hätte auch ohne Corona keine Party veranstaltet. Natürlich war Babs reingeschneit. Mit immerhin nicht ganz billigem Sekt und einem kleinen Brocken Gras. »Jetzt bist du auch eine alte Schachtel«, hatte sie gesagt. »Darauf müssen wir anstoßen, wir beiden Hübschen.« Isabel war nicht in Depressionen verfallen, zu denen sie aber ohnehin nicht neigte. Sie hatte ein robustes Gemüt. Einundvierzig war dann erst recht nicht weiter bemerkenswert gewesen.
Der Frühsommer strengte sich mächtig an und war bereits ein hyperaktiver Hochsommer. Jedes Jahr war nun eins der wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Herrschten länger am Stück über dreißig Grad, war sie froh, die sieben Stufen zu ihrer Souterrainwohnung hinabzusteigen. Sie stellte sich dann die Leute in ihren ausgebauten Dachgeschossen vor, wie sie im eigenen Saft schmorten.
Die für Isabel so ungewohnte Stille wurde plötzlich unterbrochen. Kreischend kamen die zur Erdgeschosswohnung gehörenden Kinder in den Garten gerannt, gefolgt von ihrem Vater. »Der Garten ist nur für die Partei im Erdgeschoss«, betonte Stefanie immer. »Wir haben da nichts zu suchen. Das hat er uns als Erstes unmissverständlich klargemacht. Wenn wir auch nur einen Fuß in den Garten setzen würden, würde er die Polizei rufen, ich sag’s dir. Oder gleich eine Waffe holen.« Dabei lachte sie, um anzuzeigen, dass das mit der Waffe natürlich ein Scherz war.
Isabel konnte nicht einschätzen, ob ihr Platz auf dem Balkon von unten einzusehen war. Wieso machte sie sich darüber überhaupt Gedanken? So etwas war ihr sonst doch auch egal. Sie wünschte, Stefanie käme wieder nach draußen, aber dem Geklapper nach zu urteilen, das aus der Küche drang, holte sie keinen neuen Sekt, sondern bereitete das Essen vor.
Ich könnte Stefanie in der Küche helfen, dachte sie. Sie half Stefanie nie in der Küche. Das war ja das Schöne an den Einladungen ans andere Ende der Stadt. Isabel ließ sich verköstigen und von vorne bis hinten bedienen. Inzwischen fuhr sie viel seltener als früher zu ihrer alten Schulfreundin, und das lag weder an Stefanie noch am weiten Weg, und an Corona lag es auch nicht. Widerwillig musste Isabel zugeben, dass sie sich einschüchtern ließ. Dass sie Einschränkungen in ihrem Leben ohne Gegenwehr zuließ. Auf sich selbst war sie deswegen mindestens genauso wütend wie auf ihn.
Sie fasste nach den Armlehnen, bekam einen schwachen elektrischen Schlag, mit dem sie gerechnet hatte, stand halb auf, schob den Stuhl weiter nach hinten, fast bis zur Hauswand, und setzte sich wieder. Besser so? Nein, vermutlich war sie von unten nach wie vor zu sehen. Und wenn er sie noch nicht bemerkt hatte, machte ihn spätestens das Geräusch der über den Boden kratzenden Stuhlbeine auf sie aufmerksam. Wo blieb Stefanie denn? Mit Stefanie an ihrer Seite hätte sich Isabel wesentlich besser gefühlt. Nicht so ungeschützt. Was für ein Angsthase war nur aus ihr geworden. Sie versteckte sich, klebte dicht an der Wand, damit er sie bloß nicht sah. Das mit dem Einschüchtern funktionierte recht gut.
Stefanie stand in der Balkontür. »Ich bin gleich fertig und bringe das Essen nach draußen. Ich habe heute nicht gekocht, hoffentlich ist das okay. Brot, Käse, Oliven, Salat, ich dachte, bei dieser Hitze ist was Kaltes gut.«
»Sollen wir nicht lieber drinnen essen?«, sagte Isabel.
»Drinnen? Ernsthaft? Es ist doch so schön draußen. Und immer noch so warm. Ach komm, was ist denn los mit dir? Ich dachte, du würdest gern auf dem Balkon essen. Hast du mal gesagt. Weil du selbst keinen hast. Also versteh mich nicht falsch, nichts gegen deine Wohnung, die hat ja ihren eigenen Charme … Sie ist irgendwie … ungewöhnlich … besonders … ja, wirklich … – Jetzt habe ich bestimmt was Blödes gesagt, sorry. Du hast doch sonst immer gern hier draußen gegessen.« Stefanie deutete mit dem Kopf zum Garten und senkte die Stimme. »Es ist wegen ihm. Er stört dich, oder? Kann ich verstehen, geht mir genauso. Aber ich finde, das sollte uns nicht kümmern. Wir können ja besonders laut lachen. Vielleicht vertreiben wir ihn damit.«
Alte Schulfreundin war das falsche Wort für Stefanie. Eine Freundin war sie damals nicht gewesen. Im Gegenteil, Isabel hatte sie nicht einmal besonders gemocht. Aber das war jetzt lange her und egal. Nach der Schulzeit waren sie sich in Berlin, der großen kleinen Stadt, über den Weg gelaufen – Ach, hallo, du hier? – und trafen sich seitdem alle paar Wochen. Stefanie war eine der wenigen Konstanten in Isabels Leben. Einige Jahre zuvor hatte sie ihr zu einem Job verholfen, und auf diese Weise hatte Isabel Matthias Baumann kennengelernt. Der Job hatte darin bestanden, seine Mutter ein-, zweimal pro Woche für einige Stunden in ihrer Wohnung in Friedenau zu besuchen, kleine Erledigungen für sie zu machen und ihr vorzuspielen – angeblich war sie »verwirrt« –, sie sei eine Freundin oder eine Nachbarin oder eine befreundete Nachbarin.
Elfriede Baumann war schließlich gestorben und Isabel somit den Job los. Unangenehmerweise hatte ausgerechnet sie die Tote in Friedenau vorgefunden. Sie hatte den Notarzt verständigt und die Gelegenheit genutzt, in Elfriedes Wohnung herumzustöbern. Sie wollte etwas mitgehen lassen, irgendetwas von Wert, Matthias Baumann wäre es ohnehin nicht aufgefallen, hatte aber nichts entdeckt. Bis sie schließlich im hintersten Winkel eines Schranks eine Art Tagebuch fand. Im ersten Moment wollte Isabel es achtlos beiseitelegen, fing dann aber an zu lesen. Und es lohnte sich. Dieses Tagebuch hatte es in sich und brachte ihr wenig später die zwanzigtausend Euro ein, die sie gut gebrauchen konnte.
Matthias Baumann hatte ihr verboten, jemals wieder in Pankow aufzutauchen. »Ich untersage Ihnen, noch mal hierher zu kommen. Ich will das nicht. Ich verbiete es Ihnen. Wir haben uns doch verstanden.« Das hatte er bei ihrem allerletzten Telefongespräch gesagt, kurz nach dem Eingang der Zwanzigtausend auf Isabels Konto. Er war wieder zum Sie gewechselt, obwohl sie kurz davor begonnen hatten, sich zu duzen. Nichts brachte einander näher als tiefer gegenseitiger Abscheu.
»Ja, ja, träum weiter«, hatte Isabel damals entgegnet. Für sie war und blieb er du Arschloch und nicht Sie Arschloch. Verbieten, dass ich nicht lache, hatte sie gedacht. Mir verbietet niemand etwas und schon gar nicht er. Er hatte ihr dann auch noch nahegelegt, am besten gleich die Stadt zu verlassen. »Ich rate Ihnen, den Wohnort zu wechseln, das wäre für alle das Beste, möglichst bald, sonst –«
Sonst was? Das hatte er nicht näher ausgeführt. Doch Matthias Baumann war es gewohnt, dass sich alle nach ihm richteten. Dass er der Bestimmer war, der die kleine Welt um ihn herum lenkte. Es war für ihn ein Naturgesetz. Seine Frau und seine beiden Kinder fügten sich, und auch Isabel Keppler, so dachte er vermutlich, machte hierbei keine Ausnahme, weil sie ja schlecht ein Naturgesetz außer Kraft setzen konnte.
Sie wohnte noch immer in Berlin und plante auch keinen Umzug, hatte sich also nicht gefügt. Eins hatte Baumann allerdings tatsächlich erreicht: Sie besuchte Stefanie viel seltener. Darüber ärgerte Isabel sich maßlos.