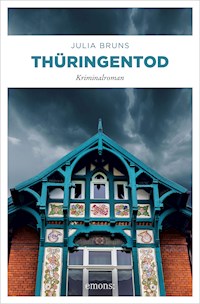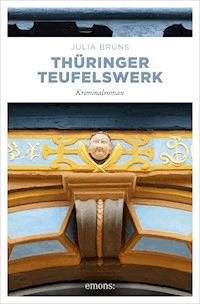8,99 €
Mehr erfahren.
Advent, Advent, ein Mörder rennt … Im kleinen Dorf Eliasborn bricht am ersten Dezember eine neue Zeitrechnung an: Der Bürgermeister wünscht sich ein »Weihnachtswunderland« und kämpft mit harten Bandagen für den Erhalt sämtlicher Traditionen. Auch Weihnachtsmuffel Adam wird gezwungen, sich einzubringen - er soll den Nikolaus spielen. Doch dann, kurz vor der feierlichen Einweihung des Adventskalenders, das Drama: Der Pfarrer wird tot in seiner Badewanne gefunden! Ein schlechtes Omen? Jetzt hilft nur noch Teamwork. Gemeinsam mit Freund Ruprecht macht sich der Nikolaus auf die Suche nach dem »Weihnachtsmörder«, um das Fest der Liebe zu retten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über das Buch
Adam ist ein echter Weihnachtsmuffel. Zu dumm, dass in seiner Heimat Eliasborn zum 1. Dezember der Weihnachtswahnsinn ausbricht. Alle Dorfbewohner werden vom ehrgeizigen Bürgermeister zu Weihnachtsstatisten gemacht. Auch Adam wird genötigt, den neuen »Nikolaus« zu geben. Er und sein Freund Ruprecht, der sinnigerweise den »Knecht Ruprecht« spielen soll, bilden gezwungenermaßen ein Team.
Doch der Start der Saison verläuft völlig anders als geplant: Kurz vor Beginn der Feierlichkeiten wird der Pfarrer tot aufgefunden. Jetzt können nur noch die ehrenamtlichen Weihnachtsexperten helfen, das Fest und die Traditionen zu retten.
Für Marlene Saal, wo immer Du jetzt auch bist
Der Thüringer Wald hat ein beschissenes Karma, das ist meine Meinung und dazu stehe ich. In der Adventszeit ist es besonders schlimm. Mit Ruprecht brauche ich darüber nicht zu reden. Er findet alles toll, insbesondere Weihnachten. Deswegen steht er auch gerade neben mir und zieht sich seine neue Thermounterwäsche an. Die hat er aus dem Discounter, aber das spielt eigentlich keine Rolle. Denn Ruprecht achtet nicht auf so etwas. Er guckt eher nach Farben, also in diesem Fall. Seine Aufmachung muss perfekt sein, hat er gesagt. Perfekt in Kackbraun, denke ich, sage aber nichts, um ihn nicht zu kränken.
Es ist der erste Dezember und ich stehe in einem weißen Sackkleid mit ziemlich viel Spitze vor dem großen Wandspiegel in Ruprechts Schlafzimmer. Ruprecht verheddert sich derweil mit dem nackten Bein in seiner langen Unterhose. Er sagt, die engen Bündchen seien schuld, nicht etwa seine großen Füße. Zwei halb nackte Männer und ein Bett. Ich gebe zu, das ist seltsam, also zumindest für mich. Ruprecht und ich sind aber nur Freunde. Mehr nicht. Das, was wir hier in seinem Schlafzimmer machen, ist schrecklicher als alles, was ich bisher mit Ruprecht erlebt habe, da bin ich mir sicher. Aber wir wurden dazu gezwungen. Also zumindest bei mir war das so. Ruprecht tut das freiwillig und ist begeistert. Es geht auf Weihnachten zu und wir haben dabei eine tragende Rolle, also Ruprecht und ich. Aber der Reihe nach.
Momentan schwitze ich nur, denn ich kämpfe mit dem Haken und der Öse des Samtumhangs, den ich mir über die Schultern werfen musste. Beides ist rostig und hinterlässt hässliche rotbraune Streifen auf meinen Fingern. Noch dazu sind die Teile so dermaßen verbogen, dass ich sie nachher mit Sicherheit nicht mehr aufbekommen werde. Im schlimmsten Fall muss dann Ruprechts Großvater heute Abend mit der Flex kommen. Beide hätte ich dann direkt vor meinem Gesicht, den halb blinden Greis und den 2000-Watt-Winkelschleifer.
Dennoch muss ich das weiße Spitzenkleid und die rote Stola irgendwann wieder loswerden. Eigentlich kotzt mich der alberne Fummel jetzt schon an. Das Zeug stinkt widerlich, nach nassem Hund und Schweißfüßen. Wieso hat nicht irgendeiner diese Lumpen einmal in die Waschmaschine gesteckt? Dazu war das ganze Jahr Zeit. Sechzig Grad hätten hier Wunder gewirkt, auch gegen das Getier, das hundertprozentig in dem Stoff siedelt. Eine Frau hätte das getan, aber bei Ruprecht und mir gibt es keine. Bei Ruprecht ist das ein Dauerzustand, bei mir eher eine Frage der Saison. Das ist aber nicht der Grund, warum wir in seinem Schlafzimmer abhängen. Garantiert nicht. In meinen Achselhöhlen fängt es an zu jucken. Am Hals krabbelt es auch. Das war’s. Jetzt kriege ich gleich Ekelbläschen auf der Zunge. Das habe ich öfter. Ruprecht sagt, was das angeht, sei ich überempfindlich. So ein Quatsch. Bis zum Abendessen jedenfalls sind die da, todsicher. Damit kann ich die Hirschknackwurst vergessen. Hirsch mit Aphten, das kommt nicht gut. Verdammt.
»Dieses ganze Weihnachtszeugs hat ein beschissenes Karma«, sage ich und merke, wie es in meinem Mund anfängt zu brennen.
»Der Blaschke Bürgermeister hängt das Kostüm ab Totensonntag immer zum Lüften in die Sternrenette in seinem Garten«, sagt Ruprecht, und ich sehe, wie seine Nasenflügel wackeln, während er mich prüfend anschaut. »Nach Kot riechst du aber nicht.«
»Karma riecht nicht«, sage ich säuerlich und kann es nicht fassen, dass Ruprecht wirklich abcheckt, ob ich nach Kacke rieche.
»Na siehst du«, antwortet Ruprecht und steht nun in seinem braunen verschlissenen Mantel dicht neben mir. Der Geruch nach Mottenkugeln steigt mir in die Nase. Ich schaue ihn im Spiegel an und entdecke Dutzende Löcher in seinem Mantel. Auf anderthalb Metern Entfernung. Sauber, denke ich, und muss grinsen. Dann wird mir das zu viel Körper. Ich mache einen Schritt zur Seite. Die elektrische Ladung lässt den Spitzensaum des Kleides an meiner langen Wollunterhose haften, an beiden Beinen. Rechts oberhalb des Knies und links darunter. Was soll das denn? Ich fange an zu hüpfen, erst langsam, dann schnell. Die Spitze ist hartnäckiger als meine Tante Hildegard, wenn sie mir jeden Sonntag ihren grausigen Bananenpudding mit Schokostückchen aufzwingen will. Die Bananen, die sie da reindrückt, sind immer vom Montag, denn nur dann fährt sie zum Einkaufen in die Stadt. Alles, was am Ende der Woche übrig ist, die braunen, matschigen Früchte, landet in der Süßspeise. Beim bloßen Gedanken daran sprießt es in meinem Mund. Wenn das so weitergeht, wird der Platz eng für die Bläschen. Ich hasse Bananen, Nachtisch und Weihnachten. Tante Hildegard rangiert irgendwo dazwischen. Und Eckbert, aber den darf man nicht hassen, der ist tot.
Eckbert, der dieses Kostüm fast fünfzig Jahre lang getragen hat, war nicht nur einen halben Meter kleiner als ich, er hatte definitiv auch keine wollenen Unterhosen dazu an. Bei Eckbert saß das Kleid, wie ein Kleid bei einem Mann sitzen muss. Bei mir hängt es halb schräg auf der Kniescheibe. Ein echter Mann sollte kein Bein zeigen, nicht einmal in einem weißen Kleid, denke ich und zerre die Spitze übers Knie. Wie gesagt, Eckbert war deutlich kleiner, aber Eckbert ist tot.
Nach der Sitzung des Weihnachtskomitees hat es Eckbert auf dem Nachhauseweg dahingerafft. Der Heilige Nikolaus von Myra, also Eckbert, hat mit dem Gesicht im Schnee seinen Rausch ausgeschlafen und ist dabei qualvoll erstickt. Nicht einmal der Bestatter konnte die blaurot erfrorene Nase von Eckbert anständig überschminken. Mit der gruseligen Visage hätte er niemals mehr den Nikolaus geben können, vorausgesetzt natürlich, er hätte es überlebt. Aber Eckbert ist tot und damit war die Rolle des Heiligen Nikolaus vakant. Nicht lange. Genauer gesagt, nur bis Eckberts Sarg in der Erde versenkt war. Dann ist Armin Blaschke, der hiesige Bürgermeister, gekommen, hat sich vor mir aufgebaut und sein Gebiss unter schmatzenden Geräuschen solange im Mund hin- und hergeschoben, bis es einsatzfähig war. Zumindest dachte er das. Denn Blaschkes Gebiss ist so etwas wie ein autoaktiver Schlagring. Jeder, dem der Bürgermeister ein Gespräch aufdrückt, fürchtet, dessen Zähne gleich noch gratis dazuzubekommen. Ruprecht und den anderen vom Weihnachtskomitee ist das schon öfter passiert. Tante Hildegard hat sogar einen fetten Bluterguss auf dem Dekolleté gehabt, nachdem sich einer von Blaschkes Schneidezähnen hineingebohrt hatte. Aber das hat auch damit zu tun, dass sie ein alter zänkischer Drachen ist. Denn wenn man den Bürgermeister in Rage bringt, steigen die Chancen, dass seine Zähne sich selbstständig machen.
»Du bist nun der neue Nikolaus. Versau es nicht!«, hatte der Blaschke genuschelt und mich dabei angesehen, als verkünde er mein Todesurteil. Mir wird heute noch ganz anders, wenn ich daran denke. Auch die Trauergäste haben mich alle angestarrt und gleichmütig genickt. Nur Eckberts Frau hat einen Schreikrampf bekommen. Ich im Kleid von Eckbert, der Gedanke hat die trauernde Witwe wohl in eine noch größere Verzweiflung gestürzt. Oder sie wusste schon, dass mir der Fetzen nicht stehen würde. Frauen ahnen so etwas.
Bis zu Eckberts Beerdigung war alles gut. Vierundvierzig Jahre. So lange lebe ich im Dorf und so lange ist es mir gelungen, mich diesem Weihnachtsquatsch zu entziehen. Und nur, weil Eckbert lieber eine Flasche Gewürz-Bitter als seine Gattin im Arm gehabt hat, soll dieses Glück nun ein Ende haben. Seitdem bin ich nun Nikolaus, warum auch immer der Blaschke Bürgermeister mich ausgesucht hat. Im Dorf jedenfalls bedeutet das was. Ich zähle die Jahre. Maximal dreißig, wenn ich nach meinem Vater komme. Nach meiner Mutter – ach, darüber will ich lieber nicht nachdenken. Nur der Tod erlöst einen hier im tiefsten Wald vom Weihnachtsfluch. Immerhin teile ich mein Schicksal mit Ruprecht. Der spielt den Knecht Ruprecht, wegen des Namens oder so, und er sieht in seinem Kostüm noch bescheuerter aus als ich. Es wird Zeit für die Wahrheit, denke ich und sage: »Ein Perverser im Taufkleid und ein Wichtel in Kacke.«
Es ist alles wie immer. Ruprecht hört nicht zu. Er justiert lieber den Gummizug hinter seinen Ohren und richtet den schwarzen Vollbart, mit dem er eher an einen Taliban als an eine Weihnachtsfigur erinnert.
»Dieser Bart sieht zum Fürchten aus. Meinst du, ich kann wenigstens die Perücke weglassen? Unter dem Kunsthaar kratze ich mich jedes Mal wund und schwitzen tue ich auch wie verrückt«, sagt er. Dabei steht er wie angewurzelt und hält die Zweitfrisur etwa zehn Zentimeter über seinen Kopf, um die Optik zu prüfen. Das sieht total bescheuert aus. Aber noch bescheuerter ist, dass der eigentlich hellblonde Ruprecht nun einen dreißig Zentimeter langen dunklen Kunsthaarbart hat.
»Sieht kein Mensch«, sage ich und frage mich, wie lange ich diesen Blödsinn noch ertragen kann. Es steht eins zu neunundzwanzig, wenn es schlecht läuft. Und das erste Türchen ist noch nicht einmal geöffnet.
Ruprecht hat meinen modischen Einschätzungen noch nie vertraut und bleibt unschlüssig vor dem Spiegel stehen.
»Das fällt doch bestimmt auf.« Er lässt die Perücke immer noch schweben.
»Kaum«, antworte ich.
»Ich bin ganz schön aufgeregt.« Ruprecht packt die Haare nun doch zusammen und schlägt sie sorgsam in Zeitungspapier ein. »Wir wissen ja noch gar nicht, wie wir so als Paar miteinander harmonieren. Die gemeinsamen Jahre mit Eckbert waren sehr nett«, sagt Ruprecht, während er eine passende braune Fellmütze so weit über die Ohren zieht, dass kaum noch seine Augenbrauen darunter hervorgucken. »So könnte es gehen«, befindet er zufrieden, schiebt seine Hand unter das Fell und beginnt, sich ausgiebig zu kratzen.
»Bis zur Silberhochzeit habt ihr es immerhin fast geschafft«, bemerke ich und fummle mir ein Kunsthaar aus dem Mund. Dann kommt mir eine Idee. Wenn ich den langen weißen Bart und die gelockte Plastikperücke an den Koteletten miteinander verbinde und eine Sonnenbrille aufsetze, kann man nichts von meinem Gesicht sehen. Das erspart mir jegliche peinliche Wiedererkennungsszene, bei den Nichteinheimischen natürlich nur. Unsere Leute sind mir egal. Aber die aus den umliegenden Dörfern kommen extra mit einem Bus angefahren. Vorn in der Scheibe liegt dann immer ein großes Schild mit der Aufschrift »Weihnachtsexpress«. Der Busfahrer ist ein Wichtigtuer. Manchmal sind auch ein paar unwissende Städter im Bus. Ob die falsch einsteigen oder tatsächlich zu uns wollen, weiß ich nicht. Letztes Jahr jedenfalls hat die Sonderfahrt eine niedliche Brünette ausgespuckt. Das passiert nicht oft, also, dass uns das Frischfleisch, wie Ruprechts Großvater sagen würde, frei Haus in den Wald geliefert wird. Aber irgendetwas Gutes muss so eine Dorfweihnacht ja auch haben.
Meine Chancen jedenfalls, heute wieder eine abzukriegen, sind mittelmäßig bis schlecht. Da mache ich mir nichts vor. Das alberne Kostüm reißt mich rein. Ich brauche meine Sonnenbrille. Dann geht das auch mit der Mitra. Wenigstens die ist neu. Die alte hat neben Eckbert im Schnee gelegen und ist ebenfalls nicht mehr brauchbar gewesen.
»Seit meinem einundzwanzigsten Geburtstag gebe ich den Knecht Ruprecht. Das weißt du genau«, nörgelt Ruprecht halb beleidigt. »Eckbert war streng, aber ich habe viel von ihm gelernt.« Er greift nach dem Reisigbesen, der neben dem Spiegel lehnt, und ich befürchte kurz, er könnte mir damit eine verpassen. Denn er ist der strenge Ruprecht und ich bin der gute Nikolaus. Ob ich wider meine Natur handeln kann, weiß ich noch nicht. Ruprecht geht in seiner Rolle auf, wobei ich denke, ihm ist bis heute nicht klar, dass er böse sein muss. Egal. Anstatt mich zu schlagen, betrachtet er zufrieden sein Werk.
Ich kann nicht mehr hingucken und grüble lieber über mein Schicksal. Mir war nicht bewusst, dass dieser Rolle ein schauspielerischer Anspruch innewohnt. Außer vier Wochen im Jahr blöd neben dem Weihnachtskomitee zu stehen und hin und wieder ein paar Kinder zu erschrecken, gibt es doch keine inhaltliche Botschaft.
»Nimm das nicht auf die leichte Schulter«, mahnt Ruprecht, als ob er meine Gedanken lesen könnte. »Ich habe es gewusst, wir hätten proben sollen. Auch eine ausführliche Unterweisung in die Weihnachtsbräuche des Thüringer Waldes hätte dir nicht schaden können.« Er schnauft. »Aber ich bin davon ausgegangen, dass Studierte so etwas wissen.«
Ruprecht nennt mich immer so, wenn er sauer ist. Der Studierte. Achteinhalb Semester Germanistik. Na ja, immerhin. Nur der Pfarrer und der Tierarzt haben mich überholt. Ich glaube, die haben sogar einen Abschluss. Aber auch das spielt jetzt keine Rolle. Ich kann die Panik in seinem Blick sehen und frage mich, ob er mich verarschen will. Will er nicht. Denn jetzt schreit er mit schriller Stimme: »Was ist das da an deinen Füßen?«
Ich denke an Ratten oder irgendwelche anderen Nagetiere. Wir sind im Thüringer Wald. Da gibt es jede Menge Natur, auch Vierbeinige. Ich schaue erschrocken an mir herunter und sehe nur meine Füße in meinen Schuhen stecken. »Man nennt es Turnschuhe, glaube ich.«
Ruprecht muss etwas Schlimmeres gesehen haben. Er ist knallrot und hyperventiliert. »Du kannst doch nicht … Nikolaus! Wirklich!«
»Ich heiße Adam und ich trage immer Turnschuhe«, sage ich und befürchte, dass ich spätestens am 6. Januar eine Persönlichkeitsstörung haben werde.
Ruprecht schüttelt energisch den Kopf. »In der Adventszeit nicht, ausgeschlossen.«
Dieser Weihnachtsscheiß macht nur Probleme, denke ich und schleudere meine Chucks in die Ecke. Ruprecht reicht mir mit strenger Miene ein paar schwere Lederstiefel. Wenigstens hatte Eckbert, alias Heiliger Nikolaus, alias Alkofrost, große Füße.
»Jungs, antreten für den Schwachsinn des Jahres.« Ruprechts Großvater steht plötzlich im Zimmer. Er sieht aus wie der junge Heesters, also, als der noch achtzig Jahre alt war. Dass wir beide uns vor dem Spiegel anziehen, scheint ihn nicht zu jucken. Aber Ruprechts Großvater war schon mal in Paris, da hat er bestimmt weitaus Unanständigeres gesehen. Er hält uns eine offene Plätzchendose hin. »Stärkung gefällig?« Der Duft von Lebkuchen übertüncht meinen eigenen Muff. »Die Teile von Marga sind besser als die von der dicken Rosemarie. Dafür kann die besser Kuchen.« Er lächelt verschmitzt aus seinem frisch gestärkten weißen Kragen, zu dem er heute noch ein teures seidenes Halstuch trägt. Ich frage mich, wieso er sich immer so aufbrezeln muss, ausgerechnet heute an diesem scheiß ersten Dezember.
»Wie viele Probierpakete hast du schon abgestaubt?«, frage ich grinsend und denke dabei an die Dutzend vollreifen Schnecken, die Ruprechts Großvater seit Jahren umgarnen. Der Alte hat einen beneidenswerten Schneid bei den Frauen. Im Dorf nennen sie ihn den Schweinebraten-Gigolo, aber Heinrich nimmt auch Konfitüren, eingelegte Gurken, Schlachtwurst, Wildbret und alles andere, was ihm schmeckt und die alleinstehenden Damen jenseits der sechzig vor seiner Haustür abstellen. Bei geschenktem Essen ist der Großvater nicht wählerisch. Im Zweifel hat er ja Ruprecht. Der ist quasi sein Hausschwein. Und was der auch nicht schafft, kriegt Herr Fuchs, also Ruprechts Dackel. Ich weiß, der Name ist für einen Hund bescheuert, aber Ruprecht ist Förster. Deswegen geht das schon.
Jetzt setzt der Großvater einen generösen Blick auf. »Ein Ehrenmann genießt und schweigt.« Er schlägt den Mantelkragen verwegen nach oben und pfeift nach dem Hund.
»Opa!«, sagt Ruprecht vorwurfsvoll.
»In meinem Alter geht alles nur noch über den Magen, Junge«, antwortet der Alte abgeklärt.
In meinem derzeit auch, denke ich und nehme eine Hand voll Pfefferkuchen mit Schokoladenüberzug, deren Krümel mit Sicherheit in den fremden Haarbüscheln in meinem Gesicht hängen bleiben. Aber das ist mir egal. Auch der Heilige Nikolaus darf etwas essen. Jetzt fange ich auch schon so an. Dieser Weihnachtskram macht einen ganz kirre.
Ruprecht reißt die Augen auf. »Du kannst doch jetzt nichts essen. Gleich ist unser erster Auftritt.« Er stemmt die Hände in die Hüften und schüttelt den Kopf. »Also ich kriege keinen Bissen runter.«
»Scheiß Advent«, resümiert der Großvater. »Scheiß Weihnachten.«
Wie wahr. Ich versuche zu fliehen und rutsche beim Laufen in Eckberts Stiefeln hin und her.
Der Großvater mustert mich. »Bei der Armee hatten wir auch solche Unterhosen. Die halten warm. Bei minus zehn Grad ist das was wert. Egal, wie man damit aussieht.« Er zieht seinen Flachmann aus der Innentasche des Mantels und nimmt einen kräftigen Schluck.
Ich raffe das Kleid etwas nach oben und begutachte meine Beine. Sie sehen aus wie immer.
»Opa! Kein Alkohol bevor das erste Türchen nicht geöffnet ist. Das hast du versprochen.« Ruprecht dreht sich nun wie ein zehnjähriges Mädchen im Prinzessinnenkostüm vor dem Spiegel.
»Natürlich, Junge.« Der alte Gmeiner zwinkert mir zu und setzt die Flasche erneut an. »Ansonsten ist das nicht zu ertragen.« Dann parkt er die Plätzchendose auf der Anrichte und kramt in seiner Manteltasche. Schließlich holt er einen I-Pod hervor, nickt mir wieder zu, hebt seine Ohrenschützer kurz an, sodass ich seine Kopfhörer sehe, und lässt das Gerät wieder im Mantel verschwinden. Schlitzohr, denke ich, und beschließe, beim nächsten Mal meinen alten Walkman mitzunehmen.
»Hast du Herrn Fuchs fertig gemacht?«, fragt Ruprecht, und schaut sich suchend um.
Der Großvater nickt im Takt.
»Opa!«
»Wenn Hunde Geweihe tragen sollten, hätte die Natur dafür gesorgt. Alles andere ist Tierquälerei«, sagt der Großvater viel zu laut, was auf die Lautstärke der Musik schließen lässt. »Außerdem ist der Dackel ein Diensthund des Freistaates Thüringen. Quasi ein Beamter. Der sollte sich nicht lächerlich machen.«
»Mach die Dinger aus den Ohren. Der Kindergartenchor singt gleich«, maßregelt Ruprecht, ohne weiter auf seinen Großvater einzugehen.
»Nikolaus und Knecht Ruprecht kommen ohne Rentier«, sage ich ruhig. »Es reicht, wenn wir uns blamieren. Lass Herrn Fuchs seine Ehre als Dackel.«
Ruprecht schaut enttäuscht. »Aber ich wollte mal eine Innovation, nach all den Jahren. Jetzt, nachdem Eckbert nicht mehr ist, können wir doch mal was wagen. Und einen Hund mit Geweih hat niemand hier bei uns.« Er zieht einen Flunsch.
»Ich muss noch mal nach Hause«, sage ich halblaut und hoffe, unauffällig verschwinden zu können. Ruprecht schaut mich an, als wäre er eine Braut, die man vor dem Traualtar stehen gelassen hat.
»Meine Sonnenbrille holen«, ergänze ich und stapfe entschlossen in Richtung Flur. Bloß nicht umdrehen, denke ich. Beim Laufen muss ich meine Zehen verkrampfen, damit mir die ollen Treter nicht von den Füßen fallen. Sauber. Morgen werde ich einen fetten Muskelkater haben. Ich hasse es, meine Muskeln zu spüren. Das kann nämlich nur bedeuten, dass ich etwas getan habe, was ich sonst nicht tue. Zum Beispiel den Nikolaus für eine bescheuerte Dorfweihnacht geben.
»Wie läufst du denn?«, fragt Ruprecht kritisch.
»Wie soll ich schon laufen? Wie immer«, sage ich.
»Unsinn. Das sieht aus, als stampfst du Sauerkraut«, meckert Ruprecht. »Nikolaus ist ein Bischof, ein Heiliger und ein Menschenfreund. Er bringt gute Gaben und auch Segen. Du wirkst eher wie ein besoffener Bauernbursche mit Hühneraugen. Von der farblich unpassenden Unterwäsche mal abgesehen.«
Ich drehe mich nicht um. Ein Gefangener sollte seinen Entführern nicht in die Augen gucken.
»Übrigens, eine Sonnenbrille ist für einen Nikolaus ein No-Go. Außerdem sind wir spät dran«, legt Ruprecht nach. Er betont die englischen Wörter total übertrieben.
Jetzt reicht es mir. »Ja, sind denn alle bekloppt hier?«, schreie ich, wobei ich mich nun doch umgedreht habe. »Ich kann die Unterhose gern ausziehen. Dann geht der Heilige Nikolaus mit nacktem Arsch und wenn es mich packt, reiße ich gleich in aller Öffentlichkeit das stinkende Kleid nach oben! Das wäre mal eine echte Innovation zum ersten Dezember.«
Der Großvater wippt schneller und formt mit den Lippen ein »Highway to Hell«.
Ruprecht knallt seine Rute auf die Dielen und schaut mich fies an. Er weiß nicht, dass das bei ihm eher dämlich als böse aussieht.
»Nikolaus, wenn du mir den wichtigsten Tag des Jahres versaust, sind wir die längste Zeit Freunde gewesen. Das hier ist nicht irgendetwas. Es ist unsere Dorfweihnacht.«
Das Wörtchen »unsere« lässt sich enorm dehnen.
»Ich heiße Adam, verdammt. Adam«, sage ich und nehme mir noch ein Plätzchen.
»Die Engel rechts rum! Hallo, rechts herum, habe ich gesagt! Ja, schieß mir doch einer das Geweih weg, wisst ihr blöden Weiber denn nicht, wo rechts und links ist?«
Der Blaschke Bürgermeister steht auf dem Dorfanger und schreit sich förmlich die Lunge aus dem Leib, wobei ich schon von Weitem sehen kann, wie die Kauleisten bedrohliche Sprünge in seinem Mund machen.
»Das ist doch kein gleichmäßig leuchtender Weihnachtsbaum, Mensch. Welcher Volldepp hat denn die Lampen da dran gebammelt. Das sieht aus, wie aus zweitausend Metern abgeworfen. Das kriegt ja meine Großmutter besser hin.«
Der Blaschke Bürgermeister hat keine Verwandten mehr, außer seiner Frau, aber er glaubt, der Spruch mache Eindruck. Das tut er irgendwie auch, denn Ulf, der Gemeindearbeiter, und dessen Frau Else setzen sogleich zum Sprint auf die vierzig Meter hohe Fichte an. Die Fichte ist das Wahrzeichen von unserem Dorf. Solange ich denken kann, steht sie mitten auf dem Platz. Als Kinder haben Ruprecht und ich immer um die Wette an den Stamm gepinkelt. Wir haben gedacht, davon wächst sie schneller. Der Blaschke Bürgermeister wollte uns dafür jedes Mal verprügeln. Damals gehörten die Zähne noch zu seinem festen Inventar, aber gekriegt hat er uns trotzdem nie.
Die Aluleiter, an der Ulf seine Else hinter sich herzieht, klappert so laut, dass die nächsten Worte des Blaschke Bürgermeisters fast nicht zu verstehen sind. Da er nur nach den Schafen für die Krippe ruft, ist das nicht weiter wild, denn die Tiere müssen die Befehle unserer kommunalen Autorität nicht befolgen. Die Glücklichen. Sie hören einzig und allein auf Hasso, aber der hat bei der lebenden Krippenszene keine Rolle und darf, als einer der wenigen Dorfbewohner, zu Hause bleiben. Ein Deutscher Schäferhund in einem Bethlehemer Stall wurde vom Weihnachtskomitee für politisch unkorrekt erklärt. Schließlich könnte jemand von der Zeitung kommen. Das ist noch nie passiert, aber trotzdem. Hasso hat es gut. Ich beneide ihn.
»Ach, sieht das schon alles toll aus«, ruft Ruprecht begeistert, während er zappelnd neben mir steht. »Schau mal, wie süß sich die Englein hergerichtet haben. Der Goldflitter überall macht echt was her.« Er lächelt glückselig.
Die Engel, das sind die Frauen des Dorfes. Früher, als wir noch keinen demografischen Wandel im Thüringer Wald hatten, durfte die Engelsschar den Altersdurchschnitt von zwanzig Jahren nicht reißen. Da hat der Advent noch Sinn gemacht, vor allem mit den kurzen Röckchen und wenn die Mädels genügend Punsch gebechert hatten. Jetzt aber muss der Blaschke Bürgermeister nehmen, was er kriegt, und wenn es zehn unförmige Weiber in der Menopause sind.
»Gold trägt auf«, kommentiert Ruprechts Großvater lapidar.
Ich kann das nur bestätigen, komme aber nicht dazu, es auszusprechen. Ulf hat in der Hektik Else mit der Leiter umgestoßen und nun liegt seine Frau neben unserem alten Pinkelplatz und wimmert. Ruprecht rennt los, um ihr zu helfen. Ich kann nicht rennen, denn dann verliere ich Eckberts Stiefel. Die Jungfrau Maria ist schneller mit der Wundversorgung. Ich bewege mich mit verkrampften Zehen zu Ulf. Der Bedauernswerte kriegt gerade die Rache von Blaschkes Gebiss zu spüren. Der Großvater nimmt derweil zwei Flaschen selbst gemachten Eierlikör von Anneliese entgegen.
Während Maria an Else herumzerrt und Ruprecht sie bedauert, schreit der Blaschke Bürgermeister in einer Tour deren Mann an. Der hat nun keine Augen mehr für die aufgeschürften Knie seiner Frau, sondern nur noch für die Verlängerungsschnur, die dafür sorgen soll, dass die Fichte nachher festliche Stimmung verbreitet. Irgendetwas stimmt wohl mit der Elektrik nicht und erstaunlicherweise juckt es den Blaschke Bürgermeister nun nicht mehr, ob die Glühbirnen gleichmäßig hängen, Hauptsache, sie leuchten überhaupt.
Die Illumination unseres Wahrzeichens ist immer der Höhepunkt am ersten Dezember. Der Blaschke Bürgermeister zählt dann von zehn runter, wobei er von einem Trommelwirbel begleitet wird. Der ist nicht echt. Denn bei uns im Thüringer Wald gibt es nur Jagdbläser und keine Jagdtrommler. Für den Wirbel müssen die Männer ihre Instrumente ablegen und in die Hände klatschen. Das klingt nicht annähernd nach Trommeln, aber der Blaschke Bürgermeister ist zu geizig, um welche anzuschaffen.
Wenn der Baum dann brennt, wird verlangt, dass die Anwesenden in Begeisterungsrufe ausbrechen. Ich habe zu diesem Zeitpunkt meistens schon drei bis fünf Becher Glühheidi intus und schreie: »Ich bin blind. Ich bin blind.« Das soll ein Witz sein, da der Baum so sehr blendet. Vor zwei Jahren hat sich die Gemeindekrankenschwester auf mich gestürzt, um mein Augenlicht zu retten. Sie war neu bei uns und wusste es nicht besser. Letztes Jahr hat sie mir nur noch einen Vogel gezeigt.
Ab heute bin ich allerdings der Nikolaus und habe ein Glühheidiverbot bis zum sechsten Januar. Das mit der Abstinenz weiß ich aber erst seit vorhin. So ein Weihnachtskomitee sagt einem auch nicht immer gleich alles. Erst, wenn du vor der Glühweinbude stehst, wird dir gesagt, dass du leer ausgehen wirst.
Mittlerweile steht der Kindergartenchor vor dem Pfarrhaus und übt sich in »O Tannenbaum«. Ein paar der Kinder sind aber ziemlich groß, denke ich und schaue Ruprecht fragend an. Dem ist vom Anblick der blutenden Else schlecht geworden, sodass Josef ihm Luft zufächeln muss. Die Jungfrau Maria prüft in der Zwischenzeit mit Ulf die Steckdosen.
»Was stimmt mit unserem Kindergarten nicht?«, frage ich den Blaschke Bürgermeister.
Der reißt den Kopf nach oben und starrt zu den Kindern rüber. Dann höre ich ihn drohend sagen: »Was soll mit denen sein?«
»Zwei von denen haben dieses Jahr Konfirmation. Mindestens drei sind volljährig.« Ich zähle im Geiste alle jene, die ich für jünger halte. »Na ja, die acht Zwerge könnten im Kindergartenalter sein.«
»Ja, soll ich mir den Nachwuchs aus den Rippen schneiden«, brüllt mich der Blaschke Bürgermeister an und rennt davon. »Mit acht Hanseln einen ordentlichen Chor auf die Beine stellen. Was denkt der Kerl denn? So einen behämmerten Nikolaus hatten wir noch nie«, höre ich ihn noch schimpfen.
Eine der Kühe aus der Krippenszene hat sich losgemacht und setzt gerade einen fetten Fladen vor dem Rednerpult ab. Klasse Statement, denke ich, und schlendere hinüber zu dem Jagdbläsersextett, das eigentlich nur noch ein Quintett ist. Albert, die Nummer sechs unter ihnen, liegt neben Eckbert auf dem Friedhof, aber die Jungs geben die Hoffnung auf einen Nachfolger nicht auf, und so lange bestehen sie darauf, ein Sextett zu sein. Es ist eben alles nur eine Frage der richtigen Einstellung. Da die Männer lieber im Wald sind und einen erlegten Hirsch beblasen, sind sie fast so schlecht drauf wie ich. Das steigert eventuell meine Chancen auf einen Kräuterschnaps oder irgendetwas anderes aus den jagdlichen Flachmännern.
»Tag, Männer«, grüße ich freundlich.
»Vergiss es, du bist der Nikolaus«, blafft mich einer von ihnen an. »Von uns kriegst du keinen Schluck. Wir mussten das beim Blaschke Bürgermeister unterschreiben.«
Ich werde wütend. In unserem Dorf leben hundertzweiundfünfzig Menschen. Das weiß ich so genau, weil Ruprecht nicht nur Mitglied im Weihnachtskomitee, sondern auch noch im Gemeinderat ist. Wenn man die Minderjährigen, Bettlägerigen und Schwangeren abzieht, bleiben mindestens noch hundertdreißig Leute übrig. Jeder von denen darf sich im Advent zulöten. Nur ich nicht. Und Ruprecht. Aber der trinkt nicht einmal an seinem Geburtstag. Der Blaschke Bürgermeister ist ein Arschloch. Ich habe es immer gewusst.
»Der Heilige Nikolaus und Knecht Ruprecht möchten sich bitte in der Zone eins einfinden.« Die Stimme der Blaschke Ehefrau piepst durch eine Lautsprecheranlage über den Anger. Ich frage mich, wie man dieses Organ auch noch potenzieren kann, da kommt Ruprecht mit knallrotem Kopf angelaufen.
»Nikolaus, beeil dich. Wir müssen uns in Zone eins aufstellen«, japst er, wobei beim Sprechen ein Teil seines Oberlippenbartes in seinen Mund rutscht. »Es geht in zehn Minuten los.«
Ich frage mich, seit wann unser Dorf Zonen hat. »Wohin?«
Ruprecht hält in seiner Bewegung inne und kneift die Augen zusammen. »Du hast den C-Plan nicht gelesen, sonst wüsstest du es.«
Ich weiß nicht einmal, was ein C-Plan ist, halte aber lieber meine Klappe, nicht, dass Ruprecht gleich total ausflippt. Er flippt trotzdem aus.
»Immer am 1. Juni gibt das Weihnachtskomitee die Regieanweisungen bekannt, schriftlich, an alle Haushalte.« Er bekommt Schnappatmung. »Als verantwortlicher Bürger unserer Gemeinde hast du die Pflicht, das zu lesen. Du bist der Heilige Nikolaus! Du bist ein Vorbild!«
»Gut, dass du mich erinnerst. Ich hatte es gerade erfolgreich verdrängt«, antworte ich. Diese Schreierei geht mir gehörig auf die Nerven. Außerdem fühlt es sich an, als ob auf meinem Rücken die Motten Tango tanzen. Widerlich.
Ruprecht hört mich nicht. Das ist vielleicht auch besser so. »Der Dorfanger ist in fünf Zonen eingeteilt. Nummer eins, das Bürgermeisteramt mit Rednerpult, Nummer zwei, das Pfarrhaus, unser erstes Türchen im lebendigen Adventskalender, Nummer drei, der Chor und die Bläser, Nummer vier, die gastronomische Versorgung, Nummer fünf, die lebensgroße Krippenszene. Wir haben alles genau durchorganisiert, damit auch nichts schiefgehen kann.«
»Letzter Aufruf für den Heiligen Nikolaus und Knecht Ruprecht«, piepst es erneut, nun aber in schärferem Tonfall.
Ruprecht reißt mich am Arm. »Komm jetzt!«
Wenn das Bürgermeisteramt nebst Pult die Zone eins ist, dann sind wir so ungefähr zehn Meter davon entfernt. Ich weiß nicht, wie lange man für eine derartige Strecke unterwegs sein kann, aber trotz meiner zu großen Schuhe würde ich auf maximal zwanzig Sekunden tippen. Ich überlege, es auf die Spitze zu treiben und noch in aller Ruhe meinen Umhang zu richten, aber Ruprecht ist schon verschwunden. Mir bleibt also nichts anderes übrig, als ihm nachzugehen. Die Frage, wieso es für diesen Blödsinn einen C-Plan geben muss, stelle ich mir lieber nicht. Dann könnte ich mich auch gleich fragen, wer Hasso illegalerweise eingeschleust und ihm ein Geweih auf den Kopf gesetzt hat.
Die Rede vom Blaschke Bürgermeister dauert eine gute halbe Stunde. Mir war gar nicht klar, was man über die Weihnachtszeit in unserem Dorf alles sagen kann. Aber der Blaschke hat richtig auf den Schlamm gehauen. Seinen Worten nach stammen alle Weihnachtsbräuche aus dem Thüringer Wald, genauer gesagt, aus unserem Dorf. Ich bin nicht naiv und weiß sehr wohl, dass Politiker immer gern etwas übertreiben. Aber dass der hiesige Tischlermeister Funke den Schwibbogen erfunden und in nächtelanger Heimarbeit hergestellt haben soll, ist selbst mir zu fett. Als Kind war mir der Funke unheimlich. Eigentlich nicht er, sondern seine Finger. Die waren nämlich an der rechten Hand nach dem Prinzip Ein-Finger-kein-Finger angeordnet. Tante Hildegard hatte mir damals einzureden versucht, dass diese Verluste vom Befummeln der Frauen kämen. Sie ist schuld, dass sich mein erstes Mal um knappe vier Wochen verzögert hat. Cindy fand das nämlich nicht so toll, dass ich alle paar Minuten meine Finger nachgezählt habe. Noch bevor ich loslegen konnte, hat sie mich als Perversen beschimpft und ist abgehauen. Und bis ich Nicole dann so weit hatte, sind eben ein paar Wochen vergangen. Die beiden sind übrigens lange weggezogen. Nicht meinetwegen, aber das ist Geschichte.
Wo der Funke Tischler seine Finger überall hatte, weiß ich nicht genau. In jedem Fall in der Kreissäge. So viel steht schon mal fest. Seitdem ist der alte Pfuscher noch grobmotorischer und meistens so besoffen, dass er unmöglich Tannenzweige und Morgensterne aus Sperrholzplatten schnitzen kann. Was die im Erzgebirge zu unserer Erfindung sagen, sei auch dahingestellt. Aber keiner der Dörfler hat widersprochen, im Gegenteil, geklatscht und gejubelt haben sie, diese Idioten. Außer die Gattin von Eckbert, die hat die ganze Zeit nur geheult und mich dabei total komisch angesehen.
Nachdem der Blaschke Bürgermeister den ganzen feierlichen Sabbel auf uns herniedergelassen hat, wobei man ihm zugutehalten muss, dass er die Zähne am Mann behalten hat, hat der Kindergartenchor aus Pubertierenden »O Tannenbaum«, »Leise rieselt der Schnee« und »Ihr Kinderlein kommet« gesungen. Die Lieder finde ich für unser Dorf nicht einmal unpassend, quasi als Mantra. Schließlich haben wir viel weniger Schnee als früher und Kinder auch nicht mehr so viele. Die Bälger hätten nur vorher vielleicht mal etwas üben sollen. Auch den Text zu kennen, könnte nicht schaden. Aber was beschwere ich mich. Ich, die zweitwichtigste Figur nach dem Blaschke Bürgermeister, habe die ganze Zeit neben Knecht Ruprecht gestanden und geatmet. Weiter nichts. Wie die Models bei der Formel Eins, die dürfen auch nicht reden, nur geil aussehen.
Irgendwann gibt der Chor endlich Ruhe und die Bläser dürfen ran. Die Kerle sind jedoch schon so hacke, dass die Töne, wenn sie denn kommen, nur noch schief klingen. Zu allem Überfluss sind denen auch noch zwei Stücke durchgerutscht. Das habe ich dem Fluchen des Blaschke Bürgermeisters entnommen, den C-Plan habe ich ja nicht gelesen. Wir befinden uns also nun in einer etwas längeren Zwangspause und Ruprecht drückt nach wie vor ein paar Tränen ab. Die Feierlichkeit ist aber auch kaum erträglich, vor allem nüchtern. Ich sehe, wie Ruprechts Großvater zwei prall gefüllte Taschen im Bushaltestellenhäuschen abstellt.
»Kommen wir nun zum großen Moment«, beschwört der Blaschke Bürgermeister sein Wahlvolk. »Endlich!«
»Das erste Türchen«, kreischt eine der Engelsdamen.
Der Blaschke Bürgermeister macht eine Pause, für die Dramatik oder so, und nickt nur gebieterisch. Ich hoffe, Ruprecht hört nicht vor Spannung auf zu atmen. Die Jagdbläser beginnen zu trommeln.
Nichts passiert. Alle schauen auf das Pfarrhaus. Dem Pfarrer gebührt die Ehre, das erste Türchen zu öffnen. Eigentlich ist es kein Türchen. Unmöglich, dass der Kerl vier Wochen lang seine Haustür offen stehen lässt. Nachher verirrt sich noch jemand zu dem. Das wäre unserem Seelsorger sicher unangenehm. Der Kerl hat eine ausgeprägte Soziophobie. Warum sonst wollte er freiwillig zu uns in den Wald?
Nun gut. Das mit dem Türchen jedenfalls ist symbolisch gemeint. Der Blaschke Bürgermeister nennt das einen lebendigen Adventskalender. Vierundzwanzig Häuser im Dorf machen mit. Eigentlich. Bei uns sind es fünfundzwanzig. Alfred Recknagel befindet sich mit seinem Haus im politischen Widerstand gegen den Blaschke Bürgermeister. Schon fünf Mal ist er bei der Wahl gegen ihn angetreten. Aber Alfred kriegt nicht einmal die Stimme seiner eigenen Frau. Deswegen hat er vor ein paar Jahren seine Strategie geändert und versucht es jetzt mit Zersetzung des Gegners. Alfred sabotiert unsere Dorfweihnacht in der Hoffnung, der Blaschke Bürgermeister bekommt einen Herzinfarkt. Bis jetzt ist diese Taktik nicht aufgegangen. Aber Alfred ist zäh. In jedem Fall ist das Pfarrhaus immer das erste Türchen. Dabei handelt es sich um einen großen über der Haustür hängenden Herrnhuter Stern, übrigens auch eine Erfindung von uns, zumindest habe ich das vorhin so verstanden. Der Herrnhuter jedenfalls leuchtet dann für vier Wochen. Die Kirche zahlt den Strom. Unser Blaschke Bürgermeister ist eben ein Stratege.
Der Blaschke Bürgermeister gibt den Bläsern ein Zeichen. »Noch mal! Lauter!«
Die trommeln wie verrückt.
Der Pfarrer lässt sich nicht blicken. Der Stern bleibt dunkel.
Der hat sich vier Wochen in die Karibik abgesetzt oder Alfred hat die Glühbirne herausgeschraubt, denke ich und freue mich über diesen Fauxpas. Das bringt Stimmung ins Dorf.
Ruprecht atmet jetzt wirklich nicht mehr. »Das ist ein schlechtes Omen«, haucht er mehrfach. »Außerdem stimmt die Choreografie nicht. Der Baum hätte zuerst brennen müssen. Es ist die falsche Reihenfolge, erst der Baum und dann das Türchen. O je.«
Ich zucke mit den Schultern. »Scheißegal, ob Baum oder Stern.«
Ruprechts strafender Blick trifft mich. Ich halte das aus. Ich kenne ihn seit dem Kindergarten.
Der Blaschke Bürgermeister scheint nichts von der falschen Reihenfolge mitzubekommen. Er kocht vor Wut und beschließt, dieser Peinlichkeit ein Ende zu setzen. Sein Marsch zum Pfarrhaus gleicht dem Gang zu einer Hinrichtungsstätte. Der Blaschke Bürgermeister ist dabei der Henker und der Pfarrer kann sich warm anziehen. Er wirft sich mit seiner ganzen Schwungmasse gegen die Tür und verschwindet im Haus. Ich behalte den Stern im Auge und hoffe insgeheim auf eine Massenschlägerei. Stattdessen tut sich eine Weile nichts. Dann ertönt ein Schrei. Ein entsetzlicher Schrei. Schließlich reißt der Blaschke Bürgermeister eines der Fenster im Obergeschoss auf und starrt uns kalkweiß an.
»Der Pfarrer ist abgenibbelt«, plärrt er über den Dorfanger. Die Zähne fliegen in hohem Boden in den Vorgarten. Die Jagdbläser beginnen wieder zu trommeln.
Das Badezimmer des Pfarrers misst keine zehn Quadratmeter. Ich zähle noch einmal die Fliesen. Achteinhalb in der Länge und fünfzehn in der Breite. Bei dieser Fliesengröße kommt das hin. Es ist billige Baumarktware zweiter Wahl mit Rissen und schmuddeligen Fugen in Trabantgrau. Noch dazu ist das Fenster nicht größer als ein A4-Hefter und von außen vergittert. Das Wort Nasszelle kriegt im Pfarrhaus eine ganz andere Bedeutung. Dabei habe ich die Wanne noch nicht einmal von dem zur Verfügung stehenden Platz abgezogen. Und die Fläche hinter der Tür auch nicht, denn die geht nach innen auf. Damit ist alles dahinter unbrauchbar. Ich bin enttäuscht. Nicht, dass ich dachte, so ein Kirchenmann lebe in Saus und Braus, schließlich sind wir ja nicht katholisch, aber das hier, nee, das geht echt nicht.
»1982 habe ich Ruprechts Großmutter ein Bad gebaut, das sah besser aus. Ochsenblutfarbene Fliesen. Alles unter der Hand organisiert.« Ruprechts Großvater steht neben mir und nickt sich selbst anerkennend zu. Zwischen seinen Waden klemmen zwei volle Beutel. Der Duft von frisch gebackenem Brot steigt mir in die Nase, wobei der es gegen den fauligen Geruch des Mini-Bades nicht aufnehmen kann. »Nur das Klobecken haben die nicht rangekriegt. Da half auch das Wildbret nichts.« Er winkt ab. »Aber egal. Der Anschluss war da und 1989 bin ich nach Coburg rüber und habe mir ein Porzellanbecken mitgebracht. Darauf sitze ich noch heute. Eins A.« Er hebt den Daumen.
»Die Leitungen sind auch hin«, antworte ich. »Das hätte nicht mehr lange gedauert und hier hätte alles unter Wasser gestanden.«
Der Großvater brummt zustimmend.
»Wie kann man denn die Wand in Moosgrün streichen?«, höre ich eine der Frauen sagen. Die anderen tuscheln.
»Und das Fenster hätte er auch mal putzen können«, bemerkt ein anderer.
»Ist er wirklich tot?« Ruprecht schluchzt. »Der arme Mann.«
Hinter der Tür jammern die Engel. Mir ist nicht klar, ob sie den Pfarrer oder ihre schlechte Sicht bedauern. Ruprecht und ich gehören für einen Monat zu den wichtigsten Leuten im Dorf. Wir dürfen neben dem Blaschke Bürgermeister in der ersten Reihe stehen. Es ist so eng, dass meine Kniescheiben gegen den Rand der Wanne gedrückt werden, weil sich immer noch mehr Leute in das Badezimmer des Pfarrhauses schieben, um einen Blick auf den Verblichenen zu werfen. Ruprechts Großvater gehört zu uns. Er hat Sonderrechte und steht ebenfalls in der ersten Reihe. Wenn er den Mund aufmacht, rieche ich den Inhalt seines Flachmanns. Hinter uns drängeln die Jagdhornbläser, die Frau vom Bürgermeister und die Eigentümer der Krippentiere. Darauf folgen die Statisten und das normale Volk. Erstaunlich, wie viele Leute in ein so kleines Bad passen, denke ich und halte nach dem Kinderchor Ausschau. Aber die haben es wohl nicht geschafft. Dafür sehe ich Hasso, der sich durch die auf einem Stuhl abgelegte dreckige Wäsche des Pfarrers schnüffelt.
Der Blaschke Bürgermeister schwitzt. »Ausgerechnet heute«, sagt er mit ehrlichem Bedauern in der Stimme. »Wenn man den Popen einmal braucht. Der wichtigste Tag des Jahres. Was soll das denn jetzt geben?«
»Er ist tot.« Ruprecht hat nun auch das Unübersehbare bemerkt. »Gott im Himmel.«
»Pfarrer im Himmel«, frotzle ich.
Ruprechts Großvater wackelt mit dem Oberkörper, so sehr muss er lachen. »Wenn der da hin kommt, holen mich die Engel persönlich ab«, sagt er zwischen zwei Lachern. »In neckischen grünen Bikinis.«
»Engel sind per se nackt«, sage ich.
»Noch besser«, antwortet der Großvater und schnalzt lüstern mit der Zunge. »Und bisschen fleischig wäre auch nett.«
Wieso die Bikinis grün sein müssen, frage ich nicht, jeder hat so seine Vorlieben. Dann schaue ich wieder den Pfarrer an. Ich konnte ihn noch nie sonderlich leiden, aber jetzt hat er irgendwie was Sympathisches.
»Warum legt der sich auch gerade heute zum Sterben in die Wanne«, blafft der Bürgermeister und ich kann aus dem Augenwinkel sehen, wie seine Zähne ans Licht drängen. Wo hat er die denn so schnell wieder herbekommen?
Der Pfarrer ist tot und er liegt in der Wanne, soweit kann ich die Beobachtungen des Blaschke Bürgermeisters teilen. Dass jemand jedoch ohne Wasser und dafür freiwillig bis zum Hals in Scherben badet, das halte ich für eine gewagte These. Dabei sieht das nicht mal schlecht aus, wenn man sich den speckigen Kopf des Pfarrers wegdenkt. Millionen von bunten Glasstückchen funkeln um die Wette. Wenn hier nicht nur eine 25-Watt-Birne von der Decke baumeln würde, wäre der Effekt noch besser. Aber der Pfarrer war geizig, schon immer. Ich beuge mich ein wenig nach vorn und betrachte das Glas. Dabei muss ich aufpassen, dass ich nicht beim Pfarrer lande, so sehr schieben die anderen von hinten. Ich habe es gleich vermutet, aber nun bin ich mir sicher: Das sind Weihnachtsbaumkugeln oder besser gesagt, die Reste davon. Der Pfarrer badet in Weihnachtsbaumschmuck. Na immerhin. Das sollte dem Weihnachtskomitee gefallen.
»Was isst der Kerl da?«, fragt der Großvater, ohne auf die Lautstärke seiner Worte zu achten. Hinter uns fängt die Meute zu spekulieren an.
»In seinem Mund steckt eine Weihnachtsgurke«, sage ich, und weil mehrere Nachfragen aus den Reihen der Engel kommen, wiederhole ich den Satz noch einmal lauter. Dann sehe ich die schmalen vertrockneten Rinnsale aus Blut an seinen Mundwinkeln. Mich würgt es. Wenn es um Blut geht, bin ich nicht so hart, wie ich aussehe. Exkremente kommen auch nicht so gut. Und natürlich Motten. Und wir begrüßen das nächste Herpesbläschen. Herzlich willkommen. Mal abgesehen von meiner möglicherweise leicht einsetzenden Ekelerregung, habe ich bis auf die Lebkuchen von Ruprechts Großvater heute auch noch nichts im Magen. Das kommt davon, wenn man auf die Glühheidi und Wildschwein am Spieß spekuliert und dann als Nikolaus ein Verzehrverbot auferlegt bekommt. Hoffentlich muss ich nicht in die Wanne kotzen.
»Die Weihnachtsgurken wurden bei uns im Thüringer Wald erfunden«, weiß der Blaschke Bürgermeister. Dann folgt eine ewig lange Erklärung über die Glasgurke, die man im Weihnachtsbaum verstecken muss und die dem Finder das ganze kommende Jahr Glück beschert.
Ich atme die Übelkeit weg. Glück würde ich das, was dem Pfarrer widerfahren ist, nicht direkt nennen. Aber wer weiß. Immerhin verpasst er die Adventszeit und Weihnachten natürlich auch. Da kann man schon mal in eine Weihnachtsgurke beißen.
»Das ist ein Fall für das Amt.« Der Blaschke Bürgermeister hat sich offenkundig nach dem ganzen Gesabbel um Weihnachten wieder im Griff.
Ich frage mich, welches Amt er wohl meint, und warte gespannt, was nun passiert.
»Ich muss das hier versiegeln«, sagt der Blaschke Bürgermeister wichtig. Er dreht sich um, wobei ich von seinem massigen Körper fast mitgerissen werde. »Hier gibt es nichts zu sehen. Verlassen Sie sofort das Objekt«, schreit er die Gemeinde an. »Alle raus und wieder auf die Plätze. Dass wir die Feierlichkeiten unterbrechen mussten, ist schlimm genug.«
Der Blaschke Bürgermeister will das wirklich durchziehen, denke ich noch, da reißt Ruprecht an meinem Umhang. »Wir müssen in Zone eins, beeil dich.«
»Hackt’s denn bei euch allen«, schreie ich. »Der Pfarrer wurde umgebracht. Ich rufe jetzt die Polizei und dann gehe ich nach Hause.«
»Der muss sich wieder wichtigmachen«, höre ich Gerhard, meinen Nachbarn, von irgendwoher sagen. Ich kann ihn nicht sehen, aber seine nasale Stimme erkenne ich sofort. Die Engel hinter der Tür kichern. So, wie das klingt, haben die meine Ration Glühheidi gehabt.
»Wie, umgebracht?«, fragt der Blaschke Bürgermeister und seine Zähne kommen mir gefährlich nahe.
Ich deute mit der Hand auf den Pfarrer und sage so was Sinnhaftes wie: »Er liegt in Glasscherben? Aus seinem Mund läuft Blut? Er beißt auf eine Weihnachtsgurke?« Das alles ist deutlich zu erkennen und ich frage mich, wieso nur mir diese ganzen Absonderlichkeiten auffallen.
Der Blaschke Bürgermeister sieht mich an, als wäre ich nicht ganz dicht.
»Wo du es sagst«, murmelt Ruprecht und ich bemerke, wie er seinen Kopf leicht hin- und herwiegt, als müsste er über meine Beobachtung noch einmal nachdenken.
Der Blaschke Bürgermeister scheint ebenfalls zu überlegen. Irgendwann sagt er: »Du meinst also, das ist kein Ritual, bei dem der Pfarrer friedlich eingeschlummert ist?«
Auf diesen geistigen Dünnschiss fällt mir nichts mehr ein.
»Ich dachte eher an was Sexuelles«, wirft der Großvater ein. »Seitdem seine Frau weg ist, kann er doch machen, was er will.«
»Freilich«, kommentiere ich. »Der Pfarrer steht auf Weihnachts-Sadomaso. Wie wir alle hier.«
»Also jetzt entschuldige mal«, bläst sich der Blaschke Bürgermeister künstlich auf. »Das kann man ja wohl überhaupt nicht vergleichen.«
Ich betrachte Ruprecht, dem schon wieder ein guter Teil seines Oberlippenbartes in den Mund gerutscht ist. Er kaut darauf herum und jammert. »Wenn das die Leute mitbekommen.«
Ich drehe mich um und schaue die Leute an.
»Nikolaus hat sicherlich recht. Wir müssen die Polizei rufen«, sagt der Blaschke Bürgermeister dann und ich kann hören, wie viel Überwindung ihn dieser Satz kostet.
»Irmgard«, haucht der Großvater neben mir und es hört sich an, als würde er von seinen Hämorrhoiden reden.
»O nein, nicht am ersten Dezember«, mosert Ruprecht.
»Das Stadtweib«, sagt der Blaschke Bürgermeister von einem Würgelaut begleitet.
Hinter mir werden Entsetzensschreie laut.
Irmgard Gmeiner ist Ruprechts Schwester. Sie ist bei der Kripo und keiner kann sie leiden, am wenigsten Ruprecht und sein Großvater. Warum das so ist, weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich, weil sich Irmgard Gmeiner nichts aus männlichen Autoritäten und Familienbanden macht. Aber wer kann schon in die Köpfe gucken. Was den Blaschke Bürgermeister angeht, na ja, der hat einfach etwas gegen Städter. Seine Frau faselt, immer wenn es um das Thema geht, von einer natürlichen Aversion. Dabei spricht sie das Wort mit einem fiesen »v« und tut von oben herab. Ich bin mir sicher, dass sie keinen Schimmer hat, was das bedeutet, aber sie sagt oft Dinge, die sie nicht versteht.
Irmgard lebt seit ewigen Zeiten in Suhl. Für den Blaschke Bürgermeister ist das in etwa so dekadent wie München, Hamburg oder Berlin. Dabei bin ich mir sicher, dass er den Thüringer Wald noch nie verlassen hat. Was soll’s? Ich habe es auch nicht so mit Irmgard. Sie hatte als junges Mädchen schon dieses viel zu lange Pferdegesicht mit der überdimensionierten Nase, wie alle aus der Familie Gmeiner. Noch dazu ist sie von jeher so klapperdürr, dass ich immer unwillkürlich denken muss, sie übersteht den nächsten Winter nicht. Irmgard Gmeiner ist richtig hässlich. Dagegen ist Ruprecht eine Augenweide. Und der sieht schon nicht besonders aus. Aber Ruprecht ist mein Freund und Irmgard ist mir egal.
»Wer ruft die Städterin an?«, fragt der Bürgermeister und ich spüre, wie sich alle Augen auf mich richten.
Ich tippe mit dem Zeigefinger gegen meine Stirn, um allen unmissverständlich klarzumachen, was ich davon halte.
»Ich rede seit Jahren nicht mit der«, murmelt der Großvater. »Außerdem habe ich kein Handy.«
Ich weiß, dass er über WhatsApp die Lebensmittelversorgung mit seinen Bräuten regelt, schweige aber höflichst.
»Du kannst dich am besten ausdrücken. Dich versteht sie«, sagt Ruprecht und streichelt meinen Arm. »Bitte, Nikolaus.«
»Ich heiße Adam, verdammt«, knurre ich und spüre, wie der Blaschke Bürgermeister seine Hand, die etwa die Größe einer Schaufel hat, auf meine Schulter legt und so viel Gewicht draufgibt, als müsse er mir die Bedeutung dieses Moments mithilfe einer gebrochenen Schulter vor Augen führen.
»Nikolaus und Knecht Ruprecht, ihr seid momentan die wichtigsten Männer im Dorf. Bitte nehmt euch dieser Aufgabe an und rettet damit unsere Weihnacht«, sagt er und schaut dabei, als wollte er uns seine Frau, Haus und Hof sowie sämtliche Ersparnisse anvertrauen.
Das hat sich der Blaschke Bürgermeister fein ausgedacht, denke ich. Irgendwo findet der immer ein paar Dumme. Der Weihnachtsscheiß allein ist schon schrecklich genug. Jetzt habe ich auch noch die hässliche Irmgard und einen toten Pfarrer an der Backe.
»Ein Weihnachtsspezialauftrag mit einem Toten«, haucht Ruprecht ergriffen. »Gut, dass Herr Fuchs zu Hause geblieben ist.«
Ich frage mich nicht einmal mehr, ob er zu heiß geduscht haben könnte. Ruprecht hat seinen Hund schon immer wie einen Menschen behandelt. Er nimmt sogar beim Fernsehprogramm Rücksicht auf ihn. Nur, weil er sich einbildet, Herr Fuchs würde nach einem Krimi schlechter schlafen. Dabei ist Ruprecht die Lusche. Der Dackel hält sogar die härtesten Thriller aus. Das weiß ich, weil ich ihn ab und zu über Nacht behalten muss und so einiges getestet habe. Also eigentlich maximal zwei Mal im Jahr, wenn Ruprecht wegen seines Jobs zwangsläufig woanders pennen muss und der Opa mit seinen Siebzig-plus-Single-Reisen unterwegs ist. Der Dackel jedenfalls ist ein echter Hardcore-Typ. Nur mit Tiefkühlpizza hat er es nicht so. Aber davon kriege sogar ich Sodbrennen. Egal. Trotzdem nicke ich.
»Natürlich, das ist kein Anblick für einen Dackel«, pflichte ich Ruprecht bei.
Hasso niest derweil in die alte Unterhose des Pfarrers.
Seit etwa zehn Minuten sind die Lichter am Weihnachtsbaum nicht ausgegangen. Ebenso lange steht Ulf, der Gemeindearbeiter, mit in den Nacken gelegtem Kopf unter dem Baum und starrt. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich denken, er meditiert beim Anblick einer der ältesten mitteleuropäischen Weihnachtsbräuche. Doch in Ulfs Gesicht steht die nackte Angst. Fast eine Stunde hat er sich an den Kabelverbindungen zu schaffen gemacht, bevor die Lämpchen an unserem Wahrzeichen geleuchtet haben. »The show must go on«, hatten Maria und Josef im Duett gebrüllt und Ulf hatte die Verlängerungsschnüre gestreichelt, als seien sie das Jesuskind. Der Blaschke Bürgermeister war schon so in Brass gewesen, dass er sogar vergessen hatte, die Jagdhornbläser zum obligatorischen Tusch aufzufordern. Das hätte ohnehin nichts mehr gebracht, denn seitdem die Männer das Pfarrhaus verlassen hatten, kannten sie in puncto Glühheidi erst recht kein Halten mehr. Das Glück der Überlebenden muss gebührend gefeiert werden. Dem Rest des Dorfes scheint es ebenso zu ergehen. Niemand achtet mehr auf das Pfarrhaus und den noch immer dunklen Herrnhuter über dessen Tür. Der Herr hat’s gegeben, der Herr hat’s genommen. Prost. Es lebe unsere Dorfweihnacht.