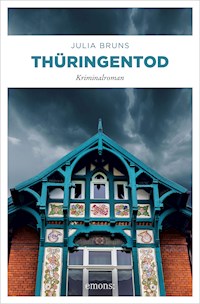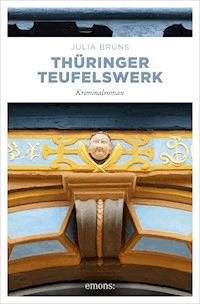Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Küsten Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein dunkles Kapitel ostdeutscher Geschichte: authentisch, tragisch und fast vergessen. Neujahrsmorgen liegt ein alter Mann mit abgeschnit-tener Zunge tot unter der Seebrücke in Sellin. Gemeinsam mit Pensionsbetreiber Sören Hilgert begibt sich Haupt-kommissarin Anne Berber auf eine Suche, die sie tief in die Geschichte Rügens führt – und stößt auf offene Wunden, die der Zweite Weltkrieg hinterlassen hat. War der Tote überhaupt derjenige, der er vorgab zu sein?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 372
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Julia Bruns, in einem kleinen Dorf mitten in Thüringen geboren, studierte Politikwissenschaft, Soziologie und Psychologie an der Universität Jena. Nach ihrer Promotion im Fach Politikwissenschaft arbeitete sie viele Jahre als Redenschreiberin und in der Öffentlichkeitsarbeit. Heute schreibt sie als freie Autorin. Bruns lebt mit ihrer Familie, zu der auch ein Harzer Fuchs gehört, in Thüringen.
www.julia-bruns.com
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
Lust auf mehr? Laden Sie sich die »LChoice«-App runter, scannen Sie den QR-Code und bestellen Sie weitere Bücher direkt in Ihrer Buchhandlung.
© 2019 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: mauritius images/imageBROKER
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Marit Obsen
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-510-7
Küsten Krimi
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Agentur Editio Dialog, Dr. Michael Wenzel (www.editio-dialog.com).
Prolog
1946
Die Schritte kamen näher. Schwer und gleichmäßig dröhnten sie über den schmalen, langen Gang. Die Nägel, mit denen die Sohlen der Stiefel fixiert waren, scharrten auf dem Beton. Es waren mindestens zwei Männer. Man konnte es am Aufsetzen ihrer Füße hören. Gleich mussten sie da sein. Jeden Moment.
Er spürte, wie sich sein Körper verkrampfte, wie jeder einzelne Muskel sich zusammenzog. Die Schläge seines Herzens hallten bis zum Hals hinauf. Kalter Schweiß trat ihm auf die Stirn. Er hielt die Luft an. Vielleicht gingen sie vorbei, zur nächsten oder übernächsten Zelle.
Und kamen morgen wieder. Es gab kein Entrinnen.
Der Tod ist nicht die Erlösung, hatte der Pfarrer letzten Sonntag gepredigt. Was weiß der schon, dachte er verächtlich. Das Leben hatte ihn etwas anderes gelehrt. Im Artilleriefeuer des Iwans, dem seine Einheit wenige Kilometer vor Königsberg knapp entkommen war, hatte der Tod einen sicheren Platz gehabt. Wenn man in der Hölle dahinvegetierte, ausgeliefert, von Todesangst gelähmt, bar jeglichen Menschseins, konnte er schnell zum einzigen Verbündeten werden. Zur Errettung für all jene, die den letzten Funken Hoffnung zwischen Zerstörungswut, Barbarei und den zerfetzten Eingeweiden der Kameraden verloren hatten.
In der vermeintlichen Gewissheit, dass dieses Martyrium das Schlimmste war, was einem menschlichen Wesen durch seinesgleichen widerfahren konnte, hatte er überlebt, war nach dem Ende des Krieges als erwachsener Mann zurückgekehrt in eine Welt, die seither eine andere war. Er war jung genug, um den Wahnsinn hinter sich zu lassen und ein neues Leben zu beginnen. Ein Mädchen hatte er sich suchen wollen, eine, die im Hotel seiner Eltern mit anpacken konnte. Irgendwann würde es schließlich ihm gehören, das herrschaftliche Haus in Sellins Prachtstraße, das seine Großeltern gegründet und zum Florieren gebracht hatten. Dann brauchte er eine Frau, die ebenso charmant lächelnd Konversation betreiben wie im Akkord Kartoffeln schälen konnte. Er sehnte sich nach einem ganz normalen Leben, wie jeder, der den Krieg überlebt hatte. Und alles war gut gelaufen. Bis zu jener lauen Nacht vor vier oder fünf Tagen, die auf einen sonnigen Oktobertag gefolgt war. Sie hatten unten an der Rezeption gestanden und nach ihm verlangt. Drei Männer. Rotarmisten. Zwei einfache Soldaten mit breiten, fremden Gesichtern und an den ausgemergelten Körpern schlackernden Uniformen, die den beißenden Geruch ihres Machorka-Tabaks verströmten. Und ihr Kommandant, der ein akkurates Deutsch sprach, sich aber auf wenige Worte und scheele Seitenblicke beschränkte.
Mit der Zunge tastete er nach der Lücke in seinem Oberkiefer. Die Wunde brannte. Im Nebenraum stöhnte jemand vor Schmerzen. Ihn hatten sie gestern geholt, oder war es vorgestern gewesen? Vielleicht war es auch ein anderer, er wusste es nicht genau, hatte keine Vorstellung, wie viele sie hier unten waren. Manchmal hörte er die Männer in den Nachbarzellen flüstern. Namen drangen herüber. Ängstliche Fragen, Unsicherheit, der verzweifelte Ruf nach zu Hause. Die meisten stammten aus Sellin, ein paar aus Göhren und Baabe. Manche hockten schon mehrere Wochen hier, andere erst seit Kurzem, die meisten hatten jegliches Gefühl für die Zeit verloren. Es gab kein Tageslicht, nur eine Hundert-Watt-Birne, die an einem Kabel von der Decke baumelte und ohne Unterbrechung ihr gleißendes Licht auf sie warf. Das Leben hatte sie vergessen, in einem zugigen, feuchten Keller ohne Decken und Wasser, allein mit sich und der wie ein dröhnender Kopfschmerz hämmernden Frage nach dem Warum.
Er schaute in die bleichen Gesichter der Jungs, die neben ihm hockten. Seine Augen brannten. Seit sie hier waren, hatten sie kaum ein Wort gesprochen, starrten nur apathisch vor sich hin. Nichts war mehr übrig von ihrer Euphorie, der Aufbruchsstimmung. Sie alle hatten den Krieg überlebt, Freunde, die danach nichts mehr trennen sollte. Ihre Uniformen hatte sein Vater nach ihrer Rückkehr eingesammelt und zwischen dem Reisig versteckt, das zum letzten Erntedankfest in Flammen aufgegangen war. Die neuen Herren dürften nicht herausgefordert werden, hatte er gesagt. Mit der einfachen Wehrmachtsuniform eines Siebzehnjährigen? Er hatte es nicht verstanden. Der Vater war wütend geworden. »Sie sind die Sieger, wir die Besiegten«, hatte er gesagt. Man müsse vorsichtig sein. Es hatte nichts genutzt. Die Zeugen der Vergangenheit ließen sich verbrennen, sie selbst holte einen jedoch immer wieder ein.
In jener Nacht waren sie alle fünf auf die Ladepritsche eines Lkw geworfen worden. Der Hänfling, der Jüngste unter ihnen, war der Letzte gewesen, den die Russen geholt hatten. Im Schlafanzug. Das Bürschchen, dessen ganzes Vergehen darin bestanden hatte, dass er in der Hitlerjugend gewesen war, wie rund acht Millionen andere mit ihm auch. Kaum dass der Wagen angehalten hatte, war er verschwunden gewesen. Ein Soldat hatte ihn weggeschleift. Sein Schluchzen klang ihm noch immer in den Ohren. Seitdem hatten sie den Hänfling nicht mehr gesehen. Kein Lebenszeichen. Nichts. Was hatten sie mit ihm gemacht? Ob er noch lebte?
Die Schritte verstummten. Stille. Die Wärter waren stehen geblieben. Sie sprachen miteinander. Er schloss die Augen. Ein dickes Schlüsselbund schlug lautstark gegen den Türbeschlag, ein Schlüssel wurde im Schloss gedreht. Die Tür schwang auf. Sie waren an der Reihe.
Zwei Rotarmisten, groß, hager, kaum älter als er selbst, mit kahl rasierten runden Köpfen und breit hervorstehenden Wangenknochen standen regungslos im Türrahmen. Ihre Blicke waren kalt und zeugten von unbeschreiblichem Hass. Der größere von beiden fing sogleich an zu schreien. Fremde, unverständliche Laute. Als er fertig war, spie er die Schalen von Sonnenblumenkernen in ihre Richtung. Niemand wagte auch nur zu zucken oder den Blick zu heben. Langsam sah der Soldat von einem Gefangenen zum nächsten. Er grölte erneut, dass seine Halsschlagadern hervortraten, während sein Begleiter zunächst scheinbar wahllos in die Gruppe zeigte, bei ihm haltmachte und ihm mit seiner rechten Hand signalisierte, dass er mitkommen sollte.
Er dachte an den Pfarrer, an den Gewehrkolben, mit dem sie ihm den Eckzahn ausgeschlagen hatten, an das Weinen der Mutter und die große alte Linde im Garten seines Elternhauses. An den verschwundenen Hänfling. Er wagte es nicht, die Freunde anzusehen. So schnell er konnte, erhob er sich von dem Lehmboden, der ihm und den anderen als Lagerstatt diente, legte die Hände hinter den Rücken, senkte den Kopf und trat hinaus auf den Gang. Um ihn herum drehte sich alles. Sein Mund war trocken. Ein Zittern erfasste seinen Körper. Hoffentlich ließen ihn seine Beine nicht im Stich. Er hatte keine Kraft. Verdammt noch mal, er hatte keine Kraft.
Die Beklemmung in seiner Brust nahm ihm fast den Atem. Er glaubte, sich übergeben zu müssen, versuchte zu schlucken, schnappte nach Luft. Atme. Du brauchst Sauerstoff. Ruhig. Weglaufen. Jetzt. Ohne Deckung? Sie würden ihn erschießen. Sofort. Er konnte ihr Lachen schon hören. Die Angst ließ ihn kaum einen klaren Gedanken fassen. Er war unschuldig, oder etwa nicht? Ein junger Mann, der in der Kriegsmaschinerie der Nationalsozialisten verheizt werden sollte. Einer, der Glück gehabt hatte, davongekommen war. Bis jetzt.
Dieser Keller. Der Hass. Die Brutalität. Warum?
Er versuchte einen festeren Schritt, fixierte die Treppe am Ende des Ganges. Wie viele Meter waren das? Zehn, zwölf? Die Stufen verschwammen vor seinen Augen. Er schloss die Lider, riss sie wieder auf. Die Treppe war kaum noch zu erkennen, eine unerreichbare graue Masse. Herr, hilf mir, bitte. Er senkte den Blick. Erstarrte. Blut. Überall auf dem Fußboden war Blut. Breite Lachen, deren Farbschattierungen von sattem Rot bis hin zu tiefem Schwarz reichten, weil erste Gerinnungsspuren an den Rändern immer wieder durch frische Rinnsale aufgeweicht wurden. Das Blut floss unter den Türen der Zellen hindurch auf den Korridor. Was immer sich dahinter abspielte, es musste furchtbar sein.
Ein fester Tritt in seine rechte Kniekehle ließ ihn vornüberfallen. Er strauchelte und knallte auf den Boden. Seine Handflächen patschten in eine Blutpfütze, dass es spritzte. Einer der Soldaten lachte dreckig, packte ihn am Oberarm, zerrte ihn wieder hoch, stieß ihn vor sich her und traktierte ihn dabei mit seinem Stiefel. Der andere pfiff ein Lied und folgte ihnen.
Sie brachten ihn in einen großen Raum, eine Art Salon mit breitem Eichenparkett und Blümchentapete. In der Mitte des nahezu leeren Zimmers stand ein riesiger Schreibtisch, hinter dem ein stämmiger Mann in Offiziersuniform und eine Frau im Pelzmantel saßen. Der Mann sagte etwas, woraufhin einer der Soldaten sich entfernte, griff nach einer halb vollen Wodkaflasche und goss ein milchiges Wasserglas, das er aus einer der Schubladen nahm, randvoll. Hinter ihm an der Wand hingen eine große rote Flagge mit Hammer und Sichel und daneben ein Schwarz-Weiß-Porträt Stalins. In den Fenstern klemmten fleckige Pappen, deren ausgefranste Ränder ein paar Sonnenstrahlen durchließen, was die Szenerie noch unwirklicher machte. Der Geruch von Alkohol, Stiefelschmiere und einem süßlichen Parfüm hing in der Luft.
Minuten vergingen, ohne dass ihn jemand beachtete. Er stand wie angewurzelt, die blutverschmierten Hände auf den Rücken gelegt, und atmete, so flach er konnte. Schräg hinter ihm hatte sich der verbliebene Soldat postiert. Irgendwann nickte die Frau dem Soldaten zu. Der schlug die Hacken zusammen, eilte zum anderen Ende des Raumes, kam mit einem Stuhl zurück, den er vor dem Schreibtisch abstellte, und nahm dann wieder seine Position neben der Eingangstür ein. Nun schaute die Frau auf ihn und wies ihn in holprigem Deutsch an, Platz zu nehmen. Dabei fuhr sie sich mehrmals mit der Zunge über die dunkelrot geschminkten Lippen. Er betrachtete irritiert den Stuhl, dem die Lehne abgesägt worden war, tat jedoch wie ihm geheißen.
Der Offizier nahm einen Schluck von seinem Wodka und sah ihn mit stechendem Blick an. In ruhigem, freundlichem Tonfall fragte er: »Kak tebja sawut?«
Die Frau im Pelzmantel übersetzte. »Wie heißt du?« Dabei blätterte sie ungerührt in einer Akte, die vor ihr lag.
Er öffnete den Mund und bemühte sich, laut und deutlich zu antworten, doch der Offizier winkte ab.
»Nu, charascho. Wir wissen«, entgegnete er mit einem breiten Grinsen, wobei er ihm fast schon freundschaftlich zuzwinkerte. Der Mann hatte ein ovales, ein wenig feistes Gesicht und trug einen Schnurrbart wie Väterchen Stalin. Die Schirmmütze, in deren Mitte der rote Stern prangte, hatte er abgenommen und vor sich auf die Tischplatte gelegt, was seine akkurat geschnittenen, kurzen dunklen Haare sichtbar machte. Langsam begann er, die ersten drei Knöpfe seiner Uniformjacke zu öffnen, ohne ihn dabei aus den Augen zu lassen.
Er versuchte nicht einmal, dem Blick des Russen standzuhalten.
Schweigen. Eine Weile passierte nichts.
Unvermittelt sprang der Offizier auf. Sein Stuhl fiel lautstark zu Boden. Er schrie, riss die Arme nach oben, fuchtelte in der Luft herum, machte einen Schritt zur Seite, trat gegen die Seitenwand des Schreibtisches. Das Holz zerbarst.
»Welcher Organisation gehörst du an?«, fragte die Dolmetscherin, ohne aufzublicken.
Er verstand die Frage nicht. Schließlich antwortete er mit zittriger Stimme: »Keiner.«
Der Offizier tobte. Unverständliche Worte prasselten auf ihn nieder.
»Du bist ein Gegner des Sozialismus, ein Kapitalist. Du bist ein Faschist«, leierte die Frau desinteressiert herunter, was nicht einmal ansatzweise der Menge der Sätze entsprach, die der Offizier gerade von sich gegeben hatte.
»Ich habe nichts …«, stammelte er, »… getan. Nichts.«
Der Mann stand nun direkt vor ihm. Breitbeinig, mit leicht nach vorn gebeugtem Oberkörper. Seine Augen waren kalt und durchdringend.
Er starrte auf die Dielen. Die stickige Luft und der Wodka im Atem des Russen vernebelten ihm die Sinne. Er kämpfte mit einem Brechreiz. »Ich habe nichts verbrochen«, wiederholte er.
Die Frau im Pelzmantel machte sich nicht die Mühe, seine Aussage zu übersetzen.
»Faschist«, schrie der Offizier. »Werwolf.« Dann schlug er ihm mit der Faust ins Gesicht. Wieder und wieder.
Blut schoss aus seiner Nase und tropfte auf sein Hemd. Er wankte, obwohl er saß. Nur mit Mühe konnte er sich auf dem Stuhl halten. Der Offizier fasste nach seinem Kragen, riss ihm das Hemd vom Leib und warf es auf den Boden.
»Charascho«, sagte er zufrieden, ließ von ihm ab und schlenderte zurück zum Schreibtisch. Dort nahm er sein Glas, leerte es in einem Zug, beugte sich vor, zog eine Schreibtischschublade auf und holte ein abgeschnittenes Stromkabel von etwa einem halben Meter Länge heraus, an dessen einem Ende eine Lüsterklemme steckte. Dabei lächelte er unentwegt breit, was eine Reihe von Goldzähnen sichtbar werden ließ.
Schlagartig jedoch knallte er die Schublade zu, und seine Miene verfinsterte sich. Mit zwei Schritten stand er wieder neben ihm, holte aus und zog ihm mit voller Wucht das Kabel über den Rücken. Dann noch einmal. Und noch einmal.
Er bäumte sich auf und schrie zum Gotterbarmen. Brennender Schmerz durchzog seinen Körper. Die Welt um ihn herum verschmolz zu einem schwarzen Nichts, aus dem hin und wieder ein paar helle Sterne aufblitzten. Sein Herz drohte stehen zu bleiben. Er röchelte. In diesem Kabel lag der geballte Hass der Sieger auf die Besiegten. Seine Lungen fühlten sich an, als wollten sie zerbersten. Die Haut an seinem Rücken begann aufzureißen.
Die Schläge nahmen kein Ende. Sein Blut tropfte hinab auf die dreckigen Dielen. Er konnte sich nicht halten, sackte zusammen. Jemand richtete ihn wieder auf. Wieder das Kabel. Er sah blutige Hautfetzen, die von seinem Rücken stammten. Die Schmerzen überstiegen alles, was er je erlebt hatte. Die Lüsterklemme drückte sich in sein nacktes, rohes Fleisch. Wieder und wieder, bis die Rippenknochen erreicht waren.
Das war das Ende. Er hatte aufgegeben. Die Welt um ihn herum verschwand im Nichts.
EINS
»Das Rauschen der Wellen hat meine Frau kein Auge zutun lassen.« Der große, hagere Mann mit dem leichten Silberblick, dessen dicke orangefarbene Steppjacke seinem Oberkörper die Fülle eines Sumoringers verlieh, hatte Mühe, den Satz mit der nötigen Entschiedenheit herauszubringen. Seine Frau stand etwas versetzt hinter ihm, wobei der Stoff ihres Anoraks, der sich von seinem nur durch eine deutlich höhere Konfektionsgröße unterschied, unentwegt den Rücken ihres Mannes touchierte und ein penetrantes Rascheln erzeugte. Dadurch, dass sie ihm nach jedem zweiten Wort unsanft ihren Ellenbogen in die Seite stieß, als könnte das seine Aggression schüren, wurde das Rascheln noch verstärkt, nicht jedoch seine Durchsetzungskraft. Obgleich die arktische Oberbekleidung sicherlich jeglichen Schmerz dämpfte, kam der bedauernswerte Mann durch die Rempeleien seiner Gattin so aus dem Konzept, dass er seine Beschwerde alles andere als flüssig hervorbrachte. »Das hätten Sie uns bei der Buchung sagen müssen. Schließlich muss man sich darauf einstellen können.« Ein erneuter und in seiner Heftigkeit bislang unübertroffener Anrempler seiner Frau ließ ihn fast vornüberfallen. »Wir verlangen einen Nachlass«, presste er hervor.
Sören Hilgert lächelte ausnehmend freundlich. »Das bedauere ich sehr, meine Herrschaften. Sie haben allerdings ausdrücklich auf ein Zimmer mit Meerblick bestanden. Da bleibt das Rauschen leider nicht aus.« Er stand hinter dem schmalen Empfangstresen seiner Frühstückspension und schaute das Paar unverwandt an. Hilgert war Anfang fünfzig und von stattlicher Größe. Tadellos rasiert, verliehen sein eckiges Kinn und die kantigen Wangenknochen seinem Gesicht etwas Markantes, keineswegs Unangenehmes, zumal seine leuchtend grünen Augen eine nahezu entwaffnende Sanftmütigkeit ausstrahlten. Seine nussbraunen, kurzen Haare glänzten ein wenig feucht, was an dem Haargel lag, mit dem er dafür sorgte, dass die Frisur ordentlich saß. Er trug, wie alle Tage, ein strahlend weißes, extrem schmal geschnittenes Oberhemd, das akkurat in seiner schwarzen Stoffhose steckte und keinen Zweifel daran ließ, dass er regelmäßig Sport trieb. Hilgert atmete entspannt. Seine gepflegten Hände ruhten auf dem hellen Holz des Empfangstisches, und sein Gesichtsausdruck blieb unverändert freundlich. Niemand, nicht einmal seine engsten Freunde, hätte ihm ansehen können, was er gerade dachte. »Es tut mir leid, dass Sie in Ihrer Nachtruhe gestört waren, aber ich kann hier nichts machen.«
Der Mann drehte den Kopf in Richtung seiner Frau. »Ich habe doch gleich gesagt, dass du dir dieses Zimmer schließlich selbst ausgesucht hast«, raunte er ihr zu.
Sie wurde rot vor Wut und antwortete, ohne ihren Mann oder Hilgert anzusehen, aber in einer Lautstärke, dank der die anderen Gäste, die sich gerade beim Frühstück befanden, mühelos jedes Wort mithören konnten: »Und das Feuerwerk. Diese ganze Knallerei. War das etwa nichts? Von den Hundertschaften, die um Mitternacht noch auf die Seebrücke marschiert sind, gar nicht zu reden. Deren Krakeelerei klingt mir jetzt noch in den Ohren. Und so etwas soll Urlaub sein? Eine Frechheit ist das!«
Den letzten Satz brachte sie mit so viel Nachdruck hervor, dass ihre Spucke Hilgerts Tresen benetzte. Als ihre Worte verklungen waren, wandte sich der Mann erneut dem Pensionsbesitzer zu und gab die Äußerung seiner Gattin nahezu identisch wieder, so als ob Hilgert von alledem nichts mitbekommen hätte.
»Das Höhenfeuerwerk auf der Selliner Seebrücke ist die Silvesterattraktion auf Rügen. Ich bedauere, dass es Ihnen nicht gefallen hat.« Hilgert vermied den Blick auf das Gepäck des Paares, das er während ihres Frühstücks für sie aus dem Zimmer geholt und neben der Eingangstür abgestellt hatte. Aus einem Rucksack ragte eine bunte Packung mit der Aufschrift »New Revolution, 12-teiliges Riesenraketensortiment mit besonders schönen Farben und extralautem Knall« heraus. Stattdessen machte er einen Ausfallschritt nach rechts, tippte an die Maus seines Computers, wartete, bis der Bildschirm aufflackerte, und klickte sich zu den Rechnungen durch. »Sie hatten einen dreitägigen Silvesteraufenthalt zum Sonderpreis von zweihundertneunundneunzig Euro im Doppelzimmer inklusive Frühstück gebucht. Möchten Sie mit Karte oder in bar zahlen?« Er lächelte.
Seit fast zwei Jahren betrieb er nun die »Seevilla«, eine kleine Frühstückspension direkt am Selliner Hochuferweg. Sie war sein neues Leben, der lang gehegte Traum, von dem er nicht geglaubt hatte, ihn jemals wahr machen zu können. Bis zu dem Moment, in dem das Schicksal einen Haken geschlagen hatte. Von jetzt auf gleich war die eigene Biografie zerfallen, zerbröselten die jahrelang stringent verfolgten Ziele bis zur Unkenntlichkeit. Auf einmal stand die Welt in Frage. Am Punkt angelangt, an dem nichts mehr ging, hatte er seinen Schreibtisch beim LKA 1 in der Berliner Keithstraße geräumt. Ohne ein Wort zu den Kollegen, nicht einmal Ece, seine engste und vielleicht auch einzige Vertraute, war eingeweiht. Er wollte nicht zurückgeholt werden, nichts erklären müssen, was sie ohnehin schon wusste. Noch am selben Abend hatte er eine E-Mail von ihr in seinem Postfach gefunden. Eine Immobilienanzeige, unkommentiert, aber bedeutender als der wortreichste Abschiedsbrief. Zwei Wochen später hatte er mit der absoluten Gewissheit, dass er diese Insel nie wieder verlassen würde, auf der Selliner Seebrücke gestanden und die Renovierungskosten für seine soeben erworbene Gründerzeitvilla überschlagen.
»Ich zahle bar«, murmelte der Mann etwas verschämt, während ihm der Schweiß die Schläfen hinunterrann. Die Daunenjacke tat hervorragende Dienste.
Hilgert kassierte und druckte den Rechnungsbeleg aus. Als er gerade dabei war, die beiden Gäste zu verabschieden, wurde ruckartig die Eingangstür aufgerissen, und Wennemar Dombrowski stürmte herein, mit hochrotem Kopf und verkniffener Miene. Ungeachtet des Schnees an seinen Stiefeln hielt er auf den Tresen zu, schlitterte über den Holzfußboden, rutschte fast aus, fing sich jedoch wieder und fluchte lautstark im schlimmsten Ruhrpott-Deutsch. »Verdammte Scheiße, Hilgert. So eine verdammte Scheiße. Beweg deinen Arsch hinunter zur Seebrücke. Da ist einer abgekratzt.«
Erst jetzt bemerkte er den Mann und die Frau, die gerade dabei waren, ihr Gepäck aufzunehmen. Er stutzte, zwang sich ein gekünsteltes Lächeln ab und presste ein »Tach auch« hervor. Dann fiel sein Blick auf Hilgert, und seine Mundwinkel senkten sich wieder. »Menno, Hilgert!«
***
»In den Brötchenteig machen die zerhackte Schalen von der Miesmuschel, wenn ihr es genau wissen wollt, die sind schön scharfkantig, damit ihr euch alle die Kehlen aufschneidet. Ich kann euch schon röcheln hören.« Der schmächtige Mann mit den zerschlissenen Arbeitshosen und dem von Motten zerfressenen dicken dunkelblauen Seemannspullover legte den Kopf nach hinten, fasste sich an den Hals, streckte die Zunge heraus und gab krächzende Geräusche von sich. Mit großen Schritten lief er vor den Mecklenburger Backstuben in der Wilhelmstraße auf und ab. Der breite Boulevard mit seinen originalen und nachgebauten weißen Bäderstil-Villen war die Prachtmeile des Ostseebades Sellin und zog seit Ende des 19. Jahrhunderts die Gäste an. Die von kugelförmigen Sommerlinden gesäumte Straße verlief im nahezu rechten Winkel zur Ostsee und endete dreißig Meter über dem Meeresspiegel am Absatz einer siebenundachtzig Stufen zählenden Treppe, die zur Südstrandpromenade hinabführte und von den Einheimischen liebevoll »Engels-« oder »Himmelsleiter« genannt wurde.
Geschäfte, Restaurants, Hotels und Pensionen reihten sich auf beiden Seiten der Wilhelmstraße aneinander. Die Mecklenburger Backstuben befanden sich in der Villa Theres, einem großen, mondänen Gebäude mit filigran gestalteten hölzernen Balkonverzierungen, grauen Rechteckfenstern und einem ins Auge fallenden Erker mit Rundfenster, unter dem in Großbuchstaben der Name des Hauses zu lesen war. Das Anwesen bildete lange Zeit das Ende der oberen Wilhelmstraße, aber jetzt, da man in Windeseile das neue luxuriöse Hochufer-Appartementhaus hochgezogen hatte, war es als markanter Blickpunkt von diesem abgelöst worden. Das Appartementhaus mit dem Namen »First Sellin« war sozusagen die erste Adresse der Gemeinde, zumindest was die Wilhelmstraße und den unverstellten Blick auf die Seebrücke und das Meer sowie natürlich die zünftigen Preise anging. Bis auf die Ladenzeile im Erdgeschoss und die Außenanlagen war das Gebäude fertiggestellt. Der Baufortschritt lag jedoch hinter einem zwei Meter hohen Bretterzaun verborgen.
Der Mann ging zu der Bretterwand, trat einmal wütend dagegen und schlurfte dann zurück zur Eingangstür der Bäckerei. Obwohl er Gummistiefel anhatte – gelbe hohe Gummistiefel, wie sie auch von den Fischern auf ihren Kuttern getragen wurden –, war er mit seinen über siebzig Jahren noch ziemlich flink unterwegs. Nur einmal stoppte er kurz, schob seine Ernst-Thälmann-Mütze in den Nacken, zog eine Tabakpfeife aus seiner Hosentasche, bückte sich, klopfte damit zweimal kurz auf einen der hohen Bordsteine, die die kahlen Linden in der Mitte des breiten Gehweges einfassten, zündete seine Pfeife an und paffte zufrieden. Dann hob er aufs Neue an und wiederholte seine Worte bei jedem Passanten, der sich dem Laden näherte. Die meisten schauten ihn nur verwundert an, manche schüttelten den Kopf, andere ignorierten ihn gänzlich. Zwei ältere, ausgesprochen elegant gekleidete Damen sahen sich ängstlich um, entschieden sich kurz vor der Eingangstür gegen einen Besuch der Bäckerei und hasteten davon.
»Gesundes neues Jahr, aber nur, wenn ihr von hier verschwindet, ihr aufgetakelten Schabracken«, rief er ihnen auf Plattdeutsch nach, während sie eilig die Straßenseite wechselten. Obgleich die Damen des Niederdeutschen sicherlich nicht mächtig waren, ließen seine Gestik und Mimik keinen Zweifel am Inhalt des Gesagten.
Erneut baute er sich vor dem Eingang zur Bäckerei auf und sprang jedem in den Weg, der an ihm vorbeiwollte. Die Beschimpfungen, die die ahnungslosen Urlauber über sich ergehen lassen mussten, nahmen an Derbheit zu. Irgendwann war man es in der Backstube leid, und ein junger kräftiger Bursche trat auf den Bürgersteig.
»Fiete, bitte treib deinen Schabernack woanders«, sagte er mit ruhiger Stimme. »Mir brummt auch so schon der Schädel. Es ist Neujahr, mach wenigstens heute mal Pause.«
Anne Berber, die in der Backstube angestanden und das Schauspiel durch die Fenster hindurch beobachtet hatte, drückte sich mit einer dicken Brötchentüte in der Hand und einem »Ich mach das schon« an dem jungen Mann vorbei und ging auf Fiete zu. Sanft fasste sie nach dem Arm des Alten und zog ihn auf die Straße, damit die Leute nicht noch mehr von dem Theater mitbekamen.
»Die können zu Hause fressen. Ich will die hier nicht. Die krallen sich die besten Grundstücke, versauen die Preise und zerstören unsere Natur. Guck dir das doch an«, moserte Fiete in stoischer Gelassenheit und deutete auf die Baustelle. »Die kaufen uns auf. Dabei haben die hier nichts zu suchen. Sechstausend Euro für den Quadratmeter, pah. Zeig mir den Selliner, der da einzieht.« Das Rauchgerät in seinem linken Mundwinkel wippte im Takt seiner Worte, und er stieß hin und wieder ein paar Tabakwolken aus. Sein rechtes Augenlid zuckte unaufhörlich. Er rieb mit der Faust darüber, kratzte sich über die ergrauten Bartstoppeln, begutachtete den Dreck unter seinen Fingernägeln und spuckte ungeniert aus.
Annes Blick folgte kurz dem Auswurf. Dann wandte sie sich wieder dem Alten zu. »Onkel Fiete, bitte. Ich verstehe dich ja. Aber was sollen wir denn machen? Wir haben nichts weiter als den Tourismus, und von irgendetwas müssen wir doch leben. Es ist nicht gut, hier so einen Aufstand zu veranstalten, auch wenn du vielleicht recht hast. Onkel Fiete, bitte.«
Anne Berber kannte Fiete seit ihrer Kindheit. Jeder in Sellin und Umgebung kannte den wunderlichen Kauz, der seit ewigen Zeiten in einer Gartenlaube am Wald wohnte, den halben Tag am Meer entlangstreifte, Seeholz sammelte und nichts so sehr zu verabscheuen schien wie Touristen. Anne mochte den alten Mann, aber sie fragte sich, warum niemand seinem Treiben Einhalt gebot. Fietes Verhalten war geschäftsschädigend, wirkte er auf zartbesaitete Gemüter doch mitunter wie ein Gemeingefährlicher, was dem guten Ruf des Seebades wenig zuträglich war.
»Geh nach Hause, bitte«, sagte sie freundlich und streichelte den Unterarm des Alten.
Fiete verzog sein vom Wetter gegerbtes Gesicht und maulte etwas Unverständliches. Dann sagte er: »Es kommt der Tag, da ersäuft dieses ganze fremde Pack in der Ostsee, und dann haben wir unsere Insel endlich wieder für uns. So lange mache ich weiter.« Zur Unterstreichung seiner Worte gab er den im Rinnstein liegenden Resten einer Feuerwerksbatterie einen Tritt und trottete in Richtung Kurverwaltung davon.
Anne zog ihre Strickmütze tief ins Gesicht und machte sich auf den Heimweg nach Baabe. Bei gutem Laufschritt würde sie circa fünfzehn Minuten brauchen. Wenn sie einen Zahn zulegte, etwas weniger. Doch es war keine Eile geboten. Um diese Zeit schlief Martin ohnehin noch. Wann war er eigentlich letzte Nacht nach Hause gekommen? Es musste so gegen vier oder fünf am Morgen gewesen sein. Dabei sollte sein Dienst doch nur bis zwei gehen.
Sie umklammerte die Tüte und spürte die angenehme Wärme der Brötchen. Sie würde Martin nicht wecken. Nein, wenn seine Eltern nachher zum Neujahrsessen kamen, wollte sie keinen unausgeschlafenen Mann am Tisch haben. Der normale Stress mit ihm reichte ihr vollkommen aus.
Zügig lief sie über den Hochuferweg und bog auf Höhe des Hotels Bernstein nach links in den Küstenwald ab. Auf der ersten Lichtung blieb sie einen Moment stehen, atmete tief ein, als könnte sie die klare, kalte Luft in ihren Lungenflügeln konservieren, und schaute über die Ostsee hinweg bis zum Horizont. Freiheit.
***
»Hilgert, machma«, forderte Wennemar Dombrowski mit strengem Blick und schlug mit der Faust auf den Tresen. Die beiden ausgecheckten Urlauber hatten geradezu fluchtartig die »Seevilla« verlassen, nun stand er breitbeinig vor dem Empfangstisch, während sich der Schnee unter seinen Schuhen in eine Wasserlache verwandelte, und schaute Hilgert erwartungsvoll an.
Wennemar Dombrowski war ein kleiner, untersetzter Mann weit jenseits der fünfzig, der seine dünnen schwarzen Haare schon seit seinem zwanzigsten Lebensjahr nur noch als Haarkranz trug. Seither versuchte er, dieses Defizit durch seine gern zur Schau gestellte üppige Brustbehaarung wettzumachen. Mit Vorliebe trug er bis zum unteren Ende des Brustbeines geöffnete Hemden in knalligen Farben, von denen böse Zungen behaupteten, es gebe sie nur in Doppelpacks an Tankstellen zu kaufen. Seine einzige Jeans, eine Pepe, sah aus, als hätte er sie bei der Gründung des Modeunternehmens 1973 gekauft und seitdem nicht mehr ausgezogen. Seine Füße steckten im Winter in Stiefeln und im Sommer in Flip-Flops. Für die wärmeren Jahreszeiten gab es die Jeans auch noch in einer kurz unter den Pobacken abgeschnittenen fransigen Variante, was bei seiner gedrungenen Gestalt überaus unvorteilhaft aussah. Im dichten Gewusel aus schwarzen Brusthaaren, die aus seinem heute lilafarbenen Hemd hervorquollen, ruhte eine lange breite Goldkette, an der ein runder Anhänger mit der Gravur »S04« hing, den auch der leger um seinen Hals geschlungene Schal nicht verdeckte. Dombrowski war ein militanter Schalke-Fan, Exilbochumer, seit fünfundzwanzig Jahren erfolgreicher Betreiber des benachbarten Hotels »Seetang« und ein Schlitzohr.
»Hilgert. Los!«, drängte Dombrowski erneut. »Wir müssen den Kerl da wegschaffen, bevor die Touris ihre Verdauungsrunden am Strand drehen. Neben der Seebrücke sieht den selbst ein Blinder.« Er stampfte so nachdrücklich mit dem linken Fuß auf, dass das mit Sandpartikeln vermischte Tauwasser geräuschvoll zur Seite spritzte und unschöne Flecken an dem teuren Holztresen hinterließ.
Hilgert rümpfte die Nase. Dombrowski war in jeder Hinsicht ein Stoffel. Vor allem in seiner Ausdrucksweise. Musste der so derb herumtönen? Immerhin bestand die Möglichkeit, dass seine Gäste das Gespräch hören konnten. Das war nicht nur peinlich, sondern für einen Gastgeber in höchstem Maße unanständig. Alles andere hielt er für ausgemachten Blödsinn, nichts als Dombrowskis übliche Wichtigtuerei. »Wennemar, kann es sein, dass du gestern zu viel gesuppelt hast?«, fragte er und nahm dabei diskret die drei besetzten Tische in Augenschein, um sich zu versichern, dass es den Herrschaften an nichts fehlte.
Dombrowski schüttelte erregt den runden Kopf. »Leck mich, Hilgert. Neben der Seebrücke liegt ein toter Kerl, und du hilfst mir jetzt, ihn wegzuräumen. Der versaut uns sonst das Geschäft. In meinem Horoskop steht, dass mir das neue Jahr jede Menge Kohle bringt. Vorhin hat sich schon die erste Reisegruppe angemeldet, es scheint an dem Sternengedöns also was dran zu sein.« Er beugte sich vor. »Wenn die Touristenfatzkes allerdings mitkriegen, dass bei uns unter der Seebrücke die Leichen vergammeln, können mir auch die Sterne nicht mehr helfen. Beweg also deinen Arsch.«
Hilgert glaubte dem aufgebrachten Dombrowski kein Wort, stattdessen fragte er sich, wie es sein konnte, dass das Hotel »Seetang« immer gut belegt war und es Gäste gab, die ihn tatsächlich öfter besuchten. Dombrowski investierte mehr Geld in seine mit bearbeiteten Hochglanzfotos bestückte Internetseite und in schicke Werbeprospekte als in das Haus. In den Zimmern des »Seetang« standen Möbel, die Dombrowski vermutlich Anfang der 1990er Jahre aus NVA-Restbeständen der Kaserne Prora übernommen hatte. Immerhin glich dadurch ein Zimmer dem anderen, soweit man das als ein besonderes Alleinstellungsmerkmal für ein Hotel begreifen konnte. Und auch sonst war das »Seetang« in einer Ära hängen geblieben, in der Richard von Weizsäcker Bundespräsident gewesen war und es in ganz Deutschland noch keine fünfstelligen Postleitzahlen gab. Nur einmal war Dombrowski auf der Höhe der Zeit gewesen. Mit der Einführung des Euro im Jahr 2002 hatte er seine Übernachtungspreise verdoppelt. Es war Hilgert ein Rätsel, wieso überhaupt jemand im »Seetang« übernachten wollte. Doch was auch immer den Reiz von Dombrowskis Hotel ausmachte, die Urlauber kamen, sein Geschäftsmodell funktionierte.
»Hilgert, Mensch! Eine Leiche bei uns in Sellin. Das gibt es doch nicht. Der Kerl liegt da einfach so tot am Strand. Wo kommen wir denn da hin?« Dombrowskis Stimme überschlug sich fast.
Sören Hilgert beugte sich über den Tresen, woraufhin ihm Dombrowskis süßlicher Rasierwasserduft unangenehm in die Nase stieg. Er kannte Dombrowskis blöde Scherze zur Genüge. Aber heute war irgendwas anders. Seine Beharrlichkeit verunsicherte ihn. »Eine Leiche, sagst du? Gleich neben der Seebrücke?«, flüsterte er. »Hast du einen Krankenwagen gerufen und die Polizei?«
»Ja, bin ich bekloppt oder was? Der Typ ist so leblos wie meine Alte, wenn ich zu ihr in die Kiste steigen will.« Dombrowski lachte dreckig. Dann wurde er wieder ernst. »Und die Bullen …« Er schaute abschätzig und machte eine wegwerfende Handbewegung. »Wir nehmen dein Auto, laden den Toten ein und bringen ihn raus zum Netto auf den Parkplatz. Da ist heute keine Sau. Mensch, wo der seinen Herzinfarkt hatte, spielt doch sowieso keine Rolle mehr. Hauptsache, nicht an unserem schönen Strand.« Er machte eine kurze Pause. »Und direkt vor meinem Hotel«, fügte er etwas leiser hinzu.
Hilgert zweifelte an Dombrowskis Verstand, aber das war nichts Neues. Er überlegte. Warum kam Dombrowski damit ausgerechnet zu ihm? Wusste sein Nachbar Bescheid? Unsinn. Er sah Gespenster. Dombrowski kam mehrmals täglich zu ihm herüber, auch aus nichtigeren Gründen. Er hatte keine Ahnung, dass Leichen einmal zu Hilgerts täglichem Geschäft gehört hatten. Niemand hier wusste das. Das musste auch so bleiben. Und was den Toten anging: Wenn es tatsächlich einen gab, war das natürlich nichts Schönes. Aber Menschen starben nun mal, auch in einem Seebad. Davon würde der Tourismus schon nicht zusammenbrechen. Wenn es hingegen nur der Restalkohol in Dombrowskis Blutbahn war, der ihm den Blick vernebelte, umso besser.
»Ich komme mit. Aber das mit dem Netto-Parkplatz kannst du vergessen«, entgegnete Hilgert knapp. »Moment.« Er lief in den Frühstücksraum, schenkte hier und da etwas Kaffee nach, plauderte kurz über das Wetter und kehrte mit der Gewissheit, dass es seinen Gästen während seiner Abwesenheit an nichts mangeln würde, zu Dombrowski zurück. Der pfiff einen alten Schlager. Hilgert warf ihm angesichts der impertinenten Störung von Beethovens Klavierkonzerten, die als Hintergrundmusik im gesamten Haus eine Wohlfühlatmosphäre schaffen sollten, einen strafenden Blick zu, nahm seinen Mantel von der Garderobe und verließ mit Dombrowski im Gefolge die »Seevilla«.
Schweigend stiegen sie die Stufen vom Hochufer zur Wilhelmstraße hinab und wandten sich nach links. Dombrowski steuerte auf den Fahrstuhl an der Seebrücke zu. Hilgert übersah das großzügig und folgte dem steilen Weg, der eigentlich nur Anlieferungen, Notfällen und natürlich Fußgängern vorbehalten war, hinunter zum Strand. Dombrowski, der sich ihm rasch wieder anschloss, schnappte schon nach ein paar Metern in Hilgerts Tempo nach Luft.
Schon von Weitem konnte man etwas am Strand liegen sehen, von dem Hilgert inständig hoffte, dass es nur Dombrowskis Restrausch entsprungen war. Doch sein Nachbar sollte recht behalten.
Der Tote lag auf dem Rücken, die Arme weit von sich gestreckt. Die rechte Hand hatte er tief in einen Haufen aus blau-schwarzen Muscheln und kleinen Feuersteinen gekrallt, so als könnte er sich daran festhalten. Lange, dünne Silberfäden umrahmten seinen Kopf wie ein Strahlenkranz eine Heiligenfigur. Mit jeder Welle, die an den Strand brandete, fingen sie an zu tanzen. Sanfte, weiche Bewegungen. Die grauen Haare umspielten sein aschfahles Gesicht im Rhythmus des rauschenden Meeres und verliehen ihm eine gewisse Anmut. Immer wieder gaben die Wellen seinen Kopf und den Oberkörper frei, um beides kurz darauf wieder zu überspülen. War sein Gesicht vollständig vom kalten Wasser der Ostsee bedeckt, glänzten seine offenen Augen wie große eisblaue Kristalle. Zog sich die See zurück, blieb nur der starre, ausdruckslose Blick eines alten toten Mannes, dessen bleiches Antlitz von einer Gänsehaut überzogen war und seltsam aufgequollen und runzelig wirkte. Die teure dunkelblaue Daunenjacke, die er trug, war komplett mit Wasser vollgesogen und ließ ihn fülliger erscheinen, als er eigentlich war. Der Reißverschluss stand oben offen, sodass der Kragen eines weißen Oberhemdes und ein weinroter Pullover mit V-Ausschnitt, dessen Bündchen unter den Ärmeln der Jacke hervorblitzten, zu sehen waren. Auf der braunen Cordhose, bis zu der die Wellen nicht vorgedrungen waren, lag eine dünne Schicht Schnee.
»Na, was sagste jetzt?« Dombrowski stand breitbeinig neben der Leiche und wippte zufrieden in den Knien auf und ab. »Wir hätten doch besser dein Auto mitnehmen sollen.«
Hilgert, der nicht im Traum daran dachte, einen toten Menschen in seinem Auto quer durch Sellin zu chauffieren, um ihn auf dem Netto-Parkplatz abzulegen, schaute betreten auf die Leiche. »Das ist Peter Klart.«
Dombrowski stoppte die Wipperei und reckte den Hals. »Echt? Den habe ich auf die Schnelle gar nicht erkannt.« Er zuckte mit den Schultern. »Na, weißt du, in dem Alter. Da kann man nach einer rauschenden Silvesterfeier schon mal tot irgendwo liegen bleiben. Quasi natürliche Auslese. Kann doch passieren.«
»Du hast vielleicht Nerven.« Hilgert bückte sich zu dem Toten hinunter und schaute ihm eine Weile ins Gesicht. »Siehst du die Platzwunde an der Schläfe? Das Wasser hat das Blut zwar abgespült, aber man erkennt sie noch ganz deutlich. Es hat den Anschein, als sei er gestürzt.« Hilgert richtete sich wieder auf. »Er wird einen Morgenspaziergang gemacht haben – und dann das«, ergänzte er mitleidig, obwohl er intuitiv davon ausging, dass dies nicht stimmte. Das würde er Dombrowski aber nicht auf die Nase binden. »So früh war heute kaum jemand unterwegs, der ihm hätte helfen können.«
»Mein Reden. Was klappert der Alte auch hier am Strand herum? Der war doch bestimmt schon weit über achtzig. Da liegt man brav neben der Mutti in der Pofe und sabbert vor sich hin. Selbst schuld, wenn er den langen Willi macht.«
»Den was bitte?« Hilgert starrte mit zusammengekniffenen Augen auf den alten Mann. Er beugte sich vor, fasste nach seinem Kinn und drückte es leicht nach unten, damit sich der Mund etwas weiter öffnete.
»Igitt, wie bist du denn drauf?«, kreischte Dombrowski angeekelt. »Du fasst den da an? Geht’s noch?«
Hilgert hörte ihn nicht. Er verharrte in der gebeugten Position, ließ seinen Blick mehrmals von der fast schwarzen Mundhöhle des Mannes über dessen leblosen Körper gleiten und prägte sich Lage und Umfeld ein. Die Kleidung des Mannes war teuer und seine ganze Erscheinung gepflegt. Das passte nicht zu den an der Jacke fehlenden Knöpfen, von denen einer dicht neben Klart im Sand steckte. Es musste einen Kampf, eine Rangelei gegeben haben. Klart war unglücklich gefallen, bewusstlos geworden. Und dann …
Hilgert hatte in seinem bisherigen Leben viele Leichen gesehen, zu viele. Mit einem Mal waren sie alle wieder da. Die Frau, die von ihrem Ehemann mit Dutzenden Messerstichen in ihrer neuen, strahlend weißen Eigentumswohnung niedergemetzelt worden war, weil er ihr nicht beichten wollte, dass der Kredit geplatzt war. Das Rentnerehepaar, das sich gegen den Einbruch zweier Albaner gewehrt hatte und das man danach mit eingeschlagenen Köpfen auf dem ausgetretenen Teppich ihres armseligen Heimes fand. Und der junge Türke, der beim Joggen im Charlottenburger Schlosspark durch einen Kopfschuss starb, weil sein Mörder ihn mit seinem Bruder verwechselt hatte. Dutzende Gesichter flogen an ihm vorbei, Bilder von Tatorten, Gerüche und Geräusche. Wie im Zeitraffer sah er sie an sich vorbeiziehen, die unzähligen Abgründe des menschlichen Seins und die immer gleichen Abläufe, mit denen sie die Urheber aufzuspüren versuchten. Die Zeugen, die Verdächtigen, die Täter, penibel auseinandergenommene Biografien und durchleuchtete Psychen. Er spürte, wie sein Jagdinstinkt zurückkehrte, den er vor zwei Jahren mit aller Kraft aus seinem Leben verbannt hatte, ob er es wollte oder nicht. Eigentlich wollte er nicht. Nie mehr. Nirgendwo. Erst recht nicht in seinem geliebten Sellin. Auch nicht, wenn der bedauernswerte alte Mann vor seinen Füßen ermordet worden war. Denn das war er. Daran bestand für ihn kein Zweifel.
Dombrowski verzog das Gesicht. »Bist du pervers oder was?«
Hilgert schloss die Augen, kämpfte mit sich. Es ging ihn nichts an. Die Polizei musste ran. Er gehörte nicht mehr dazu, war draußen, hatte den Dienst quittiert, aus freien Stücken. Niemand hatte ihn darum gebeten. Aber es war besser für ihn gewesen, besser für das gesamte Team. Er war untragbar geworden. Davon konnte Dombrowski nichts wissen. Und er würde es ihm ganz sicher nicht erzählen. Wieso auch? In Dombrowskis Augen war er der überkandidelte, erfolgreiche Hotelmanager aus Berlin, der hier in Sellin seine Kohle angelegt hatte und sich mit einer kleinen Pension die Zeit vertrieb. Das war das Leben, das Hilgert führen wollte, ein anderes gab es nicht mehr.
»Armer Kerl«, murmelte Hilgert, nur damit er überhaupt etwas sagte und Dombrowski nicht misstrauisch wurde. »Kanntest du ihn näher?«
Dombrowski zuckte mit den Schultern. »Wie man’s nimmt. Rügen ist nicht der Pott, man kennt sich halt, wobei …« Er lachte. »Es reicht, wenn man mich kennt.«
Hilgert nickte und griff zum Handy. »Ich rufe die Polizei.«
Er hatte Peter Klart nicht besonders gut gekannt. Zwei oder drei flüchtige Begegnungen bei Veranstaltungen der Gemeinde und einige kurze Aufeinandertreffen beim Bäcker, mehr nicht. Doch Hilgert wusste, dass der Mann, der hier sein Ende gefunden hatte, einer der angesehensten Bürger Sellins gewesen war. Vor einiger Zeit, es musste anlässlich seines fünfundachtzigsten Geburtstages gewesen sein, hatte die »Ostsee-Zeitung« einen Artikel über ihn gebracht. Darin wurde sein Engagement bezüglich der Sanierung des historischen Ortskerns durch Städtebaufördermittel hervorgehoben. Auch sollte er beim Abriss des ehemaligen Internates der alten Förderschule maßgeblich dazu beigetragen haben, dass direkt gegenüber dem Kleinbahnhof das neue, ansehnliche Touristenzentrum entstehen konnte. Hilgert erinnerte sich, dass im Artikel sogar von einer geplanten Ehrenbürgerschaft Klarts die Rede gewesen war. Nur was daraus geworden war, hatte er gerade nicht auf dem Schirm.
»Boah ey, ist der Idiot echt mal eben an Silvester auf die Schnauze gefallen. Konnte er damit nicht bis zur Nebensaison warten?«, moserte Dombrowski, während er ungeduldig neben der Leiche auf und ab lief. »Wo bleiben die Bullen denn, verdammt noch mal?« Prüfend sah er sich nach allen Seiten um, ganz so, als wollte er sichergehen, dass nicht zufällig ein paar Urlauber im Anmarsch waren.
Hilgert schaute hinaus aufs Meer. Eine Woge schlug gegen die dicken blauen Stützpfeiler der Selliner Seebrücke. Die kalte Luft biss auf der Haut. Leichter Schneegriesel setzte ein. Er schlug seinen Mantelkragen nach oben und vergrub sein Kinn dahinter. Neben ihm steckte sich Dombrowski eine Zigarette an.
»Was hast du eigentlich so früh hier gemacht?« Er schaute auf die Uhr. »Es ist erst kurz nach neun.« Dann schob er seine Hände tief in die Taschen. Die Befragung desjenigen, der die Leiche gefunden hatte. Der erste Schritt der Ermittlungsarbeit. Es rauschte in seinen Ohren. Nein. Er sollte das nicht tun. Es ging ihn nichts an.
Über Dombrowskis Gesicht legte sich ein Grinsen. »Hab Möwen beobachtet«, antwortete er mit kehliger Stimme.
Hilgert verzog keine Miene. »Am Neujahrsmorgen, bei dem eisigen Wetter, natürlich«, entgegnete er gelassen.
Dombrowski blies die Wangen auf und ließ die Luft sofort wieder entweichen. Der Atem kondensierte vor seinem Gesicht. »Die Kleine von der Kurverwaltung, du weißt schon. Cindy mit den dicken …« Er sprach nicht weiter, sondern veranschaulichte mit seinen Händen, was er meinte. Dabei zwinkerte er Hilgert zu. »Sie joggt jeden Morgen den Höhenuferweg entlang.«
Hilgert schwieg.
»Und mit dem Fernglas hat man richtig was davon.« Er grunzte, zog ein kleines goldenes Opernglas aus seiner linken Gesäßtasche und hielt es Hilgert stolz unter die Nase. Als sein Nachbar nicht reagierte, fuhr er kleinlaut fort: »Menno, Hilgert. Du weißt genau, dass Claudia mit mir nicht gut ist, seit ich der Biene an Weihnachten die Koffer aufs Zimmer getragen habe.« Das Opernglas wanderte zurück in die Jeans.
»Vielleicht, weil du das für keinen deiner Gäste tun würdest, erst recht nicht in den vierten Stock. Sieht ziemlich blöd aus, wenn du das dann für eine Aushilfskraft machst. Abgesehen davon ist Biene, wie du sie nennst, eine hübsche und vor allem junge Frau.« Hilgert atmete tief. Dass Biene in ihren viel zu knappen Klamotten mehr als billig wirkte und ihr ständig leicht geöffneter Mund ihrem Gesicht nichts Laszives, sondern Dümmliches verlieh, darüber schwieg er lieber. Dombrowski hatte eine Schwäche für diese Art Frauen. Seine Claudia musste einmal so ähnlich ausgesehen haben. Doch die hatte im Gegensatz zu den Weibern, denen Dombrowski heute nachgaffte, was im Kopf.
Dombrowski wackelte unschlüssig mit seinem stämmigen Oberkörper hin und her. »Das Claudia hat da was falsch verstanden.«
»Mhm.«
Ein Martinshorn war zu hören. Es wurde immer lauter. Die beiden Männer schauten in Richtung Wilhelmstraße und warteten. Irgendwann kam ein Auto in Sicht. Im Schritttempo fuhr es den Weg zum Strand hinunter und hielt vor dem letzten Strandzugang. Kurz darauf verstummte die Sirene. Dann passierte eine Weile nichts. Hilgert schloss die Augen, so sehr brannte der Ostwind darin. Als er sie langsam wieder öffnete, sah er, wie eine kleine Frau aus dem Polizeiauto sprang, hektisch ihren Parka zuknöpfte und eine knallrote Wollmütze aufsetzte, deren dicker Bommel sogleich von einer Windböe erfasst wurde und hin und her wackelte. Eiligen Schrittes kam sie auf sie zu.
»Anne Berber«, murmelte Dombrowski erschrocken. »Kripo Stralsund. Was will die denn hier?« Er warf Hilgert einen fragenden Blick zu. »Ich dachte, du hast dem Fritz von der Polizeistation Baabe Bescheid gesagt?«
Bevor Hilgert etwas erwidern konnte, kam ein weiteres Polizeiauto die Zufahrtsstraße heruntergefahren und bremste scharf hinter dem Passat. Fritz hüpfte heraus und gesellte sich zu Anne Berber, die ihn ebenfalls bemerkt und auf ihn gewartet hatte.
»Fritz, na Gott sei Dank«, kommentierte Dombrowski die Ankunft des Polizisten. »Da kann die Alte wieder abtrollen.«
»Woher kennst du sie?«, wollte Hilgert wissen. Anne Berber? Er kannte weder den Namen, noch hatte er die Frau schon mal gesehen.
Dombrowski stöhnte gequält auf. Ganz offenkundig wollte er daran nicht erinnert werden. »2014 hat sich doch so eine Frettchenfresse im ›Seetang‹ selbst um die Ecke gebracht. Mit dem Bettlaken an der Gardinenstange erhängt. Mann, sah das kacke aus. Wenigstens hat das Laken gehalten. Ich hätte nicht gedacht, dass die beim Aldi so gutes Zeug haben. Zur Eröffnung gekauft und hält heute noch, na ja, die paar Mottenlöcher hat die Claudi mit ihren goldenen Händen gut dicht gekriegt.«
»Du hast fünfundzwanzig Jahre alte Hotelbettwäsche mit Mottenlöchern?«, fragte Hilgert ungläubig.
»Hältst du mich für einen Hohlkopp oder was? Ein anständiger Hotelier muss die Investitionskosten niedrig halten, sonst wird das nichts. Ich frage mich wirklich, was sie dir auf deiner hohen Schule beigebracht haben, Herr Hotelmanager.«
Hilgert ließ das unkommentiert. Ob gelernter Hotelier oder nicht, in diesem Beruf standen die Gäste an erster Stelle. Sie mussten sich wohlfühlen. Ein stilvolles Ambiente, gepaart mit ausgezeichnetem Service, darauf kam es an. Wie sonst sollte man dieses Geschäft verstehen?