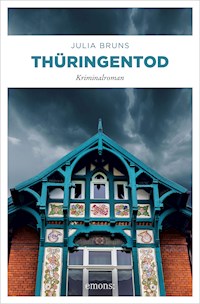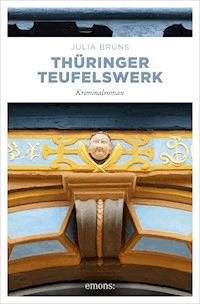10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Küsten Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein dunkles Kapitel ostdeutscher Geschichte – spannend und authentisch erzählt. Auf dem Rügener Hochuferweg finden Wanderer eine tote Frau, das Gesicht von einem Seidenschal verborgen. Kriminalhauptkommissarin Anne Berber und Pensionswirt Sören Hilgert gibt der Fund Rätsel auf – die Identität des Opfers lässt sich zuerst nicht klären, so bleibt auch ein Motiv offen. Was anfänglich nach einem zufälligen Raubdelikt aussieht, offenbart sich nach und nach als tragische Geschichte aus der Zeit der deutsch-deutschen Teilung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Julia Bruns, in einem kleinen Dorf mitten in Thüringen geboren, studierte Politikwissenschaft, Soziologie und Psychologie an der Universität Jena. Nach ihrer Promotion im Fach Politikwissenschaft arbeitete sie viele Jahre als Redenschreiberin und in der Öffentlichkeitsarbeit. Heute schreibt sie als freie Autorin.
www.julia-bruns.com
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2024 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: photocase.de/carlitos
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Marit Obsen
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-896-2
Küsten Krimi
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Agentur Editio Dialog, Dr. Michael Wenzel (www.editio-dialog.com).
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß §44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Prolog
Rostock, Plattenbausiedlung Lütten Klein 1987
Sie stand am offenen Fenster, ihr Blick verlor sich in der Dunkelheit. Der schmale Träger des Negligés, das er ihr geschenkt hatte, war auf der einen Seite bis auf ihren Unterarm hinabgerutscht und hatte ihre wohlgeformte Brust freigelegt. Eigentlich konnte er im Schein der Kerzen nur die Silhouette ihres wunderbar festen Körpers ausmachen, aber immer dann, wenn sie an ihrer Zigarette zog, offenbarte sich ihm noch einmal etwas mehr von dem, was er gerade eben noch so lustvoll in seinen Händen gehalten hatte. Er hoffte, dass sie ihren anderen Arm, mit dem sie den Fenstergriff umfasste, ebenfalls herunternehmen und der zarte Stoff dadurch gänzlich an ihr hinabgleiten würde. Die einzige Bewegung, die sie jedoch machte, war die Beugung ihres Arms, wenn sie die Zigarette in gleichmäßigen, ja fast schon beruhigenden Abständen an ihre Lippen hob. Er konnte nicht sagen, wie lange sie schon dort stand. Lange genug jedenfalls, dass die schneidende Kälte der Winternacht auf seiner nackten Haut zu brennen anfing. Er zog die Bettdecke ein wenig näher und nahm einen Schluck von dem in seinem Glas verbliebenen Cognac, den er vorhin so eilig auf dem Nachtschränkchen abgestellt hatte.
Der Weinbrand gehörte zu den lieb gewordenen Ritualen, die sie mittlerweile miteinander pflegten, ein Ausdruck ihres noch so frischen gemeinsamen Lebens. Ein paar der Flaschen hatte er aus seinem alten Zuhause mitgebracht. Zusammen mit einer kleinen Auswahl seiner Platten erinnerten sie ihn an das Leben, das nun erst einmal hinter ihm lag, und markierten zugleich auch den Beginn von etwas Neuem, Einzigartigem. Den Cognac mit ihr gemeinsam trinken zu können, war für ihn jedes Mal wieder der Beweis, dass er sich richtig entschieden hatte. Sie wusste das und strahlte ihn dabei so wunderbar offen und herzlich an, dass er nicht anders konnte, als seinen ersten Schluck von ihren Lippen zu nehmen. Es war genau diese Unbekümmertheit, die ihn vom ersten Moment an in den Bann gezogen hatte. Ihr befreiendes Lachen und die Leichtigkeit, mit der sie die Welt nahm, als wäre alles nur ein Glücksspiel und sie auf der Seite der Gewinner. Niemals zuvor hatte er eine Frau getroffen, die all seine Sehnsüchte so sehr in sich vereinte. Schon wenige Wochen nach ihrem Kennenlernen hatte er sie gefragt, ob sie ihn heiraten wolle. Ihre Antwort hatte ihn umgehauen. Sie hatte nichts erwidert, aber die Art, wie sie ihn angesehen hatte, genügte, um zu verstehen. Dann hatte sie seine Hose geöffnet und war vor ihm auf die Knie gegangen. Er hatte im Vorfeld nicht einmal darüber nachgedacht, ob der Fahrstuhl eines Luxushotels der angemessene Ort für einen Antrag sein könnte. Er wollte einfach nicht länger warten. Die neunzehn Etagen bis hinauf in seine Suite waren geeignet gewesen, um ihrer Antwort Nachdruck zu verleihen und ihn in seinem Entschluss noch zu bestärken. Mit dem Signalton der sich öffnenden Fahrstuhltür hatte er einen neuen Lebensplan gefasst, von dem ihn nichts auf der Welt mehr abbringen sollte.
»Fährst du morgen nach Lübeck?«, fragte sie leise, während sie ihre Zigarette im Aschenbecher auf der Fensterbank ausdrückte, das Fenster schloss und den Vorhang zuzog.
»So wie wir es besprochen haben«, antwortete er und streckte seinen Arm nach ihr aus. Sie trat auf ihn zu und ließ sich unter seine Decke ziehen, wo sie sich fest an ihn schmiegte. »Es sind nur noch ein paar Formalitäten. Na ja, meine Eltern werde ich wohl auch noch einmal besuchen.«
»Sie werden es irgendwann verstehen«, entgegnete sie zärtlich.
Er atmete tief. »Ganz bestimmt«, sagte er. »Wenn sie dich erst kennengelernt haben, ist alles andere vergessen.«
»Die werden mich nie hier rauslassen«, erwiderte sie tonlos.
»Aber natürlich werden sie das. Immerhin haben sie auch zugestimmt, dass ich zu dir komme.« Er küsste ihre weichen Haare. »Du wirst sehen, in ein paar Monaten bestellen wir unser Aufgebot in Lübeck, und danach flanieren wir durch die Einkaufsstraße und suchen die Möbel für unser Haus aus. Es wird dir gefallen. Aus dem Schlafzimmer sieht man direkt auf die Ostsee.«
»Wenn du dir Mühe gibst, geht das hier auch«, erwiderte sie lachend.
»Nur bin ich vorher auf dem Weg in deine Wohnung kollabiert«, scherzte er. »Ich glaube, ich sollte höchstens einmal in der Woche auf die Straße gehen. Alles andere grenzt an Leistungssport. Oder meinst du, wir sollten den Hausbewohnern einen Fahrstuhl spendieren?«
Sie reagierte nicht.
Er stupste sie an. »Hey, das war ein Scherz. Mir gefällt es hier, aber vor allem gefällst du mir.« Er nahm ihren Kopf zwischen seine Hände und küsste sie leidenschaftlich.
Es hätte niemals enden dürfen.
Doch das tat es.
Die schweren Schritte und das Rascheln der Mäntel holten ihn aus der Umnebelung seiner Gefühle zurück. Die Aura von Grausamkeit, Gehorsam und Fanatismus. Eisige Kälte ging von dem Leder aus und legte sich wie ein schwarzer Schatten über sein Glück. Als er die Augen öffnete, standen sie vor ihm, fünf Männer in dunklen Trenchcoats und mit Hüten, deren Krempen so weit über ihre Gesichter ragten, dass im Schatten dahinter nichts Menschliches mehr darin auszumachen war.
»Maximilian Lanter«, hörte er einen der Männer sagen. »Sie begleiten uns. Sofort.«
Er verstand nicht. Er spürte ihren warmen Atem auf seiner Brust, ihre Haut an seiner, ihre Hand auf seinem Arm. Das alles musste real sein und war es doch irgendwie nicht.
»Ziehen Sie sich an. Na los!«, forderte der Mann mit schneidender Stimme.
»Das muss ein Missverständnis sein«, sagte er. »Wie kommen Sie überhaupt in unsere Wohnung? Wer sind Sie?«
Seine Fragen blieben unbeantwortet. Einer der Männer trat wie beiläufig an das Fenster, an dem sie gerade noch gestanden hatte, schob den Vorhang ein wenig beiseite und schaute hinaus. Dann knipste er das Licht an und ging zurück zu den anderen, woraufhin er ihn mit der gleichen Abschätzigkeit anstarrte.
»Ich bin ein Bürger der Bundesrepublik«, sagte er, doch die Empörung, die er in seine Worte legte, war nicht viel mehr als ein schwacher Schein. Er hatte den Satz, von dem er hoffte, dass er ihn schützen würde, kaum ausgesprochen, da verließ erneut einer der Männer die Gruppe, dieses Mal in Richtung Flur. Als er zurückkehrte, hielt der Kerl etwas in der Hand, das genügte, um jeglichen Glauben an einen Zufall in Maximilian zunichtezumachen. Es waren seine Ausweispapiere nebst Pass, die die Eindringlinge ohne zu fragen und mit einem erschreckenden Selbstverständnis an sich genommen hatten.
Er war klug genug zu wissen, dass es aus dieser Situation momentan kein Entrinnen gab. Die leicht gehobenen Mundwinkel desjenigen, der hier die Befehlsgewalt zu haben schien, verdeutlichten das. Ohne eine weitere Aufforderung des Mannes abzuwarten, küsste er sie noch einmal, erhob sich aus dem Bett und begann sich anzuziehen. Er suchte nach ihrem Blick, aber vergeblich, sie starrte gelähmt vom Schock ins Leere. Am liebsten hätte er sie in den Arm genommen und festgehalten, bis dieses Spektakel vorbei war, aber das ging nicht. Er musste den Männern folgen und kooperieren, anders würde es ihm kaum gelingen, seine Rechte durchzusetzen. Zur Not würde er sich an die Botschaft der Bundesrepublik wenden. Immerhin war er freiwillig hier. Wieso sollte man ihn also einfach verhaften?
Er überlegte fieberhaft, ob er irgendetwas gesagt oder getan hatte, was dem Regime missfallen haben könnte. Es fiel ihm nichts ein. Wie denn auch? Er hatte die Wohnung seit seiner Ankunft vor zwei Wochen kaum verlassen, mit niemandem telefoniert oder auch nur geredet. Nicht auffallen, in der grauen Masse untertauchen, das war seine Strategie gewesen, um langsam in diesem fremden Land zurechtzukommen. Und er wollte doch ohnehin nicht bleiben, jedenfalls nicht bis in alle Ewigkeit. Mit dem Sozialismus hatte er nichts am Hut. Dazu war er viel zu sehr Geschäftsmann. Er wollte bei ihr sein, bis alle Formalitäten für ihr neues, gemeinsames Leben geregelt waren, ihr beim Abschied zur Seite stehen. Sie war die Liebe seines Lebens, und er würde alles daransetzen, sie nicht zu verlieren. Das hatte er offen zugegeben, und niemand schien irgendwelche Einwände gehabt zu haben.
Nein, es konnte sich nur um ein Missverständnis handeln. Er war überzeugt, dass sich die Sache regeln lassen würde. Während er seine Kleidung zusammensuchte, versuchte er, die Fremden zu ignorieren. Er setzte sich über die Furcht hinweg, die er in ihrer Anwesenheit empfand, knöpfte sein Hemd zu und schob es akkurat in seine Anzughose. Dann schaute er sich nach seinem Gürtel um und sah im Augenwinkel, wie sich einer der Schergen, der mittlerweile dicht neben dem Bett stand, anschickte, die Decke anzuheben, um ihren nackten Körper zu betrachten. Die anderen feixten.
Die Wut, die diese Unverfrorenheit bei ihm auslöste, war schlimmer als die Angst. Er sprang auf den Kerl zu, wollte ihm einen Fausthieb verpassen, aber ehe er sichs versah, lag er auf dem Boden und krümmte sich vor Schmerzen. Der Schlag musste seinen Kehlkopf getroffen haben. Die Luft blieb ihm weg, er hustete, röchelte, spuckte Blut. Sie ließen nicht von ihm ab, im Gegenteil. Fußtritt folgte auf Fußtritt, bis er nur noch an sein Ende glaubte. Wie in einem Traum tauchte dabei ihr Gesicht vor ihm auf. Es schwebte auf ihn zu, aber immer wenn er seine Hand danach ausstrecken und es streicheln wollte, verschwand es wieder. Irgendwann glaubte er, ihre Stimme zu hören. Sie schrie, und es klang entsetzlich, aber er konnte ihr nicht beistehen. Er würde ihr nie mehr beistehen können.
EINS
»Sie sah so schön aus.«
»Ja, wie eine Elfe aus dem Märchenwald.«
»Daran hast du gedacht?«
»Du nicht?«
»Hm. Vielleicht.« Pause. »Eine gewisse Ähnlichkeit besteht. Diese zarten Gliedmaßen und das puppenhafte Gesicht.«
»Das konnte man doch gar nicht richtig sehen.« Sie biss sich auf die Unterlippe und streckte dann das Kinn nach vorn, als müsste sie darüber nachdenken. »Na ja, schon irgendwie, mit ein wenig Vorstellungskraft.«
»Nach allem, was wir über den verwunschenen Granitzwald gelesen haben, würde das auch passen, eine Elfe unter dem dichten Blattgrün der Bäume und auf einem Teppich aus Moos.«
»Ja, nicht wahr? Und vergiss nicht den Schwarzen See.« Das Kaffeegeschirr klapperte, als sie die Tasse zurück auf den Unterteller stellte. »Irgendwie unheimlich ist es dort schon. Im Reiseführer stand, dass er mindestens fünfzehn Meter tief sein soll.« Sie nickte angetan. »Wer weiß, was da unten alles ist. Kannst du dir vorstellen –«
»Nein. Kein Bedarf. Unsere Elfe jedenfalls nicht. Die hatte es auf ihrem Moosbett schön weich.«
»Wenigstens das.« Die ältere Dame seufzte. »Aber dort muss es doch kalt sein. Der dichte Wald und das Wasser. Und erst das Moor. Ich persönlich finde so ein Moor ja immer etwas unheimlich … Das steckt voller Geheimnisse. Ganz gewiss.«
Ihre Freundin und Reisebegleiterin schwieg.
»Schrecklich ist das irgendwie dennoch, oder?«
»Die Tatsache an sich, nein. Wer nicht stirbt, hat nicht gelebt. So ist das nun einmal. Das Leben endet für jeden. Den Schrecken reden sich die Menschen nur ein.«
»Aber in der Blüte der Jahre –«
»Elfen sind alterslos«, fuhr ihr die Freundin über den Mund. »Oder, Herr Hilgert? Sagen Sie doch auch einmal etwas dazu.«
»Genau. Wie ist denn Ihre Meinung zu der Angelegenheit?«
Sören Hilgert antwortete nicht. Stattdessen schenkte er den beiden noch einmal von dem Kaffee ein, den er gerade frisch aufgebrüht hatte. Frau Gabriella und Frau Sylvia waren erst seit drei Tagen seine Pensionsgäste, hatten es nun aber schon das zweite Mal so hingedreht, dass er sich nach dem Frühstück zu ihnen gesellte und einen Plausch mit ihnen hielt. Dabei war Hilgert von Natur aus alles andere als gesprächig, und ihm lag erst recht nichts daran, seinen Gästen ein unterschiedliches Maß an Aufmerksamkeit zuteilwerden zu lassen, aber die beiden Berlinerinnen waren so hartnäckig in ihrem Bestreben, sich mit ihm auszutauschen, dass er sich dem schwerlich entziehen konnte. Möglicherweise ging er dabei auch nicht ganz so konsequent vor wie sonst – was daran liegen mochte, dass die beiden aus seiner einstigen Wahlheimat stammten und durchaus die ein oder andere Neuigkeit aus der Hauptstadt mitgebracht hatten. Er konnte es nicht verhehlen, ein Stück dieser faszinierenden Stadt war in seinem Herzen geblieben, auch wenn er Berlin damals so sang- und klanglos den Rücken gekehrt hatte. Von seinen Berliner Gästen erfuhr er vom Bau des höchsten Hochhauses der Stadt auf dem Alexanderplatz oder dem Abschluss der Sanierung der Nationalgalerie. Er erfreute sich an diesen Neuigkeiten, denn sie gaben ihm das Gefühl, noch immer Teil dieses pulsierenden Lebens zu sein.
Heute jedoch wünschte er sich, dass er sich vehementer hinter seinem Küchendienst versteckt hätte. So reizend die beiden älteren Damen auch waren, ihr Temperament, gepaart mit einer schier unerschöpflichen Redseligkeit, überforderte ihn gewaltig. Dabei schien es ihm einfach nicht zu gelingen, die beiden »Fräuleins«, eine Anrede, auf der beide bestanden, sicher zu unterscheiden. Die Ähnlichkeit von Frisuren, Make-up und Kleidung, zweifelsohne in voller Absicht herbeigeführt, ließ ihn immer wieder überlegen, ob er nun gerade die eine oder die andere vor sich hatte, was die beiden nicht nur bemerkten, sondern regelrecht genossen. Davon abgesehen schien sie nun schon eine gefühlte Ewigkeit das Fernsehprogramm des gestrigen Rügen-TV-Abends umzutreiben, zumindest redeten sie seit der Rückkehr von ihrem Morgenspaziergang am Hochuferweg in einem fort von nichts anderem.
Hilgert, der sich noch niemals etwas aus dieser Art der Unterhaltung gemacht hatte, da ihm das reale Leben weitaus spannender erschien, fand nichts Erquickliches an diesem Gespräch. Und so hörte er nur halbherzig zu, während seine Gedanken abschweiften, was ihn fast schon automatisch auf das seit einigen Wochen bestehende Problem mit den kaputten Fenstern im Dachboden brachte. Der letzte Frühjahrssturm hatte mächtig gewütet und das über hundert Jahre alte Haus ausgerechnet dort getroffen, wo er sich eine Pause bei den umfangreichen Sanierungsmaßnahmen des historischen Gebäudes verordnet hatte. Jetzt, mitten in der Hochsaison, konnte er unmöglich die Handwerker hierhaben, aber so langsam sollte er zumindest mit den Planungen dafür beginnen, was wiederum einen Kassensturz voraussetzte. Genau an dieser Stelle wurde es brisant. Hilgerts »Seevilla« lief zwar seit einiger Zeit ganz passabel, aber die Anzahl der Zimmer war einfach zu gering, um die horrenden Kosten für die Sanierung zu erwirtschaften, geschweige denn seinen Lebensunterhalt auskömmlich zu finanzieren. Damit er halbwegs gut über die Runden kam, brauchte es aufs Jahr gerechnet eine Auslastung von über achtzig Prozent. Da war er aber noch lange nicht. Er hatte sich das ganze Unterfangen wohl etwas zu einfach vorgestellt.
Die wiederkehrende Erkenntnis, wegen der Dachfenster dringend etwas unternehmen zu müssen, ließ ihn tief ausatmen.
»Oh nein, Herr Hilgert!«, rief eine der Damen aus. »Das wollten wir nicht. Bitte entschuldigen Sie.«
»Ach, siehst du, da haben wir schon mal einen so reizenden Tischgast, und dann verschrecken wir ihn mit dieser Gruselgeschichte«, erklärte die Freundin vorwurfsvoll. »Nicht wahr, Herr Hilgert?« Sie schaute ihn fragend an. »Das Leben in Ihrem wunderbaren Paradies hier ist so friedlich, dass Sie Ihr Glück nicht von unserem düsteren Geschwätz trüben lassen wollen. Das ist absolut verständlich.« Sie wandte sich wieder ihrer Freundin zu. »Ich habe es dir gesagt, der Herr Hilgert ist ein Schöngeist, ein feinsinniger, sensibler Mann. Meine Menschenkenntnis trügt mich nie. Wir überfordern ihn mit unserer Entdeckung.« Sie schaute sich demonstrativ nach allen Seiten um und wechselte abrupt das Thema. »Sie haben es aber auch so hübsch hier. Das muss man einfach sagen. Und die Farbe des Salons. Die hat doch bestimmt Ihre Frau ausgesucht. Wie war noch gleich ihr Name?«
»Also wirklich, wie kannst du nur so indiskret sein? Unser liebenswürdiger Gastgeber möchte sicher den passenden Moment abwarten, um uns seine Frau vorzustellen. Nicht wahr, Herr Hilgert?« Die Freundin sandte ein keckes Augenzwinkern in Richtung Hilgert. »Um deine Geduld war es noch nie sonderlich gut bestellt. Und um deine Fähigkeiten zum Small Talk, wie man heutzutage sagt, übrigens auch nicht. Sie sind mau.« Ihr Gesichtsausdruck veränderte sich nun hin zu einer strengen, an Lebenserfahrung reichen Frau, als die sie normalerweise sicherlich nicht gelten wollte. »Aber um auf das ursprüngliche Thema zurückzukommen: Es nützt nichts. Im Leben liegen Licht und Schatten nun einmal ganz eng beieinander, auch auf so einem gottgegebenen Fleckchen Erde wie der Insel Rügen. Herr Hilgert ist kein grüner Junge mehr, dass er das nicht wüsste.«
Hilgert war nicht verheiratet, noch nie gewesen. Nicht einmal zu einer Liebelei hatte er es hier auf der Insel gebracht, was wohl der Grund dafür war, dass die farbliche Gestaltung seiner Pension allein auf ihn zurückging, so wie alles andere auch. Dem erwartungsvollen Blick der beiden Damen konnte er allerdings nur mit Ratlosigkeit begegnen. Ehrlich gesagt waren das für ihn so früh am Tag viel zu viele Worte auf einmal. Er wusste nicht, ob er den beiden folgen konnte. Das wiederum schien man ihm anzusehen.
»Die tote Frau im Granitzwald«, sagte eine der Damen mit so viel Nachdruck in ihrer Stimme, dass man meinen konnte, sie wiederholte sich nun schon zum dutzendsten Male.
»Gerade eben, auf unserer Morgenwanderung«, ergänzte die andere. »Wir waren uns unschlüssig, wie wir damit verfahren sollten, zumal wir Sie nicht unnötig warten lassen wollten. Sie geben sich doch immer so ungemein viel Mühe mit dem Frühstück.«
Ihre Freundin bedachte sie mit einem maßregelnden Seitenblick. »Wir wollten das Frühstück unter keinen Umständen versäumen«, berichtigte sie. »So war es doch, Gabriella, oder nicht?«
Gabriella deutete ein Naserümpfen an. »Immerhin ist die Frau tot und merkt es nicht. Wem nützt es also, wenn unsere Eier Benedict kalt werden?«
Die letzten Sätze, absolut arglos von sich gegeben, brachten den Damen Hilgerts ungeteilte Aufmerksamkeit zurück.
»Ich glaube, ich habe Sie eben nicht richtig verstanden«, sagte er höflich.
»Sie haben nicht zugehört«, präzisierte eine der Damen.
»Jetzt bitte ich dich aber.« Die andere kicherte halb entrüstet, halb belustigt. »Das kann man den Leuten doch nicht so auf den Kopf zusagen.«
»Ich bin über achtzig Jahre alt. Ich kann das«, widersprach die Freundin. »Wollen Sie nun etwas über die Leiche wissen oder nicht?« Ihr herausfordernder Blick traf Hilgert.
»Die Leiche, die Sie vorhin bei Ihrem Morgenspaziergang in der Granitz gefunden haben?«, fragte Hilgert unsicher nach. Er war sich nicht klar darüber, ob bei den beiden nur etwas zu viel Phantasie am Werk war, die sich mit Wichtigtuerei vermischte. Womöglich wollten sie ihn auch bloß foppen, etwas, das er generell nicht ausstehen konnte, und schon gar nicht, wenn es um ein solches Thema ging. In seinem früheren Leben als Kriminalhauptkommissar beim LKA in Berlin hatte er so viele traurige und deprimierende Facetten des Todes gesehen, dass er niemals auf die Idee käme, auch nur ansatzweise darüber zu scherzen. »Im Moor?«
Die Entrüstung, die seinen beiden Gästen nun ins Gesicht geschrieben stand, war unübersehbar.
»Ich werde über diese Frage nicht beleidigt sein, Herr Hilgert.« Sie fasste ihrer Freundin an den Unterarm. »Gabriella auch nicht.« Ihre gerümpfte Nase zeigte deutlich, dass dies nicht den Tatsachen entsprach. »Im Moor findet man Moorleichen, wie der Name schon sagt. Da wir niemals auf die Idee kommen würden, ein Moor, also ein Naturschutzgebiet, zu betreten, auch weil es trotz der langen Trockenperioden gefährlich, in jedem Fall aber frevelhaft sein könnte, können wir die Frau kaum dort gefunden haben. Noch dazu weiß jedes Kind, wie wenig elfengleich Moorleichen aussehen, und eins können Sie mir glauben: Auch wenn das Gesicht der armen Person da oben nicht richtig zu sehen war, bin ich noch gut in der Lage zu erkennen, ob jemand braune oder sogar schwarze Lederhaut hat oder taufrisch aussieht.«
Gabriella nickte an den passenden Stellen. »So frisch wie eine Elfe.«
Hilgert schaute die beiden nur schweigend an. Wenn stimmte, was sie gesehen haben wollten …
»Guten Morgen.« Der nachdrücklich vorgebrachte Gruß und das nicht minder energische Klopfen gegen den Türrahmen des Frühstückssalons waren eins.
»Ach, da ist er ja, der charmante Polizist von vorhin«, juchzte eine von Hilgerts Tischgenossinnen, während sie aufsprang und sichtlich angetan, jedoch ohne sich von der Stelle zu bewegen, aufgeregt hin und her tänzelte. »Sie haben uns also gefunden.« Sie bedeutete dem Neuankömmling mit der ausgestreckten Hand, dass er neben ihnen Platz nehmen sollte. »Wie erfreulich, dass auf die Polizei noch Verlass ist. Herr Hilgert, hätten wir noch einen Kaffee für den fleißigen Beamten?«, sagte sie dann, und es klang nicht ansatzweise nach einer Frage.
Hilgert hatte den freundlich lächelnden großen Mann mit dem auffallenden rotblonden Lockenkopf noch nie zuvor gesehen. Er stand auf und ging zwei Schritte auf ihn zu. »Sören Hilgert. Wie kann ich Ihnen helfen?«
Die Nennung seines Namens löste im Gesicht des Fremden etwas aus, das Hilgert nicht deuten konnte. Er war sich absolut sicher, dass er den Mann nicht kannte, aber andersherum schien das Gegenteil der Fall zu sein. Die entspannte Miene des Beamten war einem forschenden, zweifelsohne auch kritisch musternden Ausdruck gewichen. Der änderte sich auch nicht, als er Hilgert ausgiebig betrachtet hatte und nun ungeniert die Räumlichkeiten in Augenschein nahm.
Hilgert wiederum blieb gelassen. Wenn man für jemand anderen so interessant war, war es am besten, man ließ die Person gewähren. Jede Intervention würde diesen Drang nur noch verstärken. Manche Menschen bemerkten nicht einmal, wie peinlich die Situationen waren, die ihre Neugier hervorriefen.
»Sie trinken doch einen Kaffee mit uns, junger Mann?«, insistierte eine der Damen in die seltsame Stille hinein.
Die Frage ließ den Besucher endlich reagieren. »Aber natürlich, wenn ich darf«, entgegnete er an die Frauen gewandt, um im nächsten Augenblick wieder Hilgert zu fixieren. »Knut Reed, Polizeihauptrevier Bergen. Ich würde gern mit Ihren Gästen unter vier Augen sprechen.«
Offenbar verschwendete Herr Reed keine großartigen Mühen darauf, seinem dringenden Bedürfnis, Hilgert loszuwerden, eine gewisse Höflichkeit voranzustellen. Hilgert deutete ein Nicken an, griff sich mit geschmeidigen Bewegungen die leere Kaffeekanne und verließ den Salon.
Die tote Frau im Granitzwald existierte also tatsächlich. Dass Anne Berber jedoch einem Kollegen den Fall überließ, der noch dazu so unverhohlen neugierig daherkam, konnte er sich beim besten Willen nicht vorstellen. Anne würde niemals freiwillig eine Mordermittlung aus der Hand geben, nicht einmal eine einzige damit im Zusammenhang stehende Befragung würde sie delegieren. Irgendetwas musste ihr dazwischengekommen sein. Aber was konnte das bei einer Frau, deren ganzes Leben sich nur um ihre Arbeit drehte und die alles und jeden dafür stehen ließ, schon sein? Seit sie bei ihm in der Pension wohnte, war das noch nie vorgekommen. Sie brach fast jeden Morgen weit vor den Frühstückszeiten auf. Heute hatte er das unverwechselbare Zufallen der Haustür allerdings erst zu einer annehmbaren Zeit gehört, und trotzdem hatte sie zuvor nicht einmal den Kopf zu ihm in die Küche gesteckt. Womöglich hatte sie sich nicht gut gefühlt. Aber dann hätte sie doch nur etwas zu sagen brauchen. Er hätte ihr das Frühstück auch auf das Zimmer gebracht oder wenigstens eine Tasse Tee.
Das geht zu weit, maßregelte er sich. Er schätzte Anne, aber das waren Gedanken, die ihm nicht zustanden. Es ging ihn schlichtweg nichts an. Man würde sehen, was der Tag brachte. Auf eine Leiche in seinem geliebten Sellin hätte er jedenfalls gern verzichtet.
***
Der Schal war aus einem zarten seidigen Stoff, und seine Farbe ging von einem dunklen Rot an einem Ende sanft in ein strahlendes Weiß am anderen über. Zu Anne Berbers Missfallen hatte sich der Schal bei ihrer Ankunft am Fundort der Leiche schon nicht mehr an seinem ursprünglichen Platz befunden. Ihr Kollege Knut Reed war vor ihr hier gewesen, und so, wie sie ihn einschätzte, empfand er nicht nur wegen des Vorsprungs, sondern auch wegen der manipulierten Fundsituation eine innere Freude. Verärgert über ihr Zuspätkommen, das keineswegs ihre, sondern die Schuld von Martin Kaminski, ihrem Ex, gewesen war, betrachtete sie abwechselnd die Beweismitteltüte mit dem darin befindlichen Schal, die Leiche und das Foto von der Auffindesituation, das Reed ihr endlich auf ihr Mobiltelefon geschickt hatte. Das Kleidungsstück hatte das Gesicht der toten Frau vollständig verdeckt. Dass sie es selbst so drapiert haben könnte, stand außer Frage. Sofern es kein Windstoß gewesen war, musste es jemand anders getan haben. Zwar war an der Ostsee auch im Hochsommer die ein oder andere Böe nicht ungewöhnlich, aber dass sich ausgerechnet ins Dickicht des Waldes ein Windstoß verirrt hatte, daran wollte Anne nicht so recht glauben. Noch dazu brachte keine Luftbewegung es fertig, ein Stück Stoff ordentlich Naht auf Naht zu legen. Und wieso sollte die Frau sich bei dieser Hitze überhaupt einen Schal umwerfen? Zumal einen recht schicken, der ganz und gar nicht zu dem sportlichen zitronengelben Sommerkleid passte, das sie am Körper trug.
»Hauptkommissarin Berber?« Fritz Friesen, der Kollege aus der Polizeistation Baabe, der auch für Sellin zuständig war, war unbemerkt neben ihr aufgetaucht und hüllte sie in eine beißende Wolke seines Rasierwassers ein. »Ich bin ein wenig spät dran, aber nicht mal ein Polizeiwagen kann über einen Stau auf der B196 hinwegfliegen.« Er griente über den aus seiner Sicht flotten Spruch.
Anne, die aufdringlichen Parfümgeruch verabscheute, vor allem, wenn er einen um den herrlichen Duft der Natur brachte, drehte den Kopf leicht zur Seite, um aus seinem Dunstkreis zu geraten, und schaute Friesen halb aus den Augenwinkeln an. »Viel Verkehr«, murmelte sie unbeeindruckt. »Wie immer.« Sie fragte nicht einmal mehr, wieso er überhaupt hier war. Friesen nutzte jede noch so kleine Gelegenheit, um ihr zu begegnen. Ob ihm wohl irgendwann die Unsinnigkeit dieses Unterfanges aufgehen würde?
Friesen, der sie einen Tick zu lange anblickte, nahm die lapidare Antwort eindeutig persönlich. Er senkte kurz den Kopf und räusperte sich hinter vorgehaltener Hand. »Ich würde da vorn gern zusätzlich die Weggabelung zum See absperren, wenn Sie einverstanden sind. Es muss ja niemand so nah herankommen.« Dabei wäre ihm die dicke Rolle des rot-weiß gestreiften Absperrbandes um ein Haar aus der Hand gerutscht. »Es kann nicht mehr lange dauern, bis die ersten Wanderer auftauchen. Ab elf Uhr werden in den Hotels die Frühstücksbüfetts abgeräumt, dann geht es raus ins Gelände.« Er unterstrich seine Worte mit einem unbeholfenen Grinsen, doch wieder gelang es ihm nicht, Anne zu beeindrucken. Dafür war sie viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt.
Sollte es wirklich schon so spät sein, dachte sie und sah auf ihr Handy. Tatsächlich. Kaminski hatte sie durch sein Nichterscheinen fast um den ganzen Vormittag gebracht, für nichts und wieder nichts. Wahrscheinlich war er wieder einmal nicht aus dem Bett gekommen, nur dass die Rechnung, die ihr Anwalt nach dem Termin stellte, auf die unverschuldete Wartezeit keine Rücksicht nehmen würde.
»Es gibt noch einen zweiten Weg hierher«, antwortete Anne, ohne Friesen anzusehen. »Bitte vergessen Sie den nicht. Ich weiß nicht, ob die Kollegen daran gedacht haben.«
Friesen tippte sich zur Bestätigung mit dem Zeigefinger an seine Uniformmütze. Sein Blick streifte die zu ihren Füßen liegende Frau. »Sie war sehr hübsch, also für ihr Alter«, sagte er. »Hoffen wir mal, dass Sie nicht …« Er stockte. »Na ja, wir haben Hochsaison, und wenn es die Runde macht, dass hier ein Triebtäter durch die Granitz marschiert, dann drehen uns die Feriengäste durch.«
Anne richtete ihren Blick nun ebenfalls wieder auf den Leichnam am Boden. Die Frau war ungefähr Mitte fünfzig, hatte eine schlanke Figur und war nicht besonders groß. Ihre Haut wirkte makellos und hatte etwas von der Feinheit edlen Porzellans. Ihr blasser Teint, der durch das dunkelgrüne Moos, auf dem sie lag, noch mehr zur Geltung kam, war fast schon unnatürlich hell und schien es auch gewesen zu sein, als sie noch gelebt hatte. Im Kontrast dazu stand ihr schwarzes, glattes Haar, das ihr hübsches Gesicht umrahmte und bis hinunter auf die Schultern reichte. »Schneewittchen«, entfuhr es Anne bei ihrem Anblick leise.
»Aber genau«, rief Friesen, der immer noch neben Anne verharrte. »Dass ich das nicht selbst gesehen habe. Das Schneewittchen vom Schwarzen See. Meine Güte, gäbe das eine Schlagzeile.« Er bemerkte Annes kritischen Blick und zog rasch von dannen.
Anne hockte sich neben die Frau. »Nur dass dieses Schneewittchen nicht an einem Apfelstück erstickt ist«, flüsterte sie. »Es sei denn, die Zwerge wollten es ihr mit einem Messer aus dem Hals schneiden.« Die tiefe Wunde an ihrer Kehle sah zumindest verdammt danach aus. Zum Vergleich betrachtete sie noch einmal das Bild auf ihrem Telefon. Unter dem Schal war von dieser Wunde nichts zu sehen. Hatte er deswegen dort gelegen, um die Wunde zu kaschieren? Das Bild, das sich dem Betrachter bot, wirkte dadurch jedenfalls deutlich friedfertiger und, soweit das möglich war, sogar irgendwie schön. Auch die große Menge Blut, die in den Waldboden gesickert war, fiel so erst beim genauen Hinsehen auf. Das Moos schien den größten Teil davon aufgesogen zu haben, sein sattes Grün und das diffuse Licht des dichten Waldes taten ebenfalls ihren Teil. Konnte dieses Arrangement ein Zufall sein? Anne bezweifelte es.
Sie erhob sich und umrundete in einigem Abstand vorsichtig den Leichnam. Wenn der Täter sein Opfer hier überfallen hatte, musste es Spuren im Moos geben. Die Blättchen dieser Pflanze waren zart genug, um allein durch die Abdrücke von ein paar Schuhen beschädigt werden zu können. Zu ihrem Erstaunen sah man nichts, keine herausgerissenen Wurzeln, abgeknickten Halme oder unnatürlich platt gedrückten Flächen. Die nähere Umgebung machte einen gänzlich unberührten Eindruck, so als wäre die Frau vom Himmel herab auf dieses Bett aus Moos geschwebt, um wenig später als eines der am schönsten aufgebahrten Mordopfer der Kriminalgeschichte aufgefunden zu werden.
»Wenn es nur so einfach wäre.« Anne streckte ihren Rücken durch und betrachtete den keine drei Meter entfernt liegenden Schwarzen See. Es musste viele Jahre her sein, dass sie zum letzten Mal hier gewesen war. Sie konnte diesem Ort nichts abgewinnen. Das tiefschwarze Gewässer, in dem es kein Leben zu geben schien, hatte für sie schon immer etwas Unheimliches, Verwunschenes gehabt. Das mochte daran liegen, dass ihr Vater bei seinen geliebten Pilzwanderungen gern allerlei Humbug über diesen See zum Besten gegeben hatte, angefangen bei einem unglücklichen Prinzen, der für alle Zeit hier festgehalten wurde, bis hin zum Schwarzen See als Zufluchtsort des Teufels. Und kleine Mädchen glaubten mitunter den Spukgeschichten ihrer Väter, was sich noch Jahrzehnte danach als prägend erweisen konnte. Anne dachte daran, dass sie ihre Eltern seit über zwei Wochen nicht gesehen hatte, schob das schlechte Gewissen beiseite und widmete sich wieder der unbekannten Frau.
»Haben die Kollegen Papiere, Geld oder sonst etwas sichergestellt?«, rief sie Friesen zu, der sich in einiger Entfernung zur Abwehr etwaiger Neugieriger am Flatterband postiert hatte. Knut Reed hatte ihr vorhin lediglich von den beiden älteren Damen berichtet, die die Tote auf ihrem Morgenspaziergang gefunden und die Polizei alarmiert hatten. Dazu hatte er ihr wie nebenbei die Tüte mit dem Schal in die Hand gedrückt. Mehr nicht. Anne musste zugeben, dass sie so perplex gewesen war, ihren unliebsamen Kollegen hier anzutreffen, dass sie ihn nichts weiter gefragt hatte. Sie wollte ihn nur schleunigst loswerden. Das hatte auch funktioniert, allerdings nicht ganz in ihrem Sinn, denn nachdem Reed sich angeboten hatte, die Befragung der beiden Zeuginnen zu übernehmen, konnte sie ihn kaum zurück auf die Bergener Polizeistation schicken, zumindest nicht ohne guten Grund. Und den hatte sie nicht, denn die Insel schien momentan der rechtschaffenste Ort des Landes zu sein, und es gab keine anderen drängenden Aufgaben zu bearbeiten. Zähneknirschend hatte sie Reeds Vorschlag zugestimmt. Der Kollege war in ihren Augen ein unangenehmer Schleimer, der sich mittels seiner vermeintlich herzlichen und überaus kollegialen Art das Vertrauen seiner Mitmenschen erschlich, die er dann in Kenntnis ihrer Schwächen für seine Interessen über die Klinge springen ließ.
Aber es steckte noch mehr hinter ihrer Ablehnung. Anne hielt nichts davon, sich einen Tatort mit einem Kollegen zu teilen. Sie war schon im normalen Leben nicht der Mensch, der sich leicht auf andere einließ, und im Dienst war diese Eigenschaft noch viel ausgeprägter. Erik, ihr alter Teampartner und Freund, mit dem sie viele Jahre bei der Kripo Stralsund erfolgreich zusammengearbeitet hatte, war die Ausnahme. Er hatte irgendwann mit ihr umzugehen gelernt, und am Ende verband sie sogar eine enge Freundschaft. Mit Knut Reed würde es allerdings niemals dazu kommen. Das hatte für sie vom ersten Tag an festgestanden.
»Was ist mit den Papieren?«, rief Anne noch einmal, als Friesen nicht reagierte. Er schaute sie mit großen Augen an und hob ratlos die Schultern. Dann lief er eilig zu einem auf dem Hauptweg postierten Kollegen.
»Nichts gefunden«, rief er wenig später zurück, während Anne mit ihren Gedanken schon wieder bei der toten Frau war.
»Wem bist du hier begegnet?«, fragte sie sich leise und schob die Haare der Toten ein wenig zur Seite, um die Halsverletzung genauer begutachten zu können. Dabei bemerkte sie, dass die Frau einen kleinen Kopfhörer trug. Auch das Gegenstück auf der anderen Seite war vorhanden, steckte jedoch nicht mehr in ihrem Ohr. Vorsichtig nahm Anne es auf und lauschte daran. Nichts war zu hören. Da sie aber nun mal damit unterwegs gewesen war, musste es auch irgendwo ein Mobiltelefon oder einen iPod geben.
Während Anne ihren Blick auf der Suche nach einem solchen Gerät wiederholt über die Frau und deren nähere Umgebung gleiten ließ, fielen ihr die Sneakers an den Füßen der Frau auf. An den Sohlen klebte eine dünne Schicht Waldboden inklusive Tannennadeln. »Du warst auf einem Spaziergang«, dachte sie laut. Vorsorglich schaute sie sich noch einmal um. Weit und breit war kein Auto zu sehen, nicht einmal ein Fahrrad. Nein, das passte. Die Frau musste zu Fuß unterwegs gewesen sein. Allerdings dürfte das schon einige Zeit her sein, denn der Boden war bei den derzeitigen Temperaturen selbst mitten im Wald nur am frühen Morgen feucht genug, um an den Schuhen haften zu bleiben. Anne überlegte. Zwischen Sellin und dem Schwarzen See lagen etwa zweieinhalb Kilometer, die man über einen gut ausgeschilderten Waldweg gehen konnte. Die Strecke war bei den Einheimischen wie auch den Touristen gleichermaßen beliebt. Ungestört war man auf der Route sicherlich selten, vor allem nicht in der Hauptsaison, es sei denn, man begab sich am späten Abend oder bei Sonnenaufgang hierher.
»Moin, Anne!«, grüßte Ninje Janßen, die hiesige Allgemeinmedizinerin. Anne hatte sie gar nicht kommen hören.
»Ninje?« Anne schaute überrascht in das runde, sommersprossige Gesicht, das sogar jetzt die typische gutmütige Lebensfreude ausstrahlte, die sie von der Frau ihres Onkels gewohnt war. Solange Anne die Ärztin kannte, und das musste wohl fast ihr gesamtes Leben sein, hatte sie nie anders dreingeblickt.
»Ich störe dich. Das sehe ich«, gab Ninje fast schon entschuldigend zurück.
Anne schüttelte den Kopf. »Ich bin froh, dass du da bist.«
Ninje quittierte das mit einem zaghaften Lächeln. »Du hast gerade so ausgesehen, als würdest du dich mit der Frau unterhalten«, bemerkte sie und wirkte dabei nicht im Geringsten irritiert. Sie stellte ihre Tasche ab und zog sich Gummihandschuhe über.
»Kann man so sagen. Ich verstehe nur leider nicht alles, was sie mir erzählen will. Noch nicht«, entgegnete Anne nachdenklich, den Blick wieder konsequent auf die Tote gerichtet. »Kennst du sie?«
»Glücklicherweise nein«, antwortete Ninje und schickte sich an, mit der Begutachtung zu beginnen. »Selbst meine Patienten müssen irgendwann sterben, aber auf diese Art …« Sie strich der Frau sanft über das Gesicht. »Noch ein Verlust, den wir bedauern können. Wenigstens sieht sie würdevoll aus, wie sie hier so liegt, und ein schöner Platz ist es auch. Denkst du, sie hat sich selbst …?« Als Ninje Janßen bemerkte, dass Anne nicht reagierte, schwieg sie und machte sich an ihre Arbeit.
Anne war sich sicher, dass dies kein Selbstmord war. Sie wusste zwar, dass die Stelle und der Verlauf des Halsschnittes allein keine Schlussfolgerung auf eine Fremd- oder Selbstbeibringung zuließen, aber der auf dem Gesicht abgelegte Schal erschien ihr suspekt. Noch dazu hatten sie bislang kein Messer oder Ähnliches gefunden, was bei einem Selbstmord zweifelsohne ganz in der Nähe liegen müsste. Würdevoll, dachte Anne, ist nicht die schlechteste Beschreibung. Was veranlasste einen Mörder dazu, sein Opfer zu erheben? Mord geschah aus den niedersten menschlichen Beweggründen und war ein wie auch immer gearteter Akt der Gewalt. Darin lag nichts, was auch nur ansatzweise von Respekt oder Ehrwürdigkeit geprägt war. Wieso also schnitt man einem Menschen die Kehle durch, bedeckte die Blöße mit einem Stück Stoff und bettete den Leichnam fast schon romantisiert auf weichem Moos zur Ruhe? »Weil man ein krankhaftes Faible für Märchen hat. Weil man einem Fetisch folgt. Weil man die Grausamkeit der Tat verbergen will. Weil …«, hauchte sie.
»Sagtest du etwas, Anne?« Ninje Janßen hob den Kopf und schaute sie fragend an.
Anne reagierte nicht, sondern ließ ihren Blick über die Tote schweifen. »Es gibt keine anderen Verletzungen«, konstatierte sie.
»Nichts Äußerliches. Nein«, bestätigte Ninje. »Sie scheint sich nicht gewehrt zu haben. Keine Kratzer, keine blauen Flecke, nichts, was darauf hindeuten könnte. Siehst du den Verlauf des Schnittes?« Sie fuhr mit ihrem Finger dicht über der Halswunde hin und her. »Er ist ganz gerade, und es gibt keine ungleichmäßigen Wundränder.«
»Du meinst, er hat das Messer angesetzt und …«
»Glatt durchgezogen, genau«, vervollständigte Ninje ihren Satz.
»War sie betäubt?«
»Keine Ahnung. Jedenfalls scheint sie sich nicht bewegt zu haben«, erwiderte Ninje. »Womöglich hat sie geschlafen.«
»Oder laut Musik gehört.« Anne wies auf die Kopfhörer und schaute sich um, als könnte ihr der Schwarze See die Antwort darauf geben, wieso sich die Frau an seinem Ufer aufgehalten hatte. »Der Täter muss sie überrascht haben.«
»Ob es so war, kann ich nicht sagen. Aber wenn sie sich bewegt hätte, würde die Verletzung anders aussehen«, fuhr Ninje fort. »Das Messer wurde präzise geführt. Die großen Blutgefäße sind geöffnet, und auch die Luftröhre ist verletzt. Sie hat nicht viel gespürt. Der Rechtsmediziner wird dir noch mehr dazu sagen können. Glücklicherweise ist das nicht mein Geschäft.« Sie betrachtete die Frau mitleidsvoll und fuhr dann mit ihrem Tun fort.
»Für so einen Schnitt braucht es doch sicher nicht nur einiges an Chuzpe, sondern auch Kraft«, mutmaßte Anne.
»Ich würde sagen, vor allem Schnelligkeit und Zielsicherheit. Hast du das schon gesehen?«, fragte Ninje und hielt ihr eine blutverschmierte Halskette entgegen.
Anne nahm eine Beweismitteltüte und griff damit vorsichtig danach. Die Kette war höchstens vierzig Zentimeter lang und auffallend feingliedrig. Ein Anhänger in Form des Buchstabens S hing daran, er hatte in etwa die Größe des Nagels von Annes kleinem Finger.
»Sieht ein wenig aus wie der Schmuck einer Puppe«, kommentierte Ninje. »Aber sie war ja selbst so zierlich. Da passt das schon.«
»Hm.« Anne strich mit dem Finger über den Buchstaben. Ohne Ninje anzusehen, sagte sie: »Wie lange ist sie schon tot?«
»So weit bin ich noch nicht. Schau mal hier!« Ninje fasste in den Büstenhalter des Opfers und förderte einen Haustürschlüssel, ein unbenutztes Zellstofftaschentuch und einen blauen iPod nano zutage. Über ihre Mundwinkel legte sich ein sanftes Lächeln. »Da verstaue ich meine Sachen auch immer, wenn ich in den Wald gehe und keine Tasche dabeihabe. Manchmal stopfe ich sogar noch meine Kaugummis mit hinein. Und einen Zehn-Euro-Schein für alle Fälle. Aber bei mir ist auch mehr Platz.« Sie reichte Anne die Sachen. »Hilf mir mal bitte.«
Die Frau schien ihre Wertsachen bewusst zu Hause gelassen zu haben. Wenn sie nur ein bisschen in der Granitz laufen wollte, brauchte sie sie nicht, ganz besonders, wenn sie aus der Nähe stammte oder hier Urlaub machte, wovon Anne mittlerweile stark ausging. Falls der Täter es auf ihr Geld abgesehen hatte, war er leer ausgegangen. Immerhin hätte man ihr den Schmuck oder das Abspielgerät stehlen können. Darum schien es ihm jedoch nicht gegangen zu sein. Zumal es für einen Raubüberfall sicherlich bessere Gelegenheiten gab als eine arglose Spaziergängerin im Sommerkleid. Anne beugte sich hinunter und half Ninje, die Frau auf die Seite zu drehen. Deren rechter Arm fiel dabei nach vorn, was Anne erstmals den schmalen silbernen Ehering bemerken ließ, den sie an der linken Hand trug. Sie bedeutete Ninje, dass sie kurz innehalten sollte, zog das Schmuckstück vorsichtig vom Finger des Opfers und suchte nach einer Gravur. »Armin, 7. Februar 1988«, las sie.
»Ach, das auch noch«, kommentierte Ninje. »Der arme Mann.«
Anne hörte nicht richtig hin. Sie hatte unter dem Körper der Toten etwas entdeckt. »Können wir sie ein Stückchen nach rechts bewegen?«, bat sie.
Ninje, die schon das Thermometer in der Hand hatte, nickte stumm, legte es zurück in ihre Tasche und schob ihre Hände unter die Achseln der Toten. Im nächsten Augenblick war der Moosplatz frei und bot nun direkte Sicht auf eine Spurenlage, die vorher nicht auszumachen gewesen war. Dort, wo der Oberkörper der Frau gelegen hatte, zeichnete sich ein Schuhabdruck ab. Das Moos war an dieser Stelle platter gedrückt, als es das Gewicht des Opfers vermocht hätte, was nur bedeuten konnte, dass die Person, die hier gestanden hatte, ziemlich schwer gewesen sein beziehungsweise ihr gesamtes Gewicht auf ihr linkes Bein verlagert haben musste. Auch die Größe des Schuhabdrucks war auffällig. Wenn die Person etwas mit dem Mord zu tun hatte, suchten sie nicht nach einem Hänfling.
Der mutmaßliche Tathergang stand Anne auf einmal klar vor Augen. »Sie hat hier gesessen und auf den See geblickt«, sagte sie. »Der Mörder muss von hinten an sie herangetreten sein, das Messer genommen haben und …« Sie machte eine abrupte horizontale Schnittbewegung mit der rechten Hand. »Mit den Kopfhörern im Ohr hat sie ihn sicherlich nicht kommen gehört.« Sie ging einen Schritt zurück. »Sie ist nach hinten weggesackt, womöglich sogar gegen seine Beine gefallen. Er könnte sie an den Schultern gefasst und sie dann behutsam auf das Moos gelegt haben. Mit Sicherheit hat er auch ihre Frisur und das Kleid gerichtet, ihr Gesicht und den Hals mit dem Schal bedeckt und sie so zurückgelassen.« Anne hielt nachdenklich inne. »Das kann nicht geschehen sein, ohne dass er ihr Blut abbekommen hat.« Sie schaute erneut zum See. »Er wird es abgewaschen haben, soweit das ging. Vielleicht hat er auch einen Teil seiner Kleidung im See versenkt.«
Ohne weiter auf Ninje zu achten, ging Anne ein paar Schritte zur Seite und wählte Eriks Nummer. Seit ihrer freiwilligen Versetzung nach Bergen leitete er den Kriminaldauerdienst der Stadt am Strelasund. Als Chef des polizeilichen Bereitschaftsdienstes musste er ihr wie üblich seine Kriminaltechniker schicken, und womöglich ging es dieses Mal sogar nicht ohne einen Polizeitaucher. Anne, die ihren alten Freund immer nur dann kontaktierte, wenn sie mal wieder seine Hilfe brauchte, wappnete sich innerlich gegen alle Vorwürfe, die Erik in einem fünfminütigen Gespräch loswerden konnte. Aber wider Erwarten bemühte er keinen davon. Er hörte sich alles ruhig an und verkündete dann, dass seine Männer in spätestens einer Stunde bei ihr sein würden. Sonst sagte er nichts. Keine Frage nach ihrem Wohlbefinden, keine Vorhaltungen, nicht einmal ein dummer Spruch über Kaminski oder in Bezug auf die Tatsache, dass sie noch immer nicht geschieden war. Anne war nicht böse darüber. Sie fände es gut, wenn Erik sich nun endlich damit abgefunden hätte, dass sie sich für einen anderen beruflichen Weg entschieden hatte, einen Weg ohne ihn. Er brauchte sie nicht, um einen guten Job zu machen. Und als Teampartnerin für sein Privatleben taugte sie auch nicht. Vielleicht könnte ihre Freundschaft durch diese Erkenntnis wieder etwas an Fahrt aufnehmen. Manchmal wünschte Anne sich das. Mit dem Wegstecken des Telefons verflüchtigten sich diese Gedanken. Sie stellte sich wieder neben Ninje und beobachtete deren routiniertes Vorgehen bei der Leichenschau.
»Was du da gerade über den Tathergang gesagt hast, klingt ganz schön krank«, bemerkte Ninje. »Sie ist übrigens seit maximal vier bis fünf Stunden tot. Womöglich hat sie die kühlen Morgenstunden genutzt, um ein wenig durchzuatmen. Derzeit quillt die Insel ja wieder über vor Gästen, und man kann froh sein, wenn man mal einen Moment für sich …« Mitten in diesem so dahingesagten Satz stockte Ninje und wurde auf einmal nachdenklich.
»Hast du noch etwas entdeckt?«, fragte Anne neugierig.
»Nein. Ich kann dir nicht weiterhelfen.« Ninje formulierte die Worte wie in Zeitlupe und war offenkundig mit den Gedanken ganz woanders.
»Was ist? Was hast du?«, fragte Anne nach.
»Das Ganze erinnert mich an etwas«, sagte Ninje. »Es muss Ende der achtziger Jahre gewesen sein«, sie stoppte, »ja, doch, die DDR existierte noch, siebenundachtzig oder achtundachtzig war das. Ich kam frisch von der Uni. Es war auch ein extrem heißer Sommer, ungefähr so wie jetzt. Man fand auf der Insel alle paar Wochen eine tote Frau, immer im Wald«, sie drehte ihren Kopf zu der Leiche, »und alle waren auffallend hübsch anzusehen. Fünf oder sechs Frauen müssen es gewesen sein, alle ermordet. Meine Chefin hat damals an den Tatorten die erste Leichenschau machen müssen. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie mitgenommen sie jedes Mal war. Die gute Martha. Nun lebt sie auch schon zehn Jahre nicht mehr.«
Das ist über dreißig Jahre her, dachte Anne. »Hat man den Täter damals geschnappt?«
»Ich weiß es nicht. Mitbekommen habe ich davon jedenfalls nichts. Aber du weißt ja, wie das bei uns war. Ich bin dann auch zum Praktikum nach Greifswald. Ich weiß lediglich noch, wie froh meine Mutter war, dass ich erst mal von der Insel weg bin«, sagte Ninje. Von der Erinnerung sichtlich angegriffen, atmete sie tief aus. »Die Frau hier wurde übrigens nicht vergewaltigt, also nach dem, was ich sehen kann. Aber das wurden die Mädchen damals, soweit ich mich entsinne, auch nicht.«
***
»Guten Tag. Mein Name ist Olaf Krauser. Hätten Sie noch ein Zimmer frei?«
Hilgert brauchte eigentlich nicht nachzusehen, um die Frage beantworten zu können, aber er wusste, dass das dazugehörte, wenn man als Gastgeber einen gefragten Eindruck machen wollte. Entsprechend bemühte er den vor ihm stehenden Computer. »Ich hätte noch ein letztes Doppelzimmer«, sagte er nach einer angemessenen Pause. »Wie lange wünschen Sie denn zu bleiben?«, fragte er, während er den Mann höflich anlächelte.
»Eine Woche, vielleicht auch zwei«, entgegnete Krauser, den Hilgert auf höchstens Ende vierzig schätzte, obwohl ihm seine dunkel umrahmte Brille und die ein wenig altmodisch frisierten Haare alterstechnisch nicht zum Vorteil gereichten. »Wenn das kein Problem ist?«
Hilgert schüttelte kaum merklich den Kopf und schob ihm einen Meldeschein rüber. »Ich würde das zum Ende der Woche vermerken. Wenn Sie mir Ihre Entscheidung über die Verlängerung zwei Tage vorher mitteilen könnten.«
»Selbstverständlich!«, erwiderte Olaf Krauser. »Ich weiß, wie es während der Saison auf der Insel zugeht. Dass ich ausgerechnet hier in Ihrer Seevilla noch ein Zimmer ergattern konnte, freut mich wirklich. Die Damen in der Tourismusinformation unten am Kleinbahnhof haben mir diesbezüglich nicht viel Hoffnung gemacht.« Er fasste nach seiner Brille und rückte sie ein wenig zurecht.
Hilgert konnte in seinen Augen lesen, dass Krauser es tatsächlich so meinte. »Ich freue mich auch«, entgegnete er. »Wie sind Sie denn auf mich gekommen?«
»Es war der Geheimtipp«, er beugte sich zu Hilgert vor, als erforderte die Angelegenheit tatsächlich Diskretion, »der Damen in der Tourismusinformation. Die haben in den höchsten Tönen von Ihnen geschwärmt. Und ich glaube, ich habe einfach unterstellt, dass Sie deswegen ein besonders guter Gastgeber sind. Die Villa ist ja auch nicht zu verachten, nach allem, was ich bis jetzt gesehen habe.« Er schaute sich demonstrativ um. »Ich würde die erste Woche auch sofort bezahlen«, redete er weiter. »Bar. Alles andere macht nur Umstände. Ich nehme nur ungern Dienstleistungen im Voraus an.« Ohne dazu aufgefordert worden zu sein, zog er ein paar Geldscheine aus seiner Brieftasche und legte sie vor Hilgert auf den Tisch. »Welches Zimmer habe ich?«, fragte er mit Nachdruck, bevor dieser reagieren konnte.
»Die Nummer zwei, das Appartement Donnerkeil mit Meerblick«, entgegnete Hilgert, der sich von der plötzlichen Eile des Mannes nicht aus der Ruhe bringen ließ. Er hatte den Schlüssel kaum vom Brett genommen, da griff der Fremde danach, nickte ihm kurz zu und steuerte die Treppe an. Fast dort, schaute er Hilgert über seine Schulter hinweg noch einmal an. »Zweiter Stock, ja?«
Hilgert nickte. »Darf ich Ihnen mit Ihrem Gepäck behilflich sein?«
Der Mann winkte dankend ab, übersprang zwei Stufen auf einmal und war verschwunden.
Hilgert war mittlerweile lange genug im Gastgewerbe, dass ihn dieses Verhalten kaum noch verwunderte. Die Menschen legten im Urlaub mitunter die schrägsten Verhaltensweisen an den Tag. Womöglich hatte Herr Krauser keine weitere Minute seiner kostbaren freien Zeit mit dem fremden Mann am Empfang verschwenden wollen. Ohne weiter darüber nachzudenken, nahm er das Geld und begann, es zu zählen. Es handelte sich um neunhundertachtzig Euro und damit um exakt die Summe, die sieben Nächte in der Pension Seevilla inklusive Frühstück seit vorgestern kosteten. Da hatte Hilgert die Rate auf seiner Homepage nämlich um zehn Euro pro Nacht angehoben. Nur dass er es bislang versäumt hatte, die Tourismusinformation darüber in Kenntnis zu setzen. Herr Krauser musste da wohl etwas verwechselt haben. Ein wenig verwundert betrachtete er das noch immer in seiner Hand liegende Geld.
»Hoffst du auf Vermehrung durch Anstarren, oder jagen dir die paar Penunzen so viel Ehrfurcht ein, dass du dich nicht mehr rühren kannst?« Dombrowskis tiefe und wie immer konsequent zu laute Stimme schallte durch den Eingangsbereich. »Wenn du Angst vor dicken Scheinen hast, würde ich an deiner Stelle nicht zu mir ins ›Seetang‹ rüberkommen. Claudi tapeziert bei uns damit gerade die Toilettenwände.« Er lachte sein typisches unverfrorenes Lachen.
»Wennemar, grüß dich«, entgegnete Hilgert peinlich berührt über das unbemerkte Auftauchen seines Nachbarn. Hatte er wirklich so blöd aus der Wäsche geschaut, dass es sogar dem poltrigen Dombrowski aufgefallen war?
»Claudi hat gesagt, dass du einen neuen Gast hast«, redete Dombrowski weiter, während er sich halb auf den Tresen fläzte und beim Fuchteln seines rechten Armes seinen schweißigen Körpergeruch im Raum verteilte. Dass Dombrowski zu dieser Jahreszeit grundsätzlich nur Muskelshirts, ausgefranste kurze Jeans und irgendwo kostenlos abgestaubte Flipflops trug, machte es nicht besser. Zu allem Überfluss verabschiedete sich von Jahr zu Jahr mehr von seinem Haupthaar, was ihn nicht davon abhielt, den verbliebenen Rest wachsen zu lassen und zur Vertuschung der Kahlheit kreuz und quer über seinen Kopf zu kämen. Wie ein erfolgreicher Hoteleigentümer kam er jedenfalls nicht daher. Dombrowski störte sich nicht daran. Das »Seetang« am Selliner Hochuferweg, das Dombrowski seit mehr als dreißig Jahren führte, brummte, was ihm in all seinem Tun recht zu geben schien. Auch in Bezug auf seinen Spar-Wahn, der in erster Linie das Hotel, aber auch seine persönlichen Angelegenheiten betraf. »Sie hat ihn auf dem Hochuferweg abgefangen. Sein Auto steht unten am Kurpark, irgendein Kleinwagen. Du kennst doch Claudi, die kriegt die Kisten nie auseinandergehalten. Aber wenigstens kann sie Kennzeichen lesen, und dein Neuer kommt aus der Hauptstadt. Man will ja schon gerne wissen, mit wem man es zu tun hat. Jedenfalls wollte Claudi ihm unser überraschend frei gewordenes Zimmer aufschwatzen.« Dombrowski verzog den Mund. »Zwei junge Fräuleins, nicht mal übel und keine drei Tage da. Hm. Dann quatscht die Bäckersfrau denen irgendetwas von einer Toten in der Granitz in die Ohren, und schon packen die ihre Koffer. Manche Leute sind aber auch wirklich empfindlich. Na ja, der Kerl wollte partout nicht zu uns. Obwohl ich dich mit deinen hundertdreißig Scheinen eiskalt unterboten habe.« Er zuckte mit den Schultern. »Was soll’s, der Nächste kommt bestimmt zu uns.«
Nicht einmal Dombrowski kannte also Hilgerts neue Preise, und dem entging normalerweise nichts.