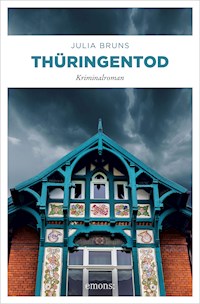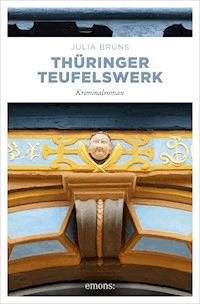9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
Dieses Weihnachtszeug hat immer noch ein beschissenes Karma Es ist schon wieder Weihnachten im Thüringer Wald und der verrückte Bürgermeister Blaschkehat sich diesmal etwas ganz Besonderes ausgedacht. Es soll ein Krippenspiel geben, allerdings mit echten Menschen und Tieren. Der altersschwache Dorfochse erlebt den Heiligabend dann aber leider nicht mehr, also müssen kurzerhand zwei Dörfler ins Kostüm gesteckt werden. Doch auf dieser Rolle liegt offenbar kein Segen. Denn während der feierlichen Aufführung bricht das Hinterteil des Ochsen tot zusammen. Jetzt müssen gezwungenermaßen wieder die Weihnachtshilfssheriffs Nikolaus und Knecht Ruprecht ran, denn das mit dem toten halben Ochsen war kein Unfall …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 403
Veröffentlichungsjahr: 2021
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Schon wieder ist Weihnachtszeit im Thüringer Wald: In Eliasborn muss die Ehre des Weihnachtsdorfes erneut verteidigt werden. Und der Blaschke Bürgermeister hat sich mal wieder etwas ganz Besonderes ausgedacht: ein Krippenspiel. Aber natürlich kein stinknormales Krippenspiel. Das ganze Dorf soll sich beteiligen und alles muss originalgetreu und vor allem lebensecht sein. Einzig mit dem Ochsen gibt es ein Problem, denn der ist kurz vor dem großen Auftritt an Altersschwäche gestorben. Notgedrungen werden zwei Dörfler in ein Kostüm gesteckt.
Als während des Krippenspiels an Heiligabend das Hinterteil des Ochsen tot zusammenbricht, müssen Nikolaus und Knecht Ruprecht gezwungenermaßen wieder ermitteln. Denn der tote halbe Ochse ist kein Unfall. Aber da hat die ungeliebte Stadtpolizistin Irmgard auch noch ein Wörtchen mitzureden …
Weihnachten ist nichts für Weicheier. Ich muss es wissen. Ich bin der Nikolaus. Aber mal schön der Reihe nach. Heute ist Heiligabend. Wir haben zwölf Grad plus. Ein fieser Regen prasselt vom Himmel. Das Mittagessen liegt mir schwer im Magen und mein Freund Ruprecht steht kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Nikolaus und Knecht Ruprecht, genau. Das ist kein schlechter Scherz, also was Ruprecht angeht. Der heißt tatsächlich so. Mein Name ist Adam Märker, ich bin fünfundvierzig Jahre alt. Und ich hasse Weihnachten. Dennoch gebe ich nun schon im zweiten Jahr den heiligen Nikolaus in unserer Dorfweihnacht. Dass ich meinen besten Freund Ruprecht, also Knecht Ruprecht, an meiner Seite habe, macht es nicht besser. Denn was Weihnachten angeht, ist Ruprecht schlimmer als jeder Drogensüchtige auf kaltem Entzug. Ich bin ihm deswegen nicht böse. Jeder braucht nun einmal eine Aufgabe, die ihn ausfüllt, und wenn es nur vom ersten Dezember bis zum sechsten Januar ist. Aber Fakt ist, wenn Ruprecht sich nicht irgendwann dem Terror unseres dörflichen Weihnachtskomitees, ja, auch der Wahnsinn hat Strukturen, gebeugt hätte, wäre mein Leben in der Weihnachtszeit anders verlaufen. Ich bin gut ausgekommen, mit den Pornos, den Tiefkühlpizzen, der Glühheidi und so. Bis Eckbert, der geborene Nikolausdarsteller, vom Alkohol dahingerafft wurde und Ruprecht nach vierundzwanzig gemeinsamen Jahren allein zurückgelassen hat. Knecht Ruprecht ohne den heiligen Nikolaus, das war für unser Dorf schlimmer als der Borkenkäfer und die Fichtenröhrenlaus im Duett auf ihrem Vernichtungszug durch den kompletten Thüringer Wald. Es grenzt an ein Wunder, dass sich das selbst ernannte Weihnachtsdorf Eliasborn jemals wieder von diesem Schock erholt hat. Jedenfalls ist der Blaschke, unser blöder Bürgermeister, auf die Idee gekommen, dass nur ich diese enorme Lücke, die die Flasche Kräuterbitter in unsere Dorfweihnacht gerissen hatte, füllen kann. Das ist hart, ich weiß. Ruprecht allerdings sagt, er vergisst mir das nie. Ich glaube, er hat sogar ein bisschen geweint. Das hätte ich auch getan, wenn mir von Anfang an klar gewesen wäre, was mich als heiliger Nikolaus hier erwartet. Ich bin eine Geißel des Weihnachtsfestes, mit oder ohne Schnee. Grüne Weihnacht ist nur was für die Deppen im Thüringer Becken. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz in den letzten drei Wochen bei uns im Dorf gehört habe. Einmal zu viel sicherlich, wenn man dem Gesetz der negativen Aura Glauben schenken darf.
»Dahinten ist schon eine winzig kleine Schneewolke«, sagt Ruprecht und ich kann an seiner undeutlichen Aussprache hören, dass er seine Nase fest gegen die Scheibe drückt. Seit wir vom Mittagessen aufgestanden sind, lehnt er in der Fensterbank und starrt in den Garten. »Komm schon Wölkchen, hierher«, flüstert er.
Opa nickt uns aus seinem Ohrensessel behäbig zu. Er hat den Hosenknopf an seinem Stresemann geöffnet und tätschelt mit der rechten Hand seinen Bauch, als könnte er damit den Kartoffelsalat und die Wiener überreden, sich leichter verdauen zu lassen. Für einen über Achtzigjährigen müssen die zwei Portionen, die er verdrückt hat, eine enorme Herausforderung sein. Marlies, quasi die derzeitige Nummer eins unter Opas Verehrerinnen, und davon hat er ein gutes Dutzend im Dorf, hat in Sachen Mayonnaise alles gegeben, vor allem Öl und Eigelb.
»Unbedingt, mein Junge«, sagt der Opa verständnisvoll und zwinkert mir zu. Ich staune immer wieder, wie er mit alledem so klarkommt. Nicht das fette Essen, das kriegt ein echter Thüringer mit nachgespültem Selbstgebranntem einigermaßen hin. Nein, die Wohngemeinschaft mit Ruprecht, seinem fast fünfzigjährigen, unverheirateten Enkelsohn, der einen ausgeprägten Hang zum Weihnachtsfetischismus hat. Vor allem Letzteres muss man mögen.
Ruprecht kriegt davon nichts mit. Er murmelt gebetsmühlenartig etwas von »Minusgraden« und »weißer Pracht« und wenn er nicht dieses Mantra herunterleiert, dann summt er leise ›Schneeflöckchen, Weißröckchen‹. Wir haben noch ein paar Stunden, bis die Christvesper beginnt. Ruprecht schwört darauf, dass dies der Höhepunkt unserer Arbeit ist, der Heilige Abend. Er kriegt ganz glasige Augen, wenn er davon spricht. Seit dreiundzwanzig Tagen, in seiner Welt Türchen, redet er von nichts anderem. Jeden Tag, der vergangen ist und an dem wir uns sinnloserweise durch unser Dorf, also den lebendigen Adventskalender gearbeitet haben, hat er mehr Adrenalin produziert. Wir gehören zu der Prozession um den Blaschke Bürgermeister, ohne die weihnachtstechnisch in unserem Dorf nichts gehen würde, also bei der Fraktion der Lichterkettenjunkies, Leuchtschlauchfanatiker und LED-Jehovas. Immerhin ist das die Mehrheit der hundertfünfzig Bewohner unseres Dorfes, also quasi alle bis auf Tante Hildegard, die den Blaschke abgrundtief hasst, meine beiden bettlägerigen Nachbarn und Alfred Recknagel, unseren Dorfoppositionellen. Damit alles seine Ordnung hat, verabschiedet das Weihnachtskomitee bereits jedes Jahr im Juni einen Ablauf- und Organisationsplan für diesen Blödsinn, Ruprecht lernt ihn komplett auswendig und wenn es so weit ist, laufe ich nur mit. Seit ich mich hier zum Deppen mache, verdopple ich im Dezember mal locker meine in den restlichen elf Monaten zu Fuß zurückgelegten Kilometer. Meinen Kenntnisstand über meine Mitbürger kann ich proportional dazu auch auffrischen, unfreiwillig natürlich.
Jedenfalls ist Ruprecht am vierundzwanzigsten Dezember absolut aus dem Häuschen, noch viel mehr als an dem Tag, an dem er erfahren hat, dass der Freistaat Thüringen die Tierarztkosten für Herrn Fuchs, also seinen Dackel, übernimmt. Ruprecht ist Förster und der Dackel ein Diensthund mit Fichtenpollenallergie, was bei uns im Thüringer Wald einem Kamikaze gleicht. Aber das tut jetzt nichts zur Sache. Bis an Heiligabend drehen hier alle komplett frei. Und danach wird es auch nicht viel besser.
Immerhin haben wir jetzt noch etwas Zeit, bis der Schwachsinn unserer Dorfweihnacht seinen diesjährigen Zenit erreicht, und ich will Ruprecht seinen Optimismus bezüglich des Schnees nicht nehmen. Schließlich haben die Indianer mit ihrem Regentanz auch mal Glück.
»Wenn die Urvölker ihr Regenritual abhalten, dann malen sie sich die Gesichter blau an oder tragen blaue Klamotten«, sage ich ein wenig zu euphorisch mitten in die zweite Strophe des Kinderliedes hinein. »Sie glauben, die Farbe lockt das Wasser an.«
Opa schaut auffällig lange auf mein weißes Spitzenkleid. Ich ahne, was er denkt, und beiße mir auf die Zunge. Wieso kann ich mit meinem gepflegten Halbwissen nicht einfach hinter dem Berg halten? Bevor hier jedoch der falsche Eindruck entsteht, das ist nur ein Kostüm und meine Intention, damit herumzulaufen, beruht allein auf Zwang. Das gilt übrigens auch für den roten Umhang und die Mitra, die ein Nikolaus zwingend haben muss und die ich nun an Opas Garderobenhaken parke. Natürlich habe ich das Zeug nicht in der Wohnung an. Ich bin ja nicht total plemplem. Wieso muss ich mich eigentlich permanent rechtfertigen? Schließlich habe ich diese dämliche Tradition nicht erfunden. Ruprecht auch nicht. Er läuft in Kackbraun. Ich will mir nicht ausmalen, was ein Schamane mit dieser Farbe auslösen könnte.
Ruprecht dreht sich zu uns um. Offenkundig hat er zugehört. Ausnahmsweise. »Meinst du, das geht?«, fragt er unsicher.
Ich zucke nur mit den Schultern. Erst jetzt bemerke ich, dass seine Wangen dunkelrot leuchten und ihm der Schweiß auf der Stirn steht. Kein Wunder, er trägt seinen zerfransten, dicken Fellmantel inklusive Hose und schwerer Stiefel.
»Wieso bist du eigentlich schon fertig angezogen?«, frage ich verwundert.
»Bin ich ja gar nicht«, entgegnet Ruprecht ein wenig trotzig und deutet auf seinen Kopf, womit er sagen will, dass er seine hässliche Kosakenmütze und den Rauschebart noch nicht angelegt hat. Über die dazu passende Perücke verlieren wir seit letztem Jahr ohnehin kein Wort mehr. Die liegt im Schrank. Dort kann sie Ruprechts empfindlicher Kopfhaut nichts mehr anhaben. Dass ein schwarzer Kunststoffbart in Kombination mit Ruprechts flachsblondem Haarschopf etwas befremdlich wirken könnte, ist nichts als ein unwesentliches Detail, wenn man bedenkt, dass wir ohnehin in der gesamten Weihnachtszeit wie zwei Idioten herumlaufen. Menschliche Würde ist bei uns im Dorf kein Argument, vor allem in der Weihnachtszeit. Ruprecht stört das nicht. Er ist glücklich. Bei mir hingegen kann man irgendwann sicherlich ein tiefsitzendes Trauma attestieren.
»Dein Mantel?«, frage ich und bemühe mich, meine Stimme dabei nicht zu heben.
Ruprecht wackelt mit dem Oberkörper wie ein verschämtes kleines Mädchen. »Du weißt doch, dass ich Mühe habe, die Knöpfe zuzubekommen, und bevor ich zu spät bin.« Er lässt den Satz so stehen und widmet sich wieder seiner Konversation mit der vermeintlichen Schneewolke. Der von Motten zerfressene Stoff auf seinem Rücken gibt alles, aber ich kann deutlich sehen, dass er diese Spannung kaum ewig aushalten wird. Wenigstens stinken der heilige Nikolaus und Knecht Ruprecht nicht mehr wie ein ausgewachsenes Iltispärchen. Letztes Jahr war es so schlimm, dass man uns nicht einmal sehen musste, um zu wissen, dass wir da sind. Peinlich war mir das nicht. Wieso auch? Ich habe ja nicht meinen, sondern den jahrzehntealten Muff von Eckbert spazieren getragen. Ich kann auch nicht sagen, dass es mir keine Freude gemacht hätte, die Dörfler mit diesem Dunst abzuschrecken, aber das hat die natürlich kein bisschen gestört. Bei uns im Thüringer Wald sind die Menschen einfach härter, auch was ihre Geruchsempfindlichkeit angeht. Nein, ich neige zu Aphten und die gesamte Weihnachtszeit mit einer Batterie voller Bläschen im Mund rumzulaufen, macht wahrlich keine Freude.
Wie auch immer. Im zweiten Jahr meiner Knechtschaft als heiliger Nikolaus hat der Fortschritt Einzug in die dörflichen Traditionen gehalten. Ich denke, das kann man so sagen. Darauf bin ich nicht stolz oder so was. Ich will es einfach mal erwähnt haben. Kurzum, nach einem Vierteljahrhundert wurden unsere Kostüme erstmals gereinigt. Halleluja! Opas besagte Marlies, die Köchin des Kindergartens und eifriges Mitglied im Weihnachtskomitee, hat sich der Sache angenommen. Marlies hat ein gutes Herz. Und noch immer ein verdammt schlechtes Gewissen, was ihre überaus großzügige Dosierung von Abführmittel im Wildschweinbraten unseres Pfarrers angeht. Eigentlich könnte ihr das egal sein, denn kurz darauf war der Kerl ohnehin tot, aber das war ja nicht die Schuld von Marlies. Die Ermordung des Pfarrers hat sich der Erzengel Gabriel auf die Fahnen zu schreiben. Der sitzt nun ein. Ich weiß nicht, wie seine aufgeschnallten Engelsflügel, die Windelhose und das goldene Brusthaartoupet bei den ganzen schweren Jungs ankommen, aber bei uns im Dorf ist er raus. Persona non grata. Punkt. Hier sind ja grundsätzlich einige etwas seltsam: die Abgeschiedenheit von der Zivilisation und der über Jahrzehnte eingefrorene genetische Status quo fordern irgend-wann ihren Tribut. Ach, vergessen wir dass. Dass jemand auf die Idee kommen könnte, den Pfarrer mit Weihnachtsgurken zu füttern, hat damit nichts zu tun. Das hoffe ich zumindest.
Der Verlust des Pfarrers hat das Zusammenleben in unserer dörflichen Gemeinschaft nahezu revolutioniert, immerhin was die Hygiene unserer Kostüme anlangt. Marlies jedenfalls wollte unseren Kram in die Reinigung bringen, zumindest habe ich das angenommen. Genau da jedoch lag der Fehler. Marlies ist eher von der pragmatischen Sorte und hat selbst Hand angelegt. Was den Garpunkt ihres Schweinebratens angeht, hat sie echt was drauf, aber beim Wäschewaschen zeigen sich deutliche Defizite. Marlies hat unsere bescheuerten Kostüme so lange durchgekocht wie ein paar Markknochen für eine Fleischbrühe. Die gute Nachricht: Was das Getier angeht, das in dem Stoff siedelte: Es gibt keine Überlebenden. Die schlechte: Wir sehen in den Klamotten nun aus wie zwei Presswürste. Ruprecht noch mehr als ich, aber er hatte schon immer etwas mehr Hüfte. Bei mir hat sich lediglich der Saum des Kleides um etwa zehn Zentimeter nach oben verschoben. Damit hat es jetzt eine modisch zeitlose Knielänge, zumindest hat das der Opa so formuliert und der ist in der Welt herumgekommen, im Gegensatz zu mir. Für nicht Eingeweihte ist die Veränderung an meinem Spitzenfummel kaum auszumachen. Denn dank der elektrischen Ladung meiner langen Armeeunterhose ist das Kleid ohnehin nie so locker gefallen wie es sollte. Dafür zeigt der Baumwollstoff der Unterhose mittlerweile deutliche Ausbeulungserscheinungen. Die Bundeswehrklamotte ist eben auch nicht auf zwei Jahrzehnte Dauerbetrieb in schwerem Gelände ausgelegt.
Marlies jedenfalls ist keine siebzig mehr und Opas Freundin. Zumindest wenn es nach ihr ginge. Ob ihrem Mann das recht ist, kann ich nicht sagen. Der hat seit ungefähr fünfzig Ehejahren keine eigene Meinung und wird sicherlich auf seine alten Tage damit nicht mehr anfangen. Opa allerdings hat immer eine, ist jedoch zu sehr Gentleman, um diese in jeder Situation kundzutun. Kurzum, Marlies hat an meiner Wäsche eigentlich nichts verloren. Ich stehe eher auf Jüngere, wobei ich nicht sicher bin, ob ich in meiner gegenwärtigen Situation überhaupt noch Ansprüche stellen sollte. Was mein Liebesleben angeht, bin ich mal wieder so richtig am Arsch. Achtzehn Monate, zwei Wochen und vier Tage sexueller Notstand holt ein Mann meines Alters niemals wieder auf. Anderes Thema.
»Die Thailänder bespritzen kleine Kätzchen mit Wasser, um durch deren Geschrei den Regen anzulocken«, vermeldet Opa, als hätte er die Lösung für Ruprechts Problem gefunden. Ich staune immer wieder, wie es ihm gelingt, seinem Enkel das Gefühl zu geben, das er dessen Sorgen ernst nimmt. Opa hat da echt was weg.
Ruprecht wendet sich erneut um. Dieses Mal gilt seine Aufmerksamkeit aber nicht uns, sondern Herrn Fuchs, seinem Dackel. Der liegt in seinem Körbchen neben dem Kachelofen und schnarcht. Ich kann förmlich sehen, was Ruprecht da gerade abwägt. Er scheint es aber zu verwerfen, jedenfalls dreht er sich wieder weg und nölt unzufrieden: »Ich werde mich über die Wettervorhersage beschweren.«
Ich weiß nicht, was das bringen soll, zumal die absolut recht behalten haben, und hoffe, dass Ruprecht jetzt nicht noch damit anfängt, dass es an Weihnachten früher immer geschneit hat. Das höre ich seit dem ersten Dezember täglich in Dauerschleife und es kommt mir so langsam zu den Ohren raus.
»Ich kann mich nicht an ein Weihnachtsfest erinnern, an dem es nicht geschneit hat. Wir hatten immer weiße Weihnachten!« Der ansonsten allzeit friedfertige Ruprecht kämpft offenkundig gerade mit einer unterdrückten Wut. Weihnachten macht aggressiv, mein Reden. Sein Frust entlädt sich, indem er zweimal mit seinem rechten Fuß aufstampft. Wenn es ihm hilft, denke ich. Tut es nicht, denn er trampelt noch mehrmals hintereinander. Ich habe eine derartige Reaktion das letzte Mal bei einem unserer Kindergartenkinder gesehen, als Mandy dem Jungen ein paar Tannenzapfen weggenommen hat. In seiner Verzweiflung musste er sich daraufhin schreiend über den Gehweg rollen. Ich schaue Ruprecht an und warte ab, was passiert. Er seufzt herzzerreißend, bleibt aber auf Position. Ach so, Mandy ist übrigens unsere dicke Kindergärtnerin und sie steht auf mich. Ich erwähne das nur am Rande. Es hat keinerlei Bedeutung, also für mich jedenfalls nicht. Nur so viel: Ich hätte nichts dagegen, wenn zur Abwechslung mal eine scharfe Braut entdecken wollen würde, dass da noch Leben unter meinem Spitzenkleid ist.
»Weiße Weihnachten ist die größte Lüge der Menschheit«, entgegne ich und versuche dabei nicht genervt zu klingen. Ruprecht ist mein Freund, aber dieses Drama um den beschissenen Schnee geht mir langsam komplett auf die Nerven. Immerhin darf man nicht unterschätzen, dass ich schon seit dreiundzwanzig Tagen diesen albernen Fummel trage und damit ebenso viele Türchen unseres lebendigen Adventskalenders öffnen durfte. Damit komme ich der Grenze hinsichtlich dessen, was ein normaler Mensch an Weihnachtsgedöns ertragen kann, schon verdammt nah.
»Da denkt sich einer das ganze Brimborium um die Geburt des Jesuskindes in einem ärmlichen orientalischen Stall aus. Der hatte dort doch auch keine idyllische Winterlandschaft um sich, oder? Ich meine, welchen Sinn macht diese Kombination dann überhaupt?«
»Weihnachten eine Lüge? Eine ganz neue Theorie, die man diskutieren sollte«, sagt der Opa und grinst amüsiert. Ich weiß, dass er diesen Weihnachtsscheiß einzig und allein wegen Ruprecht und auch ein bisschen zu meiner moralischen Unterstützung durchzieht. Wir sind also Leidensgenossen, nicht verwandt wohlgemerkt, was ich persönlich sehr schade finde. Der einzige Mensch, mit dem ich mir die Gene teile, ist Tante Hildegard und als ob das allein nicht schon schlimm genug wäre, wohnen wir auch noch in einem Haus. Meine Mutter hat es uns beiden vermacht. Tante Hildegard ist also quasi meine Erbengemeinschaft. Aber wenn ich jetzt von der anfange, kriege ich einen Pflaumensturz. Tante Hildegard ist Luzifer und der hat mit dem Heiligen Abend definitiv weniger zu schaffen als ein schlecht angezogener, ungewaschener Nikolausverschnitt.
Ruprecht fährt herum und bedenkt mich mit einem vorwurfsvollen Blick. »Nikolaus! Du sollst nicht immer alles schlechtreden. Diese negative Stimmung belastet das Fest. Dabei lebt Weihnachten von Fröhlichkeit, Wärme, Liebe … und Schnee.«
Ich kann schon problemlos auf die Weihnachtszeit verzichten, aber fehlender Schnee steht wirklich ganz oben auf meiner Skala der Belanglosigkeiten. Und überhaupt. Hat sich mal jemand überlegt, was man den Menschen mit diesem meteorologischen Anforderungsprofil für eine Last aufdrückt? Der Geschenkestress, die Essensfrage, die lästigen Familienzusammenkünfte und dann auch noch die romantische Verklärung einer Wetterlage. Ich meine, wir können uns schon die aufdringlichen Verwandten nicht aussuchen. Aber das Wetter? Was ist das eigentlich alles für eine grenzenlose Scheiße. Prima, nun ist meine Laune komplett im Keller. Und wir haben das vierundzwanzigste Türchen, und damit den Weihnachtsgottesdienst, erst vor uns.
»Nicht wahr, Opa?«, fragt Ruprecht Richtung Opa. »Weihnachten hatten wir immer Schnee.«
Der Opa hält sich diplomatisch zurück und lächelt Ruprecht milde an. Er ist etwas blass um die Nase und ich habe Sorge, dass er den restlichen Nachmittag nicht auf der Kirchenbank, sondern auf der Toilette zubringen muss. Aber das wäre für ihn dann allemal netter. Für mich weniger. Ich stünde dann allein gegen das komplette Bollwerk der Weihnachtsnarretei.
»Dieses Jahr nicht«, entgegne ich lapidar und beschließe dann umzuschwenken und Ruprecht seine halluzinatorische Wunschpsychose zu lassen. Wenn es ihn glücklich macht, bitte schön. Ich kann mich zurücknehmen. Aber ich habe schon zu viel gesagt.
»Du! Du!« Ruprecht fuchtelt mit dem Zeigefinger wie wild in der Luft herum. »Heute ist Heiligabend und damit der Höhepunkt unserer Dorfweihnacht. Dazu gehört nun mal Schnee. Für mich ist das wichtig. Nikolaus!«
Nikolaus, na klar. Seit vierundzwanzig Tagen hat mein bester Freund meinen richtigen Namen vergessen. Alle haben meinen Namen vergessen. Dass ich eine gespaltene Persönlichkeit entwickeln könnte, darauf kommt keiner. Und wennschon. Einzelschicksale zählen nicht in einer Weihnachtszauberwelt.
»Nikolaus, hörst du!« Ruprecht wird für seine Verhältnisse energisch.
»Schon klar«, murmle ich, um ihn nicht noch mehr in Rage zu bringen. Schließlich könnte der Sack, den er trägt, reißen und dann hätten wir hier ein echtes Drama. Ach Ruprecht, nenn mich doch, wie du willst. Mir ist alles egal. Ich brauche einen Schnaps. Dann kann ich doch nicht an mich halten.
»Ich bin mal gespannt, was der Weihnachtsmann sagt, wenn der Nikolaus an Heiligabend auf der Matte steht«, provoziere ich Ruprecht. Ich weiß, dass dies eine der offenen Flanken des Weihnachtskomitees ist. Die Hardliner, also Maria und Josef, alias Inge und Walter Zenker, sowie Marlies und der Pfarrer, wenn er noch unter uns weilen würde, bestehen auf den heiligen Nikolaus als Gabenbringer. Für sie ist der Weihnachtsmann nichts als ein Fluch der Moderne, ein sich durch die Hintertür hereinschleichender übergewichtiger Colavertreter. Ich habe kein Problem mit Cola, ganz im Gegenteil, aber wenn man wie Inge Zenker der Überzeugung ist, Zucker sei Nervengift, dann kann man auch Weihnachtsmänner nicht leiden. Dagegen stehen der Blaschke Bürgermeister und dessen Ehefrau sowie der Gemeindediener Ulf und seine Ilse, die der Auffassung sind, dass der Weihnachtsmann und der Nikolaus ein Team sind, so wie Ernie und Bert, Harry und Sally … Na ja, ihr wisst schon. Gegen das Christkind haben sie auch nichts, wobei ich nicht sicher bin, ob der Blaschke den Unterschied kennt. Der ist aber generell der Meinung, dass viel auch viel hilft, und freut sich über jede Weihnachtstradition, die er ausgraben kann. Ulf und Ilse sind dabei nichts als Mitläufer, aber wenn der Blaschke mein Gehalt zahlen würde, würde ich ihn vielleicht auch auf der Straße grüßen.
Was Ruprecht angeht, der hat schon Schwierigkeiten, sich im Sommer vor Kurts Softeismaschine zwischen Erdbeer- und Schokoeis zu entscheiden. Kurt ist der Wirt unserer Dorfkneipe, dem Grünen Hirschen, aber das nur am Rande. Es geht jetzt um Ruprecht. Wie soll jemand, der schon mit der Eisauswahl Probleme hat, so elementare Fragen klären wie: welchem präsenilen Weihnachtspatriarchat er sich unterwerfen soll? Sein Problem ist die Disharmonie, die in diesem Thema liegt. Damit kann er nicht.
Der Flunsch, den er nun zieht, verdeutlicht mir, dass ich ihn getroffen habe.
»Natürlich«, stimmt der Opa seinem Enkel zu und glättet damit die Wogen. »In den Kriegswintern sind wir kaum zum Weihnachtsgottesdienst gekommen, so hoch lag der Schnee. Das war eine schwere Zeit.« Er seufzt, aber es klingt nicht sehr überzeugend. »Da fällt mir ein, gibt es noch Tee, bevor die Blaschke-Festspiele starten?«
Ruprecht schaut ein wenig verstört, lässt es dann aber gut sein. Ich mache Tee für uns und fülle zwei Tassen zur Hälfte mit Selbstgebranntem auf. Eine davon reiche ich dem Opa und die andere genehmige ich mir. Opa schnallt es sofort und schlürft dankbar.
»Was macht deine Arbeit?«, fragt er.
Ich freue mich über das Interesse und darüber, dass jemand meinem Tun eine solch wertschätzende Umschreibung zuteilwerden lässt. Aber so ist der Opa nun einmal. Er nimmt mich ernst, schon immer. »Ich kann mich nicht beklagen«, entgegne ich und meine das auch so.
»Schön. Schön. Leute deiner Zunft haben es nicht leicht. Die Kreativen sind immer die Ersten, die sich Margarine anstatt Butter auf die Bemme schmieren müssen«, erwidert der Opa.
Genau, denke ich. Aber eine doppelte Lage Wurst ist mir ohnehin lieber.
»Nikolaus, äh, Adam kommt noch einmal ganz groß raus«, wirft Ruprecht von seinem Fensterplatz ein. »Das weiß ich.«
»Deine erotische Weihnachtsgeschichte letztes Jahr jedenfalls war nicht übel«, erwidert der Opa mit lüsternem Grinsen und anerkennender Geste.
Ruprecht reißt den Kopf herum und schaut mich grimmig an. Ihm habe ich dieses Meisterwerk bewusst unterschlagen, nicht aus Boshaftigkeit, wirklich nicht. Eher, um ihn vor sich selbst zu schützen. Ruprecht neigt dazu, die Dinge durcheinanderzubringen, um es einmal höflich auszudrücken. Das wiederum hält ihn jedoch nicht davon ab, alles hemmungslos herumzutratschen. Wie damals, als ich mein Studium angetreten habe. In seinem Überschwang hat er jedem davon erzählt. Blöd nur, dass niemand hier draußen bei uns wirklich etwas mit dem Fach anfangen konnte. GERMANISTIK. Wenn da nicht mein Nachbar Gerhard und seine Leidenschaft für Kreuzworträtsel gewesen wäre. Keimdrüse mit neun Buchstaben. Germinale. Germanistik, Germinale, meine Güte, welchen Unterschied macht das schon? Adam Märker hockt in der Universität und macht was mit Keimdrüsen. Da war der Weg zu den Hoden nicht weit. Na immerhin haben sich alle über Jahre auf meine Kosten amüsiert. Das ist doch auch mal was. Aber ich bin nicht nachtragend. Und was die Leute bei uns von mir denken, interessiert mich ohnehin nicht. Würde ich ansonsten den Nikolaus geben?
»Und sonst so?«, fragt der Opa, um ein anderes Gesprächsthema anzuschneiden. Er scheint Ruprecht den Missmut anzusehen. Immerhin weicht seine fahle Gesichtsfarbe so langsam einem satten Wangenrot.
»Läuft«, entgegne ich und nicke ihm gleichmütig zu. Wenn ich ihm erzählen würde, dass ich neuerdings für das Nadeljournal, also die Zeitung der Tannenbauern, schreibe, könnte er enttäuscht sein, also nach der Sache mit den eingeölten, halb nackten Rauschgoldengeln.
Ruprecht hat sich ausgeklinkt und singt wieder. Die Schneeflocken gehen nun einmal vor.
Ich spüre, wie meine Beine durch den Alkohol ein wenig schwer werden, und dusele so langsam weg. Diese Seligkeit währt nicht lange. Leider.
»So! Tach schön, Freunde.« Unerwartet und vor allem uneingeladen steht der Blaschke Bürgermeister in der Wohnküche des Forsthauses und versucht gute Stimmung zu verbreiten. Seit unsere Dorfweihnacht im letzten Jahr durch die Ermordung des Pfarrers eskaliert ist, hat der Blaschke mir gegenüber Kreide gefressen, vordergründig zumindest. Ich bin noch nicht dahintergekommen, worauf diese Persönlichkeitsveränderung wirklich basiert, aber das juckt mich auch nicht sonderlich. Zeitverschwendung. Ich weiß, dass ich dem Kerl nicht trauen kann und das genügt. Schlimm genug, dass er neuerdings meint, hier einfach so hereinplatzen zu können.
»Wir sind doch nicht zu spät?«, kreischt Ruprecht, während er herumfährt und den Blaschke mit weit aufgerissenen Augen anstarrt. Der Stoff seines Mantels macht dabei ein nicht sehr vertrauenerweckendes Geräusch.
»Nee, nee. Ich wollte nur mal gucken, wie es so ist«, antwortet der Blaschke und winkt ab. An dem ungleichmäßigen Schwingen seines Gebisses kann ich jedoch sehen, dass ihn irgendetwas umtreibt. Die Zähne vom Blaschke sind nicht mehr mit dem Rest verbunden, aber das wäre alles nicht weiter wild, wenn sie nicht sozusagen der Blitzableiter für seine emotionalen Ausnahmezustände wären. Kurzum, ist der Blaschke schlecht drauf, fliegen die Kauleisten durch die Kante.
»Und? Wer hält den Gottesdienst?«, frage ich im vollen Bewusstsein, dass ich gerade einen ganzen Sack Salz in seine Wunde kippe. Seit uns im letzten Jahr auf so unschöne Weise der Pfarrer abhandengekommen ist, liegt Eliasborn, was seinen geistlichen Beistand angeht, förmlich auf dem Trockenen. Zum letzten Weihnachtsfest fiel das nicht weiter auf, der Schock des Verbrechens in Verbindung mit der trostspendenden Glühheidi hat die Wahrnehmung der Dörfler eingetrübt und das Jahr haben wir auch ganz gut herumbekommen. Ostern, Pfingsten und all die anderen wenigen Tage, an denen sich ein Pfarrer gut in den Kulissen machen könnte, werden im selbst ernannten Weihnachtsdorf Eliasborn nicht so hoch gehandelt. In der Adventszeit hat der Blaschke auf Zeit gespielt und improvisiert, aber nun, am Heiligen Abend, puh, da wird es echt brenzlig. Diesen Tag nehmen die Leute verdammt ernst, vor allem die, die sich das ganze Jahr nicht in der Kirche blicken lassen. Da gehört der Pfarrer zum Programm wie der Kartoffelsalat zu den Würstchen. Und wehe, das Ritual bekommt Lücken. Mit einem Pfarrer ist es nämlich so wie mit einem Impfausweis. Du merkst erst, dass er nicht da ist, wenn du in einen rostigen Nagel getreten bist und der Wundstarrkrampf an die Tür klopft. Dann ist das Geschrei groß. Der Blaschke jedenfalls hat verloren, wenn er nicht irgendwie noch einen Pfarrer aus dem Hut zaubert. Und wenn es nur einer ist, den das Arbeitsamt geschickt hat. Das ist bei uns hier draußen im Wald nahezu aussichtslos. Und ebendieser Gedanke erfreut mich.
Den Blaschke offenbar nicht, denn die Hälfte seiner Zähne hängt mittlerweile in der Luft.
»Na ja Jungs, seien wir mal ehrlich. Die ganze Scheiße fängt doch schon frühmorgens mit dem Feuermachen an.« Der Opa erhebt sich langsam, klopft auf seine Hosenbeine, als wollte er sie entstauben, und richtet sein Hals- und Einstecktuch. Dann prüft er mit Daumen und Zeigefinger den Sitz seiner Haare und streckt das Kinn in die Luft, um den Falten an seinem penibel rasierten Hals keine Chance zu geben. Heinrich Gmeiner hat schließlich einen Ruf im Dorf zu verlieren. Abgesehen von seiner Eitelkeit ist dies auch eine Frage der Versorgungslage. Denn keine seiner vollreifen Schnecken wird den Drang verspüren, einen ungepflegten, hässlichen alten Mann zu bekochen. Davon haben die doch alle schon einen zu Hause.
Der Blaschke schaut etwas verstört, was jedoch dazu führt, dass sich sein Gebiss wieder nach innen verlagert. Seine Vorstellung von Heiligabend korrespondiert offenkundig nicht mit Opas ungeschönter Beschreibung unserer Situation. Er fängt sich jedoch schleunigst wieder und gibt Ruprecht Anweisungen für den Ablauf. Die hat er hundertprozentig allesamt schon Hunderte Male kundgetan, aber Ruprecht nickt eilfertig und macht dabei eine Miene, als hätte der Blaschke ein Wundermittel gegen sämtliche Geißeln der Menschheit entdeckt. Der Blaschke Bürgermeister labert so viel, dass ich schwören könnte, der will von irgendetwas ablenken. Was immer es ist, ich will es nicht wissen. Ich schlurfe zur Garderobenbank herüber, hocke mich darauf und ziehe in Zeitlupe meine Chucks an. Dabei bemühe ich mich, dass der Blaschke das mitbekommt. Es klappt. Das kann ich an den ausladenden Bewegungen seines Kiefers sehen.
»Gesoffen hast du doch auch«, haucht der Blaschke mir sichtlich wütend und im Vorbeigehen zu. Ich puste ihm etwas meiner Atemluft entgegen. Die Mischung aus hochprozentigem Klaren und den Zwiebeln aus dem Kartoffelsalat muss mörderisch sein. Dabei setze ich mein strahlendstes Lächeln auf.
»Adam Märker«, presst er zwischen seinen kraftvoll zusammengedrückten Lippen hervor, als verkünde er mein Todesurteil. Dann hebt er die Mundwinkel und tätschelt mir die Wange. »Das wird der süßen Amelie Brütting nicht sonderlich gefallen oder, heiliger Nikolaus?«, säuselt er übertrieben freundlich.
Ich frage mich, wie der Blaschke das schon wieder spitzgekriegt hat, die falsche Sau, und ich erwäge kurzzeitig, ihn dafür in die Fresse zu hauen. Das allerdings würde sich sofort bis zu Amelie herumsprechen. Eins zu null für unseren Bürgermeister. Ich balle meine Fäuste hinter meinem Rücken und lasse es gut sein. Immerhin habe ich einen Teilsieg errungen. Mein Kostüm ist sauber, Eckberts viel zu große Stiefel wurden durch meine coolen Turnschuhe ersetzt und der heilige Nikolaus unterliegt keinem Alkoholverbot mehr. Das waren meine Bedingungen dafür, dass ich in diesem Jahr wieder mitspiele. Es ist durchaus von Vorteil, seinen Marktwert zu kennen. Dann kann man auch mal was setzen. Wenn ich ehrlich bin, hätte ich im Normalfall darüber nicht einmal nachgedacht. Aber seit ich Amelie kennengelernt habe, bemühe ich mich, meinen Normalfall in den Hintergrund zu drängen. Das fühlt sich ein wenig an wie im Sitzen pinkeln. Das machen Männer auch nur, um ihren Frauen zu gefallen. Wenn es etwas bringt, würde ich mich sogar noch mehr verbiegen. Amelie Brütting jedenfalls ist der eigentliche Grund für meine erneute Selbstgeißelung. Sie findet unser Eliasborn im Weihnachtsrausch einfach bezaubernd. Und als heiliger Nikolaus dürfte ich damit verdammt gute Karten bei ihr haben.
Die Spur der Schafsköttel führt einmal um den Altar herum bis zur Kanzel hinüber. Dass die Hinterlassenschaften der Statisten noch nicht besonders lange den Fußboden unserer Kirche zieren, ist dabei unübersehbar. Die Kacke dampft. Unseren alten Schäfer stört das wenig. Er steht neben den Tieren und pafft seelenruhig seine billigen Zigaretten. Ich habe keine Ahnung, ob die Hirten beim Besuch des frisch geborenen Jesuskindes rauchen durften. Aber Maria hätte das womöglich locker gesehen. Sie war garantiert eine ziemlich coole Braut. Ich meine, wer Weihnachten quasi obdachlos mit einem Kuckuckskind im Stroh hockt und seinem Mann etwas vom Heiligen Geist erzählt, hat sicherlich andere Probleme als ein bisschen Tabakkraut. Zudem waren die Brandschutzvorschriften noch nicht erfunden, geschweige denn die Europäische Union, aber die hat im Morgenland bis heute ja nichts zu melden.
»Die Kippe aus!« Die Ansage des Blaschke Bürgermeister ist unmissverständlich. Für alle, nur nicht für unseren Schäfer. Der steht regungslos und lässt den Glimmstängel glühen. Der Blaschke kann es nicht leiden, wenn seine Befehle durch das Volk nicht umgehend ausgeführt werden. Das kratzt an seiner eingebildeten Autorität. Deswegen lässt er keine Minute verstreichen, um die Sache zu erledigen. Wie von der Tarantel gestochen schießt er auf den harmlosen Schäfer zu, reißt ihm die Fluppe aus dem Mund und wirft sie mit ordentlich Schwung auf den Fußboden. Dann schlägt er mehrfach die Hände gegeneinander, als hätte er eine enorme Drecksarbeit hinter sich gebracht und müsste nun die Spuren beseitigen. Schließlich zieht er mit zufriedener Miene ab. Der alte Bursche hingegen hat nicht einmal gezuckt. Im Gegenteil, er greift in die Innentasche seiner Jacke und zieht ein Päckchen Zigaretten hervor. In unserem Dorf befinden sich mehr Leute im stillen Widerstand gegen den Blaschke, als ich vermutet habe. Einwandfrei! Blöd ist nur, dass der Schäfer seine Merinos gut leiden kann und ihnen für den Abend eine anständige Portion Heu mitgebracht hat. Daraus steigt nun ein dünner Rauchfaden auf, der erstaunlich schnell schöne kleine gelbe Flammen entwickelt. Authentisch ist so ein Hirtenfeuer schon irgendwie, denn Maria und Josef brauchten damals sicherlich auch mal einen Kaffee, und ein Knüppelkuchen macht durchaus satt. In einer Kirche hingegen kommt das vielleicht nicht ganz so gut. Jedenfalls sieht Ulf, der Gemeindediener, das so. Er schnappt sich in seiner Verzweiflung den Abendmahlbecher und sprintet zum Taufbecken herüber. Das aber leider leer ist. Der dort stehende Esel, übrigens auch ein Statist, muss ziemlichen Durst gehabt haben. Vom geweihten Wasser ist nicht mal mehr eine kleine Pfütze übrig. Den armen Ulf erfasst die Panik oder ist es Ratlosigkeit? Ich kann es nicht genau sagen, denn der Schäferhund Hasso jagt gerade eine Katze quer durch das Gestühl, was mich kurzzeitig ablenkt. Just in diesem Moment muss die Blaschkin, also die Frau unseres Bürgermeisters, mit einem Feuerlöscher aufgetaucht sein. Der weiße Schaum kommt schon verdammt nah an Schnee ran. Aber in Bethlehem? Ruprecht wenigstens wird sich freuen. Dem Schäfer ist auch das schnurz. Er hat sich keinen Millimeter bewegt. Ich übrigens auch nicht. Die Blaschkin, die echt Mühe hatte, den Feuerlöscher zu entschärfen, hat das natürlich bemerkt und schmale Augen gemacht. Dadurch wird sie nicht ansatzweise schöner. So leicht korrigiert die Natur ihre Fehler nicht. Nein, sie will damit ausdrücken, was sie von mir hält. Sie hasst mich. Eigentlich trifft es diese Formulierung nicht, aber ich habe keine Ahnung, wie man Hass steigert.
Vor dem letzten Weihnachtsfest konnte sie mich einfach nur nicht leiden, keine unnormale Befindlichkeit bei uns im Dorf. Es gibt so einige, denen ich quer sitze. Ruprecht sagt, das hätte etwas mit meiner Ausbildung zu tun und es wäre keine Antipathie, sondern Respekt. Na ja, ein zu einem Dreiviertel abgeschlossenes Germanistikstudium kann einem schon Anerkennung abringen. Über mir in der Bildungshierarchie steht ja quasi nur noch der Tierarzt. Der hat sogar ein Diplom. Das stammt bestimmt noch aus der Vorkriegszeit, aber immerhin. So etwas verjährt ja nicht. Oder doch? Egal. Seitdem der Pfarrer im Himmel ist, hat die Blaschkin ihre Negativemotionen mir gegenüber noch potenziert. Sie und unser verblichener Geistlicher waren nämlich ein Liebespaar, ein heimliches, aber das ändert ja nichts. Kurzum, ich habe es herausgefunden und sie zurück zu ihrem Mann geschickt. Das war alles. Mehr nicht. Ich schwöre es. Natürlich habe ich bei der Partnerwahl der Blaschkin nichts zu melden. Aber sie wollte es sich in ihrer Trauer ziemlich leicht machen. Entweder der Einzug ins Forsthaus zum Opa und Ruprecht oder der Gang in das leer stehende Pfarrhaus, hat sie gesagt. Da die zweite Alternative ja wohl kaum noch eine war, zumal die Kirche da ja nicht jeden reinlässt, musste ich handeln. Es geht ja nicht an, dass so ein durchgeknalltes Weib mir mein ruhiges Leben zerschießt. Und das vom Opa und Ruprecht auch nicht. So weit kommt es noch! Der Blaschke jedenfalls hat sie ohne Beanstandungen zurückgenommen. Nach fast fünfzig Jahren Ehe war die Garantie ohnehin abgelaufen. Da kann auch ein Seitensprung nichts dran ändern.
Zu den Abwegen der Blaschkin jedenfalls kann das ganze Dorf etwas beisteuern. Außer der Blaschke selbst. Für den ist dieser Teil des Liebeslebens seiner Frau ein Mysterium. Wegen mir kann das so bleiben. Die Blaschkin sieht allerdings nicht aus, als würde sie sich vor der Wahrheit scheuen. Sie ist durchweg auf Krawall gebürstet und rächt sich in einem fort an ihrem Mann dafür, dass er noch lebt und ihre große Liebe bei den Regenwürmern liegt. Für den Blaschke, der ausnahmsweise an all dem Grusel absolut unschuldig ist, muss sich seine Ehe seit letztem Jahr wie ein falscher Film anfühlen, vorausgesetzt natürlich, er registriert davon überhaupt etwas. Er ist ja nicht die hellste Kerze auf der Torte. Aber am Ende ist der Blaschke irgendwie auch ein Mann, d. h., ich sollte ihm ein Mindestmaß an Loyalität entgegenbringen. Anders verhält es sich mit seiner Angetrauten. Ich weiß nicht, was es bringen soll, einen Menschen für dessen Existenz zu strafen, einfacher wäre es, ihn zu verlassen, aber die Blaschkin wird schon wissen, was sie tut.
»Welcher Idiot hat denn die Hühner freigelassen? Die sollten erst kommen, wenn der Ochse auf Position ist. Kann sich hier nicht mal einer an die Regeln halten.« Der Blaschke Bürgermeister hat offenkundig den nächsten Fehler entdeckt und kann diesen nur schreiend verarbeiten. »Dann regt euch bloß nicht auf, wenn Edelbert Frikassee aus dem Federvieh macht.« Er fuchtelt mit den Armen herum. »Wenn sich keiner an die Sicherheitsvorkehrungen hält, kann ich für nichts garantieren. Aber kommt mir dann bloß nicht und wollt Schadensersatz, wenn nicht alle Komparsen es überleben.«
»Vielleicht macht Edelbert ja auch aus dir Frikassee«, zischt ihm die Blaschkin im Vorbeigehen giftig zu. Dabei macht sie sich nicht einmal die Mühe, leise zu zischen, damit die anderen Mitglieder des Weihnachtskomitees es nicht mitkriegen.
»Wer ist Edelbert?«, frage ich Ruprecht, der sich gerade mit einem riesigen Knäuel Lichterketten neben mir auf der Bank niedergelassen hat und sich daranmacht, das Ganze auseinanderzufriemeln.
Die fünf Merinos nebst ihrem Hirten halten noch immer die Stellung. Dafür kommen ein gutes Dutzend Hühner von allen Seiten unter dem Gestühl hervorgeschossen, um schnurstracks an uns vorbei auf den vom Löschschaum benetzten Altarbereich zuzulaufen. Das Zeug scheint irgendetwas an sich zu haben, was die Tiere mögen. Jedenfalls führen sie sich so auf und scharren, was das Zeug hält. Hasso hingegen hat mittlerweile die Katze gestellt. Zu seinem Ärgernis hat die sich jedoch auf die Kanzel verzogen. Er hockt nun davor und starrt den Platz an, von dem der Pfarrer, wenn wir einen hätten, gleich reden würde. Ab und zu setzt er dabei einen ordentlichen Beller ab. Die Akustik in unserer Kirche ist in Ordnung. Das muss ich schon sagen.
»Edelbert ist der Ochse von den Gabel-Meiers«, antwortet Ruprecht und ich spüre, dass ihn mein Unwissen stört.
Diese versteckte Kritik muss ich mir allerdings nicht zu Herzen nehmen. Jemand, der nicht einmal die Hälfte seiner Mitmenschen namentlich kennt, muss sich wegen deren Haustiere keinen Kopf machen. Soziale Intelligenz ist Luxus. Ich schaue auf den Altarbereich unserer Kirche, der jetzt schon einem Kleinbauernhof gleicht. Nebenbei fallen mir Ulf und Else ins Auge, die jeder mit zwei dicken Weidenkörben bewaffnet auf uns zusteuern.
»Ah, da kommen die Karnickel«, stellt der Blaschke Bürgermeister zufrieden fest und weist seinen Gemeindediener nebst Ehefrau mit übertriebenen Armbewegungen ein. Er möchte, dass die Kaninchen vor allen anderen Tieren sitzen und friedlich ein paar Grashalme mümmeln. Der Plan geht kurzzeitig auch auf. Dann ist eines der Viecher in der Sakristei verschwunden. Hasso schnallt es als Allererster. Seine Chancen, ein Langohr zu erwischen, stehen im Vergleich zu der Katze gut. Entsprechend ändert er seine Strategie.
»Ist das mit den ganzen Tieren nicht etwas übertrieben?«, will ich von Ruprecht wissen.
Er hält in seiner Bewegung inne und schaut mich vorwurfsvoll an. »Die lebensechte Krippenszene ist der diesjährige Höhepunkt. Der Blaschke Bürgermeister wollte etwas ganz Besonderes nach dem Debakel im letzten Jahr«, doziert er.
Ich denke an den ermordeten Pfarrer und nicke einigermaßen betroffen. »Der Weihnachtsgurkenmord.«
Aber das hat er offenkundig nicht im Sinn. »Nachdem das mit dem Schlitten nicht geklappt hat, weil die Leute das Eintrittsgeld vom Nikolaustürchen zurückverlangt haben«, sagt er hörbar getroffen. »Dreitausend Euro. Damit hätten wir das Teil schon anzahlen können.«
Warum habe ich überhaupt gefragt.
Aus der Sakristei dringen seltsame Geräusche. Kurz darauf kommt Hasso heraus. In seinem Maul eines der Karnickel. So schlaff, wie das hängt, liegt dessen Zukunft zwischen Rotkohl und Klößen. Ich spüre, wie mich ein leichtes Hungergefühl überkommt, und halte Ausschau nach dem Opa. Der turtelt mit Marlies auf einer der hinteren Bänke. Besser gesagt, Marlies turtelt. Opa probiert sich durch kleine Gläschen mit Eingemachtem. Offenkundig will Marlies testen, auf was er besonders abfährt. Na klar, es ist Heiligabend, da muss schon etwas Exquisites her.
»Hasso! Wie kannst du …?« Ruprecht hat jetzt auch mitbekommen, dass der Hund den ersten Weihnachtsbraten gesichert hat. Fünf weitere sind noch quietschfidel, aber das ist für Hasso keine Hürde. Er steht direkt vor uns und wedelt ausgelassen mit dem Schwanz.
»Feiner Bursche. Fein«, lobe ich ihn, worauf er das tote Karnickel vor Ruprechts Füßen ablegt und wieder loszieht.
Ich erwäge kurzzeitig, bei ihm ein Huhn zu bestellen. Broiler mag ich gern. Aber dann lasse ich es lieber. Hasso versteht mich ohnehin nicht und Ruprecht könnte es mir krummnehmen. Die Schlachtung der Krippentiere kommt in der Weihnachtsgeschichte garantiert nicht vor, also zumindest nicht, bevor das Jesuskind auf der Welt ist, oder verwechsle ich da etwas?
Ruprecht betrachtet die Beute, als läge der Leibhaftige vor ihm. »Schon wieder ein Mord«, haucht er entsetzt. »Und dann noch in der Kirche an Heiligabend. Das nimmt kein gutes Ende mit unserem Dorf. Kein gutes Ende.« Er seufzt herzzerreißend und jammert weiter. »Ein schlechtes Omen, so ein schlechtes Omen.«
Ich bin der Überzeugung, dass jedes Lebewesen wertvoll ist, ja das bin ich wirklich. Aber auf die Idee, den Pfarrer und ein Karnickel auf eine moralische Stufe zu stellen, wäre ich nie gekommen. Oder meint Ruprecht das eher evolutionär? Ich schaue zu ihm herüber und will ihn gerade danach fragen, als er sein Bein ausstreckt und den Kadaver unter die Sitzbank kickt. Ohne ein weiteres Wort darüber zu verlieren, widmet er sich wieder den Lichtern.
Ich lasse es gut sein und halte nach Hasso Ausschau. Der hat schon das zweite Langohr beim Wickel, kommt aber damit nicht weit, weil sein Herrchen den Ernst der Lage erkennt und einschreitet. Hasso wird schließlich im Beichtstuhl separiert. Das Kratzen seiner Krallen am Holz mischt sich nun in die ohnehin schon anstrengende Geräuschkulisse. Kurz darauf kommen Maria und Josef durch den Mittelgang gewackelt. Sie tragen eine Holzkrippe zwischen sich und machen andächtige Gesichter. Ich kann mir das Grinsen nicht verkneifen. Maria, also Inge Zenker, ist weit über fünfzig und hat so ganz und gar nichts von einer Gottesmutter. Nun, ich bin sicherlich auch alles andere als der Prototyp des heiligen Nikolaus von Myra, aber ich bilde mir das auch nicht ein.
»Ach, heute ist ja der Termin«, flöte ich den beiden entgegen. »Da bin ich ja mal gespannt, was es wird.«
Josef ist nicht ganz so verkniffen wie seine Maria und ringt sich ein müdes Lächeln ab. Sie hingegen rümpft nur die Nase. Die beiden wuchten das für einen durchschnittlichen europäischen Säugling reichlich überdimensionierte Teil zwischen die Schafe. Dabei gibt das vom Löschschaum durchfeuchtete Heu nach und Josef kommt ins Straucheln. Ehe er sich versieht, landet er kopfüber in der Krippe und schlägt dabei unschön mit dem Kopf auf eine der Holzlatten. Maria lässt in ihrem Schock die Krippe schlagartig los und eilt ihrem Mann zur Hilfe. Der hingegen hält sich das rechte Auge und flucht dreckiger, als Tante Hildegard es draufhat, wenn ich sie bei strömendem Regen aus unserem Haus aussperre. Seinem Toben kann ich entnehmen, dass er mit seinem Auge nur knapp einen herausstehenden Nagel verfehlt hat. Auch dass der Funke Tischler schuld ist, weiß ich nun. Der hat die Krippe nämlich zusammengezimmert. Wieso man einen Mann, dessen Blut durchaus als hochprozentig durchgehen würde und bei dem von zehn Fingern nur noch eine optimistische Hälfte vorhanden ist, mit einer so wichtigen Aufgabe betraut, verstehe ich nicht. Aber der Blaschke wird auch dafür seine Gründe haben und wenn es nur der ist, dass der Funke keine Rechnungen schreiben kann. Das Zehnfingersuchsystem muss für den nach Himmelreich klingen, ein unerreichbares. Josef jedenfalls wird über die Weihnachtszeit ein dickes Veilchen tragen müssen, na ja, es gibt Schlimmeres, also zum Beispiel, wenn es Maria getroffen hätte. Die Leute reden doch, vor allem bei einem Kuckuckskind. Ich schweife ab.
Ulf und seine Ilse haben sich nun darangemacht, die Strohballen, die den Stall darstellen sollen, auf ihre Plätze zu schieben und mit Kerzen zu schmücken. Ich muss schon sagen, die Kulisse macht was her, wirklich herzig. Vor allem der große Weihnachtsbaum ist nett. Nein, wirklich. Es ist eine Nordmann, ohne Frage. Ich kenne mich neuerdings mit Tannen aus. Ich glaube zwar nicht, dass die unteren Kugeln lange heil bleiben, also nicht, wenn der Esel sich noch ein paar Mal an den Zweigen reibt, aber man wird sehen.
»Kommen noch mehr Tiere?«, frage ich Ruprecht, der nur ein paar Kabel im Mund hat, um damit den aufgedröselten Teil der Lichter von den restlichen zu trennen.
Er hält kurz inne, schaut sich um und deutet mit dem Zeigefinger auf die, die ich auch sehe. »Hühner, Schafe, Kaninchen, ein Esel …« Die Lichterkette zwischen seinen Lippen lässt ihn etwas nuscheln, aber ich verstehe ihn trotzdem. »Es fehlen noch die Enten und der Ochse. Das mit dem Fuchs klappt ja womöglich nicht.«
»Ein Fuchs ist auch dabei?«, will ich wissen. »Ich dachte eher an ein Kamel.« Ich dachte an rein gar nichts, aber Ruprecht ist mein Freund und er ist jetzt schon sauer, dass ich den C-Plan des Weihnachtskomitees wieder einmal nicht gelesen habe. Entsprechend sollte ich mich hier etwas mehr einbringen.
»Der Zirkus hat abgesagt«, entgegnet Ruprecht. »Letzte Woche. Dann hat der Blaschke das Kamel gegen einen Fuchs getauscht. Das ist ja auch irgendwie typischer für unsere Region. Deswegen haben wir alle dafür gestimmt.«
»Typischer, genau«, erwidere ich. Über die Gedankengänge des Blaschke Bürgermeisters nachzusinnen, ist zwecklos. Gleiches gilt für das Abstimmungsverhalten des Weihnachtskomitees.
»Ulf hat die Lebendfalle nun eine Woche in Betrieb. Gestern war sie noch leer. Er will aber nachher gleich noch einmal raus«, redet Ruprecht weiter. Einige der kleinen Glühbirnen scheinen sich in seinen künstlichen Rauschebart verhakt zu haben, jedenfalls macht die Lichterkette jede Bewegung seiner Lippen mit, obwohl die Kabel lange nicht mehr in seinem Mund sind.
Ich weiß nicht, warum mich das Treiben hier immer noch überrascht. Aber das tut es. Einen echten Fuchs aus dem Wald zu entführen, ihn in die Kirche zu schleppen und zum unfreiwilligen Statisten in einem Krippenspiel zu machen, hat schon so einiges an Absurdität. Ich hoffe nur, dass der Blaschke das Tier nicht auch frei herumlaufen lassen will. Nicht weil ich Angst habe, Gott bewahre.. Nein, es ekelt mich. Die Bläschen, ihr wisst schon. Seitdem ich einen Artikel über den Fuchsbandwurm geschrieben habe, bin ich dahingehend vorbelastet. Ich merke schon, wie es bei der bloßen Erinnerung an den Bandwurm in meinem Mund zu brennen anfängt. Widerlich! Das kommt davon, wenn man als Gelegenheitsschreiberling jeden Auftrag annehmen muss, um über die Runden zu kommen. Momentan hapert es sogar an den ekligen Angeboten. Aber das ist nichts Neues. Immerhin rettet mich das Nadeljournal über den Januar. Das Thema habe ich schon: »Und immer kommt das Unkraut«. Ein perfektes Thema für dunkle Winterabende. Was zur Hölle mache ich eigentlich?
»Der Blaschke sagt, mit etwas Faustan kriegt der Fuchs die paar Stunden problemlos gewuppt.« Ruprecht klingt dabei, als wäre es das Normalste der Welt.
»Ihr arbeitet mit einem Tranquilizer?«, frage ich unbeabsichtigt forsch. Er verträgt diesen Ton nicht und ich sollte sensibler sein, egal was er von sich gibt. »Bei einem Wildtier?« Mein Entsetzen und meine Sensibilität sind allerdings zwecklos. Absolut zwecklos. Denn Ruprecht ist im Weihnachtsmodus und kriegt davon nichts mit. Er plappert unbekümmert weiter.
»Ulf nimmt den Tierarzt mit in den Wald. Das ist alles kein großes Ding. Nach dem Gottesdienst bringen wir das Tier wieder zurück.«
Der Tierarzt sitzt im Rollstuhl und geht auf die neunzig zu oder ist er da schon drüber? Die Wahrscheinlichkeit, dass er Ulf und den Fuchs verwechselt, noch dazu bei Dunkelheit, grenzt an hundert Prozent. Womöglich setzt er sich sogar selbst den Schuss. Ob das Medikament Faustan überhaupt noch zugelassen ist, darüber kann ich nur spekulieren. Für Tiere jedenfalls ganz sicher nicht. Und was heißt überhaupt »wir«? Noch bevor ich das klären kann, fährt Ruprecht fort.
»Ulf hat nachher genug mit dem Abbau hier zu tun, deswegen habe ich angeboten, dass wir beide einspringen. Marlies muss ja auch erst nach Hause und den Karpfen anrichten. Bis zum Abendessen haben wir also noch ein bisschen Luft.« Die Lichterkette bedeckt Ruprechts Körper mittlerweile wie ein dunkelgrünes überdimensioniertes Spinnennetz. Möglicherweise findet er da nie wieder raus. So wie die Dinge gerade liegen, kann er von mir jedoch keine Hilfe erwarten. Unter meiner Zunge drückt sich gerade die erste Aphte heraus. Glücklicherweise fehlen mir die Worte.
»Achtung! Achtung!«, piepst die Blaschkin voller Abscheu. »Eintreffen des Ochsen Edelbert in fünf Minuten.«
»Oh!« Ruprecht fährt herum, wobei sein Werk in sich zusammenrutscht. Er kann von vorn anfangen, garantiert.
Dem Stimmengemurmel am Eingang kann ich entnehmen, dass die ersten Gottesdienstbesucher bereits eingetroffen sein müssen. Ein Blick auf Ruprechts Armbanduhr genügt, um zu wissen, dass wir noch gute zwei Stunden Zeit haben. Was soll der arme Ochse Edelbert bis zum Beginn des Gottesdienstes in der Kirche machen? Seinen Text üben? Der Blaschke Bürgermeister überzieht mal wieder vollkommen. Das wird die Freakshow des Jahrtausends, denke ich. Es wird Zeit, dass Kurt, unser Wirt, mit seinem Bauchladen voller Glühheidi hier eintrifft. Erwartungsvoll schließe ich die Augen.
»Wo ist Edelbert?« Das Brüllen des Blaschke Bürgermeister reißt mich aus dem Halbschlaf.