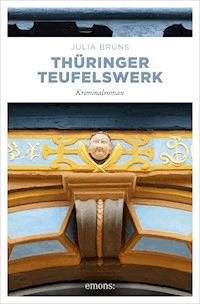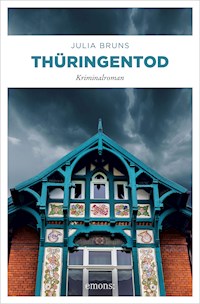
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kommissar Bernsen und Kohlschuetter
- Sprache: Deutsch
Ganz schön tot! Sömmerda im Ausnahmezustand: Tausende Thüringer feiern fröhlich den Thüringentag. Unter ihnen ist eine ehemalige Ingenieurin des alten Büromaschinenwerkes, die dreißig Jahre gewartet hat, in ihre Heimat zurückzukehren. Wenige Stunden nach ihrer Ankunft wird sie tot am Ufer der Unstrut entdeckt. Die Kommissare Bernsen und Kohlschuetter begeben sich auf die Spuren ostdeutscher Industriegeschichte und kommen einem düsteren Geheimnis auf die Spur, das alle kennen, von dem aber niemand etwas wissen will.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 432
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Julia Bruns, in einem kleinen Dorf mitten in Thüringen geboren, studierte Politikwissenschaft, Soziologie und Psychologie an der Universität Jena. Nach ihrer Promotion im Fach Politikwissenschaft arbeitete sie viele Jahre als Redenschreiberin und in der Öffentlichkeitsarbeit. Heute schreibt sie als freie Autorin. Julia Bruns lebt mit ihrer Familie, zu der auch ein Harzer Fuchs gehört, im Landkreis Sömmerda.
www.thueringen-kommissare.de
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
Lust auf mehr? Laden Sie sich die »LChoice«-App runter, scannen Sie den QR-Code und bestellen Sie weitere Bücher direkt in Ihrer Buchhandlung.
© 2019 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: Montage aus fotolia.com/ArTo; shutterstock.com/Loboda Dmytro
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Marit Obsen
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-470-4
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Agentur Editio Dialog, Dr. Michael Wenzel (www.editio-dialog.com).
Für Holk Maisel,den Buchhändler, ohne den so manches möglich,aber nicht machbar wäre.
Als ich fortging, war die Straße steil,kehr wieder um.Nimm an ihrem Kummer teil,mach sie heil.
»Als ich fortging« – Karussell, 1987
Prolog
17. Januar 1991
»Guten Morgen. Es ist sieben Uhr. Sie hören Deutschlandfunk. Die Nachrichten. Seit etwa sieben Stunden fliegen die USA und ihre Verbündeten fast pausenlos Luftangriffe auf den Irak und das besetzte Kuwait. Dabei trafen sie nach eigenen Angaben auf unerwartet geringen Widerstand. Auch blieb ein größerer Gegenschlag bislang offensichtlich aus …«
»Das ist mein Mischa. Gib ihn mir. Gib ihn mir!«, kreischte das kleine Mädchen mit knallrotem Kopf und von Marmelade verschmiertem Mund, wobei sie so sehr in ihrem Hochstühlchen hin und her ruckelte, dass man Angst bekam, sie könnte jeden Moment damit umfallen.
Ihr Bruder streckte ihr die Zunge heraus, woraufhin ein Teil einer zerkauten Wiener Wurst auf der gummierten Schlumpf-Familie landete, die die Vorderseite seines Sweatshirts zierte. Sein schadenfrohes schrilles Lachen ließ die bis dahin im Mund verbliebenen Wurstbröckchen auch noch hinterherfliegen, durch die schnellen Bewegungen seines Kopfes derart beschleunigt, dass sie gleich darauf seine Beine, das vor ihm stehende Brettchen und etwas von der Blümchentapete an der Wand neben ihm bedeckten.
»Also wirklich«, schimpfte die Mutter der beiden, sprang auf und holte aus der Küche ein Wischtuch, mit dem sie hektisch versuchte, den Schaden zu beseitigen. »Wie siehst du denn jetzt wieder aus? Wir müssen gleich los. Könnt ihr nicht einmal ordentlich frühstücken?«
Der Junge blieb von der Aufregung seiner Mutter unbeeindruckt und schleuderte den braunen Teddybären, den er die ganze Zeit hinter seinem Rücken versteckt hatte, mit voller Wucht über den Kopf seines Vaters hinweg gegen die dunkelbraune Schrankwand am Ende des Wohnzimmers. Dort wurde er von einem beerenfarbenen Rauchglasvasen-Sammelsurium aus den VEB Glaswerken Schmiedefeld abgebremst. Es klirrte.
Schweigen und schockierte Gesichter. In die Pause hinein plärrte das Radio: »Heute wird im Deutschen Bundestag der erste Bundeskanzler im wiedervereinigten Deutschland gewählt. Helmut Kohl …«
Ein gellender Schrei übertönte erneut die Durchsage. »Mein Mischa ist tot! Mein Mischa!« Dann ging die Klage in einen Weinkrampf über.
Der Vater, der die ganze Zeit kein Wort gesprochen hatte, legte sein Brötchen ab, schlug mit der flachen Hand fest auf den Tisch und sagte ruhig, aber bestimmt: »Jetzt ist Ruhe.«
Ein paar Minuten lang hörte man einzig das leise Klirren des Porzellans und die kratzenden Geräusche, die ein Messer verursachte, wenn man mit ihm auf einem Plastikbrettchen eine Scheibe Brot durchschnitt.
»Gehst du heute auch zur Belegschaftsversammlung?«, fragte der Vater der beiden Kinder, hielt kurz inne, streckte seine Hand nach den sechs oder sieben vor ihm stehenden Marmeladengläsern aus, bewegte sie unentschlossen von einem Deckel zum anderen und entschied sich schließlich für Aprikose. Diese Vielfalt hatte für ihn nach wie vor etwas Berauschendes, auch wenn es sich dabei nur um Brotaufstrich handelte. Ein herrliches Gefühl. Sie kauften allerdings nichts mehr von dem, was sie früher gegessen hatten. Westmarken waren angesagt, um das jahrzehntelang geschürte Verlangen zu stillen. Die westdeutschen Unternehmen sollte es freuen. Aber was war mit den eigenen? Wenn keiner mehr die Erzeugnisse des VEB Früchteverarbeitung Gera konsumierte, würde man diesen Betrieb in Zukunft nicht mehr brauchen – und in logischer Konsequenz die Mitarbeiter auch nicht. War der andere, der neue Geschmack das wert? Mehr war es doch nicht, oder? Ein Aroma, eine flüchtige Entdeckung, ein Schritt in eine unbekannte Welt, die wie alles früher oder später ihren Reiz verlieren konnte, ordinärer Konsum.
Nachdem er zwei Teelöffel der orangen Masse auf seinem Brot verteilt hatte, biss er enthusiastisch hinein, schloss kurz genießerisch die Augen, kaute und schaute zu seiner Frau.
»Wann ist die Versammlung denn? Und worum geht es?«, fragte sie arglos, bestrich geschäftig eine Scheibe Brot mit einer dünnen Schicht Butter, fügte Aufschnitt hinzu und drückte eine zweite Brotschnitte fest darauf. Nachdem sie das Ganze geviertelt hatte, legte sie es gemeinsam mit einem Apfel in die vor ihr stehende Brotbüchse.
Er betrachtete sie schweigend. Allein die Fragen ließen Wut in ihm aufsteigen. Sie wusste genau, welche Versammlung gemeint war. Das ganze Werk wusste es. Elftausend Menschen bangten im einstigen sozialistischen Vorzeigebetrieb VEB Robotron Büromaschinenwerk »Ernst Thälmann« Sömmerda um ihre Arbeit. Dass die den Laden vor einem halben Jahr in eine Aktiengesellschaft umgewandelt hatten, änderte daran auch nichts. Ein Teil der alten Produktionsbereiche war bereits verkauft worden. Für die Belegschaft ging es erst einmal weiter. Aber das Gros hatte Angst, vor allem, weil nicht wenige von ihnen schon mit Kurzarbeit null zu Hause saßen.
Die Werksleitung würde heute keine Planerfüllungszahlen verkünden, da war er sich absolut sicher. Und seine Frau hockte da, schmierte Schulbrote und tat so, als ob das wahre Leben an ihrem geliebten Werk vorbeiziehen würde. Wie ihn das ankotzte. Diese Lethargie.
Seit anderthalb Jahren war nichts mehr wie zuvor. Alle Pläne, ihre vorbestimmten Wege, die Sicherheit, all das hatte sich einfach in Luft aufgelöst. Ganze Biografien hatte die Wende ad absurdum geführt. Und noch war nichts überstanden, ganz im Gegenteil, alles befand sich weiterhin in einem Umwälzungsprozess. Dabei würde es Gewinner und Verlierer geben, das war ihm bewusst. Er wollte zu Ersteren gehören. Und nicht wie seine Frau warten, bis jemand kam, der sie an die Hand nahm und ihr die Richtung wies. Das würde nicht passieren. Die Zeiten waren vorbei. In diesem anderen, ihm vollkommen fremden Staat musste man sich um sich selbst kümmern. Das hatte er schnell begriffen. Genau das wollte er tun.
In den letzten Wochen und Monaten hatte er das erste Mal in seinem Leben gespürt, was es bedeutete, frei zu sein. Ein erhabeneres Gefühl war ihm bisher noch nie untergekommen. Bei allem Risiko, das die Freiheit unweigerlich mit sich brachte, er wollte sie ausleben. Er war schließlich jung, mit Mitte zwanzig war noch alles möglich. Lange genug hatte er in diesem kleinbürgerlichen Spießermief dahinvegetiert. Schichtdienst, Jugendkollektiv, Messe der Meister von morgen und dann zwei Wochen Urlaub im Betriebsferienheim Rastenberg, drei Jahre hintereinander. Nicht einmal bis zum Kleinen Inselsberg waren sie gekommen. Die Bungalows dort waren schon ausgebucht gewesen, bevor er den Ferienplatz beantragen konnte. Staatlich gelenkter Urlaub; wenn du keine Beziehungen hattest, musstest du das nehmen, was übrig blieb. Er wollte mit dem Auto quer durch Italien fahren, nach Spanien und wohin auch immer, und da würde er keinen der Genossen vorher fragen, wo und wann er anhalten durfte. Auch seine Frau nicht. Die bekam ja schon Herzrasen, wenn er nur vorschlug, in Leipzig das Gewandhaus zu besuchen. Ihr genügte der Dunstkreis der Kreisstadt. Und natürlich das Werk. Aber auch außerhalb des Büromaschinenwerkes und der an dessen Tropf hängenden Stadt Sömmerda gab es Leben. Wenn die das Werk abwickelten, was er nicht für ausgeschlossen hielt, wäre in der Stadt ohnehin alles vorbei. Aber das wollte ja niemand hören.
»Ich werde hingehen. Du musst nicht auf mich warten. Die Kollegen wollen dann nach der Arbeit noch auf ein Bier in den ›Thüringer Hof‹.« Er stand auf, küsste erst seine Tochter, dann seinen Sohn auf die Stirn, schaute seiner Frau tief in die Augen, legte ihr kurz die Hand auf die Schulter und ging.
»Aber du warst doch erst am Dienstag …«, sagte sie zögerlich.
»Ungewöhnliche Zeiten«, antwortete er lapidar. Kurz darauf zog er die Haustür hinter sich ins Schloss.
Sie würde ihn nie wiedersehen.
***
Der große Saal des Soemtron-Hauses, des seit 1963 bestehenden Sozial- und Kulturgebäudes des Werkes, war bis auf den letzten Platz besetzt. Die tief stehende Wintersonne schien durch die langen Fensterreihen und tauchte den Raum gemeinsam mit den mehreren Dutzend Neonröhren, die von der hohen sperrholzvertäfelten Decke strahlten, in ein gleißend helles Licht.
Auf der Bühne saß der Vorstand hinter einem mit einer etwas zu kurzen weißen Tischdecke bedeckten Tisch und schaute mit ernüchterten Mienen über die Köpfe der Belegschaft. Der Sprecher des Vorstandes stand an einem Stehpult neben dem Tisch, mit beiden Händen fest das helle Pressholz umklammernd, und redete. Im Saal hätte man eine Stecknadel fallen hören können.
Er war etwas zu spät dran gewesen und hatte sich nicht die Mühe gemacht, in den dichten Reihen nach einem freien Stuhl zu suchen. Stattdessen lehnte er mit verschränkten Armen an der Rückwand des Saales und ließ seinen Blick nach vorn schweifen. Hinter ihm hing das überlebensgroße sozialistische Arbeitervolk in Form einer riesigen Wandmalerei. Man konnte den erhobenen Zeigefinger Otto Knöpfers, des vor allem im Bezirk Erfurt bekannten Malers und Urhebers dieses Bildes, förmlich sehen. »Der Sozialismus siegt, du, Volk, hast es mit deiner Arbeitskraft und deinem Willen in der Hand.« Das Volk hingegen, das vor dem mit bunten Farben verewigten sozialistischen Realismus saß und dem Sprecher des Vorstandes lauschte, verkaufte seine Arbeitskraft lange an den Kapitalismus und hoffte inständig – das war in allen Gesichtern deutlich zu lesen –, dass dieser sie auch haben wollte.
»Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen uns mit unseren Produkten nicht verstecken. In ein paar Wochen werden wir mit der Produktion des K6330 beginnen. Damit können wir bei den Nadeldruckern den Leistungsbereich bis zu zweihundertvierzig Zeichen in der Sekunde abdecken. Das ist Weltmarktniveau.« Der Sprecher rang sichtlich mit sich. Er räusperte sich. »Für uns alle sind es schwierige Zeiten.« Pause. »Wie Sie wissen, sind uns mit der Währungsunion wichtige Partner, vor allem auf dem osteuropäischen Markt, abhandengekommen. Doch ich bin zuversichtlich, was den Ostmarkt angeht. Wir arbeiten seit Jahrzehnten vertrauensvoll zusammen. Man schätzt unsere Produkte. Dort werden sich neue Chancen auftun.«
Pause. Einige Zuhörer klatschten.
Ein tiefes Atmen war vom Pult zu hören. »Nichtsdestotrotz muss ich Ihnen mitteilen, dass wir aktuell die Lohn- und Gehaltszahlungen nur über einen weiteren Kredit absichern können.«
In den Zuschauerreihen regte sich Widerwillen.
»Damit ist auch unsere Jahresendprämie im Eimer!«, rief ein Mann aus dem Plenum.
Mehrere Stimmen wurden laut.
»Das ist der Anfang vom Ende.«
»Ihr habt uns verraten und verkauft.«
»Dafür haben wir das ganze Jahr geschuftet. Und was ist dabei herausgekommen?«
»Bitte, liebe Kollegen«, der Sprecher hob beschwichtigend die Hände, »es sind schwierige Zeiten, aber wir wollen und werden sie überstehen. Wir haben alles gemeinsam mit unseren Beratern durchdacht und werden das Unternehmen auf neue Füße stellen. Das Büromaschinenwerk wird künftig nur noch fünf Geschäftsbereiche haben. Wir konzentrieren uns auf unsere Kerngeschäfte. Damit steigen unsere Chancen am Markt.«
»Und was heißt das für uns Mitarbeiter?«, meldete sich einer der Männer aus der ersten Reihe zu Wort.
Der Sprecher des Vorstandes hob den Kopf, schaute kurz in die Runde und erklärte dann mit ruhiger Stimme: »Wir werden um einen radikalen Personalabbau nicht umhinkommen, wenn wir in der Marktwirtschaft bestehen wollen, leider.«
Unruhe machte sich breit. Alle redeten durcheinander.
»Was heißt das im Klartext?«, riefen ein paar Kollegen erbost.
»Für viertausendfünfhundertzweiundsiebzig Kolleginnen und Kollegen wird es im Werk keine Zukunft geben. Sie werden zum 30. Juni und 31. Dezember dieses Jahres entlassen«, antwortete der Redner angestrengt.
»Und was ist mit dem tollen neuen Konzept? Das greift hier wohl nicht, um Arbeitsplätze zu erhalten«, rief jemand wütend.
»Das ist das Konzept«, entgegnete ein anderer und lachte ironisch auf. »Arbeitsplatzabbau heißt es.«
»Das werden wir uns nicht gefallen lassen. Wir geben unser Werk nicht kampflos auf!«, schrie ein Dritter dazwischen.
Lautstarke Zustimmung.
»Das haben wir nun von dem schönen Westen. Am Ende finden wir uns alle auf dem Arbeitsamt wieder«, raunte eine neben ihm stehende Frau ihrer Nachbarin zu. »Genau so stand es in unseren alten Staatsbürgerkundebüchern. Erinnerst du dich? Arbeitslosigkeit, das böse Gesicht des Kapitalismus. Und wir schauen nun in diese Fratze und sitzen am Ende mit unseren Kindern auf der Straße.«
»So schlimm wird es schon nicht werden. Wir sind Facharbeiter, gut ausgebildet. Das ist auch im Westen was wert. Das können die sich gar nicht erlauben, so einen Betrieb wie unseren vor die Hunde gehen zu lassen. Du wirst sehen.«
Er verließ den Saal.
***
Die Sonne war untergegangen. Das gelbe schummrige Licht der Werksbeleuchtung ließ die grauen großen Gebäude, die wie bunt durcheinandergewürfelt und dicht an dicht auf dem riesigen Betriebsgelände standen, unwirklich erscheinen. In unmittelbarer Nähe hörte man ein lautes Quietschen. Die Kranbrücke des Kohlelagers musste bei dieser Kälte ganze Arbeit leisten. Irgendwo jaulte ein Motor auf.
Er hatte seine Arbeit pünktlich beendet. Als er das Gebäude verließ, hatte sein Freund im Treppenhaus gestanden und auf ihn gewartet. Schweigend liefen sie nebeneinanderher. Er konnte an seinem Atmen hören, dass der Freund mit sich kämpfte. Sie kannten sich lange genug. Aber er wollte nichts mehr erklären. Auf der Höhe des Gebäudes für Leiterplattenfertigung beschleunigte er seine Schritte. Die Zeit saß ihm im Nacken. Kurz darauf spürte er einen festen Griff an seinem Oberarm.
»Lass uns reden.« Der Freund drängte ihn in eine dunkle Ecke beim Tanklager.
Er löste sich aus der Umklammerung.
»So werde bitte vernünftig. Was du vorhast, ist Wahnsinn«, hörte er ihn sagen.
»Du hast es doch heute Mittag bei der Belegschaftsversammlung selbst gehört. Meinst du, ich drehe Däumchen und warte, bis die in spätestens einem Jahr die Werkstore schließen? Hältst du mich wirklich für so verrückt? Wir müssen unsere Chancen nutzen. Wann begreifst du das endlich?«, entgegnete er bemüht ruhig.
»Aber nicht so, Mensch! Du hast Kinder. Und was soll aus ihr werden?« Der Freund hielt inne, als erwartete er eine Antwort. Dann redete er weiter, wobei sich seine Stimme mehrfach überschlug, so aufgeregt war er. »Mann, wir sind damals für den Sozialismus angetreten. Wir hatten Pläne. Das hier war ein großes Ding, unser Ding. Und gut verdient haben wir auch.« Er schüttelte enttäuscht den Kopf. »Wegen mir hätte das alles nicht so kommen müssen. Ich habe diese vermaledeite Wende nicht gebraucht.«
Er schaute den Freund kalt an. »Du bist für etwas angetreten. Das, wofür du angetreten bist, ist lange Geschichte. Der ganze Scheiß-Sozialismus ist am Arsch, diese Gleichmacherei, der permanente Gruppendruck, die Mangelwirtschaft und das Geschwätz vom neuen Menschen. Der sozialistische Mensch, der auf Schritt und Tritt von den Genossen der Stasi bewacht wird. Was ist das für ein Staat, der seinem Volk so sehr misstraut, dass er es einsperrt und bewacht, wie man es mit einer Horde Vieh tut?«
»Sei still!« Der Freund schaute sich ängstlich um. »Du weißt nicht …« Ein paar Arbeiter kamen vorbeigelaufen. Als sie weit genug weg waren, redete er weiter. »Ich meine ja nur, das ist wie Anarchie, keiner weiß, wie er sich verhalten soll. Ich habe so etwas doch auch noch nie erlebt.«
Er lachte auf. »Siehst du, genau. Du weißt nicht einmal heute, ob die Genossen von der Stasi noch in den Ecken hocken und uns alle ausspionieren. Das ist alles so krank. Und wir sitzen hier wie die Kaninchen im Bau und warten, was passiert. Nicht mit mir, mein Lieber, nicht mit mir.«
»Lass uns wenigstens noch im ›Thüringer Hof‹ ein Bier trinken.« Die Stimme des Freundes war schlagartig friedlicher und verständnisvoller geworden. »Auf die guten alten Zeiten.«
»Ich kann nicht«, sagte er entschieden. »Für mich ist es an der Zeit. Mach’s gut.« Er drehte ab und wollte gehen. Der Freund hielt ihn fest.
»Du kannst uns nicht alleinlassen. Wir brauchen dich hier. Das alles muss neu aufgebaut werden«, sagte er nach Luft schnappend. Die Aufregung war ihm anzusehen. »Wenn alle klugen Leute einfach abhauen, geht die DDR, also die ehemalige, die geht vor die Hunde. Das ist unsere Heimat, Mensch!«
»Nein.« Er riss sich los und eilte mit entschlossenen Schritten davon. Hinter seinen Schläfen hämmerte es. Die kalte Luft brannte in seinen Lungen. Er musste sich beeilen. Dieser Idiot mit seinem moralischen Geschwätz würde ihn noch verraten. Hätte er bloß nichts gesagt.
Der kalte Beton knirschte unter seinen Schuhen. Er grub sein Gesicht tief in den Schal, erhaschte einen sanften Hauch ihres Parfüms, lächelte in sich hinein und steuerte auf das Tor 1 zu. Gerade als er die Hand zum Gruß erheben und sich von dem Wachmann verabschieden wollte, hörte er seine aufgebrachte Stimme.
»Bleib stehen, Mensch. Ich komme doch mit.«
Er hielt an und beäugte aus dem Augenwinkel das hell erleuchtete Wachgebäude, in dem der Mann hinter dem Fenster stand und sie beobachtete.
»Lass mich endlich in Ruhe, hörst du? Du stimmst mich nicht um«, raunte er ihm wütend zu.
»Mit deinem Egoismus kommst du nicht durch. Das verspreche ich dir«, entgegnete der Freund schroff. Ein heftiger Rempler gegen seine Schulter unterstrich die Worte.
Er wich zurück. »Tue nichts, was du später bereust.«
Der Freund drängte ihn seitwärts in Richtung Garagen und aus dem Sichtfeld des Wachmannes. »Du bist nicht Herr deiner Sinne.«
Er lachte gequält auf. »Ich war noch nie so klar. Und komm mir bloß nicht mit Egoismus. Meinst du wirklich, ich bin so naiv, nicht zu wissen, dass du mit deinen Kumpels von der Stasi gemauschelt hast? Du mit deinem heimlichen Getue hinter deinem Maschendrahtzaun. Du Verräter!«
Er spürte einen Schlag ins Gesicht und wie ihm Sekunden später das warme Blut aus der Nase schoss. Das war es also, das wahre Gesicht seines ältesten Freundes. Er dachte nicht einmal daran, zurückzuschlagen. »Das hast du wohl auf der Parteischule gelernt, was?«, fragte er provozierend. Dann flog er in den Dreck. Das Letzte, was er sah, waren die Scheinwerfer eines Gabelstaplers, der direkt auf ihn zurollte.
EINS
30. Juni 2019
Christian Gotthilf Salzmann lief langsam und bedächtig den Sömmerdaer Stadtring entlang. Seinen kragenlosen dunklen Rock hatte er geöffnet, und es fehlte nicht mehr viel, dann würde er die schwere Baumwolljacke ausziehen und über der Schulter hängend tragen. Die zugeknöpfte Weste und das aus dem Kragen hervorquellende Halstuch wärmten bereits genug. Noch dazu steckte er in hohen Strümpfen und einem schweren Beinkleid, der Culotte, die er bis zum heutigen Tage schon oft getragen und an die er sich so langsam gewöhnt hatte – sofern das Thermometer nicht gerade über dreißig Grad anzeigte. Neben ihm schritt seine Frau, Sophie Magdalena Salzmann, die im wahren Leben nicht die Seinige war, in einem bodenlangen dunkelgrünen Kleid mit schwarzen Applikationen und lächelte tapfer. Über ein Jahr waren sie nun als Werbeträger für den Sömmerdaer Thüringentag durch das ganze Land gereist, und heute, endlich, absolvierten sie den lang ersehnten Höhepunkt ihrer bedeutsamen Aufgabe, den großen traditionellen Festumzug des Landesfestes.
»Sömmerda! Sömmerda!«, grölten die zahllosen am Straßenrand wartenden Zuschauer frenetisch, und Salzmann nebst Gattin nickte freundlich, winkte und wechselte hin und wieder ein paar Worte mit dem begeisterten Publikum. Nur ab und zu hatte er Mühe, seine Mimik unter Kontrolle zu halten. Das waren die Momente, in denen Rufe wie »Was sinne das für Typen?« oder »Kommt jetzt der Faschingsverein?« zu ihm herüberdrangen.
Natürlich war er nicht der leibhaftige Christian Gotthilf Salzmann und mit dem 1744 in Sömmerda geborenen Pädagogen und Pfarrer seines Wissens auch nicht verwandt oder verschwägert, aber er vertrat diese wichtige historische Persönlichkeit mit Stolz und Würde, ganz, wie es sich geziemte. Er hatte sich auf diese Rolle vorbereitet, wusste, dass Salzmann, der Pfarrerssohn, eine glückliche Kindheit in der kleinen Stadt an der Unstrut verbracht hatte und seine Ideale der Erziehungsarbeit hier angelegt worden waren. Religion, körperliche Ertüchtigung, Sprachenkenntnis und Moral waren die Eckpfeiler der Salzmann’schen Pädagogik und hatten diesem zu seiner Zeit Weltruhm beschert. Prinzipien, die ihm einleuchteten und die er mit Überzeugung vertreten konnte. Dass Salzmann seine geliebte Frau Sophie im zarten Alter von vierzehn Jahren geheiratet hatte, war ein der damaligen Zeit geschuldetes Prozedere, dem maß er keine weitere Bedeutung bei. Die Pfarrerstochter aus dem benachbarten Schlossvippach war eine gute Frau gewesen, mehr musste er nicht wissen. Salzmann darzustellen fühlte sich für ihn richtig an, und wenn er heute an dem am Marktplatz stehenden Geburtshaus des Pädagogen vorbeiging, sah er diesen Ort mit anderen Augen. Der alte Salzmann war ihm in den vergangenen Monaten ein Stück weit nahegekommen, und er hoffte, dass er den Sömmerdaern seinerseits ihren großen Sohn wieder näherbringen konnte.
Es war ja auch beileibe nicht so, als hätte die kleine Stadt an der Unstrut in ihrer Geschichte eine Fülle an bedeutenden Persönlichkeiten hervorgebracht, wie es manch anderen Orten in Thüringen beschert war. Die Stadtväter hatten bei der Frage des Thüringentag-Paares, so vermutete er, eigentlich nur die Auswahl zwischen Salzmann und Johann Nikolaus von Dreyse gehabt. Selbstverständlich gab es da noch den ein oder anderen Namen, aber diese beiden waren die mit Abstand wichtigsten. Wobei Dreyse, der für die industrielle Entwicklung der Stadt zweifelsohne den Grundstein gelegt hatte, als Waffenerfinder und -fabrikant heutzutage in einem ganz anderen Licht stand als ein friedliebender Pädagoge. Er hatte sich darüber so seine Gedanken gemacht. Doch die Entscheidung war lange gefallen, und der Thüringentag, den Sömmerda in diesem Jahr das erste Mal ausrichten durfte, war ein voller Erfolg geworden. Er selbst hatte, so hoffte er zumindest, dazu beigetragen, dass manche Menschen die Stadt nun mit anderen Augen sahen.
Seit der Eröffnung auf der großen Bühne am Freitag, für die man eigens die Hauptkreuzung der Stadt abgesperrt und allerlei Prominenz herbeigeholt hatte, war Sömmerda gänzlich vom Landesfestfieber erfasst worden. Tausende von Leuten hatte es an diesem Wochenende hierhergezogen. Jung und Alt flanierten durch die Straßen, und in allen Ecken des ansonsten eher beschaulichen Ortes war fröhliche Ausgelassenheit zu spüren. Selbst in den Schrebergärten und in den Grünanlagen am Rande der Stadt dröhnten die Bässe des auf acht verschiedenen Bühnen dargebotenen Programmes, und nicht nur den älteren Semestern in den Gartenvereinen hatte die freakige Show von Radio Antenne Thüringen auf der Rentaco-Kreuzung zwei kurze Nächte beschert. Aber die Einheimischen nahmen es mit der ihnen ureigenen Gelassenheit, zumal die Stadt schon Schlimmeres erlebt hatte, als mit dem Thüringentag für ein Wochenende der Nabel der Thüringer Welt zu sein. Abgesehen davon streichelte es natürlich das Ego, wenn das gesamte Land auf die Sömmerschen schaute.
Dafür gab es ja auch allen Grund, denn die Angebote und Highlights konnten sich sehen lassen. Angefangen bei den klassischen Themenmeilen, die von keinem Thüringentag wegzudenken waren, bis zu den Vokalisten »Die Prinzen« und der rockigen Stefanie Heinzmann, die neben Tom Gregory und Culcha Candela den Massen eingeheizt hatten.
Neben der großen Bühne auf dem Obermarkt tummelte sich die Politik mit ihren Infoständen, und bekannte beziehungsweise weniger bekannte Lokalmatadore verschenkten Luftballons, Kugelschreiber und nette Worte. Am Anger hingegen ging es handfester zu. Dort standen Ritter, Bauern und Edelleute vor offenen Feuern und ließen mit Spanferkel und Met das Sömmerdaer Mittelalterflair aufleben. Die Handwerker, Gewerbetreibenden und Vereine präsentierten sich entlang der Erfurter Straße bis fast hinaus zum Martinipark, der mit einer hippen Streetfood-Area zu neuem Leben erweckt worden war. Überall herrschte ein buntes Getümmel aus vielerlei Ständen, spielte Musik und dufteten Köstlichkeiten. Alles, was Rang und den Beinamen »Thüringer« hatte, wurde aufgefahren, und wie es bei einem Volksfest nun mal üblich war, gab es auch ein Angebot an Jahrmarktsattraktionen wie Karussells, Luftballonverkäufer und Tombolas. Selbst das größte Riesenrad Thüringens, das schon beim letzten Thüringentag in Apolda gute Dienste getan hatte, war im lauschigen Stadtpark in direkter Nähe zum hiesigen Freibad aufgebaut worden. Und so schwebten die Schwindelfreien durch die Lüfte und genossen den traumhaften Blick auf die Stadt und auf das direkt unter ihnen liegende zauberhafte Areal aus Bonifatiuskirche, Pfarrhaus, Dreyse-Mühle und Rathaus, durch das sich der Altarm der Unstrut schlängelte und das wohl schönste Fleckchen der Stadt komplettierte.
Natürlich gab es einen ähnlich schönen Ausblick auch für all jene, die sich lieber auf festem Boden bewegten und deswegen anstelle des Riesenrades die hundertzweiunddreißig Stufen des Turmes der Bonifatiuskirche erklommen. Der drei Etagen hohe Turm aus dem Jahr 1464 war allein schon aufgrund seines Alters und der bis 1928 bewohnten, nahezu winzigen Wohnung des Stadtpfeifers nebst Familie und Schülern eine Attraktion. Wer sich zudem die Zeit nahm, das Innere von St. Bonifatius zu erkunden, dem offenbarte sich nicht nur ein kleiner Augenblick der Stille im allgegenwärtigen Trubel, sondern auch eine 1700 von dem Kölledaer Johann Georg Krippendorf erbaute Barockorgel, die an diesem Wochenende so manches Mal gegen das bisweilen schrille Gewimmel vor dem Kirchentor aufgespielt hatte. Die wirklich Eingeweihten nutzten die Zeit der offenen Kirche, um sich an den 1913 freigelegten sechsundzwanzig Wandbildern mit Darstellungen aus dem Alten Testament zu erfreuen. So konnte wirklich jeder zum Sömmerdaer Tag der Thüringer das finden, was er begehrte, und wenn es die neueste Eiskreation von Alessandro aus dem Eiscafé Venezia war.
Die Stadt hatte sich nicht lumpen lassen. Was Sömmerda an tausendeinhundertdreiundvierzigjähriger Geschichte aufzubieten hatte, war hervorgekramt worden, um es auszustellen und vorzuführen. Böse Zungen, die behaupteten, bis auf ein paar Getreide einbringende Ackerbauern hätte es an diesem sumpfigen Ufer der Unstrut nichts gegeben, wurden eines Besseren belehrt. Zugegeben, Sömmerda war historisch gesehen das, was man landläufig einen Spätzünder nannte, und bis auf marodierende napoleonische Truppen, die in diesem Landstrich quasi inflationär gehandelt worden waren, ein paar Hungersnöte, Stadtbrände und das unvermeidliche Unstrut-Hochwasser waren die Highlights der Stadtchronik eher spärlich gesät.
Möglicherweise wäre das beschauliche Städtchen in den Annalen der Geschichte sogar vergessen worden, wenn nicht einer seiner wohl größten Söhne, Johann Nikolaus von Dreyse, erfinderisches Geschick und unternehmerischen Mut bewiesen hätte. Spätestens durch das von ihm erfundene Zündnadelgewehr, das seinen größten Erfolg im Preußisch-Österreichischen Krieg von 1866 feierte, hatte die Stadt ihre Bestimmung gefunden, der sie bis heute die Treue hielt. Die von Dreyse 1841 gegründete Gewehrfabrik war hundertfünfzig Jahre lang das wirtschaftliche Herzstück einer ganzen Region. Und so bestaunten interessierte Gäste die original erhaltenen Dreyse-Gewehre, übten sich unter den Augen der Abgesandten des gleichnamigen Schützenvereins im Schießen der antiken Waffen oder frönten im zauberhaften Garten des Geburtshauses des Fabrikanten bei Kaffee und Kuchen zwischen von Sömmerader Bürgern gestifteten Rosen der ein oder anderen kulturellen Darbietung. Sömmerda verdankte dem Waffenfabrikanten Dreyse viel, und die im Volkshaus zur Industriegeschichte gezeigte Ausstellung ließ kaum einen Zweifel daran.
Das Ehepaar Salzmann war auf seinem Weg entlang der alten Stadtmauer inzwischen ein beträchtliches Stück vorangekommen. Das Interview mit der Moderatorin des MDR-Fernsehens, das als Medienpartner jeden Thüringentag begleitete, lag hinter ihnen und hatte sich unter den Klängen des Fanfarenzuges Bachra als wahre Herausforderung erwiesen. Doch Christian Gotthilf Salzmann, der seine Jacke nunmehr tatsächlich ausgezogen hatte, war erprobt genug, um auch dies mit Bravour zu meistern. Er führte den aus über hundert Bildern bestehenden Zug gelassen an und staunte zusehends über die Begeisterung der Menschen. Aus allen Ecken des Landes waren sie gekommen, um der Kreisstadt die Aufwartung zu machen. Die Landfrauen, Trachten- und Heimatvereine, die Kleintierzüchter, Gartenfreunde, Schulen, Kindergärten, die Lanz-Bulldog-Freunde aus dem Weimarer Land, die Trabbi-Fans aus dem nahen Kölleda, der Holzthalebener Hochzeitszug und viele mehr. Selbst Delegationen der Partnerstädte aus dem baden-württembergischen Böblingen und dem litauischen Kedainiai hatten sich in den Festumzug eingereiht.
Nicht weit hinter ihnen folgten dem Thüringentag-Paar die Thüringer Hoheiten, die bei keinem wichtigen Fest im Land fehlen durften. Die rot gewandete Erdbeerkönigin aus Gebesee hatte die mit einem lindgrünen Kleid geschmückte Kölledaer Pfefferminzprinzessin untergehakt, auch kulinarisch ohne Zweifel eine geschmackvolle Kombination. Dahinter reihten sich die Thüringer Weihnachtsbaumkönigin, die Rastenberger Kirschprinzessin, das Thüringer Apfelblütenmädchen und, als jüngstes Mitglied der blaublütigen Herrlichkeiten, die Kindelbrücker Gründelslochfee in den Festzug ein. Etwas abseits liefen, in ein intensives Gespräch vertieft, die Sömmerdaer Waidprinzessin und Kölledas Schutzheiliger, der allseits bekannte und beliebte Wippertus. Der echte St. Wigbert, ein Missionarsgefährte des Bonifatius, hatte, so sagte man, zu seinen Missionarszeiten auch das kleine Städtchen Kölleda besucht und mit ihm die gesamte Region bekehrt. 1404 hatten die Kölledaer Stadtväter ihn zum Schutzpatron erklärt, und bis heute huldigten sie dem Heiligen durch Auftritte einer zuweilen weniger frommen, aber dafür äußerst unterhaltsamen und umgänglichen Lebend-Replik. Die wiederum war gerade dabei, der Waidprinzessin die Qualitätsunterschiede der hiesigen Bratwurstanbieter darzulegen, die er vor Beginn des Umzuges hingebungsvoll getestet hatte. Denn was die Thüringer Leibspeise anging, verhielt es sich in Sömmerda nicht anders als im Rest des Thüringer Landes: Schlechte Kopien und unfähige Brater hatten keine Chance. Die zarte Waidprinzessin lächelte dazu, doch man konnte ihr ansehen, dass sie einem leckeren italienischen Eis und einem kalten Fußbad im Marktbrunnen den Vorzug geben würde, hatte sie als Repräsentation des traditionellen Waidanbaus in Sömmerda und Umgebung doch einen Thüringentags-Marathon hinter sich, der sich gewaschen hatte. Wippertus in seiner unnachahmlichen Art orientierte sich denn auch anders und scherzte mit den als Bauern verkleideten Zugteilnehmern, die auf einem mit Blumen und allerlei Grünzeug geschmückten Traktor hinter ihm herfuhren. Die lustige Truppe erinnerte mit ihrem Wagen an den im Jahr 1817 vom Sömmerdaer Pastor Martini eingeführten Ernteumzug, der nach überstandener Kriegsnot und der Missernte von 1816 die Dankbarkeit der Menschen zum Ausdruck bringen sollte. Er begründete damit eine Tradition, die, nur durch die Jahre der DDR unterbrochen, bis heute begangen wurde.
Salzmann zwinkerte der Waidprinzessin zu, die ihn fröhlich anlächelte, richtete seinen Kragen und hakte seine Frau Sophie Magdalena unter, wodurch er ein wenig in den Schatten rückte, den ihr Sonnenschirm warf. Sie winkte gelöst in die Massen, als hätte sie in ihrem Leben nie etwas anderes getan. Salzmann schaute sich um und spürte, wie die Anspannung der letzten Wochen so langsam der Freude und dem Stolz wich. Das war sein Sömmerda. Die Stadt hatte den besten Thüringentag aller Zeiten auf die Beine gestellt. Und es würde keine halbe Stunde mehr dauern, bis er darauf mit einem kalten Bier anstoßen konnte. Endlich.
***
»Unser Büromaschinenwerk«, seufzte sie. »Schau dir mal an, wie viel Mühe die sich mit dem Wagen gegeben haben.« Tränen traten ihr in die Augen. Auf die landwirtschaftlichen Bilder, die zuerst an ihnen vorübergezogen waren, folgten nun Bild für Bild die industriegeschichtlichen Etappen der Sömmerdaer Historie: die »Dreyse & Kronbiegel«-Metallwarenfabrik, Rheinmetall und, direkt vor dem Industriepark Sömmerda, das mit Spannung erwartete VEB Robotron Büromaschinenwerk »Ernst Thälmann«. »Mensch, wo die die alten Computer noch ausgegraben haben und unsere Drucker. Siehst du, da sind unsere Drucker. Meine Güte, was war das für eine schöne Zeit.« Sie wischte sich hektisch die Augen.
»Meine Plätzchenpresse habe ich heute noch. Die hätte ich ihnen borgen können.« Ramona lachte schrill. Sie schaute auf Andrea. »Du willst doch an einem so herrlichen Tag nicht etwa weinen?« Sie nahm Andrea in den Arm und drückte sie ganz fest. Dann fing sie an, sich im Takt der Musik zu bewegen, und forderte Andrea auf, es ihr gleichzutun.
»Du weißt, dass ich nicht tanzen kann«, schluchzte Andrea, wobei sich ein verschämtes Lachen auf ihrem roten Gesicht zeigte.
»Mit einem Schlückchen Prosecco wird es schon gehen«, jauchzte Ramona, nahm ihren Rucksack von der Schulter, fingerte zwei rosa Dosen heraus und hielt ihr eine davon unter die Nase. »Noch sind sie gut gekühlt, lang zu«, sagte sie auffordernd. »Lothar hat mir ein ganzes Dutzend eingepackt.« Sie zwinkerte ihr zu.
»Wo ist er eigentlich?«
»Bei seinem geliebten Kanuclub. Die kommen weiter hinten im Zug. Nun nimm schon.«
Andrea griff zu und schaute ungläubig auf die ihr für einen Prosecco ungewöhnlich erscheinende Verpackung. »Was du immer alles hast.« Sie zog an der Aufreißlasche, wartete das Zischen ab, setzte an und trank den Inhalt, ohne noch einmal Luft zu holen, aus.
»Na, hallo, du hast ja einen Zug drauf«, sagte Ramona überrascht.
»Das musste jetzt mal sein.« Sie unterdrückte einen Rülpser. »Nun geht es mir besser.« Andrea lächelte und zeigte auf den Festzug. »Jetzt guck, da sind die Mädels.« Sie wies auf eine Gruppe Frauen in blauen Dederonschürzen, die fröhlich nach links und rechts winkten. »Alle sind sie da.« Sie reckte den Hals, um mehr sehen zu können. »Gaby, Cindy und da ist Nadine. Unsere ganze alte Truppe aus der Abteilung C-Relais. Und Manuela ist auch dabei. Die war beim Rat der Stadt oder beim Kreis, erinnerst du dich?«
»Hey, ihr seht scharf aus in euren Kitteln!«, kreischte Ramona begeistert. »Ihr könntet gleich wieder antreten. Wie hat der Chef immer gesagt: ›Auf, auf Mädels, ohne euch schwankt die DDR.‹«
»Der Strom«, korrigierte Andrea. »Ohne unsere Entstörkombinationen schwankte der Strom.«
»Jetzt sei mal nicht päpstlicher als der Papst«, meckerte Ramona. »Die DDR hat auch geschwankt, bis zum Ende.« Dann grölte sie den ehemaligen Kolleginnen ein paar sozialistische Parolen entgegen. Die gingen lachend darauf ein.
»Für dich ist das alles ein Spaß«, entgegnete Andrea vorwurfsvoll.
»Na klar. Wir waren jung und ein tolles Grüppchen. Wir hatten eine gute Zeit im Werk. Alles andere …« Ramona winkte ab. »Was wussten wir schon? Jetzt, dreißig Jahre danach, ist von der DDR jedenfalls nicht mehr übrig als die Prägung von Hammer, Zirkel und Ehrenkranz auf meinem Facharbeiterzeugnis, und das hatte ich schon Jahre nicht mehr in den Händen.«
Andrea schaute geradeaus und schwieg.
»Du denkst immer noch an ihn, stimmt’s?«, fragte Ramona mitfühlend. »Entschuldige, es war dumm von mir, das alles so abzutun.« Sie schaute bedröppelt, und es war offensichtlich, wie unangenehm ihr diese Gedankenlosigkeit war.
»Weißt du, für mich hat sich damals eben alles geändert. Quasi über Nacht. Erst geht meine Heimat unter, dann verliere ich meinen Mann und schließlich auch noch meine Arbeit. Das war nicht leicht. Die Kinder waren noch klein.« Andreas Stimme zitterte. Sie biss sich auf die Lippe.
»Das weiß ich doch. Ich weiß.« Ramona drückte ihre Hand. »Aber das ist so lange her. Du hast ein neues Leben.«
Doch das hieß nicht, dass sie vergaß. Als wäre es gestern gewesen, erinnerte sie sich an den Polizisten, der die Vermisstenanzeige aufgenommen und ihr dabei beiläufig erklärt hatte, dass Frauen neuerdings nahezu täglich von ihren Männern verlassen würden. Schließlich hätten sich die Zeiten geändert. Sie hatte diese Logik nie verstanden. Nur weil ein Staat zu existieren aufgehört hatte, suchten die Männer das Weite? Nein. Ihr Mann jedenfalls gehörte nicht dazu, da war sie sicher. Schon allein wegen der Kinder nicht.
Später hatten sie behauptet, er hätte sich umgebracht. In die Unstrut sollte er gegangen sein, aus Verzweiflung über das Ende der DDR und aus Angst vor der Zukunft. Ihr Mann? Ausgeschlossen. Daran glaubte sie nicht. Niemals. Er war nicht der Typ dafür gewesen. Und: Es gab keine Leiche. Bei einem Selbstmord hätte man ihn irgendwann finden müssen. Die Unstrut gab ihre Opfer beizeiten wieder frei. Nein, ausgeschlossen. Es war anders abgelaufen, ganz anders. Die hatten ihn umgebracht. Entsorgt auch. Das Werk bot damals genügend Möglichkeiten: die Klärgrube für die alte Kühlemulsion, das Heizwerk und die großen Schmelzöfen für die Herstellung des flüssigen Aluminiums. Darin konnte man einen Menschen verschwinden lassen, ohne auch nur die kleinste Spur zurückzulassen. Das hatten die in der Geschichte der DDR unzählige Male gemacht. Von wegen, 1990 seien die alten Seilschaften längst alle gekappt gewesen. Die hatten noch viele Jahre später bestens funktioniert. Das hatte sie schon dutzendfach im Fernsehen gesehen.
Ihr Mann war vielen ein Dorn im Auge gewesen, so eigensinnig und unbeugsam, wie er war. Vielleicht hatte er auch tiefer im System gesteckt, als sie es sich vorstellen konnte. Darüber hatten sie nie geredet. Warum auch? Sie hätte es ohnehin nicht wissen wollen. Ihre Mordtheorie hatte sie nur ein einziges Mal offen geäußert, gegenüber seinem besten Freund. Aber der hatte gelacht, und es waren unschöne Bemerkungen wie »krankhafte Phantasie« und »blödsinnige Verschwörungstheorie« gefallen. Danach hatte sie lieber geschwiegen. Das Heulen der Kinder und ihre immer und immer wiederkehrenden Fragen waren nur allzu real gewesen. Die mitleidigen Blicke der Kollegen auch. Jeden Tag hatte sie am Fenster gestanden und gehofft, dass sich alles aufklären würde, dass er einfach wieder da wäre und um die Straßenecke gebogen käme. Manchmal ertappte sie sich heute noch dabei. Was für ein Blödsinn. Ihren Block hatte man längst abgerissen, und sie war schon vor Jahren aus dem Wohngebiet »Neue Zeit« in die Poststraße gezogen, aber sie konnte nicht anders. Was immer damals auch passiert war, tiefer Gram, Angst und Verzweiflung hatten sich seither so fest in ihre Seele eingegraben, dass das Leben wie Blei auf ihren Schultern lag.
Sie atmete schwer. Die Hitze machte ihr zu schaffen, kein Lüftchen wehte. Doch sie wollte keine Spielverderberin sein. Sömmerda hätte sich für seinen großen Auftritt kein schöneres Wetter wünschen können.
»Mone, hast du noch einen?«, fragte sie keck und stupste ihre Freundin an. Die lächelte erleichtert und hantierte sogleich an ihrem Rucksack.
Der Zug stoppte ungeplant, und die ehemaligen Werksfrauen kamen direkt neben ihnen zum Halten. Die Frauen herzten einander, machten Scherze, alberten herum. Der Prosecco wurde weitergegeben. Ramona war in ihrem Element, während Andrea still dabeistand und sich einfach freute, alle einmal wieder vereint zu sehen.
»Na freilich habe ich den Lothar geheiratet, und ihr glaubt es nicht, wir sind immer noch zusammen. Dass ich einmal anständig werde, hätte auch keiner gedacht, was?« Ramona lachte schallend auf. »Nee, Kinder haben wir nicht. Das war mir zu anstrengend. Und Lothar ist glücklicherweise die meiste Zeit bei seinem Kanuclub und paddelt über die Unstrut. Seit Kurzem ist er auch noch einer der Organisatoren des jährlichen Raftings. Ich sehe ihn also kaum …«
Unvermittelt brach sie mitten im Satz ab und starrte auf die gegenüberliegende Straßenseite, wo sich dicht an dicht die Zuschauer drängten.
»Was ist los? Hast du dich an deiner eigenen Frechheit verschluckt?«, witzelte eine der Frauen laut.
Ramona sagte nichts, kniff die Augen zusammen und schwenkte suchend den Kopf hin und her.
»Das war Tina. Ganz sicher. Neben der Frau mit dem Strohhut dort drüben«, erklärte Cindy resolut.
»Du hast sie auch gesehen?« Ramona stellte sich auf die Zehenspitzen und beugte ihren Oberkörper leicht nach vorn, so als stärkte das ihr Sehvermögen. »Ich war mir nicht sicher. Aber wenn du sie auch gesehen hast.«
»Tina. Bettina Fanke, na klar. Das war sie, eindeutig. Aber wo ist sie hin?« Die schmächtige Cindy hüpfte auf und ab, um über die Köpfe der Leute sehen zu können, ging mehrere Meter an den Zuschauerreihen entlang und rief immer wieder ungeniert Tinas Namen in die Menge.
Die anderen Frauen hatten sich nun ebenfalls in Richtung der Zuschauergruppe gewandt, in deren Mitte Bettina Fanke gestanden hatte.
»Bettina, wo bist du?«, stimmte Ramona in Cindys Rufe ein. »Wo bist du?«
»Seid ihr sicher, dass es Bettina war?«, fragte Andrea. »Vielleicht sah die Frau ihr nur ähnlich?«
»Ich weiß, was ich sehe. Sie sah noch genauso aus wie früher«, raunzte Cindy ungehalten. »Aber wenn sie schon in der Stadt ist, wieso kommt sie nicht zu uns rüber? Sie muss uns doch auch gesehen haben.«
»Wer von euch hat eigentlich noch Kontakt zu ihr?«, fragte Nadine.
Sie schauten einander mit ratlosen Gesichtern an.
»Also ich nicht«, gestand Ramona als Erste. »Seit sie damals verschwunden ist, habe ich nichts mehr von ihr gehört, geschweige denn gesehen. Schade eigentlich, Bettina war wirklich nett.«
»Die hat ihre Möglichkeiten genutzt.« Cindy klatschte in die Hände. »Hat bestimmt mit dem erstbesten Kerl in den Westen rübergemacht, so verrückt, wie die war.«
»Also weißt du«, erwiderte Gaby vorwurfsvoll.
»Ist doch wahr. Die hat sich nicht um uns geschert. Die war einfach weg und hat uns mit dem ganzen neuen Scheiß hier sitzen gelassen. Wisst ihr noch, wie die im April 1991 unsere ganze Abteilung plattgemacht haben? Vierhundertdreißig Leute. Bis auf ein paar wenige Hanseln mussten alle gehen.« Cindy klang wütend. »Aber da war die gute Tina lange verschwunden. Das musste sie nicht mehr kümmern.«
»Ich erinnere mich daran, als wäre es gestern gewesen«, antwortete Ramona. »Wir haben diese Scheiß-Entlassungslisten kontrolliert, weil wir dachten, die ziehen uns über den Nuckel.«
»Und? Was hat es genützt?«
Ramona zuckte mit den Schultern. »Am Ende nicht viel. Vor allem wir Frauen waren die Gekniffenen.«
»Ja, aber Bettina?«, bemerkte Andrea leise. »Schon vorher kam sie von einem Tag auf den anderen nicht mehr in die Kantine.«
»Hat ja auch nicht mehr so wild geschmeckt, der Westfraß«, kreischte Nadine, der man die Wirkung des Perlweins deutlich an ihren geröteten Wangen ansehen konnte.
Die anderen lachten.
»Es muss 1990 gewesen sein – oder sogar schon ’89? Ihr Bereich stand sofort auf der Kippe. Ihr wisst schon«, murmelte Ramona vielsagend.
»Du hast recht.«
»Freilich.«
»Und sie hat sich nie wieder gemeldet, bei keiner von euch?«
Alle verneinten.
»Seltsam. Warum steht sie dann dreißig Jahre später zum Thüringentag bei uns in Sömmerda und taucht ab, sobald wir sie entdecken?«, fragte Cindy mürrisch.
Die Unterhaltung der Frauen wurde durch aufgeregte Schreie unterbrochen. Leute aus den Zuschauerreihen liefen durcheinander, vermischten sich mit den Teilnehmern des Zuges. Das Gedränge um sie herum wurde dichter. Irgendwann rief jemand: »Feuer!« Und: »Leubingen brennt!«
Campingstühle, die die Schaulustigen an den Bürgersteigen aufgestellt hatten, um bequem sitzend dem Schauspiel folgen zu können, wurden zusammen- und kurzerhand wieder auseinandergeklappt und Getränke, Sonnenschirme, Kleinkinder aufgeregt hin und her getragen. Irgendwo fiel ein Schuss. Ein wild gewordenes Pferd galoppierte gleich darauf durch die Menschenmenge. Niemand wusste so recht, was passiert und welcher Gefahr man gerade ausgesetzt war, aber kaum einer wollte seinen Platz räumen, den sich die meisten schon Stunden vor Beginn des Festumzuges gesichert hatten. Das Gerücht eines Anschlages machte die Runde, aber selbst ein vermeintlicher Terrorist konnte die hartgesottenen Fans nicht schrecken. Was nicht sein durfte, konnte nicht sein. Da hatte Sömmerda schon ganz andere Gefahren überstanden – und wenn ohnehin nur der Ortsteil Leubingen brannte, konnte man das getrost verschmerzen.
Es war natürlich nicht die drei Kilometer entfernt liegende Gemeinde, die den Flammen anheimgefallen war, sondern das Zugbild, mit dem die Leubinger den Umzug bereichert hatten. Ein Handwagen des dortigen Heimatvereins, ein Relikt aus dem VEBIFA Motorenwerke Nordhausen, im Volksmund auch »Klaufix« genannt, hatte Feuer gefangen. Die überall in der Innenstadt verteilten Einsatzkräfte der Feuerwehren brachten das Problem schnell unter Kontrolle, und auch wenn Leubingen nun um eine Attraktion ärmer war, konnte sich der Festumzug geraume Zeit später wieder in Bewegung setzen.
Bei den Frauen des ehemaligen Büromaschinenwerkes hatte die Unterbrechung in Kombination mit dem ausgiebigen Genuss des nunmehr warmen Proseccos zu einer Ausgelassenheit geführt, der sich auch Andrea nicht mehr entziehen konnte. Fröhlich reihte sie sich gemeinsam mit ihrer Freundin Ramona bei den alten Kolleginnen ein, winkte in die Menge, warf Bonbons und freute sich, einmal wieder die Sicherheit und Vertrautheit ihres alten Kollektivs zu spüren. Bettina Fanke war vergessen.
Vorerst.
ZWEI
Friedhelm Bernsen lag im Dämmerlicht. Er hatte die Bettdecke bis zu seiner Nase gezogen und sich kerzengerade darunter ausgestreckt. Seine Arme schienen so eng an seinem Körper anzuliegen, dass man ihre Konturen unter der Decke kaum erahnen konnte. Sein strohblonder Wuschelkopf ruhte mittig auf dem frisch gestärkten Kopfkissen und wurde von den Sonnenstrahlen, die durch den schmalen Spalt zwischen den beiden hellgrünen Vorhängen in das Zimmer des Sömmerdaer DRK-Krankenhauses fielen, gleich einem Heiligenschein in Szene gesetzt. Auf seinem Nachtschrank standen ein volles Glas Wasser und ein Medikamentenbecher, der zur Hälfte mit Tabletten gefüllt war. Bis auf das Ticken der Wanduhr war es still. Nur hin und wieder stöhnte Bernsen leise auf, atmete schwer und nickte wieder weg.
»Ach du lieber Gott, nein, oh nein, mein armer, armer Friedhelm«, jammerte seine Frau, die neben ihm am Bett saß und jeden seiner Atemzüge verfolgte. Zu mehr als der Erhaltung grundlegender Körperfunktionen schien ihr Mann nicht fähig zu sein. »Was haben sie dir angetan? Ich habe es immer gewusst. Irgendwann musste es ja so weit kommen. Dieser anstrengende Beruf, die große Verantwortung, und das alles so weit weg von zu Hause, im Osten.« Sie rümpfte die Nase. »Ach Friedhelm, was soll nun werden?«
»Rotfeder«, hauchte Bernsen mit dem Pathos eines Sterbenden. Dabei blinzelte er aus fast geschlossenen Augenlidern, so als könnte er nicht die Kraft aufbringen, sie zu heben. Sein zweites »Rotfeder« wurde von einem schmerzerfüllten Ächzen verschluckt.
Seine Frau fing leise an zu weinen.
Das Rauschen einer Toilettenspülung war zu hören. Dann entleerte jemand geräuschvoll den Inhalt seiner Nase. Kurz darauf wurde ein Wasserhahn aufgedreht, und eine Stimme drang aus dem zum Krankenzimmer gehörenden Bad: »Das klebt ja wie Schifferscheiße!«
Das Rauschen des Wassers wurde lauter. Schließlich endete es, und die Badtür ging schwungvoll auf. »Friedhelm, ich hawe mal dein Duschbad jenommen. Die Rotze jing nich aus dem Waschbecken. Und du weest doch, wie die Schwestern sind. Sehen zwar scharf aus, die Weiber, aber scheddern könn die, nee, nee, nee.«
Der Mann, der aus dem Bad ins Zimmer trat, trug eine im Flecktarnmuster gehaltene Jogginghose, die irgendwo unter seinem dick hervorquellenden Bauch klemmte und sich überdies, hervorgerufen durch seine geringe Körpergröße, in breiten Falten an seinen Knöcheln aufwarf. Ein weißes geripptes Unterhemd, das keinen Raum für Spekulationen über die schlecht gemachte Tätowierung auf seinem rechten Oberarm ließ, und ein Paar Adiletten komplettierten das Bild. Seine nassen Haare hatte er streng nach hinten gekämmt, was zum Überdecken seiner Halbglatze nur bedingt taugte. Dafür umgab ihn ein Duft von Rasierwasser, dessen Strenge einem den Atem nahm. Als er sah, dass Bernsen nicht mehr allein war, stutzte er, musterte die für ihn fremde Frau ungeniert, derweil er mit Hilfe seiner Mimik eine Beurteilung ihres Äußeren vornahm, und wackelte schließlich zurück zu seinem Bett. Ein »Tach och« begleitete seine Schritte.
Die Rotfeder würdigte den Mann keines Blickes, sie hatte nur Augen für ihren Friedhelm. Schweigend saß sie am Bett und starrte ihn an.
Bernsen hob zaghaft das rechte Lid. »Rotfeder, du verpasst deinen Zug«, wisperte er.
»Ich fahre nicht ohne dich«, entgegnete sie entschieden. »Und wenn es dir so schlecht geht, bleibe ich natürlich bei dir. Eine Frau muss an der Seite ihres Mannes sein, vor allem, wenn der sich in fragwürdiger Gesellschaft befindet.« Sie machte ein abschätziges Gesicht in Richtung seines Bettnachbarn.
»Nein«, krächzte Bernsen. »Du fährst. Das tut dir gut. Die Betreuung deiner kranken Mutter hat dich so mitgenommen.«
»Na freilich, jute Frau«, mischte sich Bernsens Zimmergenosse ein, der ihre Spitze offenkundig nicht verstanden hatte. »Die janze Scheiße ist doch och schon bezahlt, und ich passe schon off den guten alten Friedhelm hier off. Sie werden sehen, morjen springt der schon wieder durch die Hütte.«
In Bernsens Bettdecke kam leichte Bewegung. Er knurrte.
»Ja, Muttis Beinbruch war nicht schön für mich, aber …« Die Rotfeder verstummte, als es an der Tür klopfte und Timo Kohlschuetter, Bernsens Teamkollege, eintrat.
»Noch ’n Bulle, wa?«, murmelte der Zimmergenosse. »Hier muss irgendwo ein Nest sein.« Er lachte dreckig.
Die Gesichtszüge der Rotfeder entspannten sich, als würde sie in Kohlschuetter ihren Retter erblicken. »Gut, dass Sie da sind, Herr Kohlschuetter«, sagte sie. »Friedhelm möchte, dass ich ihn in seinem Zustand allein lasse.« Ihre knarzende Stimme hatte einen jammernden Tonfall angenommen.
Kohlschuetter, dem sich bei dem Geräusch jedes Mal die Nackenhaare aufstellten, konnte die Situation nicht erfassen, wähnte sich aber in einem Minenfeld. Er nickte verhalten. »Na, wenn er sagt, dass er zurechtkommt«, antwortete er vorsichtig.
»Kohlschuetter passt auf mich auf«, hauchte Bernsen unter der Bettdecke. »Geh. Und gute Reise.« Ein angestrengtes Hüsteln folgte.
»Aber ich kann doch nicht …« Die Rotfeder erhob sich von ihrem Stuhl, fasste nach Bernsens Hand, schaute unschlüssig auf ihren Mann und zu Kohlschuetter.
»Freilich!«, dröhnte der Mann im Nachbarbett.
»Es ist bestimmt besser so«, pflichtete Kohlschuetter ihm bei, ohne zu wissen, was eigentlich los war.
»Ach, Herr Kohlschuetter.« Sie seufzte schwer. »Da haben Friedhelm und ich so lange auf unsere gemeinsame Kur gewartet. Drei Wochen Sylt, nur wir beide. Und nun das …«
Kohlschuetter ließ sich seine Unkenntnis nicht anmerken. Dass Bernsen einen Kurantrag gestellt hatte, war ihm neu. Von einer mehrwöchigen Fehlzeit war auch nie die Rede gewesen. Aber da sich der Kollege bezüglich seines eher fortgeschrittenen Alters ohnehin immer wie eine Mimose aufführte und für seine Alleingänge bekannt war, konnte es gut sein, dass er ihm diese Auszeit verschwiegen hatte, um keine blöden Nachfragen zu provozieren. Einfach nicht zur Arbeit erscheinen zu wollen, um ihm keine Details mitteilen zu müssen, und es anderen zu überlassen, ihn über seine Abwesenheit zu informieren, passte gut zu dem autistischen Psychopathen, der Bernsen seiner Meinung nach war. Er konnte das beurteilen, schließlich arbeitete er inzwischen lange genug mit ihm zusammen. Warum Bernsen jetzt aber nicht auf dem Weg nach Norden war, sondern im Krankenhaus Sömmerda auf der Inneren lag und peinlich vor sich hin wimmerte, dafür hatte er keine Erklärung. Erst in der letzten Woche hatten sie die Ergebnisse ihrer regulären polizeilichen Gesundheitstests bekommen, und Bernsen hatte den seinen nicht nur per Rundmail an die gesamte Polizeiinspektion geschickt, sondern, um ganz sicherzugehen, dass auch der Hausmeister über seinen hervorragenden Gesundheitszustand Bescheid wusste, den Inhalt laut auf den Fluren rezitiert. Da sie aktuell keinen Fall hatten und gerade bloß den liegen gebliebenen Schreibkram abarbeiten mussten, konnte er sich während des Dienstes ebenfalls nicht verletzt haben. Was Bernsen allerdings am Wochenende getrieben hatte, das er normalerweise in seiner Heimatstadt Bremen verbrachte, entzog sich, wie immer, Kohlschuetters Kenntnis. Irgendetwas musste passiert sein, denn umsonst begab sich niemand in ein Krankenhaus. Und so, wie seine Frau dreinblickte, konnte man den Eindruck gewinnen, er käme hier nie wieder lebendig heraus.
»Fahren«, nuschelte Bernsen.
»Jenau«, sagte der Nachbar.
»Ich behalte ihn im Auge und rufe Sie sofort an, wenn er Blödsinn macht«, versprach Kohlschuetter. »Ist kein Problem. Ich betreue ihn ja sonst auch unter der Woche.«
Bernsens Beine zuckten unter der Bettdecke.
Die Rotfeder lächelte erneut. »Ach Friedhelm, wenn du Herrn Kohlschuetter nicht hättest. Ich danke Ihnen ganz herzlich. So eine Kur ist schon teuer, und wenn wir beide nicht fahren, na ja. Sie melden sich jeden Tag, ja? Und Sie passen auch auf, dass er anständig isst, nicht zu viel von der Thüringer Wurst und diesen Convenience-Produkten. Geben Sie ihm ruhig etwas von Ihren Sachen, Herr Kohlschuetter, Obst, Gemüse, Körner. Denken Sie bitte auch daran, Cola ist für ihn strikt tabu. Wasser aus der Leitung, aber nicht zu kalt. Zwingen Sie ihn auch mal zu einer Pause. Er achtet ja nie auf sich, immer nur auf andere. Damit muss nun endlich mal Schluss sein. Herr Kohlschuetter, Sie tragen die Verantwortung.«
»Hey Friedhelm, was sollste nich esse? Konwinenz?«, plärrte der Mann im Nachbarbett. »Das hört sich ja wie eine Krankheet an.« Er grunzte. »Ah anständches Stückchen Wurscht braucht der Kerl, damit er wieder zu Kräften kommt. Un a Rungsen Speck.«
Die Rotfeder schaute pikiert.
Kohlschuetter, der sich durch die Worte von Bernsens Frau irgendwie an die Belehrungen seiner alten Kindergärtnerin erinnert fühlte, bemühte sich um einen besorgten und vertrauenswürdigen Blick. Cerealien, Wasser und Relaxen, so sollte also Bernsens Programm für die nächsten Wochen aussehen. Das konnte der Kollege haben, wobei das mit dem Relaxen für Bernsen eigentlich nie ein Problem war. In Sachen »Wie schiebe ich anderen meine Arbeit zu« brauchte der wirklich keine Nachhilfe.
Mit Tränen in den Augen tätschelte die Rotfeder Bernsens Gesicht, gab ihm einen Kuss auf die Stirn, drückte Kohlschuetter fest die Hand und eilte davon. Die Tür war noch nicht richtig hinter ihr ins Schloss gefallen, da verlangte Bernsen mit erstaunlich kräftiger Stimme: »Ingo, guck, ob sie wirklich weg ist.«
Der Zimmergenosse sprang überraschend schnell auf und tapste barfüßig hinaus auf den Flur.
»Was ist los? Warum haben Sie mich so früh hierher ins Krankenhaus bestellt, wenn Ihre Frau voller Sorge ist, dass Sie den morgigen Tag nicht überleben?«, blaffte Kohlschuetter Bernsen an. »Und warum sehen Sie plötzlich so erstaunlich fit aus?«
Bernsen antwortete nicht.
Er rührte sich erst, als Ingo von seiner Mission zurückkam und »Die Luft ist rein« vermeldete. Unversehens schleuderte Bernsen seine Bettdecke zurück, hüpfte vollständig bekleidet aus dem Bett, fuhr sich kurz durch seine Mähne, strich sein Fischerhemd glatt und machte sich daran, seine unter dem Bett stehenden Schuhe anzuziehen. Im selben Moment klingelte sein Handy. Ängstlich betrachtete er das Display, atmete durch und nahm das Gespräch entgegen. Nachdem er sich gemeldet hatte, schaute er Kohlschuetter an und formte mit seinen Lippen den Namen »Claudi«. Dann hörte er schweigend zu und legte schließlich grußlos auf. »Wir müssen los, Kollege«, beschied er Kohlschuetter. »Unschöne Kiste, tote Frau.« Er wiegte den Kopf. »Eindeutig. Na ja.« Ein scheeler Blick zu seinem Bettnachbarn folgte.