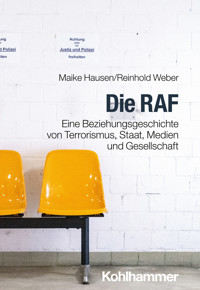
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Kaum ein anderes politisches Thema hat die "alte" Bonner Bundesrepublik so lange und so intensiv beschäftigt wie der Terror der Roten Armee Fraktion (RAF). Von ihrer Gründung im Jahr 1970 bis zur selbstverkündeten Auflösung im Jahr 1998 - also fast 30 Jahre lang - hat die RAF die Republik in Atem gehalten. Und noch immer tauchen neue Hinweise auf, werden ehemalige Mitglieder festgenommen. Der Band bettet die RAF in den Kontext der bundesrepublikanischen Geschichte seit den 1970er-Jahren ein und fragt nach den Interaktionen zwischen Terroristen, Staat, Medien und Gesellschaft. Er verbindet zeithistorische und politologische Ansätze zu einer analytischen Gesamtschau der RAF und fasst die aktuellen Forschungsergebnisse bündig zusammen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
00_Titelei
1 Einleitung
2 Forschungslage
3 Die Geschichte der RAF – drei Generationen des »bewaffneten Kampfes«
3.1 Die erste Generation – Terrorismus der Post-Revolte
3.2 Die zweite Generation – der Deutsche Herbst
3.3 Die dritte Generation – neue Phase des »bewaffneten Kampfes« und Zerfall
4 Die Mythen der RAF – Inszenierungen zum Selbsterhalt
4.1 Selbstheroisierung als »revolutionäre Avantgarde«
4.2 »Bewaffneter Kampf«
4.3 »Vernichtungshaft« und »Isolationsfolter«
4.4 Der Mythos der »Gefangenenmorde«
5 Deutsche Befindlichkeiten: Analysen und Deutungen
5.1 Zeitgenössische Gesellschaftsanalysen
5.2 Individualpsychologische Ansätze und Personenmythen
5.3 Die RAF und die »Frauenfrage«
5.4 Wege in die Gewalt
6 Staat und Gesellschaft im Zeichen des Terrorismus
6.1 Anti-Terror-Politik und Innere Sicherheit
6.2 Justizskandale, das Gericht als Bühne und Krisenstäbe
6.3 Gesellschaft im Zeichen der Terrorbekämpfung
6.4
Moral panic
, Sympathisantendiskurs und gesellschaftspolitische Polarisierungen
6.5 »Kollateralschäden« und Sprachbilder des Krieges
7 Linksterrorismus in transnationaler Perspektive
7.1 Die RAF als Teil des »Kampfes in den Metropolen«
7.2 Naher Osten: Militarisierung und Rückzug
7.3 Italien: »Traumland der Revolution«
7.4 Frankreich: Europäische Guerilla gemeinsam mit der
Action directe
7.5 Wie international war die RAF?
8 Ausblick: Was bleibt von der RAF?
8.1 Die RAF als (pop-)kulturelles Phänomen
8.2 Ein Erinnerungsort für die RAF?
8.3 Die RAF als Referenzrahmen für »alten« und »neuen« Terrorismus
Literatur
Abbildungsverzeichnis
Seitenangaben der gedruckten Ausgabe
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
Cover
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
Impressum
Inhaltsbeginn
Kohlhammer
Die Autoren
Dr. Maike Hausen ist Leiterin der Abteilung „Medien“ der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, wo sie unter anderem die wissenschaftliche Zeitschrift „Bürger & Staat“ verantwortet. Die Historikerin ist Lehrbeauftragte an den Universitäten Mannheim und Tübingen.
Prof. Dr. Reinhold Weber ist Stellvertretender Direktor der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. Er lehrt am Seminar für Zeitgeschichte der Universität Tübingen und ist ordentliches Mitglied der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg.
Maike Hausen/Reinhold Weber
Die RAF
Eine Beziehungsgeschichte von Terrorismus, Staat, Medien und Gesellschaft
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
Umschlagabbildung: Sitzgelegenheiten im Foyer des ehemaligen Mehrzweckgebäudes der Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim (picture alliance/dpa/Marijan Murat)1. Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühlstr. 69, 70565 [email protected]
Print:ISBN 978-3-17-029218-5
E-Book-Formate:pdf:ISBN 978-3-17-029219-2epub:ISBN 978-3-17-029220-8
1 Einleitung
Wohl kein Thema hat die Deutschen seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs so lange und so intensiv beschäftigt wie der Terrorismus der Roten Armee Fraktion (RAF). Der Schrecken, den die RAF mit ihren Verbrechen verbreitet hat, hat sich tief in den kollektiven Erfahrungshaushalt der Deutschen eingegraben. Der Terrorismus der RAF war die größte innenpolitische Herausforderung der »alten« Bonner Republik und hat das Land nachhaltig verändert. Innerhalb der fast 30 Jahre ihres Bestehens, von ihrer Gründung im Jahr 1970 bis zur selbstverkündeten Auflösung im Jahr 1998, hat die RAF das Land immer wieder in Atem gehalten.
Keine andere politisch motivierte und organisierte Gruppierung in Deutschland hat eine ähnliche Bilanz des Schreckens hinterlassen. Insgesamt 34 Mordopfer gehen auf das Konto der RAF, davon zehn Vertreter von Staat, Justiz und Industrie sowie sieben Soldaten bzw. Angestellte der US-Streitkräfte in der Bundesrepublik. Darüber hinaus wurden zwölf Polizei- oder Zollbeamte, vier Fahrer bzw. Begleiter sowie eine völlig unbeteiligte Frau ermordet. Hinzu kommen deutlich über 200 zum Teil schwer Verletzte, geschätzte 250 Millionen Euro Sachschaden sowie allein über 30 Banküberfälle, die der RAF sicher zugeschrieben werden können. Die Terroristen bedienten sich rund 100 konspirativer Wohnungen und stahlen etwa 200 Autos. Nicht zutage treten in dieser Aufzählung die psychischen Folgen für die Opfer und deren Angehörige sowie für ›einfache‹ Passanten, die durch bloßen Zufall in das Geschehen einbezogen wurden, weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort waren.
Aber die RAF hat nicht nur Individuen ermordet oder schwer geschädigt, sondern auch Staat, Justiz, Politik und Gesellschaft verändert. Die Maßnahmen gegen den Terrorismus aufseiten des Staates waren gewaltig. Enorm war auch der Aufwand für die (Untersuchungs-)Haft und für die Gerichtsverhandlungen gegen die RAF-Mitglieder. In Stuttgart-Stammheim wurde eigens für die RAF-Prozesse ein neues Mehrzweckgebäude neben der Justizvollzugsanstalt errichtet. Die Baukosten für die Erweiterung beliefen sich auf rund zwölf Millionen D-Mark. Mit seinem Hochsicherheitstrakt wurde »Stammheim« zur Chiffre und zum in Beton gegossenen Sinnbild staatlicher Gewalt – je nach zeitgenössischer Perspektive verstanden als »wehrhafte Demokratie« oder als Teil der »staatlichen Repressionsmaschinerie«. »Stammheim«, die Trutzburg auf dem ehemals »schwäbischen Rübenacker« (Spiegel, 19.05.1975), wurde zum politisch und moralisch aufgeladenen Symbolbegriff der bundesdeutschen Rechtsgeschichte. Das hatte mit der Prominenz der RAF-Häftlinge zu tun, aber auch mit der Doppelfunktion als Justizvollzugsanstalt und Gerichtsort sowie mit der zeitlichen Parallelität von Justizvollzug und Verschärfung der Strafprozessordnung. Bemerkenswert war der Prozess in Stammheim auch, weil nach einem zweijährigen Strafverfahren zwar ein Urteil gesprochen wurde (u. a. gegen zwei Angeklagte, die bereits nicht mehr lebten), das jedoch nie rechtskräftig wurde, weil die noch lebenden Verurteilten vor der Entscheidung über eine Revision des Urteils Suizid begingen.
Abb. 1:Deutscher Herbst – das brutale Morden der RAF hält die Republik in Atem. Mit Fahndungsplakaten wird – wie hier in Karlsruhe – nach den RAF-Terroristen gesucht.
Als Reaktion auf die terroristische Bedrohung wurden zahlreiche neue Gesetze erlassen und das bundesdeutsche Strafrecht sowie die Strafprozessordnung mit Änderungen versehen, die zum größten Teil heute noch gültig sind. Wegen des Vorwurfs der Mitgliedschaft oder Unterstützung einer kriminellen bzw. terroristischen Vereinigung (§§ 129 und 129a StGB) kam es zu tausenden von Ermittlungsverfahren. Mehr als eine Million sichergestellte Objekte wurden gesammelt, etwa elf Millionen Seiten Ermittlungsakten wurden gefüllt. Vor allem aber bleibt die Erinnerung der Bevölkerung an ein kollektives Bedrohungsgefühl und an höchst kontroverse Debatten über das spannungsreiche Verhältnis von Sicherheit und Freiheit. Durch die islamistisch motivierten Anschläge seit »9/11«, den rechtsextremen Terror unter anderem durch den »Nationalsozialistischen Untergrund« (NSU) und zuletzt durch neue Fahndungserfolge zur dritten RAF-Generation hat beides an aktuellem Bezug gewonnen. Immer wieder wird die Frage aufgeworfen, was die bundesdeutsche Gesellschaft aus der Auseinandersetzung mit dem Terrorismus der 1970er-Jahre ›gelernt‹ hat. Geblieben sind vor allem auch zahlreiche offene Fragen zur RAF und zu einzelnen ihrer Verbrechen.
Die RAF ist keinesfalls ein abgeschlossenes Kapitel in der Geschichte der Bundesrepublik. Das liegt nicht nur am Reiz der revolutionären Romantik, die manchen »Alt-68er« angesichts der Thematik überkommen mag. Vielmehr wird das öffentliche Interesse an der RAF nicht abebben, solange Opfer oder deren Angehörige leben und solange Täter sowie deren Verantwortlichkeiten nicht detailliert bekannt sind. So sind etwa die Mordanschläge auf Generalbundesanwalt Siegfried Buback (1977), den Vorstandssprecher der Deutschen Bank Alfred Herrhausen (1989) oder den Präsidenten der Treuhandanstalt Detlev Rohwedder (1991) bis heute nicht vollständig aufgeklärt. Die heftigen Kontroversen um die RAF-Ausstellung in Berlin (2003), die Diskussionen um die Freilassung von Brigitte Mohnhaupt und die Begnadigung von Christian Klar (2007) bzw. die Debatte bei seiner Haftentlassung (2009), der neu aufgerollte Prozess gegen Verena Becker in Stammheim (2010) und zuletzt die Festnahme von Daniela Klette (2024) belegen dies. Vor allem das Beispiel von Verena Becker macht deutlich, dass die selbstauferlegte Schweigepflicht der RAF-Mitglieder, ein der Mafia und ihrer Omertà (»Schweigepflicht«) entlehnter Verhaltenskodex, weiterhin funktioniert: Die noch lebenden Täter verharren weiterhin in selbstgerechtem Schweigen. Zwar hat sich die an der Schleyer-Entführung beteiligte Silke Maier-Witt im Herbst 2017 zu einer Geste durchgerungen und Jörg Schleyer, den Sohn von Hanns Martin Schleyer, in einem persönlichen Gespräch um Verzeihung gebeten. Mehr als bereits bekannte Fakten sind aber weder hierbei noch in der Autobiografie der früheren Terroristin (Maier-Witt 2025) zutage getreten.
Nun könnte man gespannt auf weitere ›Enthüllungsliteratur‹ von ehemaligen RAF-Mitgliedern warten, vielleicht auch auf Memoiren noch lebender Politiker oder Anwälte, die sich etwa im Umkreis der RAF-Verteidigerbüros bewegt haben. Aber zum einen verstecken sich diese Zeitzeugen hinter ihrem Argument des Mandantenschutzes (selbst wenn diese Mandanten gar nicht mehr leben), zum anderen ist höchst fraglich, ob sich damit die zahlreichen offenen Fragen rund um die RAF beantworten ließen. Auch die bisher gemachten Erfahrungen vor allem mit den tendenziösen literarischen Bewältigungsversuchen von sogenannten Ex-Terroristen zeigen, dass deren Informationen nur selten verlässlich sind. Vielleicht ließen sich Lücken in der Geschichte der RAF schließen, wenn es Auskünfte von Verfassungsschützern gäbe, die aber ebenfalls beharrlich schweigen oder sich noch immer weigern, der Forschung Akten freizugeben. So ist zum Beispiel die zentrale Undercover-Tätigkeit von Peter Urbach als agent provocateur in der Gründungsphase der RAF noch immer genauso unbeleuchtet wie andere dubiose Praktiken des Verfassungsschutzes, etwa beim »Celler Loch«. Im Rahmen dieser »Aktion Feuerzauber« genannten Operation hatte der niedersächsische Verfassungsschutz im Juli 1978 ein Loch in die Außenmauer der JVA Celle sprengen lassen, um einen von der RAF durchgeführten Befreiungsversuch eines inhaftierten Terroristen vorzutäuschen und so angeblich einen Informanten in die RAF einschleusen zu können.
Vielleicht ist das Ziel, die noch lebenden RAF-Mitglieder zum ›Auspacken‹ zu bringen, aber auch nur über eine Generalamnestie zu erreichen, wie sie von unterschiedlicher Seite immer wieder vorgeschlagen wird. Carolin Emcke, Publizistin und Patentochter von Alfred Herrhausen, hat darüber hinaus 2016 eine Art »Wahrheitskommission« nach südafrikanischem Vorbild vorgeschlagen, um die Mauer des Schweigens zu durchbrechen (Emcke 2016: 98–103). Eventuell ließe sich so auch die im Frühjahr 2016 bekannt gewordene »Beschaffungskriminalität« von immer noch im Untergrund lebenden RAF-Mitgliedern verhindern. Denn erstmals nach vielen Jahren führten Spuren, die bei Raub- und Banküberfällen hinterlassen worden waren, zu Mitgliedern der letzten Generation der RAF, die den Ausstieg aus der Illegalität verpasst und offensichtlich nicht an ihre Altersvorsorge gedacht hatten. Wie »unzeitgemäße Gespenster ihrer eigenen Vergangenheit«, so Carolin Emcke am 20. Mai 2016 in der Süddeutschen Zeitung, seien sie in der Gegenwart aufgetaucht, in der sie jedoch »keinen Resonanzraum mehr finden«. Das große mediale Echo nach der Festnahme Daniela Klettes, die in diesem Zuge bekannt gewordene mutmaßliche Unterstützung aus der linken Szene für die Untergetauchten und vereinzelte Solidaraktionen für die Inhaftierte zeigen jedoch, dass dieser Resonanzraum weiterhin – wenn auch in deutlich kleinerem Ausmaß – existiert.
Auch für die Zeitgeschichte ist die RAF ein Thema der Superlative. Bücher zum Thema füllen kleine Bibliotheken und die RAF sorgt für beste Verkaufszahlen sowie für Besucherrekorde bei Ausstellungen. Kaum ein anderes zeitgeschichtliches Thema hat so viel Niederschlag in Film, Literatur, Theater und Kunst gefunden. Die im steten Rhythmus von zehn Jahren kulminierende öffentliche Aufmerksamkeit rund um das Thema RAF belegt auch, dass der Deutsche Herbst 1977 nicht nur um den Aspekt Terrorismus kreist, sondern immer auch eine Auseinandersetzung über das Selbstverständnis der Bundesrepublik ist. Wie reagiert eine Demokratie auf terroristische Bedrohungen? Wie löst ›der Staat‹ im Spannungsfeld von staatlichem Gewaltmonopol und liberaler Rechtsstaatlichkeit sein Sicherheitsversprechen gegenüber seinen Bürgerinnen und Bürgern ein? Wie wird dabei das komplexe Verhältnis von staatlicher Macht und Bürgerfreiheit (neu) ausgehandelt? Nicht zuletzt: Welche Rolle spielen dabei Justiz, Rechtssystem und Medien?
Terrorismus setzt Gesellschaften – demokratische und offene Gesellschaften zumal – einem Stresstest aus. Er provoziert Krisen, erschüttert die strukturellen und normativen Grundlagen eines Gemeinwesens und katapultiert immer wieder neue Fragen nach der Legitimation staatlichen Handelns auf die politische Agenda. Terrorismus zielt also auf das »Herz des Staates« (Moerings u. a. 1988). Er verändert Staaten und Gesellschaften, und er fordert sie heraus, über ihr Selbstverständnis und ihr Handlungsrepertoire nachzudenken und sich zu rechtfertigen. Angesichts neuer Formen terroristischer Gewalt in Deutschland und der Welt sind diese Fragen nicht nur von höchster Aktualität, sondern auch eine Herausforderung für die Zeitgeschichte. Zwar werden gelegentlich vor allem von Angehörigen der RAF-Opfer Warnungen geäußert, durch das Ausmaß des globalen Terrors seit »9/11« und mit der zunehmenden Einbettung des RAF-Terrorismus in den größeren zeitgeschichtlichen sowie sozial- und kulturwissenschaftlichen Kontext der Entwicklungslinien seit den 1970er-Jahren bestehe die Gefahr, dass die RAF historisiert und ihre brutalen Verbrechen bagatellisiert würden. Dennoch ist die Auseinandersetzung mit der RAF ein Paradebeispiel für eine gegenwartsbezogene Zeitgeschichte. Denn die Bundesrepublik und andere westliche Staaten haben seit den 1970er-Jahren Erfahrungen mit terroristischen Herausforderungen gemacht, die einerseits im kollektiven Erfahrungsspeicher verankert sind, die aber andererseits einen staatlich-politischen Entwicklungspfad kennzeichnen, der sich durch die gesamte jüngere Geschichte zieht und zum Beispiel das Politikfeld Innere Sicherheit geschaffen, dynamisch verändert und bis heute geprägt hat.
Petra Terhoeven (Terhoeven 2022: 7) hat – ein Zitat von Walter Laqueur aufgreifend – mit Nachdruck dargelegt, warum »so viel über so wenige geschrieben worden ist«. Die bisweilen »morbide Faszination« an den »Stadtguerilla-Experimenten« einer kleinen Minderheit radikalisierter »68er« sieht sie darin begründet, dass die RAF vor allem vor dem Hintergrund dreier Themenkomplexe zu sehen sei, über deren Deutung bis heute kontrovers debattiert wird: erstens der Kontext der Nachgeschichte oder der sogenannten »zweiten Geschichte« des Nationalsozialismus in der Bundesrepublik, zweitens die generelle Deutungskontroverse über die internationale »68er«-Bewegung, drittens schließlich der Kontext des modernen Terrorismus.
2 Forschungslage
Die Literatur zum Phänomen des Terrorismus im Allgemeinen und zur RAF im Besonderen ist auch für Experten kaum mehr zu überschauen. Vor allem das global traumatisierende Erlebnis von »9/11« hat die Zahl der Publikationen zum Thema geradezu exponentiell ansteigen lassen. Dennoch ist allein schon bei der Frage, wie Terrorismus zu definieren ist, kein Konsens in der wissenschaftlichen community erreicht. Als weithin akzeptierte Arbeitsgrundlage hat sich jedoch die Definition von Peter Waldmann durchgesetzt:
Terrorismus sind planmäßig vorbereitete, schockierende Gewaltanschläge gegen eine politische Ordnung aus dem Hintergrund. Sie sollen allgemeine Unsicherheit und Schrecken, daneben auch Sympathie und Unterstützungsbereitschaft erzeugen (Waldmann 1998: 10).
Peter Waldmann grenzt damit beispielsweise Staatsterrorismus gegen die eigene Bevölkerung als »staatliche Zwangsstrategie« aus und unterscheidet im Rückgriff auf ältere Arbeiten drei Hauptformen des gegen eine politische Ordnung gerichteten Terrorismus (insurgent terrorism): den ethnisch-nationalistischen, den religiösen und den sozialrevolutionären Terrorismus, dem auch die RAF zuzuordnen ist.
Lange Zeit war die Literatur zur RAF von journalistischen und populärwissenschaftlichen Arbeiten geprägt (z. B. Stefan Aust, Butz Peters, Michael Sontheimer, Willi Winkler, Sven Felix Kellerhoff u. a.), denen oftmals vorgeworfen wurde, auf ungenügender Quellenbasis zu arbeiten und zu sehr am Ereignis statt an einer Gesellschaftsgeschichte des Terrorismus orientiert zu sein. Hinzu kommen (auto-)biographische und damit stark voreingenommene Arbeiten zur RAF (z. B. von Michael – »Bommi« – Baumann, Birgit Hogefeld, Peter-Jürgen Boock, Inge Viett, Margrit Schiller, Stefan Wisniewski, Till Meyer, Silke Maier-Witt und anderen). Manche dieser Aussteiger, wie beispielsweise der immer auskunftsbereite, auch »Karl May der RAF« genannte Peter-Jürgen Boock, haben im Lauf der Jahre ihre Aussagen mehrfach geändert oder ihren jeweiligen Gesprächspartnern angepasst. Insgesamt erinnern die ›Bekenntnisse‹ oftmals an Non-Fiction-Krimis, bei denen geradezu manipulativ der Wunsch des Lesers geweckt wird, bei den geschilderten ›Abenteuern‹ selbst gerne dabei gewesen zu sein. Über dieser »Aufarbeitungsliteratur« liegt oftmals eine »eigentümliche coolness wie eine glatte Patina« (Beckenbach 2005: 249), während in den allerwenigsten Fällen die individuelle Verantwortung und Schuld der Täter thematisiert wird.
Die Forschung hingegen hat sich lange Zeit auf politikwissenschaftliche, sozialwissenschaftliche, juristische oder kriminologische Fragestellungen konzentriert und vor diesem Hintergrund nach den Rahmenbedingungen für die Entstehung und Bekämpfung des Terrorismus in den 1970er-Jahren gefragt. In den letzten 20 Jahren hat sich die Herangehensweise an das Phänomen RAF jedoch inhaltlich und methodisch ausdifferenziert. Ausgehend von der bereits in den 1970er-Jahren formulierten These, dass beim Terrorismus zwar primär physische und psychische Gewalt im Mittelpunkt stehe, es aber doch immer auch um die maßgebliche Verbindung von Gewalt und ihrer öffentlichen Wirkung gehe, haben Forscher wie beispielsweise Walter Laqueur betont, dass Terrorismus auch als Kommunikationsstrategie zu verstehen sei. Damit wurde das Feld hin zu sozial- und kulturwissenschaftlichen Fragestellungen geöffnet. Basierend auf der Annahme, dass Kommunikation auf Botschaften zwischen Sendern und Empfängern besteht sowie einen Kommunikationsraum und Kommunikationsmedien braucht, konzentrierten sich die folgenden Studien auf das Geflecht von Terroristen, potenziellen Unterstützern, Staat, Gesellschaft und Medien. So wurden täterzentrierte, oft eng an die zeitgenössische Berichterstattung angelehnte Darstellungen abgelöst durch Arbeiten, die vor allem die gesellschaftlichen Folgen des Terrorismus in den Blick nahmen. Im Fokus des Interesses standen nun Fragen nach den Wahrnehmungen und Umgangsweisen mit den terroristischen Bedrohungen, nach Deutungen des terroristischen Geschehens durch Akteure aus Politik, Justiz, Medien und Kultur und daraus folgend auf reaktive staatliche Krisenbewältigungsstrategien, nicht zuletzt auch nach Auswirkungen des Terrorismus auf gesellschaftliche Diskurse, auf Narrative und Sprachbilder im Hinblick auf Aspekte wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Pluralismus und Innere Sicherheit. Im Zentrum dieser Versuche, den Terrorismus der RAF stärker sozial- und kulturgeschichtlich zu fundieren, stehen unter anderem die grundlegenden Arbeiten von Wolfgang Kraushaar, Klaus Weinhauer, Hanno Balz sowie – erweitert um die internationale Perspektive – die Forschungen von Petra Terhoeven und Johannes Hürter. Den Mittelpunkt der Überlegungen bildet die Tatsache, dass Terrorismus öffentliche Kommunikation benötigt und erst dadurch Bedeutung und Brisanz erlangt.
In diesen Forschungskontexten sind wesentliche Grundlagen für eine Sozial- und Kulturgeschichte des Terrorismus, der Inneren Sicherheit und des Diskurses über das Staats- und Gesellschaftsverständnis der Bundesrepublik der 1970er- und 1980er-Jahre erarbeitet worden – ergänzt um erste analytische Vergleiche mit anderen westlichen Ländern wie Frankreich, Italien, den Niederlanden, Großbritannien und auch den USA. Gleichzeitig hat die Öffnung der Archive der ehemaligen DDR dafür gesorgt, dass das Thema RAF auch in den Kontext der deutsch-deutschen Beziehungen und der Blockkonfrontation der 1970er- und 1980er-Jahre integriert werden konnte, etwa wenn es um die Frage nach der Unterstützung von RAF-Mitgliedern durch Ostblockstaaten oder speziell durch die Staatssicherheit der DDR geht. Hinzu kommen umfangreiche Forschungen zu einer Diskursgeschichte staatlichen Handelns gegen den Terrorismus, zur Reflexion über das, was Staat eigentlich ist bzw. sein soll, über staatliche Protagonisten und ihre Handlungsmuster, über die Rolle der Justiz sowie über Liberalisierungskonzepte und deren rückläufige Tendenzen.
Mit dem Konzept der moral panic hat Hanno Balz ein tragfähiges Konzept geschaffen, um die gesellschaftliche Situation sowie die Rolle der Medien während der »bleiernen Jahre« des RAF-Terrorismus zu analysieren. Seine Arbeiten schaffen die Grundlage für weitere Tiefenbohrungen – zum Beispiel die von Andreas Musolff zum »Kriegszustand« der Terrorjahre – hinsichtlich einer Geschichte der kollektiven Verunsicherung und des öffentlichen Angst-, Krisen- und Emotionsmanagements. Erneut wird dabei nicht zuletzt die soziale und mediale Konstruktion des Terrorismus deutlich.
Den Blick auf die politische Kultur zur Zeit der RAF schärft Wolfgang Kraushaar, der in zahlreichen Arbeiten den Verbindungen zwischen »1968« und der RAF nachgespürt hat. Diese und andere Forschungen sind von der Frage geleitet, inwieweit das Aufbegehren der ersten Nachkriegsgeneration gegen die eigenen Eltern, die in das NS-Regime verstrickt waren, und gegen die Orientierung der Bundesrepublik am (amerikanischen) Kapitalismus und Imperialismus zur Stärkung radikaler Splittergruppen beigetragen hat – neben der RAF auch anderer terroristischer Gruppierungen wie etwa der »Bewegung 2. Juni«. Aber auch das aus der Studentenbewegung hervorgegangene breite Alternativ- und Protestmilieu, aus dem heraus sich sowohl Unterstützer als auch Terroristen rekrutierten, rückt vermehrt in den Blick der Forschung. Bis heute beschäftigen sich viele Arbeiten mit der Bedeutung dieser Unterstützerkreise und ihrer theorieunterfütterten Nähe zur politischen Gewalt. Darüber hinaus hat Wolfgang Kraushaar mit der Dechiffrierung der »Mythen der RAF« herausgearbeitet, wie es den Terroristen und ihren Unterstützerkreisen gelang, die oftmals totgesagte RAF wie eine vielköpfige Hydra immer wieder aufleben zu lassen. Mittels dieser »Mythen« gelang es, den Terrorismus zumindest für eine gewisse Zeit und in bestimmten Szenen zu legitimieren.
Neben der Analyse der literarischen und filmischen Mythentradierung rund um die RAF (z. B. Cordia Baumann) hat die Forschung anregende Impulse durch den Ansatz erfahren, den Terrorismus und das staatliche Handeln gegen ihn als »performativen Akt« (Beatrice de Graaf) zu verstehen. Terrorismus wird so als »Theater« auf einer großen und öffentlichen Bühne verstanden, auf der es Akteure, Zuschauer, Performances, Inszenierungen und Rituale aller Beteiligten gibt. Sicherlich gilt: Die RAF war kein konstruktivistisches Phantom, sondern grausame Realität. Aber solche Ansätze, die mit den Aspekten Inszenierung, Perzeption, Medialisierung und Visualisierung arbeiten, vermögen doch in vielfacher Hinsicht die Perspektive zu weiten.
Eine thematisch und methodisch erweiterte Terrorismusgeschichte lässt sich nur als Gesellschaftsgeschichte schreiben. Ein kurzes Beispiel mag dies belegen: Sowohl Zeitgenossen als auch einzelne Forscher hat immer wieder die Frage umgetrieben, warum vermeintlich so überproportional viele Frauen unter den RAF-Terroristen zu finden seien. Letztendlich führen alle soziologischen oder auch psychopathologischen Untersuchungen bei dieser Frage nicht weiter, denn egal wie man die Statistiken auch dreht und wendet: Über einen längeren Zeitraum hinweg betrachtet war maximal die Hälfte der Mitglieder des engeren Kerns der RAF weiblich, was schlichtweg dem Frauenanteil in der Gesellschaft entspricht. Warum also die Frage? Ganz einfach: Die Beschäftigung mit den Frauen in der RAF fördert einiges zutage über das Frauenbild in der bundesdeutschen Gesellschaft der 1970er-Jahre und über dessen politische Instrumentalisierung in der Auseinandersetzung mit der Neuen Frauenbewegung.
Trotz der großen Fortschritte der letzten Jahre sind nicht nur unter Genderaspekten in der Forschung zum Thema RAF noch zahlreiche Fragen offen. Fast schon traditionell liegt ein Schwerpunkt der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Terrorismus auf den 1970er-Jahren und der ersten Generation der RAF. Zu den 1980er- und 1990er-Jahren liegen hingegen noch ganze Forschungsfelder brach, etwa zu den Anti-Terrorismus-Strategien von Politikern, Parteien und Regierungen, zur Rolle von Justiz und Verfassungsschutz sowie zum Auflösungsprozess der RAF. Das liegt natürlich auch daran, dass viele, vor allem auch staatliche Quellen bislang kaum zugänglich sind. Erst wenn diese Jahrzehnte besser aufgearbeitet sind und der Linksterrorismus damit klar in eine längere Linie einzuordnen ist, wird sich auch das Besondere der 1970er-Jahre akzentuierter herausarbeiten lassen.
Trotz erster Ansätze liegt ein weiterhin vielversprechendes Forschungsfeld bei international vergleichenden Studien mit der Fragestellung, wie und vor welchem historischen Erfahrungs- und Erwartungshorizont unterschiedliche Gesellschaften auf terroristische Herausforderungen reagiert haben und warum diese Provokationen in Ländern wie beispielsweise der Bundesrepublik oder Italien von größter Brisanz waren, während sie in anderen Ländern wie den Niederlanden relativ unaufgeregt bewältigt werden konnten. Ebenso sind die vielen transnationalen Verflechtungen, aber auch die nationalen Besonderheiten des sich häufig als international verstehenden Linksterrorismus der 1970er-Jahre noch nicht in einer umfassenden Studie gebündelt worden.
Offene Punkte bestehen darüber hinaus bei der Frage, wie es der RAF gelingen konnte, nach dem Wendepunkt des Deutschen Herbstes 1977 Akteurin in den linksradikalen Diskursen von gewaltbereiten antiimperialistischen Antifa-Gruppen, autonomen Hausbesetzern und militanten Atomkraftgegner zu werden. Diese diffusen und höchst heterogenen radikalen Milieus, die im Zuge der sogenannten »Jugendrevolte« vor allem in den frühen 1980er-Jahren entstanden sind, wurden bislang kaum untersucht.
Ein anregendes Forschungsfeld bietet auch die Auseinandersetzung mit der Frage, wie sich die Rezeptionsgeschichte der RAF im Laufe der Jahrzehnte verändert hat und wie sich die höchst polarisierten Erinnerungsmuster an den Terrorismus bis heute schrittweise abgeschliffen haben. 40 Jahre nach dem Deutschen Herbst hat das Erinnerungsjahr 2017 doch vor allem gezeigt, dass sich die kontroverse Debatte über die RAF deutlich abgekühlt hat. Auch jüngere Ereignisse wie etwa die Verhaftung Daniela Klettes erzeugen nicht mehr dieselbe emotionale Skandalisierung, wie etwa noch knapp zehn Jahre zuvor die Frage, ob das frühere RAF-Mitglied Christian Klar als Mitarbeiter eines Abgeordneten im Bundestag arbeiten darf. Hier kann zumindest die Vermutung geäußert werden, dass dazu vor allem die breiter angelegte gesellschaftsgeschichtlich fokussierte Zeitgeschichtsforschung beigetragen hat, aber auch die Tatsache, dass in der Öffentlichkeit inzwischen weitaus stärker die Stimmen und Perspektiven der Opfer und ihrer Hinterbliebenen wahrgenommen werden.
3 Die Geschichte der RAF – drei Generationen des »bewaffneten Kampfes«
Trotz mancher Unschärfen bildet die von Wolfgang Kraushaar eingeführte Unterteilung in drei Generationen eine plausible Grundlage für die Strukturierung der Geschichte der RAF. Der Begriff der ›Generation‹ ist in diesem Zusammenhang zwar auf Kritik gestoßen, weil er zum einen zu scharfe Abgrenzungen schaffe. So gehörte schon die erste Generation der RAF keiner einheitlichen Alterskohorte an und das Beispiel Brigitte Mohnhaupt zeigt, dass sie zwar als Kopf der zweiten Generation gilt, aber auch schon der ersten Generation zuzurechnen ist. Zum anderen aber, so die Kritiker, unterstelle das Generationenkonzept eine stringente Genealogie, wo es weder strukturell noch inhaltlich-argumentativ eine ungebrochene Kontinuität gebe. Zudem werde man damit der situativen Dynamik der Entwicklung der RAF nicht gerecht, weil gewissermaßen in der Rückschau suggeriert werde, einer Generation müsse zwangsläufig auch eine weitere folgen. Dennoch ist das RAF-Generationenkonzept in chronologischer und auch inhaltlicher Sicht nicht gänzlich von der Hand zu weisen und wird hier als Strukturmodell näher ausgeführt.
3.1 Die erste Generation – Terrorismus der Post-Revolte
Die erste Generation der RAF ist in ihrer Wahrnehmung stark personalisiert und vor allem mit den Namen Horst Mahler, Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Ulrike Meinhof verbunden. Die Brandanschläge auf zwei Frankfurter Kaufhäuser im April 1968, durchgeführt von Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Thorwald Proll und Horst Söhnlein, waren die erste massive Überschreitung der Grenzen des Legitimen und Legalen. Die Aktion, die als Fanal gegen den Vietnamkrieg verstanden werden wollte, fand ein enormes Medienecho. Sie setzte in die Tat um, was in den Flugblättern der »Spaßguerilla« um die Berliner Kommune I und Kommune II im Mai 1967 entworfen worden war. Darin wurde der tragische Brandunfall in einem Brüsseler Kaufhaus, bei dem Hunderte Menschen ums Leben gekommen waren, mit dem Leid der Opfer der Napalmbomben der US-Armee in Vietnam verglichen. Der Frankfurter Kaufhausbrand führte zu einer mehr als siebenmonatigen Untersuchungshaft der Verantwortlichen und zu einem Prozess, bei dem der spätere Grünen-Politiker und SPD-Bundesinnenminister Otto Schily sowie Horst Mahler, eine der ideologischen Leitfiguren unter den Berliner Kommunarden, als Wahlverteidiger auftraten. Nach einer erfolglosen Revision gegen die Verurteilung wegen »versuchter menschengefährdender Brandstiftung« – die Angeklagten sahen ihren kriminellen Akt als »politisches Happening« – und des damit drohenden weiteren Vollzugs der Haftstrafe tauchten Baader, Ensslin und Proll unter und flüchteten zunächst nach Paris. Während Söhnlein und Proll wenig später ihre Haftstrafe antraten, wurde Baader im April 1970 gefasst. Gudrun Ensslin blieb im Untergrund.
Abb. 2:Sprung in die Illegalität: Nach der Befreiung Andreas Baaders aus der Haft wird im Mai 1970 mit Plakaten nach Ulrike Meinhof gefahndet.
Die spektakuläre Befreiung Baaders während einer Ausführung aus der Justizvollzugsanstalt Tegel am 14. Mai 1970, geplant und durchgeführt von Gudrun Ensslin, Horst Mahler und Ulrike Meinhof, gilt gemeinhin als Gründungsdatum der RAF. Zum einen war im Schreiben zur Baader-Befreiung erstmals der Name der Gruppe genannt worden, zum anderen aber setzte mit dem »Berliner Sprung in den Untergrund« der massive Verfolgungsdruck der Behörden ein. Die von Rudi Dutschke und anderen oftmals propagierten gezielten Regelverletzungen, die auch »Gewalt gegen Sachen« einschließen sollten, um Reaktionen der »refaschisierten« Bundesrepublik zu provozieren, und die Befreiung eines Kampfgenossen waren eskaliert, weil bei einem Schusswechsel ein Unbeteiligter schwer und zwei Polizisten leicht verletzt worden waren. Zwar hatten die Beispiele Proll und Söhnlein gezeigt, dass es Ausstiegsmöglichkeiten gab. Aber für die anderen Protagonisten führten Gewalt und Fahndungsdruck nun zur Isolation, zur starken Binnensolidarisierung und zu einer Gruppenidentität, die den Weg zurück in die Legalität versperrten. Nun war der Weg zum »bewaffneten Kampf« gegen den Staat in Gang gesetzt.
Zerfall und Transformation der »68er«-Bewegung
Die RAF war eines der zahlreichen Spaltprodukte in der postrevolutionären Phase der »68er«-Bewegung. Das aus diesem Zerfalls- und Transformationsprozess hervorgehende neue linke Spektrum gilt es im Folgenden kurz zu skizzieren.
1.
In einer Renaissance des Parteikommunismus entstand um 1969/70 – teils aus der Konkursmasse des »Sozialistischen Deutschen Studentenbundes« (SDS) und der illegalen KPD – eine ganze Fülle von dogmatischen kommunistischen, trotzkistischen oder maoistischen Parteien, K-Gruppen und Kommunistischen Bünden. Diese verstanden sich zwar als proletarische Avantgarde und kümmerten sich intensiv um die Mobilisierung der Arbeiterklasse, blieben aber letztlich doch ein Projekt von Studierenden und Intellektuellen. Im »roten Jahrzehnt« der 1970er-Jahre (Gerd Koenen) verfügten sie über ein beträchtliches Arsenal an Publikationsorganen und nicht zuletzt mit ihren Hochschulgruppen über eine gute Vernetzung ins universitäre Milieu.
2.





























