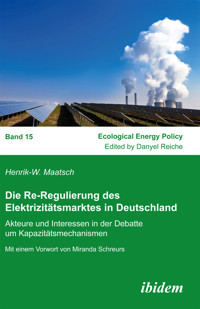
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ecological Energy Policy (EEP)
- Sprache: Deutsch
Die Liberalisierung des deutschen Strommarktes, in dem der Energy-only-Markt (EOM) – zumindest für den konventionellen Kraftwerkspark – zur Refinanzierung dienen sollte, ist mit dem Beschluss zur Reservekraftwerksverordnung im Sommer 2013 an einem Wendepunkt angekommen. Angesichts der mit der Energiewende verbundenen umfassenden Systemtransformation zu einem Strommarkt mit einem überwiegenden Anteil fluktuierender Erneuerbarer Energien gilt es, auch zukünftig ausreichend Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Kontrovers debattiert wird hier die Frage, ob es dazu einer Ergänzung des EOM durch Kapazitätsmechanismen bedarf und wie diese ausgestaltet sein sollten. Henrik-W. Maatsch untersucht detailliert den Verlauf der Debatte um Kapazitätsmechanismen seit dem Beginn der politischen Diskussion im Frühjahr 2011 bis zur Reservekraftwerksverordnung im Sommer 2013. Anhand einer Policy-Netzwerkanalyse identifiziert er die zentralen Akteure, ihre Interessen und Werteorientierungen und analysiert die entsprechenden Konflikte und Akteurkoalitionen in einer Debatte, die teilweise quer zu altbekannten Konfliktlinien in der deutschen Energiepolitik verläuft. Die Studie leistet einen wichtigen Beitrag zum aktuellen Diskurs um die Re-Regulierung des Elektrizitätsmarktes und ein neues Strommarktdesign.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 256
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Foreword
The German Energiewende is an effort to reform the entire energy structure of the world’s fourth largest economy to be highly efficient, low-carbon, and highly dependent on renewable sources of energy. In addition to the shutdown of all nuclear power plants by 2022, Germany aims to cut itsgreenhousegas emissions by about 80 percent by 2050 and to obtain 80 percent of its electricity from renewable sources. This essentially means a dual shift away from the current heavy reliance on fossil fuels and nuclear power and towards an electricity system that is dominated by renewable energy. It is one of the biggest reform projects of the twenty-first century and one that is being watched by the entire world. This makes adocumentationof thepolicyprocesses and options that have been debated regarding the energy transition so important.
Henrik-W. Maatsch’s study looks at one particularly important aspect of the Energiewende—the reform of the electricity market’s design.Approximatelyone-third of German carbon dioxide emissions stems from electricityproductionand consumption. Efforts have been underway in Germany since the early 1990s and especially since the introduction of theRenewableEnergy Law in 2000 to expand the share of renewable energy in the electricity mix. Whereas in 1990, only about 3 percent of electricityconsumed, and in 2000 somewhat less than 7 percent was derived fromrenewablesources, by the end of 2013 that percentage had expanded toalmost25 percent. The renewable energy feed-in-tariff contributed greatly to this rapid expansion. This is a substantial success that has attracted much global attention.
Germany is now moving into a new stage of the restructuring of theelectricitysystem. As the share of renewable electricity expands, additional areas of the energy transition will need to be addressed and variousreformswill be necessary. An expansion of the electricity grid infrastructure will be needed although it is debated how much more grid infrastructure is needed. More electricity storage systems will have to be created. Energyefficiencyimprovements will have to be made. In addition, a sufficientsupplyof base (reserve) power for times when there is limited electricity available fromrenewablesources will be required.
Assuring that this base capacity is available is critical for system stability in a system with a high share of fluctuating sources of electricity. Withoutadequatebase supply, then on a day of low renewable electricity availability blackouts could occur. Assuring adequate base load capacity is more than a question of having sufficient physical capacity (power plants run on stable supply sources like biofuels, hydropower, natural gas, and coal), it is also a question of costs and investor incentives. Sufficient incentives must exist to assure that reserve capacity will be maintained and investments will be made in more efficient and less carbon-intensive forms of base loadcapacity.Already there have been problems of firms shutting down newly built natural gas facilities that have proven to be uneconomical. Assuring sufficient investment in new base load facilities will be problematic unless reforms are undertaken.
There is already much pressure to reform the feed-in-tariff that hassupportedthe growth of renewable sources of electricity. The pressures forreformhave different supporters who aim to achieve different outcomes. In the long run, however, there is general agreement that there will need to be changes to the current system so that rising prices can be better held in check and costs more fairly distributed. Redesigning the electricity market to also find ways to assure an adequate base load capacity will be critical.
The future of the electricity market design is an extremely importantcomponentof the Energiewende and has therefore led to intense debates about what the best design for a new system would be. Henrik-W.Maatsch’s analysis makes use of central concepts in political science such as policy network analysis and a combination of actor-centeredinstitutionalismand advocacy coalitions. He explores the central lines of conflict in the debate that are defined by different actor coalitions’ economic interests andnormativepositions towards the Energiewende. Maatsch shows who the main coalitions of actors are that are vying to influence the design of the electricity market, the reasons why their viewpoints are sodifferent, what difference it could make which market design solutions are chosen, and the influence of these groups on policy makers. The choice of capacitymechanismswill greatly influence what kinds of energy suppliers remain in the market (will it be more coal or natural gas), the degree ofcentralizationversus decentralization of a future electricity structure, how much gridinfrastructuremight be needed, what kind of supportmechanismswill exist for the further development of renewable electricity, and many otheraspectsof the future electricity system.
Four coalitions are identified that support different solutions: a strategicreserve, supply contracts (forward capacity contracts), selective capacity markets, and a decentralized market for capacity obligations withexchangeablerights. The central roles played by the Ministry of theEnvironmentand the Ministry of Economics in the debate receivesconsiderableattention. This study provides a critical basis for understanding how these debates are likely to continue in the coming years as veryimportantpolicy decisions that will steer the Energiewende into the next stage are taken.
This high quality study is based on in-depth research of key studies andinterviewswith major players. It is the first to examine the policy debatesrelatedto how best to assure base load supply in the future as the share of renewable electricity continues to expand in such depth. It makes animportantcontribution to our understanding of how actors are linking their economic, environmental, social and political interests to the design ofcapacitymechanisms.It is highly recommended reading.
Prof. Miranda Schreurs
Freie Universität Berlin
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
API2 cif ARA Durchschnittlicher Preisindex für Steinkohlelieferung (Cost, Infrastructure, Freight)Amsterdam,Rotterdam,Antwerpen
B90/GrüneBündnis 90/Die Grünen
BAWÜBaden-Württemberg
BDEWBundesverband der Energie- und Wasserwirtschafte.V.
BEEBundesverband Erneuerbare Energiee.V.
BKBundeskanzlerin
BMWiBundesministerium für Wirtschaft und Technologie
BMUBundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
BNetzABundesnetzagentur
BNEBundesverbandneuer Energieanbietere.V.
BUNDBund für Umwelt und Naturschutz Deutschlande.V.
DSMDemand-sidemanagement(langfristige nachfrageseitige Maßnahmen zur erhöhten Energieeffizienz)
DSRDemand-sideresponse(kurzfristige Nachfrageregelung bei Spitzenlast)
EEErneuerbare Energien
EEGErneuerbare-Energien-Gesetz
EEXEuropean Energy Exchange
EnWGEnergiewirtschaftsgesetz
EOMEnergy-only-Markt(grenzkostenbasierter Strommarkt)
EUEuropäische Union
EU ETSEuropean Union Emission Trading Scheme
EU KOMEuropäische Kommission
EVUEnergieversorgungsunternehmen
EWIEnergiewirtschaftliches Institut ander Universität zu Köln
fEEFluktuierende(dargebotsabhängige)Erneuerbare Energien
GuDGas- und Dampfkraftwerk
IZESInstitut für ZunkunftsEnergieSystemegGmbH
KWKilowatt
KWhKilowattstunde
KWKKraft-Wärme-Kopplung
KKWKernkraftwerk
MWMegawatt
MWhMegawattstunde
rEERegelbare(dargebotsunabhängige)Erneuerbare Energien
ResKVReservekraftwerksverordnung
STMWIVTBayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie
TWhTerrawattstunde
UBAUmweltbundesamt
UM BWMinisterium für Umwelt, Kima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg
ÜNBÜbertragungsnetzbetreiber
VDKIVerein der Kohleimporteure e.V.
VIKVerband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft e.V.
VKU
Zusammenfassung
Der Beschluss zur Reservekraftwerksverordnung(ResKV)vom 12. Juni 2013 markiert einen Wendepunkt in der Liberalisierung des deutschen Elektrizitätsmarktes. Der Energy-only-Markt(EOM)steht hierbei angesichts einer umfassenden Systemtransformation im Rahmen der Energiewende der Herausforderung gegenüber,auch zukünftig bei einem überwiegenden Anteil Erneuerbarer Energien ausreichend Versorgungssicherheit zu gewährleisten.Kontrovers debattiert wird die Frage,ob es dazueinerErgänzungdes EOM durch Kapazitätsmechanismen bedarfund wie diese ausgestaltet sein sollten.
Vor diesem Hintergrund analysiert die vorliegende Arbeit im Rahmen einer Policy-Netzwerkanalyseden Verlauf der Debatte um Kapazitätsmechanismenseit demBeginn der politischen Diskussion im Frühjahr 2011 bis zum Kabinettsbeschluss zur ResKV. Hierbei liegt der Fokus auf der Identifizierung der zentralen Akteure, ihrer Interessen und Werteorientierungen sowie der Analyse entsprechenderKonflikte und Akteurkoalitionen inder Debatte.Hierzu werdendie netzwerktheoretischen Ansätze des akteurzentrierten Institutionalismus und des Advocacy-Koalitionsansatzes kombiniert.Neben einerakteurspezifischen Kategorisierung der debattierten Kapazitätsmechanismen wurdenhalbstandardisierte Interviews mitbeteiligtenPolicy-Expertengeführt.
Im Ergebnis zeigt sich ein Verlauf der Debatte, derteilweisequer zu altbekannten Konfliktlinien in der deutschen Energiepolitik verläuft. So wird in der Debatte ein zweidimensionales Konfliktschema ersichtlich.Eine KonfliktlinieverläuftentlangderBefürworter-, bzw. Gegnerkoalition von Kapazitätsmärktenundist insituativen(ökonomischen) Interessen begründet.Die zweite Konfliklinieverläuft entlang einer proaktivenoderreaktiven Einstellung gegenüber derEnergiewendeund ist durch langfriste Policy-Kernüberzeugungen bestimmt.
Es zeigt sich, dass die Formierung von Akteurkoalitionen über situative (ökonomische) Interessen hinweg stabil über den bisherigen Verlauf der Debatte bleibt.Es gibt in der Debattevier Akteurkoalitionen, die sich hinter den Modellender Strategischen Reserve, dem Modell der Versorgungssicherheitsverträge, dem Modell der fokussierten Kapazitätsmärkte und dem Modell des dezentralen Leistungszertifikatemarktes positionieren.BemühungenAkteurkoalitionen überGegensätzein denPolicy-Kernüberzeugungenhinwegzu bilden, wie dies im Vorfeld des Energiegipfels im Mai/Juni 2013 über die Konsolidierung der Positionen im Rahmen derClearing-Studieoder des Ergebnisberichtes des Fachdialoges Strategische Reserveversucht wurde, sind entweder gescheitertoder stellen sich als fragil und temporär dar. Der aktuelle Konsolidierungsversuch zwischen BDEW und VKU istder Sache nach alserfolgsversprechendzu betrachten, da beide AkteurePolicy-Kernüberzeugungen teilenund komplementäre Interessen in der Formulierung eines dezentralen Leistungszertifikatemarktes haben, in die das Modell der Strategischen Reservekurzfristigintegriert werden könnte.
Abstract
The introduction of the Reservekraftwerksverordnung (Ordinance on Reserve Power Plants) from June 12th 2013 marks a turning point in the liberalization of the German electricity market. In view of a comprehensive systemtransformation against the background of the Energiewende (energytransition)with an increasing share of RES-E, theenergy onlymarket (EOM)faces the challengeofprovidinglong-termsecurity of supply.It is debated whether theEOM requires complementary mechanisms to remunerate capacityand how those should be designed.
Within the framework of a policy network analysis the debate is analyzed from its beginning in early 2011 until theintroduction of the Ordinance onReserve Power Plants.It focuses on the identification of central actors, their interests and normative values as well as the analysis of thecorresponding conflicts and actor coalitions in the debate.Therefore two policy network concepts,actor-centred institutionalism and the advocacy coalition framework,were combined. Next to an actor-specific categorization of the debated capacity remuneration schemes, semi-structured interviewswith involved policyexperts wereconducted.
As a result theanalysis showsthatthelines of conflict in the debate partially run transverse to established conflict patternsinGerman energy policy. A two-dimensional conflict pattern emerges.One line of conflict runsbetweentheactorcoalitions in favor or against capacity markets and is determined by situational (economic) interests. The second line of conflictruns between the actor coalitions that show a proactive or reactive attitude towards the energytransition. It shows that the formation of actor coalitions alongmutual situational (economic) interests is stable over the course of the debate. This accounts for the four actor coalitions promoting the model of the strategic reserve, forward capacity contracts, selective forward capacity contracts and capacity obligationswith exchangeable rights, respectively.Attempts to coalesce acrosspolicy core beliefseither fail or remain highly fragile and temporary, as was the case before the Energy summit in May/June 2013 when BMWi and BMUattempted to consolidate actor coalitionsvia the Clearing-Report andtheReport on theStrategic Reserve Dialogue, respectively.The current attemptof BDEW and VKU to coalesceis promisingbecause both actorssharesimilar policy core beliefs andshow complementary interests in the formulation of a decentralized capacity obligations model thatoffers potential tointegrate the strategic reservemodelin the short term.
1.Einleitung
Mit dem Beschluss des Bundeskabinetts zur Reservekraftwerksverordnung(ResKV)vom12. Juni 2013 wurde dieGesetzesvorlage zur sogenannten „Winterverordnung“ der EnWG-Novelle vomDezember2012 konkretisiert(EnWG 2013).Die ResKV, vom Bundeswirtschaftsminister Röslerals „ordnungspolitisch nicht ganz glücklich machende Maßnahme“(BDEWonline 2013) bezeichnet,markiert einen Wendepunkt in derLiberalisierung des deutschen Elektrizitätsmarktes.[1]Die ResKVverbietetKraftwerksbetreibern die Stilllegung ihrerKraftwerke,soferndiesevomzuständigenÜbertragungsnetzbetreiber (ÜNB)als systemverantwortlich eingestuftunddie geplante Stilllegung nicht bereitszwölfMonate zuvor dem ÜNB oder der Bundesnetzagentur (BNetzA) angekündigt wurde.
Kraftwerksstilllegungen erfolgen gegenwärtig in zunehmendem Maße, da sie nurunzureichendihreDeckungsbeiträge am Energy-only-Markt (EOM)erwirtschaften können.Dies betrifft insbesondere hocheffiziente und emissionsarme,im Kapitaldienst befindlicheNeuanlagen,vermehrtaber auchbereits abgeschriebeneMittellastkraftwerke, die ihre variablen Kosten kaum decken können.Zudemsind momentanalle der17Erdgaskraftwerksprojekte (5,5 GW), die sich in einer konkreten Realisierungsphase befinden,ausgesetzt,weil sie gegenwärtig amEOMnicht wirtschaftlich betrieben werden könnten(BDEW 2013a). DerEffektunzureichender Investitionsanreizeim EOMistwomöglichsystemimmanent, tritt allerdings zu einem Zeitpunktauf, indem die deutsche Elektrizitätswirtschaftdas erste Mal nach Beginndes Liberalisierungsprozesseseinemumfassenden Investitionszyklusin Erzeugungskapazitäten gegenübersteht.
DerEffektwirdaufgrund desrasantwachsenden AnteilsfluktuierenderErneuerbarer Energien(fEE)am Bruttostromverbrauchundeinesgegenwärtigam Boden liegendeneuropäischen Emissionszertifikatehandels(EU ETS)beschleunigt und führtin der Folgezu einem verstärkten Margenverfallvor allemfür Spitzenlastkraftwerke. Aufgrund einerzunehmendfluktuierenden Residuallastsind diese jedochvermehrtrelevant für die Gewährleistung von Versorgungssicherheit.Obwohl mittlerweile eine weitestgehend einheitliche Problemwahrnehmungin Bezug aufeine möglicherweise unzureichendeGewährleistung von Versorgungssicherheit nach 2020 eingetreten ist, herrscht nach wie vor Dissens in derFormulierungkonkreter problemlösungsorientierter Handlungsoptionen. Eine unterschiedliche Gewichtung der Relevanzkriterien in der energiepolitischen Zieltrias als auch divergierende situative ökonomische Interessen der Policy-Akteure kennzeichnen eine komplexe Debatte.
In der Debatte um Kapazitätsmechanismen[2]werden Fragennach der Notwendigkeit von Kapazitätsmechanismensowiederen Reichweite und Ausgestaltung kontrovers diskutiert.Im Einzelnen stehen sichdieModellverschläge derStrategischen Reserve,des umfassenden Kapazitätsmarktes für Versorgungssicherheitsverträge, der fokussierten Kapazitätsmärkte sowie des dezentralen Leistungszertifikatemarktesals ergänzende Instrumente zum EOM gegenüber.
Die Debatte um dieEinführung und Ausgestaltung von Kapazitätsmechanismenwird von einer Vielzahl von Policy-Akteuren geführt, die neben staatlichen Institutionen auf nationaler und subnationalerEbeneebenso eine Vielzahl privatwirtschaftlicher und anderer nicht-staatlicher Institutionen jeglicher Couleur umfasst. Sie ist dabei Spiegelbildder unterschiedlichen Interessen und normativen Werteorientierungen einer Vielzahl von Policy-Akteuren:
“In Germany, the mix and geography of (new) capacity is subject to strongpressuresfrom market, political, environmental and other lobby interest groups. It is likely that such interest groups will try to bias the design – e.g., the rating ofcertaintechnologies and locations, towards their interest” (Cramton/Ockenfels 2011: 30).
Ziel dieser Arbeit ist es, imRahmen einer Policy-Netzwerkanalyse den Verlauf der Debatte um Kapazitätsmechanismen seit dem Beginn der politischen Diskussion im Frühjahr 2011 bis zum Kabinettsbeschluss zur ResKVdarzulegen. Hierbei liegt der Fokus auf der Identifizierung der zentralen Akteure, ihrer Interessen und Werteorientierungen sowie der Analyse entsprechender Konflikte und Akteurkonstellationen in der Debatte.
1.1Fragestellung und Abgrenzung des Untersuchungsgegenstandes
Mit dem Kabinettsbeschluss der Bundesregierung vom 12.Juni2013 wurdendie in der EnWG-Novelle vom Dezember 2012 gesetzlich verabschiedeten Änderungen zur Stilllegung von systemrelevanten Kraftwerken in Form einer Gesetzesverordnung bis 2017 konkretisiert(„Wintergesetz“). Damit wurde temporäreinDe-facto-Kapazitätsmechanismus beschlossen, ohne dass jedochEntscheidungen getroffen wurden hinsichtlich einesumfassendenund langfristig orientiertenneuenStrommarktdesigns.Die Entscheidungdes federführenden Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi)für eine „Übergangslösung“ in Form derResKVund der damit verbundenenvorläufigenAbsage aneinetransparente undmarktorientierteLösung in Form der Strategischen Reserveistsowohl Ausdruck politischen Handlungsdrucks vor der Bundestagswahl 2013als aucheines komplizierten Diskurses ineiner sehr heterogenen Akteurlandschaft der deutschen Energiepolitik mit einer Vielzahl teilweisekonfligierenderInteressen.[3]Der„große Wurf“ einer politischen Einigung auf ein neues,umfassendesStrommarktdesign wurdeaufdie folgendeLegislaturperiode verschoben.Die Debatte um die Ausgestaltung eines Kapazitätsmechanismus istalsokeinesfalls beendet,sondernwird sich in den kommendenMonaten der neuen Legislaturperiodeim Vorfeld einerallseitserhofftenInteressenkonsolidierung der beteiligten Akteuresehr wahrscheinlichintensivieren.
Sowohl die Hintergründe des Kabinettsbeschlusses für dieResKValsauch die grundlegenden InteressenkonflikteeinerVielzahl beteiligterAkteure in der Debatte um ein neuesStrommarktdesign im Allgemeinen undumdieNotwendigkeit undAusgestaltung eines Kapazitätsmechanismus für Deutschland im Speziellen sind bis dato nicht wissenschaftlich untersucht worden. Daher ist es das Ziel dieserArbeit,einen akteurbezogenenUntersuchungszugang zur aktuellenDebatte um Kapazitätsmechanismenherzustellen. Der Fokus der Arbeit liegt demnachauf der Identifizierung und Analyse der Entwicklungen undVerhaltensweisen derbeteiligten Akteure, ihrerInteressen unddenentsprechendenKonfliktlinien in der Debatte um Kapazitätsmechanismenvor dem Hintergrund der Entscheidung für die ResKVim Vorfeld der Bundestagswahl 2013.
Es soll dabei folgendeFragestellungbeantwortet werden:
Was sind die zentralen Akteure, ihre Interessenund Werteorientierungen,die entsprechenden Konflikteund Akteurkonstellationeninder Debatte um Kapazitätsmechanismen in Deutschland und wie verhielten, bzw. verändertensich diese über den Untersuchungszeitraum, d.h. wie ist die Debatte im Detail verlaufen?
1.2Untersuchungsdesign
Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeitsind die Akteur- und Interessenkonstellationen in derDebatte um Kapazitätsmechanismen in Deutschland bis zumKabinettsbeschluss der Bundesregierung vom 12.Juni2013zurResKV.Die Debatte um Kapazitätsmechanismenist damitkeinesfalls abgeschlossen,denn dieResKVist zeitlich bis 2017 befristetund stellt somit lediglich„eineÜbergangsregelung bis zu einer Entscheidung im Hinblick auf den[sic!]zukünftigenRahmenbedingungen des Energiemarktes dar“(BMWi 2013b: 15).Es sei daherexplizit darauf hingewiesen, dass es sichbei der vorliegendenArbeit um die Analyse eines keineswegs abgeschlossenen und sehr umfassenden politischen Entscheidungsprozesses handelt, der im Kabinettsbeschluss zur ResKVlediglich eine erstelegislative Entscheidung als konkretes politisches Ereignisvon befristeter Dauervorweist.[4]Es soll daher der Analyserahmen der Policy-Analyse verwendet werden,um dieEntwicklungen der Debatteum Kapazitätsmechanismenbis hin zu diesemkonkretenpolitischenEreignissowohl in prozessualer Hinsichtmitzeitlichem Fokusauf dieersten drei Phasendes Policy-Cycles(Problemwahrnehmung, Agenda-Setting und Politikformulierung)als auch in struktureller Hinsichtmit Fokus auf die Akteur- undInteressenkonstellationendurch Anwendung einer qualitativen Netzwerkanalyseumfassendbetrachten zu können.
Die Debatte umdie Ausgestaltung vonKapazitätsmechanismen und im weiteren Kontext um ein neues Elektrizitätsmarktdesign,das ebenso andere Baustellen wie etwadie Marktintegration der Erneuerbaren Energien(EE)addressiert,wird von einer Vielzahl vonPolicy-Akteuren geführt,dienebenstaatlichenInstitutionen auf nationaler und subnationaler Ebene ebensoeine Vielzahlprivatwirtschaftlicherundanderer nicht-staatlicherInstitutionenjeglicher Couleur umfasstund in einem Mehrebenensystem stattfindet(Mayntz/Scharpf 1995: 44).Zu den zentralen Akteuren derDebatte um Kapazitätsmechanismen in Deutschland zählen neben den für Energie- und Umweltpolitik zuständigen BundesministerienBMWi und BMUund Bundesbehören wie der BNetzA und dem UBAebensodie Interessenvertreter der privatwirtschaftlichenund korporativenAkteureder Energiewirtschaft,so zum Beispiel dieIndustrie- und Unternehmensverbände BDEW, VKU,8KU,BNE, BEEund natürlich die großen vierdeutschenEnergieversorgungsunternehmen (EVU)EON, RWE, Vattenfall und EnBWsowieStadtwerke, Übertragungsnetzbetreiber und Bundesländer.Darüber hinaus sindnebenUmweltverbändenund NGOswiedem WWF,Greenpeaceoder BUNDebensopolitikfeldnahe wissenschaftliche und privatwirtschaftliche Forschungseinrichtungen und BeratungsunternehmenwiedasEWI, Öko-Institut,Consentec,r2b,Enervisetc. in der Policy engagiert.All diese Institutionensind am Gestaltungsprozess derdeutschen Energiepolitikin der Vernetzung staatlicher und nicht-staatlicher Akteure des Neokorporatismus unmittelbarbeteiligt, verfügen über eine hohe fachspezifische Expertise und sind ebenso stark von Eigeninteressen geleitet alsdasssie diese auf die gesetzgebenden Entscheidungsträgerzuübertragen suchen.
Im Rahmen einerqualitativenNetzwerkanalyse sollen die Akteure, Interessen unddaskonfliktäreAkteurverhalten während der Debatte um Kapazitätsmechanismen in Deutschlandmethodisch erfasst unduntersucht werden. Hierbei ermöglicht die qualitativePolicy-Netzwerkanalyse die „handlungsleitenden Orientierungen von individuellen Akteurinnen in ihrer wechselseitigen Bezüglichkeit zu rekonstruieren, um Netzwerkkonstellationen, ihre Genese und Dynamik sowie die daraus resultierenden Policies zu verstehen“ (Schindler 2006: 288).Die Debatte um Kapazitätsmechanismen in Deutschland istzu einem großen Teilgeprägt von den institutionellen Rahmenbedingungen, in denen sich die in der Debatte agierenden Akteure gemäß ihrer jeweiligen ökonomischen Interessen und immateriellen Überzeugungen bewegen. Somitprägensowohl institutionelle Strukturenund die daraus resultierenden Erwartungshaltungen ebenso wienormativeÜberzeugungen das Verhalten der Akteure.Um diesen beiden Einflusssphären adäquat Rechnung zu tragen, verknüpft dievorliegendeArbeitin einerPolicy-NetzwerkanalysedienetzwerktheoretischenAnsätzedesakteurzentrierten Institutionalismus nachRenateMayntz undFritz W.Scharpf (1995) mit demAdvocacy-Koalitionsansatznach Paul A. Sabatier (1993, 1998, 2007). Auf diese Weise wird der Zugangdes rationalen Institutionalismuszu Policy-Netzwerken,oftmals kritisiert aufgrund der NichtberücksichtigungnormativerWertvorstellungen der Akteure, um den konstruktivistischenAdvocacy-Koalitionsansatzerweitert. Dieserermöglichtzum einen,die Akteure systematisch ihren jeweiligen, mitunter konfligierenden,Interessen nach zu „kategorisieren“ als auch einemöglicheVeränderung ihrer handlungsleitenden (im)materiellen Orientierungen hinsichtlich ihrer Auswirkung auf diebetreffendePolicy zu untersuchen.Mittels des akteurzentrierten Institutionalismus und des Advocacy-Koalitionsansatzes sollen verschiedene Arbeitshypothesen hinsichtlich der Interessen und Werteorientierungen der Akteure sowie den resultierenden Konflikten in der Debatte um Kapazitätsmechanismen getroffen werden. In einer Fallstudie wird die Debatte dann chronologisch abgerissen, wobei die Strukturierung nach den ersten drei Phasen des Policy-Cylces der Problemwahrnehmung, des Agenda-Setting und der Politikformulierung erfolgt.Abschließendwerden die getroffenen Hypothesengemäß den Erkenntnissen der Fallstudie auf ihre Gültigkeithin überprüft.
1.3Methodologie
Die rational-ökonomischen Interessen und handlungsleitenden, immateriellen Überzeugungeneiner Vielzahl vonAkteurensowie die darausresultierenden dynamischen Verhandlungsprozesse im Policy-Netzwerk um die Debatte um Kapazitätsmechanismen sind alsUntersuchungsgegenstanddieser Analyse nur schwerquantifizierbarhinsichtlich ihreskonkretenEinflusses auf Politikergebnisse. Darüber hinaus handelt es sich bei dem Untersuchungsgegenstand um einehöchstaktuelle undkeinesfallsabschließend geführte Debatte, die bisher kaum wissenschaftlich dokumentiert und durch belastbare standardisierte Daten erfasst istund überderen Verlaufebenfalls keine Sekundärliteratur existiert.Daher werdenin dieser Analysequalitative Methoden in einer Kombination aus Dokumentenanalyse und leitfadengestützten Experteninterviews angewandt.
Die Dokumentenanalyse stützt sich auf Primärquellen in Form vonöffentlichen Regierungsdokumenten (Gesetze, Verordnungen, Stellungnahmen, Wortprotokolleetc.)sowievon den involvierten Akteuren (Ministerien,Behörden,Unternehmens-,Industrie- und Umweltverbänden,Forschungsinstitutionen, Beratungsunternehmen usw.)publizierte, bzw. im Rahmen von Auftrags- und extramuraler Ressortforschung initiierter Gutachten, Studienund Reporten, Stellungnahmen sowie Positionspapieren.Ziel ist es,zu zeigen in welchem Kontext die jeweiligen Dokumente entstanden sind, was für dievorliegendeArbeit bedeutet, dass ihre Entstehungals Ausdruck spezifischerund oftmals konfligierenderInteressen derunterschiedlichenAkteureim Verlauf der Debatte um Kapazitätsmechanismeneingeordnet werden soll.
Eine umfassende AnalyseentsprechenderPrimär- und Sekundärquellen war nötig, um die Experteninterviews in gewünschtem Maße durchführen zu können. DieausgiebigeRecherche und Auswertung von Sekundärliteratur zurdeutschen Energiepolitikund -ökonomiesowie derLiberalisierung des deutschenElektrizitätsmarktes bildetehierbeidie Basis für die Identifizierungder relevantenPolicy-Akteure, dieFestlegung ersterArbeitshypothesen über verhaltensbestimmende Faktorenund die Vorbereitung der Experteninterviews.
Um die verschiedenen Perspektiven in der Debatte möglichst umfassend und objektiv wiedergeben zu können,wurde versucht,zumindest jeeinen Akteur einer Akteurkoalition zu interviewen,was bis auf das BMWiund die vier großen deutschenEVUgelungen ist.Das fachspezifischeInsiderwissen der unmittelbarin der Debatteinvolvierten Experten ist für die Analyse des vorliegendenUntersuchungsgegenstandes umso wichtiger, da es sich,wie beschrieben,um eine in Deutschland relativ junge undhöchstaktuelle Debatte handelt, die sich aller Voraussicht nach in den folgendenMonatenintensivieren wird.
Mit denPolicy-Experten wurdenhalb-standardisierte, leitfadengestützteInterviewsdurchgeführt. Diesermöglichtes,das Interview flexibel an dieindividuelleSchwerpunktlegung des Befragten anzupassen undzugleich in strukturierter Weisediefür den Untersuchungsrahmen der ArbeitrelevantenThemengebiete abzudecken(Blatter et al. 2007: 61f.).Die Fragen waren möglichst offen formuliert, um den befragten ExpertenausreichendRaum für eigene Einschätzungen und Ergänzungen zu geben.Jedes Interview wurde individuell vorbereitet und inhaltlich an die jeweiligeInstitutionundden professionellenHintergrund desbefragtenExperten angepasst,um bestmöglich die gewünschten Informationen zu erhalten und Lücken in der Debattenanalyse soweit wie möglich zu schließen.
Die insgesamt11Interviewswurden im Juliund August2013persönlich oder telefonischdurchgeführt, dauertenim Mittel 45 Minuten und wurden digital aufgenommen. Alle in dieser Arbeit vorliegenden Aussagen der Experten wurden nach vorheriger Abspracheund mit demexplizitenEinverständnis dieseranonymisiertverwendet.Die Anonymisierung der in dieser Arbeit verwendeten Expertenaussagen ist der hohen Sensitivität der Aussagen in Bezug auf die Aktualität,denetwaigenEinfluss auf den zukünftigen Verlauf derDebatteund nicht zuletzt der professionellen Integrität der Expertengeschuldet.Ohne die Zusicherung der Anonymität wären die Interviews kaum realisierbar gewesen.EineAuflistung derinterviewtenExperten sowie des Interviewleitfadens findet sich im Anhang 1und 2.
1.4Gliederung der Arbeit
Im folgenden Abschnitt werden die grundlegenden theoretisch-konzeptionellen Überlegungen der vorliegenden Arbeit näher vorgestellt.ImRahmen einerPolicy-AnalysewerdenzweiPolicy-Netzwerkansätzekombiniert. Dies sind der in der rational-choice-theory begründeteundpolicy-strukturbezogene Ansatz desakteurzentrierten Institutionalismusvon Mayntz und Scharpfund dernormativeAdvocacy-Koalitionsansatzvon Sabatier.Während der akteurzentrierte Institutionalismus die situativen Interessen der Akteure betont, ermöglicht derAdvocacy-Koalitionsansatzeine Betrachtung der langfristigen Werteorientierungen der Akteure. Die Kombination dieser Ansätze erscheint daher angemessen zur Untersuchung der Debatte um Kapazitätsmechanismen als zweidimensionaler Konflikt um die Frage der Notwendigkeit von Kapazitätsmechanismen und deren etwaiger Ausgestaltung, bzw. Reichweite.
Der dritte Abschnitt der Arbeit stellt dendeutschen Elektrizitätsmarktim Kontext eines sich imumfassendenUmbruch befindlichen Marktumfeldesdar. Neben einem grundlegenden Verständnis der Funktionsweisedes EOMund einerErläuterungdessenwomöglich inhärent unzureichender Investitionsanreize für eine hinreichende Gewährleistung der Versorgungssicherheit, sollen ebenso die rasanten strukturökonomischen Veränderungen desMarktumfeldesdurch den Ausbau der EEdargelegt werden. Anschließend werden die zentralen in der Debatte diskutierten Kapazitätsmechanismen kurz vorgestellt.Sie stellen gewissermaßen die„Politikprogramme“der beteiligtenPolicy-Akteure dar undrepräsentieren sowohl derensituativeökonomische Interessen als auch die wertebasierten Überzeugungenhinsichtlich Fragen der Notwendigkeit undderAusgestaltung eines Kapazitätsmechanismus. Der Abschnitt schließt miteinerKategorisierung dieser und einer Darstellung der Implikationen und Vorteilnehmer der jeweiligen Modelle.
Im vierten Abschnitterfolgtim Rahmen einer Fallstudie diechronologische Analyse derEntwicklung der Debatte um Kapazitätsmechanismen über den Untersuchungszeitraumbeginnend mit der KKW-Stilllegung im März 2011 biszum Beschluss des Bundeskabinetts zur ResKVim Juni 2013.Hierbei wird derbisherigeVerlauf der keineswegs abschließend geführten Debatte gemäß des Policy-Cycles in drei Phasen der Problemwahrnehmung, des Agenda-Setting und derfrühen Phase derPolitikformulierung unterteilt,um eine strukturierte Untersuchung der Debatte hinsichtlicheiner Evolution derAkteur- und Interessenkonstellationen zu ermöglichen.
Im letzten Abschnitt werden die im theoretisch-konzeptionellen Teil der Arbeit hergeleiteten Hypothesen überprüft,die Ergebnisse der Fallstudie zusammenfassend dargelegtund ein abschließender Ausblick gegeben.





























