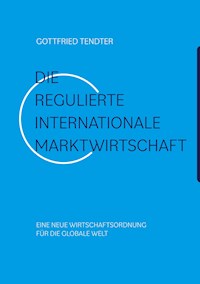
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Krisen, gespaltene Gesellschaften, unversöhnliche Machtblöcke, Kriege, Umweltzerstörung und endlose Flüchtlingstrecks dürfen nicht zum Markenzeichen unserer modernen globalen Welt werden. Die Globalisierung darf nicht länger vornehmlich unter der alleinigen Regie der Wirtschaft erfolgen. Gefordert ist hier die Politik. Sie muss den nationalen Egoismus ablegen, sich ebenfalls international organisieren und nationale Macht an eine übergeordnete autorisierte politische Macht/Institution abgeben. Aus diesem Primat heraus muss die Politik die Weltwirtschaft nach dem gesellschaftlichen Hauptziel des globalen Wirtschaftens führen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
1 Einleitende Bemerkungen
2 Die globale Wirtschaft im Dienst der Menschheit
2.1 Wissenschaft und Technik revolutionieren Kapital und Arbeit
2.2 Nationaler Einfluss
2.3 Industriestaaten in Gefahr
2.4 Die Regulierbarkeit des Kapitalismus
2.5 Die Politik ist gefordert
2.6 Die „Dreigliedrigkeit“
3 Die Führung der Weltwirtschaft
3.1 Was zu tun ist
3.2 Gefangen im Machtgefüge der Nachkriegsgeschichte
3.3 Die Vereinten Nationen als führende politische Instanz
3.3.1 Aufgaben, Macht, Mitgliedschaft und Finanzierung
3.3.2 Hauptorgane und höchste Repräsentanten
3.3.3 Räte und Friedenstruppen
3.3.4 Sonderorgane
4 Die Einordnung Europas
4.1 Die Union verliert den Anschluss
4.2 Der europäische Staat
4.2.1 Das Wesen des europäischen Staates
4.2.2 Höchste Organe und Repräsentanten
4.2.3 Die Gesetzgebung
4.2.4 Verfassungsänderung und Referendum
4.2.5 Die Einordnung der Unionsländer
4.3 Europas Wirtschaft als integraler Bestandteil der „Regulierten internationalen Marktwirtschaft“
4.4 Den Produktionsfaktor Arbeit stärken
4.5 Europas Amtssprache
5 Schlussbemerkungen
Quellen und Anmerkungen
1 EINLEITENDE BEMERKUNGEN
Mit dem Zusammenbruch des sozialistischen Weltsystems und der Auflösung der Sowjetunion fielen auch die Schranken der bipolaren Weltordnung. Der Ost-West-Konflikt, der die Welt 45 Jahre in Angst und Schrecken hielt, war zu Ende. Die machtpolitischen Rivalitäten und die weltanschaulichen Gegensätze zwischen Moskau und Washington hatten, zu unser aller Glück, den kalten Aggregatzustand nicht verlassen. Im letzten Moment siegte immer noch die Vernunft. Die Welt atmete auf und blickte mit großer Zuversicht in die Zukunft. Der Politikwissenschaftler Francis Fukuyama prognostizierte im Sommer 1989 sogar das Ende der Geschichte.1 Er sah mit dem Zusammenbruch des Sozialismus und dem Sieg der liberalen westlichen Demokratien alle wirklichen großen Fragen der Weltgeschichte geklärt.
Tatsächlich war die Zeit nach 1989 für die internationale Entwicklung der Produktivkräfte eine weltgeschichtliche Sternstunde. In Wissenschaft und Technik, allen voran auf den Gebieten der modernen Kommunikation, der Informatik, der Automatisierungstechnik und des Transportwesens, vollzog sich eine regelrechte technische Revolution. Große Datenmengen konnten jetzt unkompliziert, schnell, billig und zuverlässig um die Erde geschickt und bei Bedarf millionenfach multipliziert werden. Die moderne Technik ermöglicht es, Arbeitsprozesse beliebig zu zergliedern, auszulagern und die Fertigung über verschiedene Orte, Länder und Kontinente ohne zeitliche Einbuße und Gewinnschmälerung zu koordinieren.
Der liberale Welthandel versetzte die Wirtschaft in die Lage, alle Gebiete unseres Planeten in ihre strategischen und operativen Planungen einzubeziehen und die Erkenntnisse aus Wissenschaft und Technik im internationalen Maßstab komplex anzuwenden. Das revolutionierte das unternehmerische Denken und Handeln. Heute geht es um weltweite Märkte, Produkte und Dienstleistungen. Die Arbeit wird unter dem Blickwinkel der Effizienz rund um den Globus verteilt. Unterstützt durch einen unkomplizierten und kostengünstigen, auf Kreditkarten aufbauenden, weltweit standardisierten Zahlungsverkehr, entstehen im rasanten Tempo neue Wirtschaftsmächte, Wirtschaftszentren, Rohstoff- und Konsummärkte.
Unter konsequenter Nutzung der sich eröffnenden Chancen, hat das internationale Unternehmertum die Globalisierung der Wirtschaft auf eine völlig neue Stufe gestellt. Die globale Organisation der Wirtschaft hat Dimensionen und Strukturen erreicht, wo sie die Welt und deren Institutionen nicht mehr nur oberflächlich berührt, sondern in ihren Grundfesten regelrecht erschüttert. Nichts bisher Bewährtes und traditionell Gewachsenes scheint den Erfordernissen der Zukunft noch standzuhalten. Daran ändern auch ein unter dem ehemaligen US-Präsidenten Trump forcierter Protektionismus oder ein zeitweiliger Rückbau internationaler Lieferketten nichts Grundsätzliches.
Festzustellen ist andererseits aber auch, dass sich diese gigantischen, schon märchenhaft anmutenden wissenschaftlich-technischen und wirtschaftlichen Entwicklungen weder in einem allgemeinen weltumspannenden gesellschaftlichen Fortschritt niederschlagen noch die grundlegenden Probleme unserer Erde wesentlich entschärfen.
Die Folgen des Klimawandels werden für die Weltgemeinschaft mehr und mehr zu einer völlig unkalkulierbaren Größe. Aber auch internationale Konflikte, Krisenherde und Kriege nehmen wieder merklich zu.
Die Spannungen zwischen den USA und China, der EU und Russland sind in einem Fahrwasser, das an den Kalten Krieg erinnert. Was als Geschichte geglaubt, rückt wieder auf die Tagesordnung
Nordkorea bleibt auch nach dem Gipfeltreffen von Präsident Trump und Kim Jong Un eine ernste Gefahr für den Weltfrieden und es ist sicherlich keine Übertreibung, wenn man resümiert, dass die gesamte islamische Welt gegenwärtig einem Pulverfass gleicht. Der islamisch motivierte Terrorismus bleibt eine Bedrohung für die menschliche Zivilisation.
Die mit dem Arabischen Frühling im Dezember 2010 aufkeimenden Hoffnungen haben sich nicht erfüllt. In Syrien, Jemen und Libyen herrscht statt Demokratie Bürgerkrieg. In Ägypten regiert der ehemalige Oberbefehlshaber der ägyptischen Streitkräfte und heutige Präsident Abd al-Fattah as-Sisi nicht weniger autokratisch als ehemals Mubarak. Ansätze für eine demokratische Entwicklung nach westlichem Vorbild gibt es, wenn überhaupt, nur noch in Tunesien.
Mit der Kündigung des Iran-Atomabkommens durch die USA im Mai 2018 und die erneute Inkraftsetzung von Sanktionen gegen das Land, ist ein endlich gelöst geglaubter Konflikt wieder auf die Tagesordnung gerückt, mit ernsten Gefahren für den Weltfrieden. Alle Hoffnungen ruhen hier jetzt auf dem neuen US-Präsidenten Joe Biden.
Selbst Europa, für die Welt bisher ein sicherer Orientierungspunkt für Frieden, Freiheit, Stabilität und Völkerverständigung, ist zum Problemfall geworden. Die Spannungen der EU mit Russland, der Ukraine-Konflikt, die Unruhen in Weißrussland oder der Brexit haben Krieg, Unsicherheit und Spaltung direkt vor die Haustür der Europäer gebracht. Gleichzeitig beförderten die Krisen der letzten Jahre, die Flüchtlingsströme sowie die Corona-Pandemie, die zwischen den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union ruhenden Differenzen an die Oberfläche. Die Union ist zerstritten und für andere Länder nicht mehr attraktiv. Nationales Gedankengut und nationale Orientierungen erhalten wieder neue Nahrung.
Wenn der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, am Neujahrstag 2018 in seiner Neujahrsbotschaft „die Alarmstufe Rot für unsere Welt“ anzeigt und im Dezember 2020, also 5 Jahre nach der Pariser Klimakonferenz, das Ausrufen des „Klima-Notstandes“ in allen Staaten unserer Erde fordert2, ist dies nicht von ungefähr.
32 Jahre nach der Wende ist von den Prophezeiungen Fukujamas nicht viel übrig geblieben. Die Welt ist weder friedlicher noch gerechter, sozialer oder umweltfreundlicher geworden. Dabei hat die Globalisierung in Teilen der Welt durchaus zu einer wesentlichen Förderung des Wohlstandes beigetragen. Wem die Integration in den internationalen Warenaustausch gelang, hat in der Regel auch davon profitiert. Die Industrienationen verzeichneten diesbezüglich aufgrund ihrer bisherigen Entwicklung zweifellos einen unübersehbaren Vorteil.3
Aber auch andere Länder, allen voran die sogenannten Emerging Markets, konnten trotz immer wiederkehrender Rückschläge deutliche wirtschaftliche Fortschritte verzeichnen. Vor einem halben Jahrhundert gehörten große Teile Ostasiens noch zu den ärmsten Regionen der Welt. Heute ist China z. B. die zweitgrößte Wirtschaftsmacht. Mit der Unterzeichnung des Freihandelsabkommens: Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) im November 2020 entstand in der Asien-Pazifik-Region die größte Freihandelszone der Welt.4
Der Weg vom Agrar- zum Industrieland, verbunden mit dem Aufbau eines leistungsfähigen Dienstleistungssektors und eines internationalen Handels- und Kommunikationsnetzes, führte in den aufstrebenden Ländern zu Wirtschaftswachstum, einem umfangreichen Warenangebot und erhöhtem gesellschaftlichen Wohlstand. Investitionen brachten und bringen technologischen Fortschritt, Wissenschaft, Arbeit und Kaufkraft ins Land. Der internationale Warenaustausch sowie die internationalen Kapital- und Finanzströme nahmen Fahrt auf und gewinnen an Kraft und Beständigkeit.
Im Gegenzug werden von diesen Ländern Rechtssicherheit, politische Stabilität und der ernsthafte Wille zur allseitigen Modernisierung gefordert. Dieser Druck und der unausweichliche Zwang, sich der globalen wirtschaftlichen Entwicklung stellen zu müssen, fordern Regierung und Gesellschaft zu Reformen auf.
Trotz dieser Erfolge gelang vielen Ländern bisher aber leider nicht der Anschluss an die internationale Arbeitsteilung.
Die Länder starten mit ungleichen wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Voraussetzungen in den globalen Wettbewerb. Die Globalisierung verläuft deshalb auch nicht gleichmäßig auf unserer Erde. „Ausgestoßene“ drohen regelrecht im Elend zu verharren. Was wird aus diesen Ländern und den Menschen, die dort leben? Was wird z. B. aus Afrika?
Kein Unternehmer investiert aus reiner Nächstenliebe in eine Region, ein Land oder einen Standort. Aktiv und mobil werden er und sein Kapital nur, wenn der Einsatz sich lohnt, entsprechende Gewinne winken und das Eigentum sicher ist. Unter den gegenwärtigen Bedingungen bedeutet dies, dass die Länder sich zu den bestmöglichen Konditionen auf den internationalen Märkten feilbieten müssen. Gefragt sind hier neben Rechtssicherheit und politischer Stabilität vor allem niedrige Steuerquoten, hohe finanzielle Ansiedlungshilfen, ein unkomplizierter und billiger Zugriff auf landeseigene Ressourcen, niedrige Löhne und hohe Arbeitszeiten, niedrige Sozial- und Umweltstandards, hoch motivierte, gut ausgebildete, aber unorganisierte Arbeitskräfte und Ähnliches. Selbst Kinderarbeit ist immer noch willkommen. Nach Schätzungen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und UNICEF sind weltweit 160 Millionen Mädchen und Jungen Kinderarbeiter.5 Sie arbeiten in der Landwirtschaft, in Fabriken, in Minen, als Dienstmädchen, Müllsammler, Dienstboten, Straßenverkäufer, Schuhputzer oder sogar als Zwangsarbeiter, Leibeigene, Haussklaven, Schuldknechte, Kindersoldaten, Drogenkuriere oder Prostituierte.
Dass dieser Missbrauch den Kindern in jeglicher Hinsicht schweren Schaden zufügt, bedarf hier keiner weiteren Erläuterung. Aber die Kinder müssen an Geld kommen, weil ihre Eltern vielfach nicht in der Lage sind, die Familie allein zu ernähren. Dabei gibt es gerade in den Hochburgen der Kinderarbeit, südlich der Sahara, in Asien oder in Südamerika, auch ein riesiges Heer von arbeitslosen Erwachsenen. Aber Kinderarbeit ist eben in jeder Hinsicht billiger. Kinder sind für Arbeitgeber immer noch ein einträgliches Geschäft.
Viele Menschen versuchen der ewigen Odyssee von Krieg, Unterdrückung, Ausbeutung und Armut sowie der damit verbundenen Lebensgefahr und Perspektivlosigkeit zu entfliehen. Sie machen sich mit ihren Familien auf einen abenteuerlichen Weg und suchen ihr Glück in Europa oder anderen entwickelten Regionen des Westens.
Die in den modernen Medien gezeigten Bilder von vollen Supermärkten und Warenhäusern sowie die ansprechenden politischen, wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse in diesen Ländern suggerieren in ihrem Verständnis eine Art Paradies. Die Verheißungen einer sicheren und friedlichen Zukunft, gepaart mit den Erwartungen auf einen bisher nicht vorstellbaren Lebensstandard, lassen alle Ängste und Gefahren in den Hintergrund treten.
Gelingt es nicht, die Länder Afrikas, Vorder- und Südasiens in absehbarer Zeit so spürbar politisch und wirtschaftlich zu stabilisieren, dass die Menschen dort für sich und ihre Kinder eine ausreichende Perspektive erkennen, werden die jetzt noch mehr oder weniger beherrschbaren Flüchtlingsströme – zusätzlich forciert durch den Klimawandel und die Corona-Pandemie – bald zu einer unbeherrschbaren Völkerwanderung, mit unabsehbaren Folgen für den Norden unserer Erdkugel. Hier ist Eile und kluges politisches Handeln vonnöten.
Hat man sich an das Wohlstandsgefälle zwischen den Industrienationen und der übrigen Welt bereits mehr oder weniger gewöhnt, so ist leider nicht zu übersehen, dass in den vergangenen Jahrzehnten die wachsende soziale Ungleichheit auch innerhalb der entwickelten Industrieländer zu einer permanenten Geisel geworden ist. Der wissenschaftlich-technische Fortschritt hat viele Arbeitsplätze überflüssig werden lassen. Gleichzeitig sind mit dem Eintritt der Schwellenländer in die Weltwirtschaft zahlreiche Arbeitsplätze von den Hoch- in die Billiglohnländer verlagert worden. Von dort werden jetzt vielfach gleichwertige Waren zu erheblich niedrigeren Preisen in den Industrieländern zum Kauf angeboten, was bei den noch ansässigen Unternehmen wiederum Zwang zur Senkung der Produktionskosten auslöst. Diese Spirale führt zu einem durchgängig ruinösen Wettbewerb, ganz besonders auch auf dem Arbeitsmarkt. Neben Arbeitslosigkeit rücken Lohndumping und prekäre Arbeitsverhältnisse auf die Tagesordnung. Dass drückt die Einkommen der breiten Masse, während Gewinne und Kapitaleinkünfte einiger Weniger unverhältnismäßig steigen.
Von 1989 bis 2010 stieg die Produktivität in den USA um 62,5 Prozent, während die realen Stundenlöhne des privaten und öffentlichen Sektors im gleichen Zeitraum gerade mal um 12 Prozent wuchsen. Ein Prozent der Amerikaner haben zwischen 1989 und 2007 56 Prozent aller Einkommenszuwächse erhalten.6
Die Menschen, die im Herbst 2011 in den USA im Rahmen der Occupy-Wall-Street-Bewegung mit Slogans wie: „Besetzt die Wall Street“ oder „Wir sind die 99 Prozent“ u. Ä. auf die Straße gingen, waren keine Krakeeler, Vagabunden oder soziale Randgruppen. Hier fand sich vor allem die Mittelschicht, die organisiert nach dem Vorbild des Arabischen Frühlings gegen die Macht der Reichen, die Macht der Banken, gegen die Abzocke der Broker, gegen Arbeitslosigkeit und für mehr Demokratie demonstrierte.
Der Vorwurf: 99 Prozent der Bevölkerung bekommt nichts, während ein Prozent immer reicher wird, wiegt schwer.
Obwohl die Arbeitslosenquote von 2010 bis 2018 von 9,61 Prozent auf 3,87 Prozent kontinuierlich gesunken ist7, leben laut Armutsbericht der Vereinten Nationen, 40 Millionen US-Bürger in Armut, 18,5 Millionen in extremer Armut und 5,3 Millionen in der absoluten Armut der Dritten Welt. Die Vereinigten Staaten verzeichnen die höchste Einkommensungleichheit unter den westlichen Ländern.8
Selbst das verdiente Geld von mehreren Jobs reicht vielfach nicht zum Leben. Die Menschen spüren, dass das soziale Gefüge im Land aus dem Ruder läuft. Sie sehen für sich und ihre Kinder keine gesicherte Perspektive und fühlen sich von der Politik verlassen. Entwicklungen, die Paul Krugman bereits 2002 als „amerikanischen Albtraum“ bezeichnete.9 Der ideale Nährboden für das breite Genre der Populisten.
In Europa vollzieht sich Ähnliches. Im Zuge der Finanz- und Schuldenkrise ist auch hier das soziale Gefüge in eine gefährliche Schieflage geraten. Südeuropa wird mehr und mehr zum Armenhaus der Union.
Im Mai 2021 betrug die saisonbereinigte Arbeitslosenquote der Europäischen Union 7,3 Prozent und in der Euro-Zone 7,9 Prozent. Die traurigen Rekorde hielten Griechenland und Spanien, mit 15,4 Prozent bzw. 15,3 Prozent.10
Besonders erschreckend ist die Jugendarbeitslosigkeit. Im Mai 2021 betrug die saisonbereinigte Arbeitslosenquote der unter 25-Jährigen in der Europäischen Union 17,3 Prozent und in der Euro-Zone 17,5 Prozent. Die Schlusslichter sind Griechenland mit 38,2 Prozent, Spanien mit 36,9 Prozent und Italien mit 31,7 Prozent.11
Betrachtet man hier den Zeitraum vom Beginn der Finanzkrise 2008 bis jetzt, so steht in diesen Ländern nahezu eine ganze Generation im Abseits. Die Auswirkungen sind gegenwärtig noch gar nicht abzuschätzen.
In Deutschland betrug die saisonbereinigte Arbeitslosenquote im Juni 2021, 5,9 Prozent12 und die Jugendarbeitslosigkeit 4,8 Prozent.13 Deutschland ist relativ gut durch die Krisen der vergangenen Jahre gekommen. Aber wenn lt. Sozialbericht der OECD 10 Prozent der Deutschen über beinahe 60 Prozent des gesamten Nettohaushaltsvermögens14 verfügen, so ist auch hier eine erhebliche Schieflage des sozialen Gefüges nicht zu verkennen.
Auch in Deutschland blieben im vergangenen Jahrzehnt die Löhne und Gehälter hinter den Gewinn- und Vermögenseinkommen zurück. Zwischen 2000 und 2013 sind die durchschnittlichen Bruttolöhne je Beschäftigten real sogar gesunken. Am Tiefpunkt 2009 lagen sie 4,3 Prozent niedriger als 2000. Erst 2014 wurde das Niveau von 2000 wieder überschritten, um 1,4 Prozent.15
Im Juni 2016 lag der Anteil der Hartz-IV-Empfänger an der Bevölkerung bundesweit bei 7,7 Prozent.16 Seit 2017 ist die Tendenz hier leicht rückläufig.
2019, vor der Corona-Pandemie, waren in Deutschland 3,1 Millionen Menschen trotz Arbeit von Armut bedroht. Auch viele Rentner müssen weiter arbeiten gehen, weil die Rente zum Leben einfach nicht ausreicht.17
Verbunden mit solchen Zahlen ist stets auch Kinderarmut. 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren (also mehr als jedes fünfte Kind) wachsen in Deutschland in Armut auf.18
Die wachsende Kluft zwischen arm und reich treibt einen gefährlichen Keil in die Gesellschaft, dessen Wirkung deutliche Spuren hinterlässt. Dabei hat Deutschland eine solche Entwicklung doch überhaupt nicht nötig.
Niemand auf unserer Erde wird dauerhaft ein Leben in Frieden und Freiheit führen können, wenn aller Reichtum nur einem ganz geringen Teil der Menschheit zufällt, während die übergroße Mehrheit der Menschen, sogar trotz Arbeit, immer ärmer wird. Wie frei ist ein Leben z. B. in einer Villa, eingepfercht hinter meterhohen Mauern, auf den Mauern zum Schutz noch Rollstacheldraht, an jeder Ecke eine Videokamera und Security-Begleitung auf Schritt und Tritt? Eine solche Art der Freiheit kann weder der Einzelne noch die Gesellschaft anstreben.
Die Wirtschaft ist kein Selbstzweck, sondern sie hat gegenüber der Gesellschaft stets dienende Funktion. Das Wirtschaften muss im Dienst der Menschen stehen und unter Berücksichtigung der Endlichkeit unseres Ökosystems zur Förderung des Gemeinwohls; zu einem guten Leben der Menschen auf unserem Planeten beitragen. Diese unumstößlichen Maximen gelten selbstverständlich auch für das globale Zeitalter.
Das gesellschaftliche Hauptziel des globalen Wirtschaftens kann deshalb im Kern nur darin bestehen:
Bei Bewahrung der Schöpfung die Lebensqualität aller Menschen auf unserer Erde zielstrebig zu verbessern und darauf hinzuwirken, dass die Menschen auf allen Erdteilen ein würdevolles und erfolgreiches Leben führen können.
Auf diese Zielstellung ist alles globale Wirtschaften grundsätzlich auszurichten; denn alle Menschen auf unserer Erde haben Anspruch auf ein Leben in Würde und Wohlstand. Alle Menschen bedürfen der Chance auf ein gedeihliches und erfolgreiches Leben.
Aber genau das gelingt in der Praxis gegenwärtig nicht. Die Früchte des wissenschaftlich-technischen Fortschritts und der Globalisierung erntet bisher nicht die breite Masse, sondern hauptsächlich nur ein geringer, privilegierter Teil der Weltbevölkerung.
„Wenn sich 20 % der Menschen in der wohlhabenden Welt herausnehmen 80 % aller globalen Ressourcen zu verbrauchen, können wir der Frage von Gerechtigkeit nicht länger ausweichen. Wir sind eine Welt. Wir müssen sie umbauen, indem wir die Voraussetzungen schaffen, dass pro Jahr weitere 80 Millionen Menschen auf der Erde leben können.“19
Wie sich zeigt, erfüllt sich das neoliberale Versprechen: „Wohlstand für alle“ eben nicht im Selbstlauf. Nicht einmal optimistische Zukunftsaussichten sind hier berechtigt. Die uns in immer kürzeren Zeitabständen ereilenden Krisen tragen nicht schlechthin nur neue Vornamen, sondern haben infolge der globalen Verflechtungen auch gravierende weltweite Auswirkungen.
Die einzelnen Nationalstaaten sowie die existierenden internationalen Organisationen und Gremien stehen diesen Entwicklungen weitestgehend rat- und machtlos gegenüber. Maßnahmen der Politik, um die globale Wirtschaft in geordnete Bahnen zu lenken, bleiben weitestgehend wirkungslos, unvollkommenes Stückwerk und erreichen außer Aufmerksamkeit in den Medien keine nachhaltigen Veränderungen.
Infolge dieser Ohnmacht werden Arbeitslosigkeit, Sozialabbau, Ausbeutung, Ungerechtigkeit, Ausgrenzung, Raubbau an Umwelt und natürlichen Ressourcen, Wirtschafts-, Banken- und Staatskrisen sowie die damit verbundenen gesellschaftlichen Verwerfungen, vielfach sogar schon als unabänderliche Folgen, als eine Art hinzunehmendes Schicksal der Globalisierung betrachtet. Die Ungleichheit erhält mehr und mehr den Status eines unüberwindbaren Naturgesetzes. Die Sicherung der wichtigsten Grundbedürfnisse, wie z. B. ausreichend Nahrung, eine menschenwürdige Wohnung, sauberes Wasser, eine solide Grundausbildung oder eine gute ärztliche Versorgung für alle Menschen auf unserer Erde scheint in einer unerreichbaren Ferne zu liegen; ja, zu einem utopischen Gefasel zu werden.
„Der Glaube der Menschen an die Stabilität der Welt ist erschüttert wie nie zuvor seit dem Zweiten Weltkrieg. Viele sehen das Ende des Wachstums, das Ende der Technik, das Ende der Moderne – oder sogar den Anfang vom Ende der Zivilisation“.20
Hier tritt die ganze Ohnmacht unserer Zeit zutage. Derartige Gedanken und Entwicklungen stellen aber doch den Sinn der Globalisierung völlig auf den Kopf. Was ein Segen für die gesamte Menschheit sein könnte, bürgt so in sich mehr und mehr die Gefahr eines weltumspannenden Desasters. Ein Desaster, das unser aller Frieden und Freiheit gefährdet!
Wo aber liegen für solche Entwicklungen die Ursachen? Wer zeichnet hierfür hauptsächlich verantwortlich? Was gilt es zu verändern?
Die Globalisierung ist weder von Gott gemacht, noch sind ihre negativen Auswirkungen von Gott gewollt. Hierfür zeichnet allein der Mensch verantwortlich. Sie ist auch keine Erfindung unserer Zeit, sondern eine höchst langfristig angelegte, folgerichtige und zutiefst wünschenswerte Entwicklung der kapitalistischen Wirtschaft. Marx und Engels weisen bereits 1848 im „Manifest der Kommunistischen Partei“ darauf hin, dass der Kapitalismus über die ganze Erdkugel jagen wird, sich überall einnistet und „auch die barbarischste Nation in die Zivilisation“ reißt.21
Nein, die Globalisierung der Wirtschaft an sich ist nicht die Ursache für Krisen, Ausbeutung, Arbeitslosigkeit, Armut, sozialer Ausgrenzung, Unterdrückung, Gewalt, Terrorismus, Umweltzerstörung oder Staatspleiten, sondern sie bietet ganz im Gegenteil einmalige Chancen zur nachhaltigen Bekämpfung solcher Erscheinungen und zur Erreichung eines allgemeinen Wohlstandes. Es ist auch nicht schlimm, dass das Unternehmertum wie ein Phantom rastlos um die Erde jagt und immer wieder nach Regionen Ausschau hält, wo sich das eingesetzte Kapital noch besser verwertet.
Von entscheidender Bedeutung ist vielmehr, dass diese dem Unternehmertum innewohnende Gier an keiner Stelle unseres Planeten Platz und Raum zu einer ungehemmten Entfaltung finden darf, sondern stets auf verbindliche und unumstößliche Grenzen, Spielregeln und Normen stößt, deren Einhaltung einer strengen Kontrolle unterliegen und Verstöße einer empfindlichen Sanktionierung.
Das bleibt bisher allerdings nur eine schöne Illusion, denn die Wirtschaft führt die Prozesse der Globalisierung weitestgehend unbeeinflusst, unkontrolliert und unbeirrt in ihrer ganz eigenen Regie und bestimmt nahezu im Alleingang Ziele, Spielregen und Normen des globalen Wirtschaftens. Politik und Arbeiterbewegung haben die Chancen nach 1989, sich ebenfalls global zu organisieren, wenn überhaupt, nur höchst unzureichend genutzt. Sie sind der Wirtschaft nicht gefolgt. Der eigene Nationalstaat ist für beide der Mittelpunkt des Interesses geblieben.
Dabei wird durchaus erkannt, dass die Wirtschaft und die mit ihr verbundenen Märkte mehr und mehr den nationalen Einflussbereich verlassen und in den staatsfreien Raum wechseln. Die G7-oder die G20-Treffen lassen das politische Bewusstsein erkennen, globale Probleme auch durch eine globale Herangehensweise lösen zu müssen.
Aber auch diese politischen und wirtschaftlichen Schwergewichte handeln letztlich vorrangig wieder in ihrem eigenen Interesse. Sie können auch die internationale Staatengemeinschaft in ihrer Vielfalt und Vielschichtigkeit nicht repräsentieren. Gleichfalls haben die Beschlüsse dieser informellen Foren keinen rechtlichen Status und bleiben deshalb vielfach nur „gutwillige Bekundungen“.
An der Arbeiterbewegung und ihren Organisationen indes, scheint die Globalisierung allerdings nahezu ganz vorbeigegangen zu sein. Die Funktionäre haben sich im nationalen Rahmen gut eingerichtet und genießen die Vorzüge ihrer gut bezahlten Stellungen. Einen internationalen Schulterschluss gibt es weder zwischen den Industrienationen, geschweige denn mit den Schwellen- und Entwicklungsländern. In Europa gibt es zwar den Europäischen Gewerkschaftsbund (EGB). Seine Bedeutung für Europa und die Welt ist allerdings sehr bescheiden.
Die Wirtschaft ist unbestritten gegenwärtig die Haupttriebfeder der internationalen Entwicklung und der Hauptkonstrukteur der internationalen Netzwerke. Alle anderen gesellschaftlichen Institutionen sind im Nachhinein mehr oder weniger nur noch gezwungen, dem Voranschreiten, dem Drängen und den Interessen der Wirtschaft zu folgen.
Dieser Zustand eröffnet der Wirtschaft alle Möglichkeiten der internationalen Selbstentfaltung. Leider vielfach auch mit den Folgen, dass Gier, Gewinnsucht und Egoismus in den Vordergrund treten. Die Wirtschaft manipuliert die Spielregeln des Wirtschaftens in ihrem Sinn. Spekulanten formulieren nicht nur die Erwartungen, sondern sorgen auch gleich selbst dafür, dass diese Erwartungen in Erfüllung gehen. Die Finanzwirtschaft verliert völlig die Bodenhaftung. Ihre dienende Funktion gegenüber der Realwirtschaft wird zur Nebensache. Sie verselbstständigt sich mit eigenen Produkten. Das Geld gewinnt an Eigendynamik, dreht sich um sich selbst und vermehrt sich wie von Geisterhand. Vermögensverwalter und Fondsmanager verfügen in unvorstellbaren Dimensionen über das Geld anderer, lassen es heckend um den Erdball kreisen und verschaffen sich so einen bisher nicht gekannten Einfluss in Politik und Wirtschaft. „Die neue Illusion, dass dies uns am Ende alle reicher machen wird, ist in Wahrheit die neue Gefahr, dass die Welt schon bald ihre nächste große Weltwirtschaftskrise erfährt.“22
Die Wirtschaft errichtet so ihr ganz eigenes Machtsystem, wird zum Selbstzweck und entledigt sich ihrer dienenden Funktion gegenüber der Gesellschaft.
Es ist ein völliger Irrtum zu glauben, dass die Wirtschaft (vielleicht auch noch die kapitalistische) ihr Handeln im Selbstlauf auf das gesellschaftliche Hauptziel des globalen Wirtschaftens ausrichtet oder die Stabilität der Gesellschaft in den Mittelpunkt ihres Wirkens stellt.
Nein, auf Derartiges orientiert sich die Wirtschaft nicht aus sich heraus. Solche Aufgabenstellungen würden sie im Kern auch völlig überfordern. Vielmehr bedarf es einer übergeordneten politischen Macht bzw. Institution, die das Wirken der global organisierten Wirtschaft zielstrebig auf das vorn genannte gesellschaftliche Hauptziel orientiert.
Auf unserer Erde gibt es gegenwärtig aber keine autorisierte Macht, die der international agierenden Wirtschaft einen verbindlich ordnenden Rahmen setzt und sie nach entsprechenden Zielen und Normen führt. Es gibt keine international autorisierte Macht und keine verpflichtenden Institutionen, die aus dem gesellschaftlichen Hauptziel des globalen Wirtschaftens notwendige Teilziele und Teilaufgaben ableiten, diese der Wirtschaft mit erkennbarer Aussicht auf ökonomischen Erfolg zur Realisierung anbieten, verbindliche Kriterien, Regeln, Normen und Verbote für die Zielerfüllung und das globale Wirtschaften vorgeben, die Einhaltung dieser Vorgaben sorgfältig kontrollieren, Verfehlungen aufgreifen und sie mit der erforderlichen Konsequenz auch strafrechtlich verfolgen können. Im internationalen Recht z. B. herrscht gegenwärtig vielfach eine Art Anarchie, sodass Straftaten, wenn überhaupt, oft nur mit größten Schwierigkeiten strafrechtlich verfolgt und grenzüberschreitende Streitfälle nur selten erfolgreich geschlichtet werden können. Einige Länder und Personen sind hier einfach „gleicher“.
Nach 1989 glaubte man zunächst, dass die USA als verbleibende Supermacht die Rolle des „Weltgestalters“ übernehmen könnte. Kritiker, die das stets bezweifelten, sollten Recht behalten. Dieses Land konnte der internationalen Staatengemeinschaft in der jüngsten Vergangenheit keine gestaltenden Impulse geben. Auch wird sich die moderne globale Welt auf Dauer niemals der Dominanz einzelner sogenannter Supermächte unterwerfen, wer immer diese auch sein mögen.
Die Weltgemeinschaft verlangt vielmehr nach international autorisierten Organisationen und Institutionen, die sich den politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Problemen unserer Zeit, unter dem Blickwinkel der Gleichberechtigung aller Akteure, stellen und diese einer zielstrebigen Lösung zuführen. Ohne das Wirken solcher Organisationen und Institutionen können Lösungen für die vorn aufgeworfenen Fragen und Probleme stets nur unbefriedigendes Stückwerk bleiben.
Die Vereinten Nationen sollten hier in den Fokus rücken. Aber wie später noch gezeigt wird, können die Vereinten Nationen die o. g. Anforderungen gegenwärtig überhaupt nicht erfüllen. Nationaler Egoismus und einmal erworbene historische Privilegien überlagern auch hier wie ein Spinnennetz das Handeln dieser Organisation. Die Vereinten Nationen bewegen sich in einem historisch längst überholten Rahmen, in einem historisch längst überholten Korsett, das der modernen internationalen Staatengemeinschaft mit ihrer Vielfalt an Problemen und Aufgaben überhaupt nicht mehr gerecht wird. Von der Gleichberechtigung der Mitglieder ganz zu schweigen.
Dies zu ändern oder diesbezüglich zumindest wirksame Anstöße auf den Weg zu bringen ist deshalb ein unabdingbares Erfordernis unserer Zeit.
Speziell unter der Präsidentschaft von Donald Trump wurden Macht und Einfluss bestehender internationaler Organisationen und Gremien immer wieder bewusst infrage gestellt. Die mit der Präsidentschaft verbundene Renationalisierung der Wirtschaft und sein demonstratives Desinteresse an internationalen Treffen und Foren haben nicht nur den Welthandel geschwächt, sondern auch dem Ansehen internationaler Organisationen weiter geschadet.
Gleichzeitig ist aber der Weltöffentlichkeit auch vor Augen geführt worden, dass solche Organisationen, wie z. B. die Vereinten Nationen oder die WTO, ihre Aufgaben gegenwärtig längst nicht so erfüllen, wie es notwendig wäre; oder besser, so erfüllen können, wie es die moderne globale Welt verlangt.
Eine Globalisierung unter Federführung der Wirtschaft führt weder zum Schutz von Klima und Umwelt noch zu ausgewogenen Lebensverhältnissen und schon gar nicht zur Entwicklung einer modernen, gleichberechtigten und friedfertigen Weltgemeinschaft.
Nach Schätzungen der Vereinten Nationen wird die Weltbevölkerung bis 2050 auf fast 10 Milliarden Menschen anwachsen.23 Der größte Zuwachs wird in Afrika, südlich der Sahara, der heute bereits ärmsten Region der Welt, erwartet. Gleichzeitig lehnen sich die aufstrebenden Länder wie China, Indien oder Brasilien immer stärker an den Lebensstil der Industrienationen an. Auch die Menschen in Afrika und den anderen bisher vernachlässigten Regionen unserer Erde werden künftig ihren Anteil einfordern und vom Wohlstand partizipieren wollen. Diesen finden sie aber, von einigen Ausnahmen abgesehen, nicht irgendwo in der Welt, sondern den müssen sie in erster Linie in ihrer angestammten Heimat finden.
Die Zukunft fordert uns also heraus. Wissenschaft und Technik werden die internationale Entwicklung der Produktivkräfte weiter vorantreiben. Die Prozesse der Globalisierung sind unumkehrbar, auch wenn sie vorübergehend immer wieder mal an Fahrt verlieren.
Gefragt ist verantwortungsvolles, bewusstes, internationales Handeln in Politik und Gesellschaft. Wir müssen es lernen, international verbindlichen Zielen, Aufgaben und Normen den Vorrang vor nationalen Interessen und Befindlichkeiten einzuräumen.
Wir Menschen müssen begreifen, dass man auf Kosten anderer nicht dauerhaft in Frieden und Freiheit leben kann. Unterdrückung und Ausbeutung waren noch nie tragende Fundamente. Die Geschichte hat die Unterdrücker und Ausbeuter stets wieder eingeholt.
Wir müssen begreifen, dass die Möglichkeiten unserer Erde begrenzt sind, Umwelt und Klima keine größeren Belastungen mehr vertragen und die natürlichen Ressourcen, auch bei immer besseren Abbau- und Aufbereitungsverfahren, nicht endlos sind. Ignoranz, Sorglosigkeit, Verschwendung und Raubbau sind hier die schlechtesten Ratgeber.
Ob und wie wir die Herausforderungen der Zukunft meistern, hängt neben dem politischen Willen entscheidend mit davon ab, wie es gelingt, das globale Wirtschaften auf das gesellschaftliche Hauptziel zu konzentrieren. Das verlangt nach einer klaren, zielstrebigen, ganz bewussten Führung der Weltwirtschaft und nach einer mit der notwendigen Macht und dem notwendigen Fachwissen ausgestatteten, international autorisierten Institution, die die globale Wirtschaft nach der gesellschaftlichen Zielstellung des globalen Wirtschaftens führen kann.
Ein solcher Schritt muss der internationalen Gemeinschaft gelingen, sonst wird unsere Welt immer wieder in unversöhnliche Machtblöcke zerfallen. In diesem Sinne gilt es, alles daran zu setzen, um einen nächsten Kalten Krieg frühzeitig die Basis zu entziehen.
Aber ist der moderne, international organisierte Kapitalismus, in seiner ganzen globalen Komplexität und seiner fortgeschrittenen Verselbstständigung, überhaupt noch im Dienste der Weltgemeinschaft beherrsch- und beeinflussbar, lässt sich dieser Kapitalismus überhaupt noch im Sinne des gesellschaftlichen Hauptzieles regulieren?
Wenn, dann wie und von wem?
Wer soll eine solche Weltwirtschaft führen, Regeln und Normen für das globale Wirtschaften aufstellen, ihre Einhaltung kontrollieren und international verbindlich Recht sprechen?
Welche Wirtschaftsordnung kann den künftigen Herausforderungen überhaupt noch genügen?
Welche Entwicklungen und welche Stellung sollte Europa – unsere Heimat – in einer globalen multipolaren Welt anstreben, damit wir die Zukunft nach unseren liberalen rechtsstaatlichen Werten mit gestalten können und den Völkern auch künftig ein Garant für Frieden, Freiheit, Völkerverständigung und Wohlstand sind?
Der Verfasser greift nachfolgend die aufgeworfenen Fragen auf. Dabei zwingt die Komplexität der Thematik das Wesentliche in den Ausführungen nicht zu verlassen. Geöffnet werden soll vor allem der Blick für neue Perspektiven und Lösungen; für notwendige politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen, sodass die Früchte der Globalisierung letztlich allen Menschen auf unserer Erde zugutekommen. Der Verfasser wendet sich deshalb insbesondere an die Avantgarde unserer Zeit, an interessierte Menschen in Politik, Wissenschaft und Gesellschaft, die nicht in alten Klischees, übersteigerten nationalen Denkschemen oder im ganz persönlichem Egoismus verharren, sondern die atemberaubenden Entwicklungen in Wissenschaft, Technik und Wirtschaft als Herausforderung und Chance erkennen, sich dem eigenen und dem Leben nachfolgender Generationen verpflichtet fühlen und begreifen, dass nationale Politik nur noch dann Zukunft und Tragweite besitzt, wenn sie international abgestimmt und Bestandteil eines tragfähigen, weltumspannenden Gesamtkonzeptes ist.
2 DIE GLOBALE WIRTSCHAFT IM DIENST DER MENSCHHEIT
2.1 Wissenschaft und Technik revolutionieren Kapital und Arbeit





























