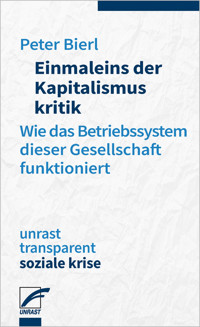15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unrast Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Rosa Luxemburg ist eine Ikone der Linken, doch ihre inhaltlichen Positionen werden oft ignoriert. Diese Ambivalenz zeigte sich bereits kurz nach ihrer Ermordung, als die KPD der Märtyrerin zwar ein Denkmal errichtete, ihre Ansichten aber als »Syphilisbazillus« diffamierte. Für die SED galt, dass Luxemburg immer falsch lag und irrte, wo sie anderer Meinung war als Lenin. Heute wird vielerorts ihr Konzept der ›revolutionären Realpolitik‹ wieder aufgegriffen oder auf ihre Imperialismustheorie verwiesen, wenn es um Strategie und Taktik, um imperiale Lebensweise oder Landgrabbing geht. Andere suchen Inspiration für einen sozialistischen Feminismus oder beziehen sich auf die ›rote Rosa‹, die die Tierquälerei beklagte. Vor diesem Hintergrund werden in diesem Buch wesentliche Positionen Luxemburgs sowohl im historischen Kontext als auch hinsichtlich ihres aktuellen Gebrauchswerts diskutiert. Einerseits war Luxemburg befangen im deterministischen Marxismus der Zweiten Internationale. Andererseits versagte sie sich jede Beteiligung an der Administration der Kapitalverwertung. Sie bestand auf einem radikalen Bruch zugunsten einer klassen- und herrschaftslosen Gesellschaft, die nur demokratisch zu erreichen sei. Von Anfang an bekämpfte sie die autoritäre Politik Lenins, setzte stattdessen auf Lern- und Selbstverständigungsprozesse in konkreten Kämpfen und verfocht eine anti- und transnationale Haltung. Das sind Elemente, auf die auch eine moderne Linke aufbauen muss. »Das Fazit gleich vorweg: Lesen. Unbedingt.« – Aurora, rso revolutionär sozialistische organisation »Das Buch ist eine gut lesbare Einführung in Luxemburgs Werk und Aktivismus, auch geeignet für Leute, die noch nicht so viel darüber wissen.« – Buchladen zur schwankenden Weltkugel
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 500
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Peter Bierl, 57, ist freier Journalist und Autor. Er studierte Politikwissenschaften und war jahrelang politischer Aktivist und Mitglied der DJU/Verdi.
Peter Bierl
Die Revolution ist großartig
Was Rosa Luxemburg uns heute noch zu sagen hat
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar
Peter Bierl:
Die Revolution ist großartig
1. Auflage, Dezember 2020
eBook UNRAST Verlag, September 2023
ISBN 978-3-95405-079-6
© UNRAST Verlag, Münster
www.unrast-verlag.de | [email protected]
Mitglied in der assoziation Linker Verlage (aLiVe)
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung
sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner
Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter
Verwendung elektronischer Systeme vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag: David Hellgermann, Münster
Satz: Andreas Hollender, Köln
Inhalt
Hinweise zum Text
Kapitel EinsZwischen Verehrung und Verdammung
Kapitel ZweiMarx, Luxemburg und der Marxismus
Kapitel DreiReform, revolutionäre Realpolitik, Transformation und Revolution
Kapitel VierNational, International, Transnational
Kapitel FünfAkkumulation des Kapitals und imperiale Lebensweise
Kapitel SechsFeminismus und die Soldaten der Revolution
Kapitel SiebenDemokratie, Selbstorganisation, Emanzipation
Kapitel AchtTalking about a Revolution
Literaturverzeichnis
Anmerkungen
Hinweise zum Text
Es ist wichtig, nicht Gleichheit vorzutäuschen, wo keine existiert. Das macht es schwierig, Texte zu gendern. Es gab Anarchistinnen, Kommunistinnen und Sozialistinnen, aber lange Zeit keine Parteiführerinnen und keine weiblichen Abgeordneten. In den Theoriezeitschriften der sozialistischen Parteien waren Autorinnen rar, als promovierte Ökonomin war Rosa Luxemburg ein Solitär. Das sind die Wirkungen einer patriarchalen Gesellschaft, die sich in der Sprache niederschlagen. Bis heute wird Luxemburg an vielen Stellen einfach als ›Rosa‹ bezeichnet, ohne Familiennamen, und das nicht nur, wenn es um ihre Kindheit geht. In der Verwendung des Vornamens drückt sich Distanzlosigkeit und Verkleinerung aus.[1] Niemand würde von Karl, Friedrich oder Wladimir schreiben, wenn Marx, Engels oder Lenin gemeint sind.
Mein Maßstab für das Gendern ist die (mutmaßliche) Zusammensetzung. In allen Fällen, in denen eine Gruppe nur oder fast ausschließlich Männer umfasst, findet sich die männliche Schreibweise, und die weibliche, wenn eine Gruppe ganz oder weit überwiegend aus Frauen besteht. Außerdem habe ich in Zitaten und bei der indirekten Wiedergabe von Quellen die Schreibweise des Originals übernommen, das gilt mitunter auch für diskriminierende Bezeichnungen. Alles andere wäre eine Fälschung von Dokumenten. In Zitaten wurde auch die jeweilige Rechtschreibung belassen.
Dann gibt es Grenzfälle. Ist die Bezeichnung »Faschisten« angemessen – handelt es sich doch um eine dezidiert männerbündlerische, sexistische und antifeministische politische Richtung – oder übergehen wir damit den Anteil von Millionen von Mitläuferinnen und Täterinnen, der in der feministischen Bewegung lange geleugnet wurde?[2] Problematisch scheint mir die Bezeichnung »Jüdinnen und Juden« zu sein, weil konservative und völkische Autoren einen Typus vor Augen hatten, zugespitzt im Terminus »der Jude«, der sich besonders im NSDAP-Umfeld nachweisen lässt. Diesen Terminus zu gendern, erscheint mir wie Geschichtsklitterung, aber es gab männliche und weiblich jüdische Menschen, die Widerstand leisteten, diskriminiert, verfolgt und ermordet wurden. In beiden Fällen werde ich also gendern.
Wer Luxemburgs Schriften liest, wird mitunter irritiert sein. Ihr historischer Optimismus ist für uns kaum nachvollziehbar, so wenig wie ihr pathetischer Bezug auf das Proletariat und noch weniger auf das Volk. Für Luxemburg war die Assoziation von Volk und ›plebs‹ naheliegend, eine Konglomerat subalterner Klassen, unruhig und gelegentlich rebellisch wie die Massen, die 1789 die Bastille stürmten. Diese Gemengelage löst sich im Lauf des 19. Jahrhunderts auf, der Sansculottismus als kleinbürgerlicher Radikalismus wanderte in Frankreich politisch nach rechts.[3] Bei Luxemburg bleibt das »Volk« in ihren Texten ein positiver Begriff, das Synonym für ausgebeutete und unterdrückte Klassen oder, enger gefasst, das Proletariat, dem sie einen Teil der Kleinbäuer*innen und Kleinbürger*innen zuschlug. Auch die Bedeutung von Nation, Volkstum und Volksgemeinschaft, die in Deutschland immer mitschwingt, gehörten nicht zu ihrem Verständnis. Sie verwendete auch nur männliche Formen: der Arbeiter, der Proletarier, die Arbeiterbewegung.
Erklärungsbedürftig ist auch der politische Terminus »Linke«. Der Begriff stammt aus dem Parlamentsbetrieb des postrevolutionären Frankreich und bezog sich auf die Sitzordnung. Inhaltlich markiert die Frage der sozialen Gleichheit eine Trennlinie. Die Linken fordern sie, die Rechten lehnen sie ab. Die Zuordnung wird unterlaufen von linken Biologist*innen, Rassist*innen und Eugeniker*innen. Als relative Positionsbestimmung politischer Kräfte scheint mir der Begriff immer noch sinnvoll in einer Klassengesellschaft, in der politische Fragen soziale Fragen sind. Als Linke werden in diesem Buch alle gefasst, die in der Fremd- und Selbstwahrnehmung als links gelten, also etwa Anarchist*innen, Sozialdemokrat*innen, Sozialist*innen und Kommunist*innen. Als radikale Linke bezeichne ich jene, die mit Kapital und Staat brechen wollen. Eine radikale und zugleich emanzipatorische Linke ist obendrein antiautoritär und basisdemokratisch – und derzeit eine marginale Größe, von gesellschaftlicher Hegemonie weit entfernt.
Zuletzt möchte ich einigen Menschen für ihre Unterstützung danken. Zuerst den Genoss*innen vom Arbeitskreis Staat in München und der Gruppe Mittwochsdisko in Dießen, wo ich seit Jahren in regelmäßigen Diskussionen viel gelernt, neue Ideen gewonnen und meine Positionen geschärft habe. Besonders danken möchte ich Nicolas Hähnel, Sona Hähnel, Jan Hoff, Herbert Panzer und Wolfgang Veiglhuber, die einzelne Abschnitte mit kritischem Blick gelesen haben, sowie Moritz Zeiler, der sich das ganze Manuskript vorgenommen hat. Die Fehler im Buch bleiben selbstverständlich meine.
EINSZwischen Verehrung und Verdammung
Rosa Luxemburg ist eine Ikone der Linken wie Che Guevara, Fidel Castro, Lenin, Kurt Eisner, Emma Goldman oder Gustav Landauer. Luxemburg kann als aufrechte Revolutionärin und Märtyrerin verehrt werden, weil sie durch ihre Ermordung im Gefolge der Novemberrevolution nicht mehr in die folgenden Irrungen und Wirrungen der radikalen Linken verwickelt war. Sie wurde und wird für politische Anliegen in Beschlag genommen, wobei die Auseinandersetzung mit ihren Werken in der Regel nebensächlich ist. Augenfällig ist das alljährlich bei der großen Gedenkveranstaltung für Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht im Januar in Berlin. Dort versammelt sich ein Spektrum von Sozialdemokrat*innen bis Stalinist*innen. Dass die Linkspartei ihre Stiftung nach Luxemburg benannt hat, ist eine Ehrung, die diese Frau mehr als verdient hat. Für die Partei jedoch ist die Beteiligung an Regierungen ein kaum hinterfragtes Ziel. Die Namenspatronin hingegen hielt Fundamentalopposition für die einzig mögliche parlamentarische Strategie. Das Urteil von Hannah Arendt, wonach Luxemburg »die umstrittenste und mißverstandendste Gestalt der deutschen Linken«[1] sei, ist trotz aller Verehrung bis heute gültig.
Viele versuchen das Werk Luxemburgs in aktuelle Debatten und Kämpfe einzubinden. Das ist prinzipiell zu begrüßen, auch wenn sich über manche Ergebnisse streiten lässt. In vielen Debatten wird auf sie Bezug genommen, ohne ihre tatsächlichen Positionen oder den historischen Kontext ihrer Entstehung zu berücksichtigen. So wird das Schlagwort von der revolutionären Realpolitik gerne aufgegriffen, wenn Linke über Strategie und Taktik räsonieren. Dabei hat Luxemburg diese Wortkombination nur einmal verwendet, der Begriff hat keine weitere Bedeutung für ihr Werk. Verfechter*innen der Konzepte der imperialen Lebensweise und der Externalisierungsgesellschaft oder des Landgrabbing verweisen auf Luxemburgs theoretisches Hauptwerk über die Akkumulation des Kapitals, mit dem sie den Zusammenbruch des Kapitalismus beweisen wollte. Andere suchen Ansatzpunkte für einen ethischen oder sozialistischen Feminismus. Linke Tierrechtler*innen beziehen sich auf Luxemburg, weil sie in Briefen Tierquälerei eindringlich beklagte. Auf ihre Theoriebildung hatte das aber nicht den geringsten Einfluss.
Zum 100. Jahrestag der Novemberrevolution 1918 und der Räterepubliken von 1919 bot die Linke viele Publikationen und Veranstaltungen landauf und landab. Es war wichtig, an die Ereignisse zu erinnern und der Opfer zu gedenken, die von Todesschwadronen im Auftrag einer SPD-Regierung massakriert wurden. Eine selbstkritische Aufarbeitung müsste sich jedoch damit auseinandersetzen, warum Luxemburg diese Revolution bereits Mitte Dezember 1918 für gescheitert erklärte. Sie beharrte darauf, dass eine soziale Revolution nur von einer überzeugten Mehrheit der Bevölkerung ausgehen und getragen werden könne, die sie jedoch als nicht gegeben ansah. Überdies kritisierte Luxemburg als eine der ersten bereits im Oktober 1918 die autoritäre Deformation der Oktoberrevolution. Beides hatte Konsequenzen. Auf dem Gründungsparteitag der KPD zur Jahreswende 1918/19 plädierte sie für den Namen »Sozialistische Partei«, um sich von den Bolschewiki abzugrenzen, sowie für eine Beteiligung an Wahlen und warnte vor Aufstandsversuchen, die sie für zum Scheitern bestimmt erklärte.
Auch wenn Historiker*innen solche Gedankenspiele nicht mögen, kann es lohnend sein sich auszumalen, ob die Geschichte der radikalen Linken und der Weimarer Republik anders verlaufen wäre, hätte sich Luxemburg damit auf dem Gründungsparteitag der KPD durchgesetzt. Wäre dann vielleicht eine radikal-emanzipatorische, basis- oder rätedemokratische Bewegung entstanden, mit mehr Ausstrahlungskraft und Erfolg als der bald stalinisierten KPD?
Die Missachtung von Luxemburgs Positionen, bis hin zur persönlichen Beschimpfung, hat Tradition. Führende Sozialdemokraten schmähten sie machomäßig als »doktrinäre Gans« (Viktor Adler), als »gescheite Giftnudel« (Ignaz Auer) oder »hysterisches und zänkisches Frauenzimmer«.[2] Von der konservativen deutschen Presse wurde sie als gewalttätige Krawallmacherin, als Jüdin, Migrantin und Frau angegriffen. Antisemitische Schmähungen kamen von polnischen Nationalliberalen wie deutschen Sozialdemokraten. Der russische Kommunist Nikolai Bucharin tat ihr ökonomisches Hauptwerk als »talmudistische Sophisterie« ab.[3]
Groteske Züge nahm die Haltung der kommunistischen Bewegung an. Einerseits wurde sie als Märtyrerin verehrt, andererseits wurden ihre Ansichten verdammt. Die Auseinandersetzung begann, als Paul Levi, ein Freund und Mitbegründer der KPD, sich 1921 mit der Partei überwarf und ihre Kritik an der Oktoberrevolution veröffentlichte. Fortan war Luxemburg für Parteikommunist*innen ein Problemfall.[4] Den Ton gab Wladimir Iljitsch Lenin vor, Georg Lukács folgte als einer der ersten seinem Verdikt. Fünf große Irrtümer hielt Lenin ihr vor, darunter ihre Kritik an der russischen Revolution. Dennoch bleibe Luxemburg »ein Adler« und die Erinnerung an sie müsse geehrt werden.[5]
Die KPD errichtete 1926 auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde in Berlin ein Denkmal für Liebknecht, Luxemburg und andere Revolutionäre. Dort fand bis zur Regierungsübernahme der NSDAP 1933 die jährliche Lenin-Luxemburg-Liebknecht-Demonstration statt. 1928 benannte die KPD ihre Reichsparteischule in Dresden nach Luxemburg. Im Juni 1924 beschloss der fünfte Kongress der Komintern die Bolschewisierung der Kommunistischen Parteien. Die nationalen Sektionen mussten alle organisatorischen und taktischen Prinzipien der russischen Partei übernehmen. Für die KPD war das verbunden mit der Absage an die vermeintlich von Luxemburg vertretene Ansicht, nur die Spontanität der Massen könne eine Revolution bewirken.[6] Im gleichen Jahr diffamierte die KPD-Führerin Ruth Fischer Luxemburgs Positionen als »Syphilisbazillus« in der Arbeiterbewegung.[7] Im Exekutivkomitee der Komintern setzte Grigori Sinowjew 1925 die Losung vom Kampf gegen den »Luxemburgismus« durch, der als ein dem Marxismus-Leninismus feindliches Gedankensystem verdammt wurde. Josef Stalin bezeichnete Luxemburg 1931 als Begründerin der Theorie der permanenten Revolution, die seiner Idee vom »Sozialismus in einem Land« widersprach. Daraus wurde die Theorie der trotzkistisch-luxemburgistischen Verschwörung gegen die Sowjetmacht imaginiert. Stalin forderte, den »Luxemburgismus« mit Stumpf und Stiel auszurotten.[8] Der KPD-Führer Ernst Thälmann maß dem Urteil Stalins im Jahr 1932 in einer Rede »wegweisende Bedeutung« zu. Angesagt sei der »schärfste Kampf gegen die Überreste des Luxemburgismus«, weil dieser »niemals eine Brücke zum Marxismus-Leninismus bilden« könne, »sondern stets nur einen Übergang zum Sozialfaschismus, zur Ideologie der Bourgeoisie« darstelle.[9] Die Kommunistische Partei Polens (KPP) distanzierte sich von Luxemburgs Vorstellungen, es brauche aber »Manneskraft«, um diese auszumerzen. Der Kniefall nutzte nichts. Die KPP wurde dennoch als luxemburgistisch diskreditiert, auf Geheiß Stalins 1938 aufgelöst und ihre Führung ermordet.[10]
In der DDR galt die Maxime Thälmanns, dass Luxemburg immer falsch lag und irrte, wo sie anderer Meinung war als Lenin.[11] Der Historiker und SED-Politiker Fred Oelßner schrieb 1952, der Luxemburgismus sei »ein ganzes System falscher Auffassungen« und stelle »eine der entscheidenden Ursachen für die Niederlagen der KPD nach ihrer Gründung« dar.[12] Luxemburgs Werk sei »eine Abart des Sozialdemokratismus« und ihr berühmter Satz von der Freiheit des Andersdenkenden laufe auf »Freiheit für die Konterrevolution« hinaus.[13] Das war die parteioffizielle Haltung bis zur Entstalinisierung 1956 unter Nikita Chruschtschow, als Luxemburg und die KPP rehabilitiert wurden. Nun wurde Luxemburg wieder als »vorwärtsdrängende, revolutionäre, marxistische Führerin ihrer Klasse, des internationalen Proletariats« gefeiert, wie etwa von Günter Radcun 1974 im Vorwort zum vierten Band ihrer Gesammelten Werke.[14] Die Demokratie habe sie lediglich im instrumentellen Sinn bejaht, als Mittel zur proletarischen Machteroberung.[15] Ihre Kritik an der Oktoberrevolution sei »aufgrund ungenügender Informationen, befangen in fehlerhaften Auffassungen« zustande gekommen, was Luxemburg nach den Erfahrungen der Novemberrevolution selbst eingesehen habe.[16]
Trotz solcher Vereinnahmungsversuche blieb die Frau vielen ein Ärgernis. Das zeigte sich auch, als am 15. Januar 1988 eine Gruppe oppositioneller und ausreisewilliger Bürger*innen der DDR die SED-Kundgebung an der Gedenkstätte für Luxemburg und Liebknecht nutzte, um mit dem Zitat »Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden« zu demonstrieren. Sie wurden verhaftet und nur einige durften in die BRD ausreisen. Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) nutzte den Anlass, um Luxemburg in einer Debatte über die Vorfälle im Bundestag als Kronzeugin gegen die DDR anzuführen. Sonst wurde Luxemburg in der Bundesrepublik von rechts als ›rote Megäre‹ und ›Flintenweib‹ geschmäht. Der sozialdemokratische Historiker Manfred Scharrer warf ihr vor, in der Novemberrevolution die demokratische Tradition der deutschen Arbeiterbewegung verraten zu haben.[17]
Auf der Kundgebung in Ostberlin hatte Egon Krenz die »unsterblichen Kampfgefährten Karl und Rosa« noch in Beschlag genommen und getönt, »mit jeder Tat für unsere Deutsche Demokratische Republik erfüllen wir das revolutionäre Vermächtnis von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg«.[18] Nun mussten Expert*innen zur Relativierung antreten. Der Historiker Heinz Kamnitzer bezeichnete die Kundgebung der Opposition als »verwerflich wie eine Gotteslästerung«, eine Schändung des Andenkens der »ermordeten Nationalhelden«.[19] Zur Parole von der Freiheit der Andersdenkenden schrieb er, diese sei herrlich und grauenhaft zugleich. »Wenn man diese Maxime bejaht, dann ist Rosa Luxemburg ihr Opfer geworden.«[20] Annelies Laschitza, Mitherausgeberin der Werke und Briefe, unterstellte, Luxemburg habe nicht beachtet oder mindestens übersehen, dass die Rechte und Freiheiten, die sie anmahnte, »durch die Konterrevolution mißbraucht bzw. umfunktioniert werden können«.[21]
Ziemlich randständig blieb neben der stalinistisch-leninistischen Verdammung die positive und kritische Rezeption Luxemburgs in dissidenten Strömungen wie den Rätekommunist*innen. Die holländische GruppeInternationaler Kommunisten (GIK) um Herman Gorter und Anton Pannekoek würdigte insbesondere jene Punkte, die Leninist*innen ablehnten, ihre Kritik an der bolschewistischen Parteikonzeption und der Oktoberrevolution sowie die antinationale Haltung.[22] In Frankreich bezog sich die linkssozialistische Spartacus-Gruppe in den 1930er-Jahren auf Luxemburg.[23] Die Organisation und Zeitschrift Socialisme ou Barbarie (1949–1967) um Cornelius Castoriadis benannte sich nach Luxemburgs Motto »Sozialismus oder Barbarei«. Die deutsche APO entdeckte Luxemburg als Theoretikerin des Spontaneismus, während italienische Linke in ihren Schriften Ansätze für eine Erneuerung der sozialistischen Bewegung suchten.[24]
Wir sollten uns heute wieder mit Luxemburgs Werk auseinandersetzen, weil es Aspekte enthält, die für eine radikale und emanzipatorische Linke im 21. Jahrhundert nützlich sein können. Dabei kann es keinen unvermittelten Zugriff auf ihre Erkenntnisse und Positionen geben, kein direktes Übertragen, zumal Luxemburg im Unterschied zu Marx nur wenige Schriften mit theoretischem Anspruch hinterlassen hat, sondern sich meistens zu aktuellen Ereignissen und Kontroversen äußerte. Ausgang muss deshalb eine konsequente Historisierung sein, das heißt, eine Analyse ihrer Ansichten im Entstehungskontext. Nur vor diesem Hintergrund lässt sich über einen aktuellen Gebrauchswert ihrer Vorstellungen diskutieren. Es gilt, Luxemburg als Politikerin und Publizistin ernst zu nehmen – mit ihren Vorzügen und ihren Defiziten, getreu der Maxime von Jean Jaurès, das Feuer und nicht die Asche aus der Vergangenheit zu übernehmen.
Luxemburg wurde 1871 in Zamość im Südosten Polens in eine assimilierte jüdische Familie geboren. Aufgrund einer Krankheit behielt sie lebenslang ein Hüftleiden. Nach dem Umzug der Familie besuchte Luxemburg ein Gymnasium in Warschau. Dort erlebte sie an den Weihnachtstagen 1881 ein dreitägiges Pogrom gegen die jüdische Bevölkerung mit, das sie traumatisierte.[25] Gegen Ende ihrer Schulzeit war sie bereits für die illegale sozialistische Partei Proletariat aktiv. Von der zaristischen Polizei gesucht, flüchtete sie Ende 1888 über die Grenze und ging in die Schweiz. Dort studierte sie in Zürich zuerst Mathematik und Philosophie, Zoologie und Botanik, schließlich Rechtswissenschaften und Ökonomie. 1897 promovierte Luxemburg über Die industrielle Entwicklung Polens mit magna cum laude.[26]
In der sozialistischen Bewegung arbeitete sie vorwiegend als Journalistin, verdiente so ihren Unterhalt. Sie wurde von der SPD-Führung als Rednerin in Wahlkampfzeiten oder für Kampagnen auf Reisen geschickt oder von Ortsvereinen eingeladen. Als Abgeordnete konnte Luxemburg nicht kandidieren, da es zu ihren Lebzeiten kein Wahlrecht für Frauen gab. Sie konnte vor 1907 auch nicht in den Parteivorstand gewählt werden, weil das preußische Vereinsrecht es verbot. Aber Luxemburg gehörte zur Führung der Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy (SDKPIL), der Sozialdemokratischen Partei des Königreichs Polen und Litauen, die sie mit gegründet hatte, und war oft Delegierte auf SPD-Parteitagen und internationalen Kongressen sowie im Büro der Sozialistischen Internationale tätig.
Ihr Wirken spiegelt sich in ihren Schriften wider. Meist schrieb sie Artikel, Kommentare, Berichte oder Polemiken für die sozialistische Presse. Hinzu kamen einige Schriften zu strategischen, taktischen und prinzipiellen Fragen, etwa gegen den Reformismus (1899), für den Massenstreik (1906) sowie über den Weltkrieg und einen Neuanfang der Linken (1915), die als Broschüren veröffentlicht wurden. Theoretische Werke hat Luxemburg hingegen nur wenige hinterlassen, etwa ihre Dissertation (1898), das Hauptwerk zur Akkumulation des Kapitals (1913), die Antikritik (1916) und eine unvollendete Einführung in die Nationalökonomie (1925).[27]
Ein Großteil ihrer Schriften und Briefe wurde in den 1970er- und 1980er-Jahren in der DDR in den Gesammelten Werken und Gesammelten Briefen veröffentlicht. Dazu publizierte Jürgen Hentze 1971 einen Band mit Schriften, die bis dahin nur auf Polnisch zugänglich waren.[28] Seit dem Zusammenbruch des sogenannten real existierenden Sozialismus 1989/1991 ist das Wissen um ihr Leben und Werk noch einmal gewachsen. Holger Politt hat weitgehend unbekannte Texte aus dem Polnischen übersetzt. Die Gesammelten Werke und Gesammelten Briefe sind um mehrere Bände mit insgesamt einigen tausend Seiten erweitert worden und damit viele Texte erstmals wieder zugänglich.[29]
Zwar sind keine Dokumente aufgetaucht, die grundlegend neue Positionen aufzeigen, gleichwohl sind einige Aspekte neu oder schärfer konturiert. Das neue Material unterstreicht, dass das Zerwürfnis mit Lenin in grundlegenden Fragen der Emanzipation tiefgehend und anhaltend war, was ihre spätere Ablehnung durch die kommunistische Bewegung erklärt. Beiträge über die Dreyfus-Affäre in Frankreich und die Pogrome in Russland belegen nicht nur ihren Antinationalismus. Sie zeigen, dass ihr die Gefahren des Antisemitismus und der aufkommenden nationalistischen Bewegungen, die wir heute als präfaschistisch einstufen würden, deutlich waren. Ihren spezifischen Charakter und mögliche Ursachen ihrer Attraktivität und Verbreitung analysierte sie aber nicht, sondern verblieb im Interpretationsrahmen der Zweiten Internationalen, die annahm, das Problem werde sich von selbst erledigen. Antisemitismus wurde als reaktionäre Ideologie von Schichten beurteilt, die zum Untergang verurteilt waren und in den sich zuspitzenden Kämpfen zwischen Bourgeoisie und Proletariat keine wichtige Rolle mehr spielen würden. Luxemburg traf sogar die krasse Fehleinschätzung, das Proletariat wäre gegen Antisemitismus immun.
Grundsätzlich lässt sich sagen, dass Luxemburg in ihrem Denken beständig war. Viele Positionen lassen sich schon in ihren ersten Texten nachweisen. Es wird aber auch eine Entwicklung deutlich: In den permanenten Diskussionen innerhalb der Linken bildete Luxemburg in einigen Punkten eine eigenständige Position heraus, punktuell überschritt sie den Rahmen des ›Weltanschauungsmarxismus‹ der Zweiten Internationale. Insgesamt blieb Luxemburg jedoch dem dogmatischen Marxismus der Zweiten Internationale treu.
Im Folgenden werden in einem einführenden Kapitel zunächst die wichtigsten gesellschaftlichen Entwicklungen skizziert, die zur Zeit Luxemburgs eine Rolle spielten, außerdem der Marxismus als Doktrin der Zweiten Internationale, die sich in wichtigen Punkten von der Marxschen Position unterschied. Damit sollen Verständnis und Einordnung der anschließenden Themen erleichtert werden. Den Anfang macht im zweiten Kapitel Luxemburgs Verständnis von Reform und Revolution, die sie im sogenannten ›Revisionismusstreit‹ entwickelte, der um 1900 die internationale Sozialdemokratie beschäftigte.
Im dritten Kapitel wird die antinationale Position Luxemburgs vorgestellt. Anfangs wandte sie sich gegen die polnische sozialistische Partei, die die Unabhängigkeit forderte, weitete diese Kritik jedoch aus zu einer prinzipiellen Haltung. Wenngleich mit gelegentlich ökonomistischer Tendenz, entwickelte sie eine transnationale Haltung gegen einen nationalen Konsens, der weitgehend unhinterfragt in der Linken herrschte.
Das Werk Luxemburgs zur Akkumulation des Kapitals wird im vierten Kapitel behandelt. Zunächst wird ihr Anspruch diskutiert, die Marxsche Theorie weiterzuentwickeln und den Zusammenbruch des Kapitalismus als ökonomisch logisch und unvermeidlich zu beweisen. Diese Position war Konsens in der marxistischen Linken, allerdings wurde Luxemburgs Erklärung, wonach das Kapital auf nichtkapitalistische Sphären angewiesen sei, von fast allen verworfen. Mit dieser Schrift leistete sie jedoch einen wertvollen Beitrag zur Debatte über Imperialismus, Kolonialismus und Rassismus. Aktuell wird darauf in Brasilien, China oder Südafrika zurückgegriffen, in Theorien über Landnahme, eine imperiale Lebensweise und eine Externalisierungsgesellschaft.
In den 1970er-Jahren griffen die sogenannten Bielefelder Soziologinnen, Veronika Bennholdt-Thomson, Maria Mies und Claudia von Werlhof, auf Luxemburgs These zurück, um Marxismus und Feminismus, die Analyse von Kapitalismus und Patriarchat zu verbinden. Sie erklärten die Hausarbeit zur nichtkapitalistischen Sphäre, die vom Kapital ausgebeutet werde, insofern als Frauen dort unbezahlte Reproduktionsarbeit leisten, die Ware Arbeitskraft umsonst herstellen. Dieser Ansatz sowie weitere Versuche, Luxemburg als Feministin zu deuten, sind das Thema des fünften Kapitels. Deutlich wird aber, dass Luxemburg zwar für die Gleichberechtigung der Frau eintrat, Feminismus als bürgerliche Sonderbewegung jedoch ablehnte. In der Gebärstreikdebatte wandte sich Luxemburg gegen Geburtenkontrolle mit dem bevölkerungspolitischen Argument, dann würden »Soldaten für die Revolution« fehlen. Das zeigt, dass sie mit alltäglichen Problemen von Arbeiterinnen wenig zu tun hatte.
Im sechsten Kapitel geht es um Luxemburgs Vorstellung von Demokratie. Unter diese Rubrik fallen ihr Staatsverständnis, ihr Verhältnis zu bürgerlich-liberalen Herrschaftsformen, die Entdeckung der Rätedemokratie, vor allem aber der Streit mit Lenin über die Struktur der revolutionären Partei, die Frage nach Emanzipation und Klassenbewusstsein.
Luxemburg war keine Säulenheilige, die nie irrte. Ihre Schriften enthalten Feuer und Asche. Ihre Persönlichkeit wurde ziemlich widersprüchlich dargestellt, das Spektrum reicht von ihrer Idealisierung als hochsensible Frau, die Menschen und Tiere liebte, bis zu dem harschen Verdikt, sie sei eine unangenehme Besserwisserin gewesen, die überall im Mittelpunkt stehen wollte.[30] Dieses Streitthema überlasse ich gerne den Biograph*innen und konzentriere mich auf ihre politischen Ansichten.
Manches bietet noch heute wertvolle Ansätze für einen libertären Sozialismus oder Kommunismus. Aktuell geblieben sind ihre Verweise auf die Gewaltförmigkeit einer Gesellschaft, in der alle in Konkurrenz zueinander gesetzt sind. Statt wie deren Apologet*innen die offene Gesellschaft, Freiheit, Marktwirtschaft und Demokratie zu beweihräuchern, müssen wir immer wieder auf die offene wie die strukturelle Gewalt der bürgerlich-kapitalistischen Ordnung hinweisen, auch wenn sich das anfühlt »wie Asche im Mund«, um Bert Brecht zu zitieren. Von Bedeutung ist ihre antinationale Haltung für eine transnationale Orientierung. Wegweisend und zukunftsträchtig sind Überlegungen, die auf Selbstorganisation, Eigeninitiative und direkte Aktion hinauslaufen, immer in Verbindung mit einer stabilen Organisation. Linke Regierungsbeteiligungen oder einen »Marsch durch die Institutionen« lehnte sie ab. Aus beiden Überlegungen sind Konsequenzen für die politische Strategie zu ziehen.
ZWEIMarx, Luxemburg und der Marxismus
Um die Positionen Rosa Luxemburgs zu verstehen, muss man die Bedingungen kennen, unter denen sie entstanden sind. Darum sollen in diesem Kapitel die wichtigsten ökonomischen und politischen Entwicklungen vor dem Ersten Weltkrieg kurz skizziert werden sowie deren Interpretation durch die Linke. Politiker*innen und Theoretiker*innen der Zweiten Internationale schufen in dieser Epoche, anknüpfend an die Vorstellungen von Marx, eine Lehre, die als Marxismus bezeichnet wurde. Der Begriff kam um 1879 auf und setzte sich als Kampfbegriff von Kritiker*innen wie Vertreter*innen durch.[1] Die wichtigsten Positionen dieses Marxismus sollen hier vorgestellt werden, weil Luxemburg dieser Richtung zuzurechnen ist, auch wenn sie den Rahmen dieser Doktrin punktuell überschritt.
Der Marxismus bot eine einleuchtende Erklärung für die gesellschaftliche Entwicklung in Europa und Nordamerika aus der Perspektive von Arbeiter*innen und kritischen Intellektuellen, das schnelle Voranschreiten der Industrialisierung, zunächst in England, gefolgt von Deutschland, Belgien, Frankreich und USA und anderen Ländern, bei allgemeiner Verelendung weiter Teile der Bevölkerung. Die stetig steigende Produktivität veränderte das Leben, die agrarisch-handwerkliche, ständisch geordnete Gesellschaft zerfiel, neue soziale Gegensätze rissen auf und vergrößerten sich. Immer mehr Menschen zogen vom Land in die Städte, wo sie in den neuen Fabriken arbeiten konnten, oft zu Hungerlöhnen bei Arbeitstagen von zehn bis 16 Stunden. Die hygienischen und sanitären Bedingungen in manchen Vierteln waren katastrophal, es entstanden regelrechte Slums. Die organisierte Arbeiter*innenklasse kämpfte bald um bessere Löhne, kürzere Arbeitszeiten, Arbeitsschutz und politische Rechte und errang Erfolge. Dadurch und auch angesichts der steigenden Produktivität stieg am Ende des 19. Jahrhunderts der Lebensstandard der Mittelklassen und einiger Segmente der Arbeiter*innenklasse langsam an, was in der marxistischen Literatur mit dem Begriff ›Arbeiteraristokratie‹ belegt wurde. Aus den ärmeren Ländern und Regionen vor allem im Süden und Osten Europas wanderten zur gleichen Zeit Millionen von Menschen nach Amerika aus.
Ein wichtiges Moment war die weltweite ökonomische Depression von 1873 bis 1895. Die Dominanz des Liberalismus und der Freihandelslehre schwand, die meisten Staaten griffen zu protektionistischen Maßnahmen wie Schutzzöllen, antisemitische Vorstellungen fanden in Deutschland, Frankreich, Österreich und Russland enormen Zuspruch. Ab 1895 folgte wieder eine Phase des wirtschaftlichen Aufschwungs, geprägt durch Innovationen im Bereich der Chemie- und Elektroindustrie. Damit verbunden war eine enorme Konzentration von Kapital in großen Unternehmen, es entwickelten sich Monopole, Trusts und Kartelle. Die USA und Deutschland begannen, Großbritannien als führende Industriemacht zu überholen. Die Linke bezeichnete diese Entwicklung als ›Monopolkapitalismus‹ und betrachtete den Imperialismus als dessen politische Konsequenz. Der Kolonialismus fand in der Aufteilung Afrikas und Angriffen auf China einen weiteren grausamen Höhepunkt und sorgte für Spannungen und wachsende Kriegsgefahr unter den Großmächten.
In fast allen Ländern Europas, in Nord- und Südamerika sowie in Teilen Asiens und in Südafrika entstanden Arbeiter*innenparteien und Gewerkschaften, die für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen kämpften, und Frauenbewegungen, die für Gleichberechtigung eintraten. Ein zentrales Ziel war das allgemeine Wahlrecht, dessen Ausweitung demokratisch-republikanische Gruppen, Arbeiter*innen- und Frauenbewegungen in teilweise heftigen Kämpfen schrittweise erkämpften. Die Ausweitung des Wahlrechts hob das politische Machtmonopol von Bürgertum und Großgrundbesitzern potenziell auf, Mittelklasse und Arbeiter*innenklasse konnten am parlamentarischen System teilhaben. Um die Klassenherrschaft unter diesen Bedingungen aufrechtzuerhalten, formierten sich bürgerliche und christliche Massenparteien.
Vertreter*innen von sozialistischen Parteien und Gewerkschaften aus Europa und Amerika trafen sich 1889 zu einem ersten internationalen Kongress in Paris, der mit Bedacht am 14. Juli, dem 100. Jahrestag des Sturmes auf die Bastille, eröffnet wurde. Mit der Zweiten Internationale, die aus diesem Kongress hervorging, beginnt die Geschichte des Sozialismus als internationale Massenbewegung. Die erste Internationale, die Internationale Arbeiterassoziation (IAA), die von 1864 bis 1876 existierte, bestand aus Einzelpersonen, kleinen Gruppen und einigen Gewerkschaften. Während die IAA daran zugrunde ging, dass sie aus verschiedenen anarchistischen Fraktionen, den Anhänger*innen von Marx und Engels und Auguste Blanqui sowie englischen Gewerkschaften bestand, die über Fragen von Strategie und Taktik, aber auch die Ziele uneins waren, dominierten in der Zweiten Internationale bald Parteien, die sich auf Marx beriefen, Anarchist*innen wurden ausgeschlossen. Als mitgliederstärkste und bei Wahlen erfolgreichste Partei wurde die SPD von anderen sozialistischen Parteien als Vorbild bewundert und genoss den größten Einfluss. Die wichtigste gemeinsame Forderung war die Einführung des Acht-Stunden-Tages. Als gemeinsame Aktion wurden sich jährlich wiederholende Demonstrationen am 1. Mai geplant. Die Durchführung war jedoch umstritten: fielen die Kundgebungen nicht zufällig auf einen Sonntag, kam die Teilnahme automatisch einem Streik gleich. Manche Parteien, vor allem die SPD, fürchteten deshalb Repressalien.
Die Auseinandersetzungen in der Zweiten Internationale um Demonstrationen am 1. Mai, Generalstreiks, Regierungsbeteiligungen, Kolonialismus und Krieg spiegelten letztlich eine wachsende Diskrepanz zwischen revolutionärem Anspruch und reformerischer Praxis wider, die sich wegen der Erfolge der Parteien und Gewerkschaften bei Wahlen und Arbeitskonflikten immer weiter zuspitzte. Das führte zu Spaltungen in Italien und Frankreich, während die englische Arbeiterbewegung lange im Schlepptau der Liberalen blieb und später die Labour-Party sich nie als marxistisch verstand. Allen radikalen Bekundungen zum Trotz, konnte sich die Zweite Internationale nie auf gemeinsame militante Aktionen einigen. Sie zerbrach im Sommer 1914, als die wichtigsten Parteien einen Burgfrieden mit der jeweiligen Bourgeoisie schlossen und ihre Anhänger in die Schützengräben schickten. Die Integration in die bürgerliche Gesellschaft war an ihr logisches Ende gekommen. Im Verlauf des Krieges spaltete sich die marxistische Linke an dieser Konfliktlinie in Sozialdemokrat*innen und Kommunist*innen.
In der IAA hatte der Ansatz von Marx kaum mehr Gewicht als die Lehren Blanquis, Michail Bakunins, Pierre-Joseph Proudhons oder Robert Owens. Bevor sich der Marxismus als gemeinsame Ideologie durchsetzte, gab es in der Zweiten Internationale am Anfang unterschiedliche Tendenzen, darunter die der französischen Reformist*innen, britischen Gewerkschafter*innen sowie Anarchist*innen. Dabei ist zu beachten, dass Marx und Marxismus nicht gleichzusetzen sind.
Marx hatte sich vom radikalen Demokraten zum Kommunisten entwickelt. Dies geschah vor dem Hintergrund des Pauperismus, der ungeheuren Verelendung, die die Industrialisierung ausgelöst und die er bereits in seiner Geburtsstadt Trier erlebt hatte.[2] Die Auseinandersetzung mit der Philosophie Georg Friedrich Wilhelm Hegels spielte für Marx anfangs eine wichtige Rolle. Er übernahm dessen dialektische Methode, betonte jedoch, seine eigene Version dieses Denkens sei das »direkte Gegenteil«. War für Hegel die Idee das Subjekt, so sei bei ihm, Marx, »das Ideelle nichts andres als das im Menschenkopf umgesetzte und übersetzte Materielle«. Immerhin habe Hegel die allgemeinen Bewegungsformen der Dialektik entdeckt. »Man muß sie umstülpen, um den rationellen Kern in der mystischen Hülle zu entdecken«, schrieb Marx.[3]
Im Unterschied zu Engels und Lenin war für Marx Dialektik keine allgemeine Methode, die sich etwa auch für die Naturwissenschaft eignet, sondern eine Form der Diskussion und Darstellung gesellschaftlicher Phänomene. Ihm ging es um eine kritische Auseinandersetzung mit dem Kapital, wobei er Kategorien wie Ware, Wert, Gebrauchswert, Mehrwert und Profit auf der Grundlage umfangreichen empirischen Materials entwickelte und deren inneren Zusammenhang betonte. Wichtig ist der Gesichtspunkt der Totalität, als Erfassung der bürgerlichen Gesellschaft in ihrer Gesamtheit.
Als Journalist und Chefredakteur der Rheinischen Zeitung 1842/1843 sowie im Exil in Paris und Brüssel setzte sich Marx mit sozialen Fragen sowie den damals kursierenden sozialistischen und kommunistischen Theorien auseinander. Er lernte Engels kennen, der 1844 eine umfangreiche Studie über die Lage der englischen Arbeiterklasse publizierte. Gemeinsam traten Marx und Engels 1847 in Brüssel in den Bund der Kommunisten ein. Ein Jahr später verfassten und veröffentlichten sie in dessen Auftrag das berühmte Kommunistische Manifest, das zur Weltliteratur gezählt werden darf. Es war und ist die bekannteste und am meisten verbreitete Schrift aus ihrer Feder. Darin sind allerdings Positionen formuliert, die Marx später revidierte. Während im Manifest davon die Rede ist, dass sich die Gesellschaft in Bourgeoisie und Proletariat aufspalte, schrieb Marx später über wachsende Mittelklassen. Während mit dem Manifest staatssozialistische Konzepte begründet werden können, äußerte sich Marx später staatskritischer, insbesondere nach der legendären Pariser Kommune, einem Aufstand von Arbeiter*innen im März 1871, die wenige Wochen mit demokratischen und sozialistischen Maßnahmen experimentierten, bevor die Regierung der neuen Republik sie massakrierte, mit etwa 30.000 Toten. Die Kommunard*innen versuchten, den Staatsapparat zugunsten einer kommunalen Selbstregierung der Produzent*innen aufzulösen. Die Stadträte der Kommune waren jederzeit absetzbar, ihre Mehrzahl bestand aus Arbeitern, Frauen waren einmal wieder ausgeschlossen. Es war der erste Versuch einer Rätedemokratie, ohne dass der Begriff gebraucht worden wäre.
Im Exil in London entstand das Hauptwerk von Marx, seine Kritik der politischen Ökonomie, die allerdings ein Torso blieb. Ursprünglich plante Marx sechs Bände, 1867 kündigte er vier Bände an. Tatsächlich erschien aus seiner Feder nur der erste Band des Kapital, den zweiten und dritten Band stellte Engels posthum zusammen, wobei er erheblich in das Originalmanuskript eingriff, so dass bei aller Hochachtung vor seiner Arbeit, umstritten ist, wo Marx aufhört und Engels anfängt, was sich heute jedoch dank der Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA) genau feststellen lässt. Karl Kautsky veröffentlichte zwischen 1905 und 1910 drei Bände mit dem Titel Theorien über den Mehrwert, die als vierter Band des Kapital galten, aber zu einem Manuskript gehören, das zwischen 1861 und 1863 entstand.[4]
Zur Zeit der Zweiten Internationale waren erst wenige Schriften von Marx und Engels publiziert und bekannt. Neben dem Pamphlet Die heilige Familie oder Kritik der kritischen Kritik und der Schrift Das Elend der Philosophie lagen vor allem Zeitungsbeiträge von Marx aus der Rheinischen Post vor. Viele Schriften kamen erst im Nachlass zum Vorschein. Engels verfasste noch zu Lebzeiten von Marx eine Reihe von Schriften, in denen er die Grundideen des historisch-kritischen Materialismus zusammenfasste. Er wollte damit das Eindringen von bürgerlichen positivistischen und sozialreformerischen Strömungen in die sozialistische Bewegung verhindern. So wurden neben dem Kommunistischen Manifest der Anti-Dühring (1877/1878), der sich gegen die Ideen des Ökonomen und Antisemiten Eugen Dühring wandte, und DieEntwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft (1880) zu den populärsten Darstellungen von Engels. Diese Schriften lieferten Generationen von Leser*innen, Freund wie Feind, das Deutungsmuster für das Verständnis von Marx. Die Entstehung einer ›Marxschen Schule‹ wird auf das Erscheinen des Anti-Dühring und die Rezeption dieses Werkes durch Karl Kautsky, Eduard Bernstein und andere Sozialist*innen dieser Zeit datiert.[5]
Wichtig ist zu verstehen, dass Marxismus und Marxismus-Leninismus holzschnittartige Versionen der Theorien von Marx sind, die deren kritischen Gehalt zum Teil verkennen. Das beginnt damit, dass Marx zwar den Anspruch der Wissenschaftlichkeit pflegte, Engels jedoch einen Schritt weiter ging und den Sozialismus in den Rang einer Naturwissenschaft erhob, dessen Aussagen der Stellenwert von Naturgesetzen zukommen sollte.[6] Der unangebrachte Optimismus und der unangenehme Triumphalismus mancher späteren Sozialist*innen und Kommunist*innen fußt wesentlich auf solchen dogmatischen Setzungen. »Die Lehre von Marx ist allmächtig, weil sie wahr ist«, sollte Lenin 1913 schreiben.[7]
Was Lenin als Vorzug pries, die »einheitliche Weltanschauung«, geschlossen und harmonisch, die der Marxismus angeblich den Menschen beschere, hat mit kritisch-historischem Denken und mit Marx wenig zu tun. Zwar finden sich in den Schriften von Marx immer wieder Belege für einen »in Geschichtsphilosophie umkippenden historischen Optimismus«, aber eben auch eine Kritik der Geschichtsphilosophie und der politischen Ökonomie.[8] Insgesamt verweist das Werk von Marx auf einen Menschen, der ständig forschte und reflektierte, seine eigenen Positionen verwarf und neu formulierte. Das ist wohl mit einer der Gründe, warum sein Hauptwerk unvollendet blieb. Die Schriften des späten Engels hingegen werden heute von manchen Marx-Interpreten kritisch gesehen, sogar als ›Engelsismus‹ bewertet.[9]
Als weiterer Begründer des Marxismus darf Kautsky gelten, dessen Deutungen ein hohes Maß an Ansehen genossen. Er war der Begründer der Strategie des Attentismus, der Ermattung des Gegners, also des politischen Abwartens auf eine Revolution, was ihn später in Gegensatz zu Luxemburg brachte. Der junge Kautsky war Darwinist, der an eine evolutionäre Entwicklung der Gesellschaft glaubte. Als Marxist betonte Kautsky die Entwicklung der Produktivkräfte als das entscheidende Moment, dass die kapitalistischen Eigentumsverhältnisse schließlich sprengen würde. Zwar wies er eine fatalistische Haltung ausdrücklich zurück und plädierte für ein aktives Eingreifen des Proletariats, allerdings in dem Sinn, dass die Grundtendenzen der gesellschaftlichen Entwicklung erkannt, ausgenutzt und vorangetrieben würden. Für Kautsky stellte »die unaufhaltsame ökonomische Entwicklung die Grundkraft der gesamten gesellschaftlichen Entwicklung« dar. Das Proletariat müsse in diesen Prozess eingreifen, um ihm eine seinen Interessen entsprechende Richtung zu geben, um nicht nur sich selbst, sondern auch die Produktionsweise weiterzuentwickeln. Als Beispiel führte Kautsky Streiks und Arbeitsschutzgesetze an, die »das Maschinenwesen erheblich gefördert« hätten.[10]
In der radikalen Linken setzte sich später Lenins Verdikt von Kautsky als dem Renegaten durch, weil dieser die Oktoberrevolution und die Diktatur der Bolschewiki kritisiert hatte.[11] Luxemburg überwarf sich schon früher mit Kautsky, weil er den Massenstreik als revolutionäre Aktionsform ablehnte, Anton Pannekoek diagnostizierte deshalb, dass Kautsky immer mehr vom Radikalismus zum Revisionismus driftete.[12] In anderen wichtigen Fragen vertrat Kautsky ambivalente Positionen. So lehnte er die Kolonialpolitik strikt ab, was damals unter Sozialist*innen nicht selbstverständlich war, und vertrat eine transnationale Perspektive. Er arbeitete sich kritisch an zeitgenössischen Rassenlehren ab, ohne jedoch die falsche Vorstellung, Menschen ließen sich in Rassen aufteilen, zu überwinden. Als Verfechter einer sozialistischen Eugenik verstärkte er derartige Tendenzen in der Linken, die schließlich in einer verbrecherischen Politik der Zwangssterilisierung im sozialdemokratischen regierten Schweden gipfelten.[13]
Ein Kennzeichen des Marxismus, wie Kautsky ihn vertrat, war ein etwas naiver Realismus, die Vorstellung, es gebe eine objektive Wahrheit der historischen Entwicklung, die sich in der Erkenntnis der Menschen direkt widerspiegeln könne und die Praxis anleite. Dass unser Denken und Handeln selbst historisch-praktisch und subjektiv vermittelt sind, wie Marx 1845 in seinen Thesen über den Religionskritiker Ludwig Feuerbach betont hatte, wurde übergangen. Stattdessen herrschte im Marxismus eine positivistische Sicht von Realität und Erkenntnis vor, verbunden mit der Überzeugung einer linearen Evolution der Geschichte, sozusagen vom Einzeller zum Kommunismus. In diesem Geschichtsbild galt das Proletariat als revolutionäres Subjekt, das sich zwar gelegentlich irren, aber seine historische Mission der Befreiung der Menschheit nicht verfehlen konnte. Der Verlauf der Geschichte ergibt sich demnach aus der Entwicklung der Produktivkräfte, der Art, wie die Menschen ihre Lebensmittel erzeugten.
So schrieb der SPD-Parteivorsitzende August Bebel, der Sozialismus werde nicht durch »willkürliches Einreißen und Aufbauen« verwirklicht, sondern durch »naturgesetzliches Werden«.[14] Das war die perfekte Begründung für den Attentismus. Bebel war gelernter Handwerker, später ein kleiner Fabrikant, ein großer Redner und die überragende Integrationsfigur der Bewegung. Wegen der Verehrung durch die Basis wurde er auch spöttisch als ›Ersatzkaiser‹ bezeichnet. Sein Buch Die Frau und der Sozialismus (1879), aus dem obiges Zitat stammt, hatte enormen Einfluss auf die Arbeiter*innenbewegung. Es gilt als das Werk, das von Anhänger*innen der SPD damals am meisten gelesen wurde. Der Erfolg ist darauf zurückzuführen, dass Bebel nicht nur über die Rolle der Frau schrieb und die Parteidoktrin zusammenfasste, sondern vor allem eine künftige sozialistische Gesellschaft schilderte. Dieses Ausmalen der Zukunft war unter Marxist*innen verpönt, weil sie fürchteten, die Anhängerschaft könnte sich an Details klammern und darüber zerstreiten, auch sollten dem künftigen ›Verein freier Menschen‹, wie Marx die kommunistische Gesellschaft im Kapital bezeichnet hatte, keine Vorgaben gemacht werden. Das Bedürfnis nach utopischen Konstrukten war gleichwohl weitverbreitet, wie der Erfolg sozialistischer Schriftsteller wie Edward Bellamy oder William Morris zeigte.
Der Kapitalismus wurde von vielen Sozialist*innen wie etwa William Morris einfach als räuberische Ausbeutung gedeutet, eine Sicht, die Marx strikt ablehnte. Denn Marx hatte betont, dass die Bildung und Akkumulation von Mehrwert auf Seiten des Kapitals auch dann möglich ist, wenn Arbeiter*innen den Wert der von ihnen verkauften Ware Arbeitskraft vollständig erhalten. Den Sozialismus missverstanden manche als Verteilungsfrage oder als schlichte Übernahme einer Wirtschaft, die das Kapital vorher dankenswerterweise in Form von Aktiengesellschaften und Monopolen organisiert und geplant hat. Diese Perspektive fand in der These vom ›organisierten Kapitalismus‹ ihre Vollendung, die Rudolf Hilferding entwickelte.[15] Dass die Herrschaftsförmigkeit der Kapitalverwertung auch die betriebliche Arbeitsorganisation, die Technik und den Stoffwechselprozess mit der Umwelt prägt, blieb unbeachtet. Vorbilder für eine sozialistische Ökonomie waren für Lenin die deutsche Reichspost und Kriegswirtschaft. Den Taylorismus betrachtete er als Methode, um die höchste Arbeitsleistung zu erzielen.
Der Staat wiederum wurde nicht als autonome, politische Form der bürgerlichen Klassenherrschaft verstanden, sondern als Instrument der jeweils herrschenden Klasse, ein neutrales Werkzeug, das die siegreiche Arbeiterklasse erobern und für sich nutzen sollte. Diese Perspektive konnte aus dem Kommunistischen Manifest abgeleitet werden, aber auch aus mehrdeutigen Äußerungen von Engels. Dieser bezeichnete den Staat 1880 in einem Satz als »Staat der Kapitalisten« und als »ideellen Gesamtkapitalisten«. Formulierungen wie ›Staat der Kapitalisten‹ ebenso wie ›geschäftsführender Ausschuss der Bourgeoisie‹ konnten so verstanden werden, als handele es sich um einen Apparat, der unmittelbar dem Interesse der bürgerlichen Klasse diene. Engels selbst widersprach allerdings dieser Sichtweise. Er führte an dieser Stelle weiter aus, dass er den Staat eben »nicht als ein Werkzeug der Bourgeoisie« auffasse, sondern als eine Instanz der bürgerlichen Gesellschaft, »um die allgemeinen äußeren Bedingungen der kapitalistischen Produktionsweise aufrechtzuerhalten gegen Übergriffe sowohl der Arbeiter als auch der Kapitalisten«.[16]
Dieser traditionelle Marxismus lieferte die Basis für den Leninismus und die weitere Kanonisierung der Lehre unter Stalin als Marxismus-Leninismus, der als Legitimationsideologie des real existierenden Sozialismus dienen sollte. Andererseits kam es zu Ablösungsprozessen aufgrund der Erfahrungen des Zusammenbruchs der Zweiten Internationale, dem Scheitern der Revolution außerhalb Russlands, aber auch der weiteren Entwicklung der Oktoberrevolution.
Für diese Tendenzen benutzte der britische marxistische Historiker Perry Anderson 1976 die Sammelbezeichnung ›westlicher Marxismus‹, die sich einbürgerte. Für Anderson beginnt diese Entwicklung mit den Schriften von Karl Korsch und Georg Lukács, der insbesondere Engels kritisierte, aber auch Antonio Gramscis Überlegungen zu Staat, Politik und Ideologie. Dabei wurden insbesondere Fatalismus und Geschichtsdeterminismus des traditionellen Marxismus angegriffen und die Rolle der Praxis und des Subjekts herausgestellt. Im Rahmen dieser Arbeit ist es nicht möglich auf Differenzen und Ambivalenzen einzugehen, vor allem bei Lukács und Gramsci, die beide überzeugte Leninisten waren.
Deutlich über den Marxismus hinaus ging die Kritische Theorie um Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Erich Fromm und Herbert Marcuse. Sie gaben die Vorstellung einer revolutionären Mission des Proletariats unter dem Eindruck des Faschismus auf. In ihren Studien zum autoritären Charakter räumte die Kritische Theorie zu Recht der Sozialpsychologie einen großen Stellenwert ein, während Staatskritik und Kritik der politischen Ökonomie eine geringere Rolle spielten.[17] In den 1960er-Jahren entwickelte sich anhand einer Analyse der Wertformen sowie der Mystifikations- und Fetischtheorien die Neue Marx-Lektüre, die auf eine Rekonstruktion der politischen Ökonomie zielte.[18]
Luxemburgs politische Sozialisation fiel in die Zeit, als sich der Marxismus herausbildete, ihr Wirken fand in dessen Hochphase statt, ihr Werk ist deutlich davon geprägt, was ihr von einigen den Vorwurf des Determinismus oder Ökonomismus einbrachte. In seinen Gefängnisheften warf Gramsci ihr in einer Notiz sowohl ein ökonomistisches als auch spontaneistisches Vorurteil vor.[19] Lukács hingegen rühmte Luxemburg, weil sie die »Gewißheit des Untergangs des Kapitalismus« und der »am Ende – siegreichen proletarischen Revolution« verteidigt und bewiesen habe.[20] Ähnlich gespalten fiel das Urteil später aus. Leszek Kolakowski schrieb, Luxemburg sei von »ehernen Gesetzen« ausgegangen, die den historischen Verlauf bestimmten und den Menschen zum bloßen Werkzeug degradierten.[21] Vittantonio Gioia bezichtige Luxemburg, wie sämtliche Theoretiker*innen der Zweiten Internationale, des Ökonomismus und »Katastrophismus«.[22] Michael Löwy hingegen machte einen Ablösungsprozess vom »optimistischen Fatalismus« aus, der vor allem mit der Erfahrung des Weltkrieges zusammenhing und in der Junius-Broschüre von 1915 mit der Parole ›Sozialismus oder Barbarei‹ seinen Ausdruck fand.[23] Eine dritte Position vertraten Norman Geras und Rudolf Walther, die auf Ambivalenzen hinwiesen, schon in früheren Werken, eigentlich von Beginn an.[24] Tatsächlich lassen sich sowohl Belege für eine deterministische Haltung finden, die »eiserne Überzeugung«, dass es für die geschichtliche Entwicklung »objektive Gesetze von derselben Art wie die Naturgesetze gibt«, wie Gramsci rügte, als auch für das Gegenteil, dass die menschliche Praxis ausschlaggebend und der Ausgang der Geschichte offen sei.[25] Gelegentlich scheinen bei Luxemburg solche Aussagen unvermittelt nebeneinanderzustehen. Auch in der Frage, ob der Sozialismus das vorherbestimmte Ziel der menschlichen Geschichte sei und die Arbeiterklasse die Mission habe, dieses zu realisieren, zeigen sich in ihren Schriften zu einem frühen Zeitpunkt Widersprüche.
Zunehmend betonte Luxemburg, dass die menschliche Praxis und ihre Reflexion einen eigenständigen Faktor darstellen. Diese Haltung wurde von zwei Entwicklungen verstärkt: Wesentlich war ihre persönliche Erfahrung der ersten russischen Revolution von 1905 und damit verbunden die Entdeckung des Massenstreiks als direkte Aktionsform. Luxemburg setzte sich außerdem intensiv mit dem Kolonialismus auseinander, die Agitation gegen Militarismus und Kriegsgefahr nahm sie immer mehr in Anspruch.
Besonders deutlich wurde diese Haltung im Verlauf des Weltkrieges, der ihren Glauben an den Sieg des Sozialismus erschütterte. Für Luxemburg war dieser Krieg nicht nur das unvermeidliche Resultat des Zusammenstoßes imperialistischer Mächte. Sie arbeitete als eine der ersten heraus, dass und warum Deutschland aufgrund seiner spezifischen Politik die Hauptschuld trug, wie es später im Versailler Vertrag hieß, und seit den Forschungen von Fritz Fischer auch wissenschaftlich belegt ist. Der Sozialismus war für Luxemburg nicht länger das verbriefte Ziel menschlicher Geschichte. Das führte zu der Formel ›Sozialismus oder Barbarei‹, womit etwas anderes gemeint war als der Zusammenbruch des Kapitalismus, den Luxemburg in früheren Schriften als ausweglose Wirtschaftskrise darstellte.
Gleichwohl findet sich in Luxemburgs Schriften bis zuletzt die deterministische Seite. So verwendete sie etwa in ihrer Kritik der Oktoberrevolution den Begriff Proletariat synonym mit Partei. Das ist einerseits konsequent, weil sie die Partei als Teil des Proletariats fasste, nicht als abgetrennten Kader wie Lenin, andererseits aber problematisch, weil das Proletariat als Einheit, als Subjekt auftritt, das richtig oder falsch handeln kann. Die Arbeiter*innen werden als historisches revolutionäres Subjekt vorausgesetzt, statt von empirisch vorhandenen Menschen auszugehen, die im Alltag vereinzelt und Konkurrent*innen sind und sich erst in politischen Kämpfen als Klasse begreifen können.[26] Selbst in Deutschland mit dem höchsten Organisationsgrad der Arbeiter*innen gehörte am Vorabend des Ersten Weltkrieges nur eine Minderheit den Gewerkschaften und ein noch kleinerer Teil der Partei an, abgesehen davon, dass sich viele Mitglieder und Anhänger*innen passiv oder gar proimperialistisch verhielten.
Andererseits kann Determinismus verschiedene Dinge meinen. Ein Aspekt ist, dass der Kapitalismus die Grundlage des Sozialismus schafft. Einerseits sind die Menschen dem blinden Walten des Kapitals ausgesetzt, das Arbeitslosigkeit, Armut und Hunger hervorbringt. Die Beziehungen der Individuen sind entfremdet, ihre Bedürfnisse und ihr Handeln fallen auseinander.[27] Die rastlose Kapitalverwertung stürzt immer mehr Menschen in Abhängigkeit und Elend, in einen Zustand »allgemeiner Verwilderung«, wie Luxemburg bemerkte.[28] Andererseits vergesellschafte das Kapital die Produktion und schaffe eine hohe Produktivität, die eine Gesellschaft möglich mache, in der niemand materielle Not leidet, sondern mit einem Minimum an Arbeitsaufwand alle Bedarfsgüter hergestellt werden könnten.[29] In diesem Sinn forderte Luxemburg, sozialistische Politik müsse »mit beiden Füßen auf dem Boden der kapitalistischen Entwicklung stehen«.[30] Denn dieser sei die »objektive Voraussetzung einer sozialistischen Umwälzung«.[31]
Der zweite Aspekt des Determinismus ist die Frage nach dem Ende des Kapitalismus und dem Übergang zum Sozialismus. Im Revisionismusstreit spielte dieses Thema eine herausragende Rolle. Diese Frage wird im nächsten Kapitel in ihrem historischen Kontext behandelt, an dieser Stelle soll lediglich Luxemburgs Haltung skizziert werden.
Ihre Schriften aus dieser Zeit scheinen sie als eindeutige Verfechterin einer ›Zusammenbruchstheorie‹ auszuweisen. Unauflösbare Widersprüche des Kapitalismus führen »zur Explosion«, zum »Zusammenbruch, bei dem wir den Syndikus spielen werden«, erklärte sie 1898 auf dem SPD-Parteitag.[32] Die Vorstellung eines allmählichen Hinübergleitens ins »sozialistische Jenseits« sei illusionär, die Sozialdemokratie müsse »im Gegenteil sozialen und politischen Katastrophen entgegensehen«.[33] Denn der Zusammenbruch sei »die Form des Übergangs des Kapitalismus in die sozialistische Gesellschaft.«[34] Das Tempo der Entwicklung werde jedoch nicht nur von ökonomischen, sondern auch von politischen und geschichtlichen Faktoren »in so hervorragendem Maße« beeinflusst, dass eine zeitliche Prognose unmöglich sei.[35] Das Ende dürfe nicht hinausgeschoben werden durch eine falsche Politik, durch Schutzzölle etwa, die die Entwicklung des Kapitalismus verlangsamen.[36] Die Gewichtung in diesen Schriften ist klar: Der Kapitalismus zerstört sich selbst aufgrund seiner inneren Widersprüche, wann und in welcher Weise dieser Zusammenbruch eintritt, ist jedoch abhängig von politischem Handeln.
Ihre Einwände gegen die Revisionist*innen fasste Luxemburg 1899 in der Schrift Sozialreform oder Revolution? zusammen. Darin heißt es wiederum, »die wachsende Anarchie der kapitalistischen Wirtschaft« mache »ihren Untergang zum unvermeidlichen Ergebnis«.[37] Sie sieht den zeitgenössischen Kapitalismus in einer Übergangsphase zwischen den Anfängen und der »Periode der Schlußkrisen«. Bisherige Wirtschaftskrisen seien »Kinderkrankheiten« gewesen, die sie als Handelskrisen erklärt, verursacht durch die »Erweiterung des Gebietes der kapitalistischen Wirtschaft«.[38] Das Endstadium werde erst erreicht, wenn der Kapitalismus global die einzige Wirtschaftsweise ist, dann führe der Widerspruch zwischen wachsender Produktivität und beschränkten Absatzmärkten zu Überproduktionskrisen, die das Ende bedeuten würden.[39] Fest stand für Luxemburg jedenfalls: »Ohne Zusammenbruch des Kapitalismus ist die Expropriation der Kapitalistenklasse unmöglich.« Ihrem Kontrahenten Bernstein hielt sie entgegen:
»Entweder folgt die sozialistische Umgestaltung nach wie vor aus den objektiven Widersprüchen der kapitalistischen Ordnung, dann entwickeln sich mit dieser Ordnung auch ihre Widersprüche, und ein Zusammenbruch in dieser oder jener Form ist in irgendeinem Zeitpunkt das Ergebnis.«[40]
Oder aber Anpassungsmittel greifen und verhindern den Zusammenbruch, »dann aber hört der Sozialismus auf, eine historische Notwendigkeit zu sein, und er ist dann alles, was man will, nur nicht ein Ergebnis der materiellen Entwicklung der Gesellschaft.«[41]
Ihr Werk über die Akkumulation des Kapitals endet mit der Prognose, die Widersprüche des Kapitalismus könnten »auf einer gewissen Höhe der Entwicklung […] nicht anders gelöst werden als durch die Anwendung der Grundlagen des Sozialismus«.[42] Allerdings ging sie davon aus, dass der Übergang sich als »Periode der Katastrophen« vollziehen werde.[43] Wir sehen an diesen Belegen, dass Luxemburg ihre Position zwischen 1898 und 1913 nicht verändert hat: Der Kapitalismus ist aufgrund innerer Widersprüche zum Untergang verurteilt. Allerdings folgte daraus bei Luxemburg nicht automatisch eine sozialistische Gesellschaft, das unterschied sie vom sogenannten ›Zentrum‹ um Bebel und Kautsky.
Sie wollte ihre Prognose eines Zusammenbruchs lediglich als »eine theoretische Fiktion« verstanden wissen, »gerade weil die Akkumulation des Kapitals nicht bloß ein ökonomischer, sondern ein politischer Prozeß ist«.[44] Die Theorie leiste
»ihren vollen Dienst, wenn sie uns die Tendenz der Entwicklung zeigt, den logischen Schlußpunkt, auf den sie objektiv hinsteuert. Dieser selbst kann sowenig erreicht werden, wie irgendeine frühere Periode der geschichtlichen Entwicklung bis zu ihrer letzten Konsequenz sich abwickeln konnte. Er braucht um so weniger erreicht zu werden, je mehr das gesellschaftliche Bewusstsein, diesmal im sozialistischen Proletariat verkörpert, als aktiver Faktor in das blinde Spiel der Kräfte eingreift.«[45]
Diese Formulierung stammt aus Luxemburgs letzter theoretischer Schrift. Demnach würden ihre Aussagen zum Zusammenbruch lediglich einen idealtypischen, einen modellhaften Verlauf beschreiben. Wir hätten es mit einer Analyse auf demselben Abstraktionsniveau wie die Marxsche Kritik der politischen Ökonomie zu tun, der Konstruktion eines Zusammenbruchs ›in seinem idealen Durchschnitt‹ gewissermaßen.
Einige Äußerungen in früheren Texten und Briefen deuten in dieselbe Richtung. In einer Kritik der polnischen Partei Proletariat bemängelte Luxemburg 1897, diese würde einseitig nur objektive Bedingungen berücksichtigen. Bloß aus wirtschaftlichen Tendenzen lasse sich aber keine »Marschroute für die Partei ableiten«. Die Arbeiterklasse spiele eine eigenständige »aktive Rolle […] in der politischen Entwicklung der kapitalistischen Ordnung«.[46] Anlässlich einer Rezension ihrer Doktorarbeit schrieb Luxemburg im Jahr 1898 in einem Brief, dass »zweifellos eine Wechselwirkung des politischen und des ökonomischen Faktors in dem sozialen Werden beständig stattfindet.« Dabei sei »der wirtschaftliche in letzter Linie ausschlaggebend.« Das dürfe jedoch nicht so missverstanden werden, betonte Luxemburg, als ob »die ökonomische Entwicklung gleichsam wie eine selbstzufriedene Lokomotive durch das historische Geleise saust und die Politik, die Ideologie etc. bloß wie tote Güterwagen hilflos und passiv ihr nachtrotten.«[47] Ganz ähnlich hatte sich Engels 1890 geäußert,
»nach materialistischer Geschichtsauffassung ist das in letzter Instanz bestimmende Moment in der Geschichte die Produktion und Reproduktion des wirklichen Lebens. Mehr hat weder Marx noch ich je behauptet. Wenn nun jemand das dahin verdreht, das ökonomische Moment sei das einzig bestimmende, so verwandelt er jenen Satz in eine nichtssagende, abstrakte, absurde Phrase.«[48]
In Sozialreform oder Revolution? betonte Luxemburg, dass »die objektive Entwicklung uns bloß die Bedingungen einer höheren Entwicklungsstufe an die Hand gibt, daß aber ohne unser zielbewusstes Eingreifen, ohne den politischen Kampf der Arbeiterklasse um die sozialistische Umwälzung«, diese nicht stattfinden wird.[49] In einer Würdigung von Marx schrieb sie, dessen Werk mache bewussten Klassenkampf möglich, gestützt auf die Einsicht in die »Gesetzmäßigkeit der historischen Entwicklung«.[50] Erstmals könne dadurch die Einheit von menschlichem Wollen und realer Entwicklung hergestellt und das »Stadium der bewußten, gewollten, wahrhaft menschlichen Geschichte« erreicht werden.[51] Voraussetzung dafür sei jedoch, dass »die Theorie […] zur Bewusstseinsform der Arbeiterklasse und als solche zum Element der Geschichte wird.«[52]
Wie Marx ging Luxemburg davon aus, dass das Proletariat zum revolutionären Subjekt prädestiniert sei, aber erst durch Klassenkämpfe und Lernprozesse tatsächlich zur revolutionären Klasse werden könne. Luxemburg beschäftigte deshalb wie Marx, Engels oder Lenin die Frage, welche Vorgehensweise dazu beitragen könne.[53] Sie verwies auf England und Frankreich, wo Sozialismus und Arbeiterbewegung nicht gleichzusetzen waren.[54] Für Luxemburg stand fest, dass Widersprüche zwischen der realen Arbeiterbewegung und dem sozialistischen Anspruch nur in der Praxis aufgehoben werden können, und zwar durch eine Arbeiterpolitik, die sich nicht auf Interessenvertretung beschränke, wie Gewerkschaften, sondern sich »in der Richtung des Klassenkampfcharakters der Partei« bewege.[55]
Unter dem Eindruck der russischen Revolution stellte Luxemburg 1905 fest, Geschichte werde von Menschen gemacht, aber dank sozialistischer Theorie könne Geschichte bewusst gestaltet werden. Denn das Wissen um historische Tendenzen befreie
»keineswegs von der tätigen Einmischung […], erlaubt uns keineswegs, fatalistisch die Hände auf der Brust zu falten und […] abzuwarten, was die Zukunft bringt. ›Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken‹, sagt Marx. Völlig richtig könnte man den Satz auch umgekehrt sagen: Die Menschen machen ihre eigene Geschichte nicht aus freien Stücken, aber sie machen ihre eigene Geschichte. Wenn wir mit der Tendenz des objektiven Geschichtsprozesses rechnen, so schwächt und lähmt das keineswegs die aktive, revolutionäre Energie, sondern weckt und härtet gerade Willen und Aktivität, in dem es uns Wege zeigt, wie wir erfolgreich das Rad des gesellschaftlichen Fortschritts vorwärts drehen können, in dem es uns davor bewahrt, frucht- und machtlos mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen…«[56]
Im Zusammenhang mit der Entwicklung in Polen, aber durchaus auch als allgemeine Feststellung gültig, ist Luxemburg Bemerkung, die revolutionäre Tat bestehe darin, »in diesen spontanen Geschichtsprozeß Bewusstsein einzubringen und ihn dadurch abzukürzen oder zu beschleunigen.«[57] Dieses Zitat belegt allerdings wiederum die Ambivalenz von Luxemburgs Haltung. Denn die Formulierung besagt, dass die Menschen lediglich das Tempo, aber nicht den Verlauf der Geschichte in der Hand haben. Auch sind die Belege, in denen sie den Stellenwert der Praxis hervorhob, oft Reaktionen auf Einwände. Sie löste sich nur allmählich von deterministischen Positionen und dieser Prozess kam erst angesichts eines Weltkriegsgemetzels zum Abschluss, das jeden Geschichtsoptimismus Lügen strafte. Das zeigen die Schriften Luxemburgs während des Krieges und in den wenigen Wochen nach der Novemberrevolution bis zu ihrer Ermordung.
In der Junius-Broschüre rechnete Luxemburg 1915 mit der Zustimmung der Sozialdemokratie zum Krieg ab. Als eine der Ursachen für diese Haltung der SPD führte sie eine fatalistische Geschichtsauffassung an. Der wissenschaftliche Sozialismus lehre zwar die objektiven Gesetze der geschichtlichen Entwicklung zu begreifen, notierte sie, und das Proletariat sei vom jeweiligen Reifegrad der gesellschaftlichen Entwicklung abhängig, aber es sei eben selbst Teil dieser Entwicklung, »in gleichem Maße ihre Triebfeder und Ursache, wie es ihr Produkt und ihre Folge ist. Seine Aktion selbst ist mitbestimmender Teil der Geschichte«. Trotz aller materiellen Vorbedingungen könne der Sozialismus nicht »wie ein Fatum vom Himmel fallen«, sondern müsse erkämpft werden.[58]
Luxemburg verwies auf eine Bemerkung von Engels, die sie zuspitzte. Demnach stehe die bürgerliche Gesellschaft vor dem Dilemma, den Übergang zum Sozialismus zu schaffen oder einen Rückfall in die Barbarei zu erleben. Dieser Weltkrieg, so Luxemburg, sei der Rückfall in die Barbarei, der Imperialismus vernichte die Kultur, sporadisch während der Dauer des Krieges »und endgültig, wenn die nun begonnene Periode der Weltkriege ungehemmt bis zur letzten Konsequenz ihren Fortgang nehmen sollte.«[59] Nun zeige die bürgerliche Gesellschaft ihre wahre Gestalt, »nicht wenn sie, geleckt und sittsam, Kultur, Philosophie und Ethik, Ordnung, Frieden und Rechtsstaat mimt«, sondern »als reißende Bestie, als Hexensabbat der Anarchie, als Pesthauch für Kultur und Menschheit.«[60]
Sozialismus war für Luxemburg nun nicht mehr das vorgegebene Ziel der Geschichte, sondern Notwendigkeit »nicht bloß deshalb, weil das Proletariat unter den Lebensbedingungen nicht mehr zu leben gewillt ist, die ihm die kapitalistischen Klassen bereiten, sondern deshalb, weil, wenn das Proletariat nicht seine Klassenpflichten erfüllt und den Sozialismus verwirklicht, uns allen zusammen der Untergang bevorsteht.«[61] Anstelle der Siegeszuversicht war der Zweifel getreten, die Entwicklung des Kapitalismus drohe mit der Vernichtung, dem Untergang aller Kultur zu enden. Immer wieder kam Luxemburg in ihrer letzten Schaffensperiode auf den Schlagsatz ›Sozialismus oder Untergang in die Barbarei‹ zurück, der zum Motto des Spartakusbundes wurde. Der Ausgang der Geschichte war damit offen, allein menschliches Handeln ausschlaggebend.[62] In diesem Sinn könnte Luxemburg mit gleichem Recht wie Gramsci und Lukács als Begründerin eines westlichen Marxismus gelten.
DREIReform, revolutionäre Realpolitik, Transformation und Revolution
In den beiden Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg führte die Sozialdemokratie zwei große Debatten, an denen Luxemburg maßgeblich beteiligt war. Die Revisionismus- und die Massenstreikdebatte werden in diesem Kapitel dargestellt sowie die Frage nach einer ›revolutionären Realpolitik‹ diskutiert, einen Begriff, den Luxemburg aufbrachte und auf den sich manche heute noch beziehen. Es ging um Grundsatzfragen, die bis heute aktuell sind: Wie entwickelt sich der Kapitalismus? Welche Widersprüche treten auf? Was ist die richtige Strategie, die richtige Organisationsform? Welchen Stellenwert haben Wahlen und Parlamente, direkte Aktionen und Militanz?
Grundsatzfragen
Für viele Frühsozialist*innen war eine explizit politische Strategie zunächst kein Thema. Sie setzten auf die Vorbildfunktion von Kollektiven, Kommunen, Genossenschaften oder Tauschbörsen, in denen Menschen gemeinsam arbeiten und leben würden, manche appellierten an die Regierung oder gar an die Reichen und den König, solche Projekte zu unterstützen. Das berühmteste Modell malte Charles Fourier mit Liebe zum Detail aus. In einem Phalanstère, wie er diese Kommunen nannte, sollten 500 bis 2.000 Menschen leben. Bald tauchte, etwa bei Flora Tristan, die Vorstellung auf, Arbeiter*innen sollten sich zusammenschließen, um ihre Forderungen im Parlament zu vertreten.
In der Ersten Internationalen wurde über strategische Fragen heftig gestritten. Anarchist*innen lehnten etwa die politische Aktion, worunter sie die Beteiligung an Wahlen und Parlamenten fassten, als ersten Schritt zur Integration in das verhasste System strikt ab. Sie forderten direkte Aktionen, worunter sie zunächst den bewaffneten Aufstand verstanden. Bakunin schmiedete Pläne für einen Geheimbund, dem die Massen der Ausgebeuteten und Unterdrückten folgen würden. Marx und Engels hielten die Eroberung der politischen Macht für unabdingbar. Der Staatsapparat sollte übergangsweise genutzt werden, um eine sozialistische Gesellschaft aufzubauen. Wäre diese Gesellschaft aufgebaut, würde der Staatsapparat überflüssig und könnte aufgelöst werden. Unter dem Eindruck der Pariser Kommune forderte Marx später jedoch, der Staatsapparat müsse sofort zerschlagen und durch neue politische Strukturen ersetzt werden.[1] Dann warnte der Militärexperte Engels, ein Barrikadenkampf alten Stils wäre aufgrund moderner Waffentechnik nicht mehr zielführend. Die Arbeiterklasse sollte vielmehr eigene Parteien aufbauen, das allgemeine Wahlrecht erkämpfen und mit dem Stimmzettel die Macht erobern. Zuwächse an Wählern und Mandaten wertete er als Erfolge auf diesem Weg. Allerdings kalkulierten Marx und Engels stets, dass die Bourgeoisie sich nicht durch eine parlamentarische Mehrheit entmachten lasse, sondern eher ein Blutbad anrichten würde. Sie hofften jedoch, dass bis dahin ein revolutionäres Bewusstsein so weit verbreitet wäre, dass die Masse der Soldaten den Befehl verweigern und zu den Revolutionären überlaufen würde.[2]
In Deutschland konkurrierten anfangs zwei Parteien um die Gunst der Proletarier*innen: der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein (ADAV), von Ferdinand Lassalle 1863 gegründet, und die Sozialdemokratische Arbeiterpartei (SDAP), die sich 1869 um August Bebel und Wilhelm Liebknecht formierte und von Marx und Engels unterstützt wurde. Lassalle nahm ein ›ehernes Lohngesetz‹ an. Niemals würde der Lohn für mehr reichen als das bloße Überleben. Eine Überwindung dieser Verhältnisse könne nur über eine Mehrheit der Arbeiterparteien im Parlament erreicht werden und nicht über gewerkschaftliches Engagement. Er forderte, der Staat solle Produktionsgenossenschaften für Arbeiter unterstützen, die die private Konkurrenz niederringen würden. Eine Kooperation mit bürgerlichen Demokraten lehnte er ab, wollte aber mit dem preußischen Staatskanzler Otto von Bismarck paktieren, um seine Ziele zu erreichen.[3] Hingegen lehnte die SDAP ein Bündnis mit reaktionären Kräften strikt ab, plädierte aber für die Kooperation mit Demokraten und förderte die gewerkschaftliche Organisierung.[4] 1867 wurden mit Johann Baptist von Schweitzer für den ADAV sowie Bebel und Liebknecht, zunächst für die Sächsische Volkspartei, erstmals dezidierte Sozialisten in den Reichstag des Norddeutschen Bundes gewählt. Damit entstand ein neuer Streitpunkt: die Frage nach der Taktik bei Wahlkämpfen und in Parlamenten.
Trotz der Gegensätze vereinigten sich die beiden Parteien 1875 in Gotha zur Sozialistischen Arbeiterpartei (SAP), um ihre Schlagkraft zu erhöhen. Das gemeinsame Programm wurde von Marx scharf kritisiert, sein Kommentar jedoch erst Jahre später veröffentlicht. Marx kritisierte vor allem die Forderung nach ›gerechter Verteilung‹, die sich bis heute in der Linken großer Beliebtheit erfreut, als nebulöse Phrase. »Behaupten die Bourgeois nicht, daß die heutige Verteilung ›gerecht‹ ist? Und ist sie in der Tat nicht die einzige ›gerechte‹ Verteilung auf Grundlage der heutigen Produktionsweise?«, fragte er. Außerdem hielt er es für falsch, die Verteilung der Güter in den Mittelpunkt zu rücken, denn diese resultiere aus der Verteilung der Produktionsmittel. Sozialismus sei keine Frage der gerechten Verteilung von Konsumgütern, sondern der Enteignung von Produktionsmitteln.[5]
Drei Jahre später nutzte die Regierung zwei Attentatsversuche auf Kaiser Wilhelm I., um im Reichstag ein sogenanntes Ausnahmegesetz durchzusetzen, dass die SAP verbot. Deren Aktivist*innen gingen ins Exil oder blieben im Untergrund aktiv. Lediglich die Kandidatur für das Parlament und die Arbeit der Fraktion blieben erlaubt, auch das Theorieorgan Die Neue Zeit konnte erscheinen. Im Rahmen einer Strategie von Zuckerbrot und Peitsche führte die Regierung unter Bismarck Kranken- und einer Unfallversicherung sowie Alters- und Invalidenrente ein. Über die richtige Taktik angesichts der Repression sowie der Einschätzung dieser Reformen wurde innerhalb der Partei heftig gestritten. Auf dem ersten Parteitag im Exil, auf Schloß Wyden in der Schweiz, wurde eine radikale Gruppe um Johann Most ausgeschlossen, die sich dem Anarchismus näherte. Gravierender war allerdings, dass die Mehrheit der Abgeordneten zu einem nachgiebigeren Kurs neigte, in der Hoffnung, die Regierung milder zu stimmen, was von Bebel, Eduard Bernstein und Georg von Vollmar kritisiert wurde, Engels wetterte über die »Schwachmatikusse« in der Fraktion. Eine Spaltung der Partei stand im Raum.[6]
Nach dem Sturz Bismarcks im Frühjahr 1890 erneuerte der Reichstag das Ausnahmegesetz nicht mehr, was von der Sozialdemokratie als großer Sieg gefeiert wurde. Die Partei hatte sich nicht unterkriegen lassen und selbst in der Illegalität an Stimmen und Mandaten hinzugewonnen. Der Streit um die Ausrichtung ging jedoch in die nächste Runde. Auf dem Parteitag in Halle, wo sich die Partei in SPD umtaufte, kam es zur Auseinandersetzung mit den ›Jungen‹, wie sich die linksgerichtete Opposition innerhalb der SPD nannte, die forderten, sich auf eine Revolution vorzubereiten. Der Zwist endete ein Jahr später mit dem Ausschluss dieser Strömung, unter ihnen Rudolf Rocker, später einer der wichtigsten Vertreter des Anarchismus. Die ›Jungen‹ glaubten nicht, dass die Gesellschaft durch parlamentarische Reformen umgewälzt werden könnte. Sie waren mit die ersten, die den Zwiespalt zwischen radikaler Rhetorik und reformistischer Praxis kritisierten.[7] Eleanor Marx berichtete Engels aus Halle, in der Partei existiere eine Spießerströmung, die Reichstagsfraktion sei verbürgerlicht und Vollmar wesentlich gefährlicher als die ›Jungen‹.[8]