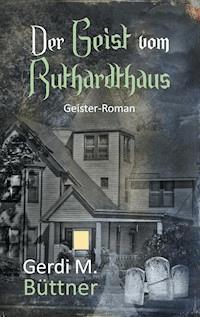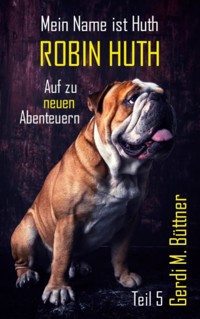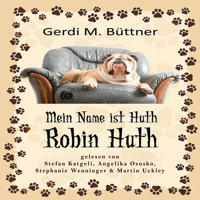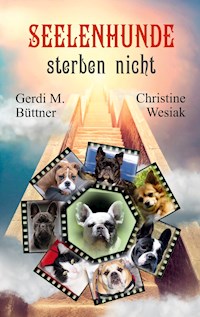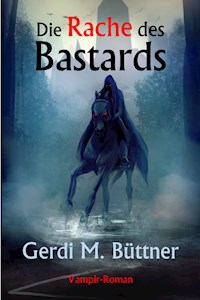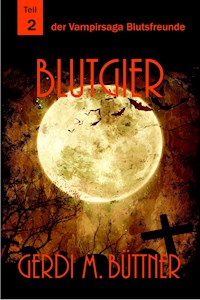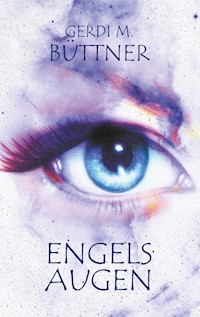Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Auf der Suche nach seinem alten Mentor Erasmus tritt Adrian eine Zeitreise in das Aschaffenburg des Jahres 1636 an und trifft dort auf die junge Zenta, deren Mutter Agatha wegen Hexerei angeklagt ist. Adrian findet heraus, dass sie mit Erasmus im Kerker sitzt. Er lässt sich zum Schein als Wärter anstellen und es gelingt ihm, Agatha und Erasmus zu befreien. Auf der anschließenden Flucht ist auch Zenta dabei. Sie schließen sich einer Zigeunerhorde an, um unerkannt zu bleiben. Doch der Hexenrichter schickt Häscher aus, die Entflohenen einzufangen, um ihnen doch noch den Prozess zu machen. Adrian wird gefangen genommen, die anderen entkommen. Um den Hexenrichter von den Freunden abzulenken, beschuldigt sich Adrian selbst der Hexerei und wird zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt. Nur durch die Rückkehr in seine eigene Zeit kann er sein Leben retten. Doch die Sorge um Agatha, Erasmus und Zenta lässt ihn nicht ruhen, so reist er trotz der Gefahr für sein Leben erneut in die Vergangenheit zurück.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 498
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PROLOG
Träge zogen Regenwolken über den Himmel und ab und zu zuckte ein entferntes Wetterleuchten am Firmament. Die Luft war stickig, das aufziehende Gewitter brachte keine Abkühlung. Im Gegenteil, es lud die Atmosphäre nur noch mehr auf.
Eine einsame Gestalt stand reglos am geöffneten Turmfenster und starrte selbstvergessen über die Weiten des Taubertals. Vom Turm der Burg Hohenberg hatte man einen prächtigen Ausblick, doch Simon zu Hohenberger nahm ihn nicht wahr. Erst als aus dem Zimmer nebenan das quäkende Geschrei eines Säuglings erklang, kehrten seine Gedanken in die Gegenwart zurück.
Lächelnd schloss er das Fenster und verließ das dunkle Zimmer um in sein von sanftem Kerzenschein erleuchtetes Schlafgemach zu treten. Der Anblick, der sich ihm bot, erwärmte sein Herz. Seine geliebte Frau Nelia saß bequem, von dicken Kissen gestützt, im Bett und stillte den kleinen Adrian. Neben ihr lag noch ein weiteres winziges Bündel. Roland, der zweite Säugling. Er war noch nicht erwacht, begann sich jetzt aber ebenfalls zu regen. Die Zwillinge waren erst wenige Tage alt.
Simon setzte sich auf den Bettrand um seinen Sohn auf den Arm zu nehmen. Der Säugling sah ihn aus ernsten blauen Augen an und begann dann heftig an seinem Fäustchen zu saugen. Als er davon nicht satt wurde, begann er aus Leibeskräften zu brüllen.
Nelia setzte Adrian von ihrer Brust ab und überreichte ihn seinem Vater. Dann legte sie Roland an ihrer anderen Brust an. Sofort verstummte das Geschrei und nur noch leise, schmatzende Geräusche waren zu hören.
„Ich kann nicht schlafen“, ertönte jetzt ein zartes Stimmchen aus dem angrenzenden Kinderzimmer. Die zweijährige Freija stand im Nachthemd unter der Türe, ihren Plüschhund fest an sich gedrückt. Ihre großen blauen Augen blickten neugierig. Noch hatte sie sich nicht an ihre kleinen Geschwister gewöhnt und war ein wenig eifersüchtig auf die Konkurrenten um die Gunst der Mutter.
„Na, komm her mein Schatz. Hier im Bett ist Platz genug, da passt du auch noch herein.“
Simon winkte seine Tochter heran, hob sie hoch und gab ihr einen lauten Schmatz auf die Wange. Dann legte er sie auf die freie Seite des Bettes und deckte sie zu. Freija gähnte zufrieden und drückte den Stoffhund fest an sich.
Nach einer Weile kehrte Ruhe ein. Die Zwillinge schliefen jetzt friedlich in ihrer Wiege und auch Freija war eingeschlafen. Nelia, die von der anstrengenden Geburt noch erschöpft war, gähnte verhalten. Simon gab ihr einen zärtlichen Gutenachtkuss und verließ das Schlafzimmer. Grüßend nickte er der Zofe zu, die nun leise ins Zimmer schlüpfte um den Schlaf der Wöchnerin zu bewachen.
Ziellos wanderte er durch die nur schwach erleuchteten Gänge. Schon seit Tagen fand er keine Ruhe. Und das lag nicht nur an der Geburt der Zwillinge. Eine innere Unruhe hielt ihn gepackt, die er sich nicht erklären konnte. Erneut öffnete er eines der Fenster und spähte in die Dunkelheit, lauschte auf die Geräusche der Nacht.
Er wusste nicht wie lange er so dastand, ein plötzlicher greller Blitz ließ ihn zusammenzucken. Dann grollte schon der Donner und der Himmel öffnete seine Schleusen. Ein erfrischender Regen wusch endlich die Schwüle aus der Luft. Wie befreit atmete Simon auf.
Die Blitze zuckten in schneller Folge über den Himmel, erhellten für Bruchteile von Sekunden die Umgebung als sei es heller Tag. Fasziniert betrachtete der Herr von Burg Hohenfels das elementare Naturschauspiel.
Plötzlich stutzte er und schaute aus zusammengekniffenen Augen auf den Weg, der zur Burg heraufführte. War da nicht zwischen den Bäumen und Sträuchern für einen Moment eine dunkle Gestalt auszumachen?
Der nächste Blitz bestätigte es. Ein Reiter auf einem dunklen Pferd und in ein schwarzes Cape gehüllt, näherte sich dem Burgtor. Hoffnung und Misstrauen durchzuckten gleichzeitig Simons Brust und er eilte die Treppen hinunter um den späten Besucher einzulassen. Kurz überlegte er, ob er ein paar Bedienstete wecken sollte, entschied sich aber dagegen. Sicher suchte der Reiter nur Schutz vor dem Gewitter und er wollte ihm seine Gastfreundschaft nicht verwehren.
Dennoch spähte er erst vorsichtig durch das kleine vergitterte Fenster am Tor. Aber er konnte nur eine große schwarze Gestalt auf einem riesigen schwarzen Pferd ausmachen. Doch dieser Anblick reichte aus, ihn sofort ohne Bedenken das Tor öffnen zu lassen.
„Adrian?“ fragte er ungläubig um es im nächsten Moment fast hinauszuschreien. „Adrian, mein Gott, du bist es wirklich!“
Ein tiefes dröhnendes Lachen klang unter der Kapuze vor, dann sprang Adrian auch schon behände aus dem Sattel und umarmte Simon stürmisch. Dabei achtete er nicht darauf, dass er dessen Kleidung total durchnässte. Lange lagen sich die Freunde in den Armen, lachten und weinten vor Glück über das Wiedersehen.
Endlich löste der große Mann sich von seinem jüngeren Freund und meinte atemlos.
„Ich denke, wir sollten unser Wiedersehen im Haus feiern. Hier draußen ist es reichlich ungemütlich. Ich bringe nur schnell mein Pferd in den Stall. Luzifer liebt Gewitter überhaupt nicht, sieh nur, wie ungebärdig er sich benimmt.“
Tatsächlich strebte der riesige schwarze Hengst jetzt energisch auf die Stallungen zu. Er kannte sich hier aus und wollte endlich ins Trockene. Schnell öffnete Simon die Stalltüre, damit das Pferd sie nicht einfach mit seiner mächtigen Brust einrammte.
Adrian winkte ab, als Simon einen der Stallknechte wecken wollte. „Nein, nein, das mach ich schon selbst. Du weißt doch, Luzifer ist sehr eigen was Fremde betrifft. Ich möchte nicht, dass er deinen Knecht verletzt.“
Routiniert sattelte er das Pferd ab und rieb es mit einem alten Tuch trocken. Währenddessen schüttete Simon Hafer in die Krippe und legte ein großes Büschel Heu dazu. Zufrieden begann der Rappe zu kauen.
Kurze Zeit später saßen sich die Freunde im geräumigen Burgzimmer gegenüber. Adrian hatte seine nassen Sachen ausgezogen und saß nun, in einen von Simons Morgenmänteln gehüllt da.
Sein noch leicht feuchtes Haar lag lockig auf seinen Schultern. Er schürzte anerkennend die Lippen als er die Einrichtung musterte. „Ich muss sagen, Nelia hat einen sehr guten Geschmack bewiesen. Das Zimmer ist nicht mehr wiederzuerkennen. Diese Frau ist ein wahrer Glücksfall für dich. Wo ist sie überhaupt, schläft sie etwa schon?“
Fragend blickte er den Freund an.
Voller Stolz erzählte Simon von der Geburt der Zwillinge.
„Roland und Adrian“, verkündete er feierlich und fügte mit einem verschmitzten Lächeln hinzu. „Ich hätte allerdings nicht geglaubt, dass du deinen Patensohn höchstpersönlich bei der Taufe morgen halten kannst. Möchtest du Nelia und die Kinder sehen? Sie hat ganz sicher nichts dagegen, wenn ich sie deinetwegen wecke. Sie wird vor Freude ganz aus dem Häuschen sein.“
Adrian lächelte, schüttelte aber den Kopf.
„Nein, lass sie schlafen. Morgen ist Zeit genug zur Begrüßung. Nelia braucht nach der Anstrengung einer Zwillingsgeburt so viel Ruhe wie sie nur kriegen kann. Ach, ich bin wirklich sehr glücklich, wieder hier zu sein. Wie lange lebst du und deine Familie schon wieder auf der Burg?“
Vor etwa zwei Jahren war Burg Hohenberg durch einen Brand zu großen Teilen zerstört worden. Simon überlegte zuerst, ob er sie einreißen lassen sollte, entschloss sich aber dann zum Wiederaufbau. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen.
„Oh. Wir wohnen erst seit einigen Wochen hier. Nelia wollte unbedingt, dass die Geburt hier stattfindet. Fast, als ob sie geahnt hätte, dass du zurückkommst und dein Haus selbst brauchst. Zwar sind noch nicht alle Räume wieder bewohnbar aber es reicht vorerst aus. Bis die Jungs eigene Zimmer brauchen, ist sicher auch der Rest wieder hergestellt.“
Er nutze die entstehende Pause um sein Gegenüber gründlich ins Auge zu fassen. Seit Adrian auf so spektakuläre Weise aus seinem Leben verschwand, war etwa ein dreiviertel Jahr vergangen. Damals hatten sie beide nicht gewusst, ob sie sich jemals wiedersehen würden.
Adrian hatte sich durch seine abenteuerliche Zeitreise kaum verändert, stellte er erleichtert fest. Vielleicht trug er ein paar Falten mehr um die Augen und seine Wangen sahen ein wenig hagerer aus als Simon es in Erinnerung hatte. Doch die schwarzen Augen blickten ernst und ruhig wie immer. Was auch immer Adrian in den vergangenen Monaten erlebt hatte, es hatte ihm anscheinend nichts anhaben können.
Er dachte an den Tag zurück, als der Hexer in die Vergangenheit reiste, um seinem alten Freund und Mentor in höchster Gefahr beizustehen. Er hatte ihn auf dem Ritt zu den Extern-Steinen im Teutoburger Wald begleitet, jenem magischen Steingebilde, dessen Inneres einer alten Legende zufolge ein Tor in die Zeit barg.
Damals konnte Simon nicht so recht daran glauben, dass es tatsächlich möglich sein sollte, in ein längst vergangenes Zeitalter zu reisen. Doch Adrian kannte derlei Zweifel nicht. Getreulich folgte er den Träumen, die ihm Erasmus, der alte Hexer sandte um seine Hilfe zu erbitten. Simon erinnerte sich noch sehr genau. Es war stürmischer Tag gewesen, es hatte wie aus Kübeln gegossen und ein heftiger Sturm war übers Land gefegt. Doch selbst ein Orkan hätte Adrian nicht von seinem Vorhaben abhalten können. Unbeirrt hatte er zwischen den Steinen das Ritual absolviert, das ihn in eine andere Zeit bringen sollte. Simon war weit außerhalb der fünf Felsen zurückgeblieben, gleich Adrian hatte er die magischen Formeln gemurmelt. Und dann war es tatsächlich geschehen, die Statur des Hexers wurde durchsichtig und kurz darauf war er verschwunden. Nur das Feuer, das er im Schutz der Steine entzündet hatte, war noch einmal kräftig aufgelodert und dann plötzlich erloschen. Lange hatte er so gestanden und die Felsen angestarrt. Doch sie hatten ihr Geheimnis nicht preisgegeben. Schließlich hatte er sich abgewandt und war langsam zu den wartenden Pferden zurückgegangen. Schweren Herzens hatte er den langen Heimweg angetreten, nicht wissend, ob er Adrian jemals wiedersehen würde. Und nun saß ihm der Hexer gegenüber, gesund und zumindest äußerlich unversehrt. Simon brannte darauf, zu erfahren, was Adrian erlebt hatte und wie es ihm in der Vergangenheit ergangen war.
Inhaltsverzeichnis
PROLOG
Kapitel 1: Eine lange Geschichte
Kapitel 2: Zuflucht im Pfarrhaus
Kapitel 3: Ich, der Folterknecht
Kapitel 4: Ein Geständnis und ein Kuss
Kapitel 5: Der Überfall
Kapitel 6: Eine Nacht mit Folgen
Kapitel 7: Erasmus unter der Folter
Kapitel 8: Die Befreiung der Hexen
Kapitel 9: Auf der Flucht
Kapitel 10: Tod und neues Leben
Kapitel 11: Fahrendes Volk
Kapitel 12: Eine unvermutete Begegnung
Kapitel 13: Zurück zu den Wurzeln
Kapitel 14: Zurück nach Aschaffenburg
Kapitel 15: Unter der Folter
Kapitel 16: Der Prozess
Kapitel 17: Der Scheiterhaufen
Kapitel 18: Wieder in meiner Zeit
Kapitel 19: Eine Entscheidung des Herzens
Kapitel 20: Ein riskantes Vorhaben
Kapitel 21: Zuflucht oder Kerker?
Kapitel 22: Roderichs wundersame Genesung
Kapitel 23: Zukunftspläne
Kapitel 24: Eine neue Zukunft
Weitere Teile der Hexer-Trilogie
Kapitel 1: Eine lange Geschichte
Adrian nahm einen großen Schluck des kühlen Weins und lehnte sich dann bequem zurück. Er konnte die Neugierde im Blick seines jungen Freundes sehen und lächelte leicht. Dann wanderte sein Blick zu der mächtigen Standuhr, die gerade mit dröhnenden Schlägen die zehnte Abendstunde verkündete. Sein Blick glitt zu Simon zurück.
„Ich kann dir ansehen, wie sehr du darauf brennst, meine Abenteuer zu erfahren. Also gut, dann will ich dich nicht länger auf die Folter spannen. Ich hoffe, du bist noch nicht allzu müde. Denn was ich zu berichten habe, nimmt eine Weile in Anspruch...“
Simon war keinesfalls müde. Und auch der Hexer machte trotz seines langen Rittes keinen erschöpften Eindruck. Seine langen Finger strichen über das struppige Fell des alten Burgkaters, der es sich auf seinen Schenkeln bequem gemacht hatte und behaglich schnurrte. Simon wollte den sonst so griesgrämigen Kater vertreiben, doch Adrian wehrte ab.
„Lass ihn doch, ich mag Katzen. Und dieser rabenschwarze Bursche passt doch hervorragend zu mir. Ein Hexer und ein schwarzer Kater, fehlt nur noch eine Warze auf meiner Nase.“
Er lachte leise und begann dann zu erzählen:
„Damals, zwischen den Extern-Steinen erfasste mich plötzlich ein unwiderstehlicher Sog. Er war so stark, dass ich dachte ich müsse ersticken. Die Luft wurde mir mit Vehemenz aus den Lungen gepresst, ich hatte das Gefühl, durch eine enge Röhre gezogen zu werden. Und ich meinte, ich rutsche in eine bodenlose Tiefe. Ich kann nicht sagen, wie lange dieser Zustand anhielt, ich verlor jegliches Zeitgefühl. Das einzige, an das ich noch denken konnte, war Erasmus. Fast meinte ich, er zöge mich per Gedankenkraft zu sich. Doch als ich nach endloser Zeit aus der beklemmenden Enge erlöst wurde, war ich genau dort, wo meine Zeitreise begann.
Ich stand noch immer zwischen den Felsen und dachte frustriert, dass wohl etwas schiefgegangen sei. Doch als ich dann nach dir Ausschau hielt, warst du nicht mehr da. Als nächstes fiel mir auf, dass die Sonne heiß vom Himmel schien. Keine Spur von dem Sturm, der tagelang getobt hatte, ja der Boden unter meinen Füßen staubte sogar, als ich aufstampfte. Kein Zweifel, es hatte schon sehr lange Zeit nicht mehr geregnet.
Die Erkenntnis, in einer anderen Zeit gelandet zu sein, erleichterte und besorgte mich gleichermaßen. Denn ich hatte keine Ahnung, in welchem Jahr oder auch Jahrhundert ich gelandet war. Ich schaute an mir herunter und erschrak. Meine Kleidung war zwar noch die gleiche, doch nun sah sie so schäbig aus, als wäre ich durch ein Feuer gegangen. Sie war schmutzig, voller Ruß und Dreck und an vielen Stellen durchlöchert oder zerrissen. Außerdem passten mir meine Sachen nicht mehr richtig, sie waren plötzlich zu weit.
Kopfschüttelnd zurrte ich den Gürtel enger zusammen, damit ich meine Hose nicht verlor. Anscheinend hatte ich bei meiner Zeitreise einiges an Gewicht verloren. Doch das war im Moment meine geringste Sorge. Die Goldstücke fielen mir ein, die ich in einem Beutel um meinen Hals trug. Hatten sie die Reise durch die Zeit überstanden? Falls nicht, so stand ich mittellos da.
Doch ein schneller Griff beruhigte mich. Der Beutel war noch da, als ich ihn berührte klimperten die Münzen leise. Ich atmete auf, eine Sorge weniger.
Ratlos stand ich eine Weile herum, überlegte, wie ich nun wohl Erasmus finden konnte. In welche Richtung sollte ich mich halten? Dann ging ich einfach los, den Weg zurück, den ich mit dir gekommen war. Ohne Pferd und in der Hitze kam ich nur langsam voran. Ein Blick zum Himmel verriet mir, es war etwa Mittag. Weit und breit sah ich keine Menschenseele. Und auch die Straße war nicht mehr da, nur ein schmaler Pfad führte irgendwo hin. Ich ging ihm einfach nach.
Endlich, nach Stunden ermüdenden Fußmarsches, kam in der Ferne ein kleines Dorf in Sicht. Bald darauf lief ich durch reifende Felder. An den Apfelbäumen, die den Wegrand säumten, hingen reife Äpfel, die sicher bald geerntet wurden. Das sagte mir, dass ich in einer anderen Jahreszeit gelandet war, jetzt war es zweifellos Herbst.
Hungrig pflückte ich ein paar Äpfel und verzehrte sie im Gehen. Vorsorglich steckte ich mir noch einige als Reserve in die Taschen. Wer weiß, dachte ich, wann ich die nächste Mahlzeit bekomme. Als ich hinter mir das Rumpeln schwerer Räder vernahm, drehte ich mich neugierig um.
Ein Bauer mit einem Gespann Kühe vor seinem hoch beladenen Heuwagen kam hinter mir her. Ich blieb stehen und als er heran war, musterte er mich mit missbilligendem Blick. Ich beäugte ihn ebenfalls, machte mir ein schnelles Bild von seiner Kleidung. Sie sah nicht ungewohnt aus, war grob gewebt und formlos zusammengenäht, doch ich konnte daran nicht erkennen, aus welchem Zeitalter sie stammte. Es war einfach nur bäuerliche Arbeitskleidung, praktisch und robust. Dem Mann kam meine Kleidung jedoch merkwürdig vor, ob es aber an dem ihm ungewohnten Schnitt oder nur am Schmutz und den Löchern lag, konnte ich ihm nicht ansehen. Und fragen wollte ich ihn nicht.“
„Na, junger Mann“, sprach er mich an. „Du siehst aus, als wärst du schon lange unterwegs. Wenn du willst, kannst du bis ins Dorf mitfahren.“
Das war mir nur recht, meine Beine schmerzten von dem langen Fußmarsch. Außerdem fühlte ich mich nicht ganz wohl, was ich den Strapazen der Zeitreise zurechnete. Also stieg ich zu ihm auf den Wagen. Er war wortkarg und ich wusste auch nicht, was ich sagen sollte. Die Fragen, die mir auf der Zunge lagen, konnte ich ihm nicht stellen. Ich würde anderweitig herausfinden müssen, in welchem Zeitalter ich gelandet war.
Und ich wollte auch nicht fragen, warum er mich mit junger Mann angesprochen hatte. Er war zwischen fünfunddreißig und vierzig, schätzte ich, also höchstens fünf, sechs Jahre älter als ich. Bevor er zu seinem Hof abbog, ließ er mich absteigen. Meinen Dank beantwortete er mit einem grunzenden Laut, dann tupfte er den Kühen mit der Peitsche auf den Rücken und zog von dannen.
Ich zog weiter meines Weges, nicht wissend, wohin ich überhaupt gehen sollte. Als es dunkel wurde, legte ich mich in einem leeren Schafstall zum Schlafen nieder. Zuvor hatte ich mir an einem Bach den Magen mit Wasser gefüllt. So spürte ich meinen nagenden Hunger nicht allzu sehr.
Ich schlief fast auf der Stelle ein. Dann kam der Traum wieder. Erasmus, wie ich ihn schon seit Nächten sah. Hilflos hob er mir seine mit Stricken gefesselten Hände entgegen und sah mich bittend an. Doch diesmal sprach er zum ersten Mal zu mir. Es war nur ein Satz. „Geh nach Aschaffenburg zurück.“
Dann war er verschwunden und ich schlief traumlos bis mich die Sonne weckte. Seine Worte klangen mir noch im Ohr.
„Geh nach Aschaffenburg zurück.“
Wenigstens wusste ich jetzt, wohin ich mich wenden musste. Instinktiv hatte ich ja bereits den richtigen Weg eingeschlagen. Doch bis Aschaffenburg war es zu Fuß noch ein endlos weiter Weg. Ich musste zusehen, ob ich ein Pferd auftreiben konnte. Oder wenigstens auf einem Wagen mitfahren konnte.
In meinem Brustbeutel klimperten die Goldmünzen, die ich vorsorglich mitgenommen hatte. Sie stammten aus dem sechzehnten Jahrhundert, ich konnte nur hoffen, dass sie eine gültige Währung darstellten. Wenn nicht, so würde ich sie einfach bei einem Goldschmied oder Juwelier eintauschen, nahm ich mir vor. Gold war schließlich ein zeitloses Zahlungsmittel. Ich müsste mir dann aber eine plausibel klingende Geschichte einfallen lassen. Denn ich hatte natürlich keine Lust, als Dieb festgenommen und vielleicht sogar aufgehängt zu werden.
In der nächsten größeren Stadt, die ich zwei Tage später erreichte, suchte ich zuerst einen Laden auf in dem es neben allerlei Gebrauchsgegenständen auch Kleidungsstücke zu kaufen gab. Die Auswahl war nicht allzu groß, besonders für meine Größe. Ich entschied mich schließlich für formlose Beinlinge, die oben durch einen Strick zusammengehalten und an den Beinen mit Lederriemen umwickelt wurden. Dazu ein grob gewebtes Oberteil, eine Weste aus gegerbter Ziegenhaut und einen wollenen Umhang. Der grobe Stoff des Oberteils kratzte unangenehm auf meiner Haut und die Weste roch sehr streng. Aber ich behielt die Sachen gleich an, mit meinen verdreckten, kaputten Sachen fiel ich nur unangenehm auf.
Ich kaufte noch einen Jutesack und stopfte die alte Kleidung und den Umhang hinein, dazu einen großen Brotfladen und eine geräucherte Wurst. Zu meiner großen Erleichterung nahm der Ladenbesitzer meine Goldmünze an, nach einem kritischen Blick auf mich biss er nur kurz darauf, um sich von ihrer Echtheit zu überzeugen. Als Wechselgeld gab er mir einige Kupfer- und Silbermünzen zurück, die ich sorgsam in meinem Brustbeutel verstaute. Ich wollte sie mir später genau ansehen.
Draußen suchte ich mir einen schattigen Platz unter ein paar Bäumen um von dem Brot und der Wurst zu essen. Noch immer wusste ich nicht in welcher Zeit ich gelandet war. Und ich konnte nicht einfach vorübergehende Menschen fragen, welches Jahr wir denn schrieben, sie hätten mich für verrückt gehalten. Also musste ich es anderweitig herausfinden. Der Zufall kam mir zu Hilfe, als ich beschloss weiterzuziehen. Am Stadtrand errichteten ein paar Männer eine Kapelle. Zum Dank an die Mutter Gottes, dafür, dass die Pest die Stadt bislang verschont hatte und auch weiterhin verschonen werde, gaben sie mir auf meine Frage zur Antwort. In den Sandstein über der Türe war das Jahresdatum eingraviert, Anno 1632 stand da.
Ich war also hundertdreiundvierzig Jahre in der Zeit zurückgereist. Flüchtig fragte ich mich, was Erasmus wohl an diesem Zeitalter so interessant gefunden hatte. Es herrschte der dreißigjährige Krieg, das Leben in dieser Zeit war alles andere als einfach. Neben durchs Land ziehenden Truppen verletzter und von Siechtum und Hunger gezeichneter Soldaten stellten Hungersnöte und Krankheiten wie Pest und Blattern eine allgegenwärtige Gefahr für die Menschen dar. Auch Aschaffenburg war meines Wissens nicht davon verschont geblieben. Ja, wenn ich mich recht erinnerte, war am Ende dieses schrecklichen Krieges, das erst im Jahre 1645 sein würde, gerade mal noch ein Viertel der einstmals stolzen Einwohnerzahl von dreitausend Menschen am Leben gewesen. Doch bis dahin würden noch etliche Jahre ins Land gehen, ich hoffte inständig, dann längst wieder in meiner eigenen Zeit zu sein.
Nun, zumindest konnte ich mich jetzt auf die Gepflogenheiten und Bräuche dieser Zeit einstellen. Zumindest was das alltägliche Leben betraf, ging es damals ähnlich wie heute zu. Ich musste also nicht befürchten unangenehm aufzufallen. Vorsichtshalber, da ich nicht wusste in welcher Zeit ich landen würde, hatte ich mich vor meiner Reise aus Büchern gleich über die zurückliegenden fünf Jahrhunderte klug gemacht. Wahrscheinlich wusste ich darüber besser Bescheid als mancher Zeitgenosse.
Satt und angetan mit unauffälliger Kleidung machte ich mich daran, ein Pferd zu erstehen. Das war gar nicht so einfach, da die Heerführer die meisten Pferde für die Truppen beanspruchten und sie den Bauern oftmals einfach wegnahmen. Deswegen wurden die Tiere sorgsam vor den Augen der Soldaten versteckt. Nach langem Feilschen erstand ich von einem listigen Bauersmann schließlich einen robusten Rotfuchs mitsamt Sattel und Zaumzeug. Nun stand meiner endgültigen Rückkehr nach Aschaffenburg nichts mehr im Wege. Und ich wollte keine Zeit mehr verlieren.
Dennoch kam ich nicht allzu schnell voran. Das Wetter schlug plötzlich um, hatte ich soeben noch unter der spätsommerlichen Hitze gestöhnt, so fror ich nun im eiskalten, einsetzenden Regen. Die Straßen verwandelten sich innerhalb kürzester Zeit in schlammiges, unsicheres Gelände.
Es schien, als habe sich auf einmal alles gegen mich verschworen. Mein wollener Umhang wurde immer schwerer vom ständigen Regen, bald war ich bis auf die Haut durchnässt und bekam eine Erkältung. Wie, um das Maß voll zu machen glitt mein Pferd im Morast aus, verlor ein Eisen und lahmte. Ich führte es bis zur nächsten Ortschaft und tauschte es nach längerer Suche bei einem Schmied gegen einen hochbeinigen, nervösen Apfelschimmel ein. Kein guter Tausch, denn die Stute bockte jedes Mal, wenn sie erschrak und brach dann aus. Leider erschrak sie sehr oft, so dass ich mehrmals unsanft im Straßengraben landete.
Nach acht schlimmen Tagen stand ich endlich vor den Toren Aschaffenburgs. Ich litt unter leichtem Fieber, heftigem Schnupfen und einer beginnenden Bronchitis. Immerhin kannte ich mittlerweile die Tücken meines Pferdes und war in den letzten Tagen nicht mehr abgeworfen worden. Ja, ich hatte mich sogar mit der Stute ein wenig angefreundet. So beschloss ich sie doch nicht sofort zu verkaufen, wie ich es eigentlich vorgehabt hatte.
Das Aschaffenburg des Jahres 1632 sah auf den ersten Blick nicht viel anders aus als das Heutige. Doch an den folgenden Tagen fiel mir schnell auf, dass es viel schäbiger war. Nur das prächtige Schloss, erst fünfzehn Jahre zuvor fertiggestellt, strahlte Prunk aus. Die Straßen und Wegen befanden sich noch in wesentlich schlechterem Zustand, sie waren nicht gepflastert und bestanden meist nur aus sandigen, tief ausgefahrenen Wagenspuren. Es gab sehr viele ärmliche Häuschen und mit Stroh gedeckte Hütten zwischen den wenigen Steinbauten. Davor waren Gräben für die Abwässer ausgehoben, jetzt nach dem Dauerregen schwamm Unrat und auch hin und wieder der Kadaver eines Haustieres oder einer Ratte darin. Dementsprechend war der Geruch, der bei Windstille wie eine Glocke über der Stadt lag.
Ich wollte mich zuerst auf die Suche nach einer Unterkunft machen. Am liebsten wäre mir ein Zimmer oder eine Dachkammer im Hause einer Witwe gewesen, bei der ich auf unbestimmte Zeit wohnen konnte und wo ich mit regelmäßigen Mahlzeiten versorgt wurde. Aber das war nicht einfach, ich musste mich erst umhören.
Da der Abend rasch hereinbrach, beschloss ich eine Gaststube aufzusuchen um mir ein kräftiges Mahl und einen heißen Apfelwein zu gönnen. Vielleicht, so hoffte ich, konnte ich dort schon eine Adresse bekommen. Der Wirt nannte mir dann auch bereitwillig ein paar Namen von Frauen, die Zimmer vermieteten. Nach dem Essen wollte ich mich sofort auf die Suche machen.
Ein Satz des Gastwirtes ging mir nicht aus dem Kopf.
„Einen jungen Kerl wie dich nehmen die Vermieterinnen aber nicht so gerne“, hatte er gesagt.
„Junge Burschen essen zu viel und zahlen auch manchmal ihre Zeche nicht.“
Ich war betroffen. Mit meinen zweiunddreißig Jahren konnte man mich doch beim besten Willen keinen jungen Kerl mehr nennen. Ich war doch ein respektabler Mann. Warum nur nannten mich alle einen jungen Kerl?
Mein gravierender Gewichtsverlust nach meiner Passage in dieses Zeitalter fiel mir wieder ein und mir schwante langsam, was geschehen war. Indem ich in der Zeit zurückreiste, war ich jünger geworden. Aber wie jung? War ich überhaupt schon ein Mann oder nur ein halbwüchsiger Junge?
Leichte Panik überfiel mich bei dem Gedanken. Was, wenn ich plötzlich ein siebzehn- oder achtzehnjähriger Jüngling war? Wie sollte ich in diesem jugendlichen Alter den Hexer befreien können? Niemand würde mich überhaupt ernst nehmen. Und wie stand es mit all den Dingen, die ich mir im Laufe meines Lebens so mühsam angeeignet hatte? Mein Studium der Medizin, mein Hexenwissen, meine allgemeine Bildung. All dieses Wissen war sehr wertvoll für mein Vorhaben. Ich konnte unmöglich darauf verzichten.
Nur mit Mühe gelang es mir einen klaren Kopf zu behalten und nachzudenken. Ich zwang mich dazu mir Dinge ins Gedächtnis zu rufen, die ich erst im erwachsenen Alter gelernt oder erfahren hatte. Vor Erleichterung habe ich glaube ich, laut aufgestöhnt. Es war alles noch da. Zumindest der Inhalt meines Kopfes war nicht der Verjüngung zum Opfer gefallen. Ich konnte noch immer wie ein Erwachsener denken und handeln. Da spielte mein Äußeres eine eher untergeordnete Rolle. Aufatmend fuhr ich mir mit der Hand übers Gesicht. Mein Kinn zierte ein Bart, stellte ich dabei fest. In den vergangenen Tagen hatte ich mich nicht rasiert, da keine Möglichkeit dazu bestand. Als ich jetzt meinen Bart befühlte merkte ich, dass er eigentlich dichter hätte sein müssen. Doch jetzt bedeckten nur etwa die Hälfte meines üblichen Bartwuchses Kinn und Wangen. Das beseitigte meine letzten Zweifel - ich war wieder zu einem jungen Mann geworden. Bei der ersten sich ergebenden Möglichkeit musste ich mich unbedingt in einem Spiegel betrachten. Halb belustigt, halb besorgt, machte ich mich auf den Weg zur ersten der angegebenen Adresse. Es war mittlerweile vollkommen dunkel geworden. Noch immer fiel ein leichter Nieselregen, ich schlug fröstelnd den Kragen meines Umhanges hoch. Dann ging ich, die Stute am Zügel führend, durch die engen Gässchen. Vor mir tauchten die dunklen Umrisse der Muttergottes-Pfarrkirche auf. Ich musste gleich bei der ersten Adresse angekommen sein.
Die leichtfüßigen Schritte, die schnell auf mich zukamen, überhörte ich zuerst fast. Dafür hallten die kräftigen Tritte mehrerer genagelter Stiefel deutlich an mein Ohr. Da rannte auch schon eine schmale Gestalt in mich hinein. Ich konnte sie gerade noch auffangen, bevor sie stürzte. Für meine Stute war dieser plötzliche Aufstand zu viel. Sie wieherte schrill stieg auf die Hinterhand und schlug dann wild aus. Nur mit Mühe gelang mir sie zur Räson zu bringen, zudem behinderte mich die Gestalt in meinem Arm gewaltig. Dennoch versuchte ich instinktiv, sie zu schützen.
Die lauten Tritte verstummten abrupt und ich warf einen schnellen Blick zu den vier Jungen hin, die mich nun unschlüssig anstarrten. Einer deutete auf die Gestalt in meinem Arm und rief aufgebracht. „Lass sie los, sie ist eine Hexe. Sie wird dich verhexen mit ihrem bösen Blick.“ Dann bekreuzigte er sich schnell.
Ich warf einen ersten Blick auf das Mädchen, das noch immer in meinem Arm hing. Ich sah nur dunkles wirres Haar, sie ging mir kaum bis unters Kinn. Da hob sie den Kopf und warf mir einen gehetzten Blick zu. Doch außer Umrissen konnte ich von ihrem Gesicht nichts sehen. Die Nacht war finster, kein Stern erhellte den Himmel. Nur ein schwacher Lichtstrahl aus einem erleuchteten Fenster spiegelte sich für Sekunden in großen, dunklen Augen. Ich konnte die Angst darin deutlich erkennen.
Das genügte, um meinen Beschützerinstinkt zu wecken. Ich drehte mich ein wenig zur Seite, so dass das Mädchen nun durch meinen Körper vor den jungen Burschen geschützt war. Aber die waren nicht gewillt so bald aufzugeben. Einer bückte sich und hob einen Stein auf, warf ihn in unsere Richtung. Da er nur halbherzig gezielt hatte, verfehlte uns das Geschoss.
Aber durch diese Tat wurden die anderen mutiger. Sie bückten sich ebenfalls nach Steinen, von denen es mehr als genug gab. Schon der nächste Wurf traf meine Schulter. Mein dicker Umhang verhinderte jedoch, dass ich verletzt wurde. Dennoch stieß ich einen erschreckten Laut aus.
Das spornte die jungen Kerle anscheinend an und plötzlich hagelte es Steine. Sie trafen mich und mein Pferd. Das Mädchen blieb zum Glück verschont, da sie sich eng an meinen Körper presste.
Vergeblich versuchte ich, meine Stute zu besänftigen und gleichzeitig den Wurfgeschossen auszuweichen. Das Pferd tänzelte wie toll und versuchte sich loszureißen. Dabei wurde es von noch mehr Steinen getroffen, die eigentlich mir und dem Mädchen galten. Doch leider fanden auch einige Steine ihr Ziel, ich wurde an Kopf und Rücken getroffen. Gerade wollte ich entnervt die Zügel fahren lassen, da sah ich, wie sich neben der Kirche ein Tor öffnete. Ein Mann trat heraus, einen riesigen Prügel in der Hand, den er drohend schwang.
Sein Anblick besänftigte die Steinewerfer sofort, eilig flüchteten sie in eine dunkle Gasse. Ich starrte eine Zeitlang auf den Mann, dann wurde mir plötzlich schwarz vor Augen. Ich merkte nicht einmal, wie ich zu Boden fiel.
Mein Kopf schmerzte so heftig, dass ich mich nicht getraute die Augen zu öffnen. Das Rauschen in meinen Ohren übertönte jedes andere Geräusch und ebbte erst nach einer ganzen Weile allmählich ab. Als ich leise Stimmen wahrnahm, wagte ich endlich die Augen einen Spalt zu öffnen.
Das Flackern um mich herum erschreckte mich. Doch dann merkte ich, dass es nur die Kerzen waren, deren Flammen sich in der Zugluft bewegten. Sie warfen unruhige Schatten an die Wände. Ein männliches Gesicht beugte sich über mich, Schwarze Augen musterten mich besorgt.
„Wie fühlst du dich, mein Sohn?“ fragte eine freundliche Stimme.
„Ich weiß nicht so recht. Mein Kopf schmerzt recht heftig. Wie lange war ich denn ohnmächtig?“
„Ach, nicht sehr lange, ein paar Minuten nur. Aber du blutest heftig. Ein Stein hat dich böse am Haaransatz erwischt. Die Wunde klafft ziemlich auseinander. Ich weiß nicht, was ich tun soll um die Blutung zu stoppen. Sobald ich das Tuch wegnehme, rinnt das Blut herunter.“
„Am besten wäre es, die Wunde nähen. Dann hört die Blutung auf. Habt Ihr so etwas schon einmal gemacht?“
Ich sah seinem ratlosen Gesichtsausdruck an, dass das nicht der Fall war.
„Normalerweise bin ich nur für das Seelenheil meiner Schäfchen zuständig. Mit den körperlichen Gebrechen kenne ich mich nicht aus.“
Oh Gott, dachte ich. Ich war ausgerechnet im Haus eines Pfarrers gelandet. Na, immerhin hatte sich der Mann als mutig genug erwiesen, die jungen Burschen in ihre Schranken zu verweisen. Da konnte er unter meiner Anleitung vielleicht auch eine Wunde nähen. „Ich kenne mich damit aus, ich mach das“, ertönte eine leise, aber bestimmte Mädchenstimme. Erstaunt wandte ich den Kopf in ihre Richtung. Da saß das Mädchen, das ich beschützen wollte. Sie war es zweifellos. Obwohl ich in der Dunkelheit kaum etwas von ihrem Gesicht sehen konnte, verrieten sie ihre schwarzen Haare und Augen. Solche Augen gab es kein zweites Mal.
Ich glaube, ich habe sie mit offenem Mund angestarrt. Sie war noch sehr jung, höchstens sechzehn, schätzte ich. Obwohl ihr Haar noch immer wirr um ihr Gesicht hing und Schmutzflecke ihren Wangen bedeckten, war sie das schönste Mädchen, das ich je gesehen hatte. Sie kam mir wie eine dunkle Fee vor.
Die Worte der Burschen fielen mir wieder ein. „Sie ist eine Hexe“, hatten sie gerufen. Nun, das erschreckte mich nicht besonders. Schließlich wurde ich auch Hexer genannt. Ihr Angebot, meine Wunde zu nähen, verriet mir, dass sie sich zumindest in der Heilkunde auskannte. Vielleicht war sie ja tatsächlich eine Hexe.
„Wenn du meinst, das zu können, nur zu.“
Der Pfarrer atmete sichtlich auf. So, wie er es vermied die Wunde anzusehen, konnte er wahrscheinlich noch nicht einmal Blut sehen. „Ich hole nur schnell meine Utensilien.“
Leichtfüßig sprang das Mädchen auf und eilte durch die Türe. Ich starrte ihrer schlanken Gestalt hinterher.
„Kreszentia ist ein Schatz“, riss mich die Stimme des Pfarrers in die Wirklichkeit zurück. „Ich danke dir sehr, dass du sie vor diesen bösen Buben beschützt hast.“
Er seufzte bekümmert auf.
„Sie wurde in meine Obhut gegeben. Ihre Mutter sitzt im Kerker. Sie wird beschuldigt, eine Hexe zu sein. Nur mit Mühe konnte ich verhindern, dass Kreszentia ebenfalls inhaftiert wurde. Dazu musste ich ihr unter den Augen des Richters eine geweihte Hostie auf die Zunge legen und sie mit Weihwasser besprengen. Als nichts geschah, durfte ich sie mit in das Pfarrhaus nehmen. Hier muss sie solange bleiben, bis über ihre Mutter das Urteil gesprochen ist.“
Er seufzte erneut tief auf.
„Was danach mit ihr geschieht, weiß nur Gott alleine.“
Die Angst in seiner Stimme schockierte mich so sehr, dass ich meine Kopfschmerzen völlig vergaß.
„Was meint Ihr, wird mit ihr geschehen? Man wird sie doch nicht ebenfalls der Hexerei beschuldigen? Sie ist doch fast noch ein Kind.“
Aber er zuckte nur unglücklich die Schultern.
„In den heutigen Zeiten kann das niemand wissen. Sie hat...“
Er brach ab, weil sich die Türe öffnete und das Mädchen wieder ins Zimmer trat. Sie trug einen Beutel aus Hasenfell mit sich, den sie nun neben mich auf das Bett legte. Ohne mich anzusehen, kramte sie eine Weile darin herum und zog dann ein kleines Etui hervor. Darin lagen ein paar grobe Nadeln und dünne Fäden, gereinigte und getrocknete Katzendärme vermutete ich. Die gebräuchlichen Utensilien eines Heilers - oder auch einer Hexe.
Mit flinken Fingern walkte sie einen der steifen Fäden durch bis er geschmeidig war und fädelte ihn dann geschickt in das Nadelöhr. Beim Anblick der dicken, ungleichmäßig geformten Nadel wurde mir ein wenig mulmig zumute. Das war kein Vergleich zu den dünnen Nadeln, die ich allgemein benutzte. Aber die Wunde musste genäht werden, da führte kein Weg daran vorbei.
Eilig trat der Priester zur Seite, als Kreszentia den blutigen Lappen von meiner Stirn nahm. Ich fühlte, wie ein dünnes Rinnsal an meiner Backe herunterlief. Sie achtete nicht darauf, sondern begann sofort beherzt mit ihrer Arbeit. Wie ich befürchtet hatte, tat das Nähen mit diesen plumpen Nadeln ziemlich weh. Doch ich zwang mich stillzuliegen und keinen Laut von mir zu geben. Mein Körper verriet mich jedoch, indem er dicke Schweißperlen über mein Gesicht rinnen ließ.
Nach fünf Stichen war die Wunde geschlossen. Kreszentia tupfte sie noch einmal mit einer Kräutertinktur ab, dann betrachtete sie abschätzend ihr Werk. Wie es schien, war sie zufrieden damit. Zum ersten Mal lächelte mir das Mädchen zu.
„Das war‘s. Du hast es gut überstanden. Ich denke nicht, dass es Komplikationen gibt. Es war ein einfacher Riss.“
Ich danke dir“, sagte ich ehrlich. „Das hast du gut gemacht.“
Fast ein wenig schnippisch gab sie zur Antwort:
„Es war keine besondere Sache. Außerdem muss ich dir danken. Du hast mich vor den üblen Scherzen der Knaben errettet. Sonst wäre ich es vielleicht, die nun hier läge.“
Ihre Stimme gefiel mir, sie klang zwar leise aber sehr melodisch und passte gut zu ihr. Überhaupt gefiel mir alles an ihr, ich war auf dem besten Wege mich Hals über Kopf in das Mädchen zu verlieben.
Der Gedanke gefiel mir keinesfalls. Sie war fast noch ein Kind, bisher hatte ich kaum einen Gedanken an so junge Mädchen verschwendet, ich zog reifere Frauen vor. Außerdem hatte ich eine Aufgabe zu bewältigen, die den Einsatz meiner ganzen körperlichen und geistigen Fähigkeiten verlangte.
„Wo musst du denn hin, mein Sohn?“ unterbrach der Pfarrer meine Gedanken. „Ist es weit bis zu deinem Zuhause?“
Seine Frage erinnerte mich an mein eigentliches Vorhaben. Ich musste mir ja noch ein Zimmer suchen. Und was war eigentlich mit meinem Pferd?
Während ich mich aufsetzte und meine Hände an meinen brummenden Schädel presste um das Karussell darin zum Stillstand zu bringen, gab ich eine kurze Erklärung ab.
„Meine Stute“, fragte ich dann, „ist sie fortgelaufen?“
Doch der Priester beruhigte mich. Sie sei im Stall, ich hätte während meiner kurzen Ohnmacht die Zügel eisern in der Hand behalten. Hoffnungsvoll schaute er mich an.
„Aber wenn du eine Bleibe suchst, dann kannst du auch hier eine Kammer bekommen. Es gibt zu wenige Männer in diesem Pfarrhaushalt. Meine Knechte, ja sogar die Messdiener und der Küster, sind in diesen unseligen Krieg gezogen. In diesen schlimmen Zeiten bin ich der einzige Mann, der die Schätze der Kirche verteidigen kann. Ich wäre dir also dankbar, wenn du dich entschließen könntest hierzubleiben. Ich verlange kein Geld, im Gegenteil, du bekommst sogar noch regelmäßige Mahlzeiten. Das Einzige, was ich dafür verlange, ist deine Hilfe falls wir überfallen werden. Du bist jung und kräftig, genau so jemanden brauchen wir hier.“
Ich überlegte kurz. Das klang annehmbar. Meiner Meinung nach war die Gefahr, hier überfallen zu werden, nicht besonders groß. Eine Kirche wurde normalerweise selbst von hartgesottenen Rabauken verschont. Und soweit ich mich an die Geschichte Aschaffenburgs zurückerinnerte, war auch keine Kirche geplündert oder abgebrannt worden. Außer dem Beginenkloster, doch das war schon fast hundert Jahre zuvor passiert.
Also sagte ich zu. Nicht zuletzt wegen Kreszentia.
Der Pfarrer war erleichtert. Schnell rief er seinen ganzen Hausstand zusammen um mich vorzustellen. Dem Pfarrhaushalt gehörten fünf Frauen und ein uralter Mann an. Kreszentia kannte ich schon. Daneben gab es noch die Haushälterin, Augusta Pohl. Sie war eine unverheiratete Cousine des Pfarrers, der sich mit Andreas Pohl vorstellte. Beide waren sie etwa gleich alt, so um die Vierzig.
Die drei Dienstmägde hießen Ella, Pauline und Walburga. Der alte Mann war Hans. Eigentlich sollte er im Pfarrhaus seinen Lebensabend verbringen, er hatte schon dem Vorgänger Pfarrer Pohls lange gedient. Doch er machte sich noch immer im Stall nützlich und sorgte auch für das tägliche Feuerholz.
Ich hatte also eine Bleibe gefunden. Von hier aus konnte ich in Ruhe mit meinen Nachforschungen nach Erasmus dem Hexer beginnen.
Kapitel 2: Zuflucht im Pfarrhaus
Natürlich konnte ich dem Pfarrer nicht die ganze Wahrheit über meine Suche nach Erasmus erzählen. Schon gar nicht, dass er ein Hexer war. Die Kirche hatte - besonders in früheren Zeiten - im Allgemeinen wenig Verständnis für Hexerei. Zwar schien dieser Pfarrer anders zu denken, immerhin hatte er ja die Tochter einer inhaftierten Hexe aufgenommen. Trotzdem wollte ich auf keinen Fall unliebsames Aufsehen erregen. Und schon gar nicht riskieren, dass er mich wieder fortschickte. So erzählte ich nur, dass ich hier mit meinem väterlichen Freund und Arbeitgeber verabredet wäre. Doch ich blieb in meiner Geschichte so dicht an den tatsächlichen Begebenheiten, wie es eben ging. Denn ich wusste, dass man sich bei komplizierten Lügengeschichten leicht in seinen Aussagen verhedderte.
Deshalb berichtete ich, ich wäre durch widrige Umstände von meinem Mentor, dem Arzt Adam Baumann getrennt worden und hoffe, ich würde ihn hier in Aschaffenburg endlich wiederfinden.
Selbst getraute ich mich nicht, mich als Arzt auszugeben. Wenn sich mein Äußeres wirklich so stark verjüngt hatte, wie ich befürchtete, würde mir das niemand abnehmen. Es nützte weder mir noch Erasmus, sollte ich als Scharlatan im Gefängnis landen. Da gab ich mich lieber als Gehilfe aus.
Anscheinend genügte dem Pfarrer meine dürftige Erklärung. Er bat mich, ihn doch Bruder Andreas zu nennen, wie es alle seine Schäfchen taten. Ich hatte ihn mit Hochwürden angesprochen, was ihm sichtlich missfiel.
„Ich stamme ursprünglich aus dem Kapuziner-Kloster, das sich der gottgefälligen Bescheidenheit und Demut verschrieben hat“; erklärte er mir. „Und ich vertrete den eigentlichen Geistlichen nur. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass er jemals wieder selbst seine Aufgaben als Pfarrers ausführen kann. Er leidet unter einer seltsamen Krankheit, die ihn seit zwei Jahren ans Bett fesselt.“ Er bat Ella mir meine Kammer zu zeigen.
Doch wieder bot Kreszentia an.
„Ich werde sie ihm zeigen. Und ihm gleich erklären, wie er die Kräutertinktur weiterhin anwenden soll.“
Das wusste ich zwar selbst, sagte es aber nicht. Die Aussicht mit ihr alleine zu sein, und sei es auch nur für ein paar Minuten, gefiel mir. Hinter ihr stieg ich die engen hölzernen Stiegen hinauf, die zu meiner Kammer im Dachgeschoß führten. Dabei konnte ich ungeniert ihre schlanke Figur und ihren federleichten Gang beobachten. Sie trug noch das Kleid, in dem ich sie auf der Straße angetroffen hatte. Am Saum hafteten getrocknete Schlammspritzer, außerdem war er an einer Stelle heruntergerissen. Vermutlich war das bei ihrer Flucht vor den jungen Burschen passiert.
Sie öffnete eine niedere Türe und ließ mich eintreten. Um mir nicht den Kopf zu stoßen, musste ich mich bücken. Die dahinter liegende Kammer war sehr klein. Es gab ein einfaches Bett und eine Truhe darin und unter dem winzigen Dachfenster stand ein schmaler Tisch mit einem Stuhl davor.
„Hier in der Schublade liegen Kerzen. Am besten ist es, du bringst dir immer einen brennenden Kerzenstummel von unten mit herauf, damit du Licht hast. Stell die Kerzen nur auf die eisernen Untersetzer und lasse sie nicht unbeaufsichtigt brennen. Das Holz des Dachstuhles ist alt, es würde sofort Feuer fangen.“
Ich nickte zu Kreszentias ernsten Ermahnungen. Dann ging ich zur Truhe, öffnete sie und legte mein Bündel hinein. Hans hatte es mir erst kurz zuvor in die Hand gedrückt.
„Die Stute hat ein paar Kratzer abbekommen“, hatte er mir dabei zu gemurmelt. „Aber nichts Ernstes, ich habe sie schon versorgt. Jetzt kaut sie zufrieden ihr Heu.“
Kreszentia musterte zuerst mich, dann das Bett kritisch. Mit leichtem Kopfschütteln meinte sie zweifelnd.
„Ich glaube nicht, dass du hier gut schlafen wirst. Das Bett ist viel zu klein für dich. Du musst dich zusammenrollen wie ein Hund damit deine Beine nicht unten raushängen. Ich werde nochmals mit Bruder Andreas reden. Er soll dir das Zimmer neben meinem geben. Dort steht ein richtig großes Bett.“
„Ach, mach dir doch keine Umstände, es wird schon gehen.“
Ich hatte zwar ebenfalls Zweifel wegen der Bettlänge, wollte aber keine Forderungen stellen. Doch Kreszentia ließ sich nicht beirren. „Nein, guter Schlaf ist wichtig. Und wenn du länger hierin schläfst, wirst du ganz sicher Kreuzschmerzen bekommen.“
Sie war nicht aufzuhalten und sprang leichtfüßig die Treppe hinunter. Ich legte mich einmal der Probe halber auf das Bett. Es war wirklich sehr kurz und zudem war die Matratze ziemlich durchgelegen. Nein, hier würde ich wirklich kaum Schlaf finden.
Es dauerte etwas länger, dann kam Kreszentia zurück. Sie wirkte ein wenig erhitzt, schaute mich aber zufrieden an.
„Du kannst das untere Zimmer haben. Bruder Andreas war zuerst dagegen. Aber ich habe ihn überzeugt. Nimm dein Bündel und komm mit.“
Ohne sich noch einmal umzudrehen eilte sie erneut die Treppen hinab. Ich folgte ihr schnell und betrat ein anderes Zimmer, dessen Türe sie mir offenhielt. Ich blieb beeindruckt unter dem Rahmen stehen. Eine sehr gemütlich eingerichtete Stube breitete sich vor mir aus. Dunkel gebeizte Möbel, angefangen vom prächtigen Himmelbett bis hin zum wuchtigen Schreibtisch standen darin. An den zwei Fenstern hingen schwere Vorhänge.
„Wem gehört dieses Zimmer?“ fragte ich neugierig. Es war ganz bestimmt nicht für Bedienstete bestimmt. Kreszentia sah mich einen Moment undurchdringlich an, dann zuckte sie die Schultern und meinte leichthin.
„Es gehörte einmal meinem Vater. Aber er ist schon seit zwei Jahren tot. Du kannst es ruhig haben.“
Täuschte ich mich, oder hörte ich aus ihrer Stimme sowohl Zorn, als auch Trauer heraus? Aber ihr Blick sagte mir, sie wollte keinesfalls darüber reden. Dennoch wagte ich eine weitere Frage zu stellen. „Dein Vater? Ich dachte, das sei ein Pfarrhaus. Ich denke doch nicht, dein Vater ist ein Pfarrer?“
Das war zwar nicht ganz abwegig, viele Pfarrer konnten der Fleischeslust nicht widerstehen. Aber die wenigsten standen zu der Frucht ihrer Leidenschaft. Kreszentia lächelte kühl, sie wusste genau, woran ich dachte. Ihre Worte klangen abweisend.
„Nicht was du denkst. Mein Vater war der Bruder des früheren Pfarrers. Immer wenn er Streit mit meiner Mutter hatte, kam er hierher. Vermutlich war das oft der Fall, ich sah ihn nur sehr selten zu Hause.“
Sie presste die Lippen zusammen, so als hätte sie schon zu viel gesagt. Ich wollte nicht mehr weiter in sie dringen, obwohl ich immer neugieriger wurde. Deshalb lenkte ich ein.
„Und du willst, dass ich hier wohne? Das ist sehr großzügig von dir. Ich nehme das Zimmer sehr gerne.“
„In der Kommode befinden sich noch allerlei Dinge, die ein Mann anscheinend braucht. Du kannst sie benutzen.“
Sie stellte das Fläschchen mit der Tinktur auf den Tisch.
„Hier. Du wirst du es sicher alleine schaffen, die Wunde mehrmals täglich damit zu betupfen.“
Sie wollte sich zum Gehen wenden, doch ich hielt sie zurück.
„Du hast das sehr gut gemacht“, ich berührte vorsichtig die Nähte an meiner Stirn. „Wo hast du das gelernt?“
„Ich bin die Tochter einer Hexe, hast du das vergessen? Entgegen der Meinung des Schultheißen, der sie verhaften ließ, ist meine Mutter eine gute Hexe. Sie hat den Menschen stets geholfen. Und sie hat mir ihr Wissen mitgeteilt. Aber du solltest dich ausruhen. Mit Kopfwunden ist nicht zu spaßen. Gute Nacht.“
Ehe ich noch ein Wort sagen konnte, war sie verschwunden. Ich starrte auf die Türe, die hinter ihr ins Schloss fiel. Dann seufzte ich leise auf. Es war sehr viel Wut und Verbitterung in diesem schönen Mädchen. Aber ich konnte sie verstehen. Sicher hatte sie viel durchgemacht und wie die heutige Attacke bewies, war es noch nicht zu Ende. Nun, vielleicht gelang es mir ja ihr Vertrauen zu gewinnen. Ich fühlte mich aus irgendeinem Grund sehr zu ihr hingezogen und wollte ihr gerne helfen.
Die Geräusche im Haus erstarben nach und nach, anscheinend ging man hier früh zu Bett. Auch ich war müde, mein Kopf schmerzte noch immer und das Bett machte einen einladenden Eindruck. Doch bevor ich mich zur Ruhe legte, wollte ich mich noch säubern. Der Reisestaub klebte noch an mir und mein Bart juckte mich.
Kreszentias Worte fielen mir ein. Ich zog die Schubladen der Kommode auf und spähte neugierig hinein. Tatsächlich lagen allerlei Dinge darin, die einem Mann das Leben erleichterten. Auch eine Rasierschale, ein Pinsel und ein Messer waren dabei. Wasser stand in einem Krug bereit, es war sogar noch warm. Daneben stand eine Waschschüssel. Schwamm und Handtuch gab es ebenfalls.
Schnell entkleidete ich mich und wusch mich von Kopf bis Fuß. Ein wenig Wasser hatte ich mir zum Rasieren aufgespart. Nun nahm ich die dazu notwendigen Utensilien aus der Kommode und drehte mich zum Spiegel um.
Bisher hatte ich nur einen flüchtigen Blick auf mein Spiegelbild geworfen, nun ging ich näher heran. Der junge, bärtige Mann, der mir entgegensah war mir vertraut und fremd zugleich. Vor allem der ungepflegte Bart ließ mich mir fremd aussehen, bislang hatte ich mich stets glattrasiert.
Also begann ich emsig, Schaum zu schlagen und meinen Bart einzuseifen. Das Messer war vom langen Nichtgebrauch stumpf geworden, ich schärfte es an dem Riemen, der an einem Pfosten hing. Danach machte ich mich sorgfältig ans Werk.
Nach kurzer Zeit starrte mir mein verjüngtes Ich entgegen. Es mutete mir seltsam an, den etwa zwanzig oder zweiundzwanzigjährigen Mann als mich selbst zu akzeptieren. Ich war tatsächlich um gut zehn Jahre jünger geworden. Wenn ich noch weiter in der Zeit zurückgereist wäre, grübelte ich, wäre dann aus mir vielleicht ein Kind oder sogar ein Säugling geworden? Ein schrecklicher Gedanke. Insgeheim dankte ich Erasmus, dass er nur ins siebzehnte Jahrhundert gereist war.
Erasmus war bestimmt auch jünger geworden. Aber um wieviel Jahre? Wurde man prozentual zu seinem wahren Alter jünger oder richtete sich der Verjüngungsprozess nach den Jahren, die man zurückreiste? Ich hatte keine Ahnung. Auf jeden Fall musste ich, sollte ich Adam Baumann jemandem beschreiben, wahrscheinlich mindestens fünfzehn bis zwanzig Jahre von seinem normalen Alter abziehen. Dann wäre er jetzt vielleicht zwischen vierzig und fünfzig. Als Vierzigjährigen hatte ich ihn allerdings noch gar nicht gekannt, ich konnte nur rätseln, wie er damals ausgesehen hatte. Die Bewältigung meines ohnehin schon komplizierten Vorhabens wurde immer schwieriger.
Nachdem ich noch einen kritischen Blick auf meine Stirnwunde geworfen hatte, ging ich endlich zu Bett. Die Wunde blutete nicht mehr, pochte aber noch leicht. Auch meine Kopfschmerzen ließen nicht nach. Eine leichte Gehirnerschütterung, vermutete ich. Da war Ruhe und ausreichender Schlaf tatsächlich das Beste. Wenn ich Glück hatte, war morgen früh das Schlimmste überstanden.
Erasmus schickte mir auch in dieser Nacht keinen Traum. Oder ich konnte mich einfach nicht mehr daran erinnern.
Am Morgen ging es mir schon viel besser. Die Kopfschmerzen waren, bis auf ein leichtes Stechen, wenn ich mich schnell bewegte, zurückgegangen. Die Wunde sah sauber aus, die Wundränder waren getrocknet. Ich beschloss, die Tinktur nicht mehr anzuwenden und ging ins Erdgeschoß hinunter. Der Duft eines kräftigen Frühstücks lockte mich, mir lief das Wasser im Mund zusammen und mein Magen knurrte vernehmlich.
Frau Pohl, die Haushälterin schaute mir entgegen. Sie musterte mich zuerst verwundert, dann grinste sie freundlich.
„Ich hätte dich ohne das Gestrüpp im Gesicht fast nicht erkannt. Aber so gefällst du mir viel besser. Wie geht es dir, hast du noch Kopfweh? Setz dich an den Tisch, ich bringe dir gleich dein Frühstück. Die anderen sind schon bei der Arbeit.“
Es schmeckte mir ausgezeichnet und ich langte kräftig zu. Frau Pohl setzte sich mir derweil ich aß gegenüber um mit mir zu schwatzen. Sie fragte mich ein wenig aus und ich gab ihr einsilbige Antworten. Um nachdenken zu können, was ich ihr unbesorgt verraten konnte, steckte ich mir große Brocken in den Mund und kaute lange darauf herum.
„Was wirst du heute tun?“ fragte sie schließlich.
Wahrheitsgemäß antwortete ich, ich wolle ein wenig in der Stadt herumstreifen um nach Adam Baumanns Verbleib zu forschen.
Vielleicht kannte ihn ja jemand.
„Ach“, jammerte sie, „in diesen schlimmen Zeiten verschwinden sehr viele Menschen spurlos. Dieser endlose Krieg fordert immer neue Opfer. Ständig fallen ausländische Truppen über uns her, plündern und morden. Selbst vor unseren eigenen Leuten ist man nicht mehr sicher. Immer wieder werden die Bürger zur Kasse gebeten, müssen den Soldaten kostenlos Essen und sonstige Gebrauchsgegenstände zur Verfügung stellen. Wer sich weigert kommt in den Kerker oder wird gleich ermordet.“
Ich sagte nichts zu ihrem Gejammer. Dabei hätte ich sie aufklären können, dass es den Bürgern der Stadt noch immer einigermaßen gut ging. In nur wenigen Jahren sollte das ganz anders aussehen. Den plündernden Truppen folgten Zerstörung, Krankheit und Elend auf dem Fuße. Und zu Ende des dreißigjährigen Krieges würde nur noch ein Häufchen der Aschaffenburger Bürger am Leben sein.
Als ich so ihr bekümmertes Gesicht betrachtete, zerfaserte es plötzlich vor meinen Augen. Die Umgebung löste sich auf und veränderte sich in erschreckender Weise. Ich sah den hingestreckten, blutüberströmten Körper der Frau inmitten zerbrochener, verkohlter Möbelstücke liegen. Genauso schnell wie die Vision erschienen war, verschwand sie wieder. Frau Pohl schaute mich bestürzt an, denn ich hatte mich wie in Schmerzen zusammengekrümmt und die Hände vors Gesicht geschlagen. Es bereitete mir große Mühe, in die Wirklichkeit zurückzufinden.
„Entschuldigung“, keuchte ich erstickt. „Ein plötzlicher scharfer Schmerz in meinem Kopf. Ich bin wohl doch noch nicht ganz gesund. Nein, nein, keine Sorge, es ist schon wieder vorbei.“
Es war schon lange her, seit mich das letzte Mal eine so klare Vision heimgesucht hatte. Und natürlich konnte ich der Haushälterin nicht sagen, dass ich soeben ihren Tod vorausgesehen hatte. Sie würde eines der vielen Opfer dieses Krieges werden. Grausam geschändet und ermordet.
Kurz überlegte ich, ob ich sie warnen sollte, ließ es aber sein. Ich wusste ich nicht, zu welchem Zeitpunkt es geschehen würde und wollte sie nicht ängstigen. Andererseits war ich schon in meiner eigenen Zeit genug Anfeindungen durch die Bekanntgabe meiner Visionen ausgesetzt gewesen. In diesem Jahrhundert, wo es noch Hexenprozesse, Folter und Scheiterhaufen gab, würde ich deswegen vielleicht am Galgen oder im Feuer enden. Das wollte ich auf gar keinen Fall riskieren. Ich war nicht durch die Zeit gereist, um hier zu sterben. Ich stand auf, griff mir in der Diele meinen Umhang und verließ überstürzt das Haus. Frau Pohl folgte mir zur Türe und schaute mir kopfschüttelnd hinterher. Ich konnte fast ihren verwunderten Blick in meinem Rücken fühlen.
Nur langsam klärten sich meine Gedanken wieder. Ich versuchte, mich auf mein eigentliches Problem zu konzentrieren und ging langsam durch die Straßen und engen Gassen. Immer wieder verharrte ich und horchte in mich hinein. Vielleicht, so hoffte ich, würde Erasmus meine Anwesenheit spüren und sich bemerkbar machen. Ich wusste, er beherrschte die Gabe der Telepathie. Und er hatte schon durch die Träume, die er mir schickte bewiesen, dass er mit mir Kontakt aufnehmen konnte.
Mir selbst ist ja die Gabe der Telepathie und des Gedankenlesens ebenfalls geschenkt, doch lange nicht in solchen Ausmaßen wie ihm. Es strengt mich meist an in die Gedanken der Menschen zu dringen. Deshalb tue ich es nur in besonderen Fällen. Auch an diesem Tag verzichtete ich ganz darauf, ich begnügte mich damit meinen Geist offenzuhalten. Doch so sehr ich mich auch konzentrierte, ich spürte Erasmus nicht. Müde vom Umherstreifen lehnte ich mich an den Stamm einer Buche. Wohin sollte ich meinen Schritt nun wenden? Ich rief mir nochmals die Traumbilder in Erinnerung. Darin waren Erasmus‘ Hände stets mit Stricken gefesselt. Das musste nicht unbedingt tatsächlich so sein, es konnte durchaus sinnbildlich auf seine Lage hinweisen. Davon war ich bislang ausgegangen, dass er sich in einer ausweglosen Situation befand, ihm sozusagen die Hände gebunden waren. Jetzt überlegte ich ob er vielleicht wirklich irgendwo mit gebundenen Händen gefangen gehalten wurde. Es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Er saß im Gefängnis, anders konnte es gar nicht sein. Warum war ich nicht sofort darauf gekommen? Kreszentias Mutter fiel mir ein. Sie saß ebenfalls im Kerker, der Hexerei angeklagt. Was, wenn Erasmus auch der Hexerei beschuldigt wurde? Er war ja tatsächlich ein Hexer, bewandert in den weißen aber auch den schwarzen Hexenkünsten. Mein Herz wurde schwer. Wenn es stimmte, was ich vermutete, wie sollte ich ihm da helfen können? Ich würde nicht einmal in seine Nähe kommen. Nicht geständige Hexen wurden sorgfältig von der Außenwelt abgeschirmt.
Und wer konnte schon wissen, ob er nicht gar schon gefoltert worden war um ihm ein Geständnis abzuringen. Ich hatte in mehreren Büchern über die Hexenverfolgungen gelesen. Man war nicht zimperlich mit den Verdächtigen umgesprungen. Unter der Folter wurden viele zum Krüppel. Für die meisten bedeutete der Tod auf dem Scheiterhaufen eine Erlösung von ihren schweren Verletzungen.
Trotz meiner Ängste machte ich mich unverzüglich zu den Gefängnissen auf. Es gab derer gleich zwei, den Hexenturm und den Cent- oder Folterturm. Dem Hexenturm war ich näher, also ging ich zuerst dorthin. Und dort schlug sie mir plötzlich entgegen, die Aura meines väterlichen Freundes. Mir wurde mulmig zumute. Warum musste er ausgerechnet hier gefangen gehalten werden...?“
Adrian hielt zum ersten Mal in seiner Geschichte inne und blickte düster zu Simon hin. Der erwiderte den Blick betroffen. Er konnte sich denken, wie dem Freund zumute gewesen sein musste. Denn vor nicht allzu langer Zeit hatte Adrian selbst im Hexenturm gesessen. Und er war ebenfalls der Hexerei und des Mordes beschuldigt worden. Zwar war die Folter inzwischen abgeschafft worden und Adrian musste zumindest nicht befürchten, zum Krüppel gemacht zu werden. Doch ihm hatte der Tod durch den Strang gedroht. Und die wochenlange, zermürbende Gefangenschaft in der engen Zelle hatte ihn fast in den Wahnsinn getrieben.
Damals hatte Simon nichts unversucht gelassen, den Hexer zu entlasten, doch es schien alles vergebens. Die Lügen und Intrigen seiner Feinde hatten den Strick um Adrians Hals immer fester zusammengezogen.
Erst im allerletzten Moment konnte durch das Auftauchen seines Vaters, des Herzogs zu Wolffhardt, eine vorläufige Einstellung und ein späteres erneutes Aufrollen des Falles erzwungen werden. Der Hexer wurde freigesprochen.
„Ausgerechnet der Hexenturm“, sagte Simon mitfühlend.
„Das brachte dir sicher deine ganzen unguten Erinnerungen wieder ins Bewusstsein.“
„Ja, das tat es allerdings“, bekannte Adrian. „Aber es hinderte mich nicht daran, das Gefängnis zu betreten.“
Simon schaute ihn ungläubig an.
„Du bist da hineingegangen? Aber was wolltest du dort? Etwa Erasmus besuchen? Du sagtest doch, zu den als Hexen verdächtigten Personen wurde niemandem Zutritt gewährt.“
Jetzt lächelte Adrian leicht.
„Niemand, außer dem Kerkerpersonal und den Folterknechten. Also fasste ich kurzerhand einen aberwitzigen Plan...“
Bevor ich zum Gefängnis ging, blieb ich erst einmal in der nahen Pforte eines Hauses stehen. Ich musste nachdenken, wie ich weiter vorgehen wollte und sicher, so dachte ich bei mir, schadet es nicht das Gefängnistor eine Weile im Auge zu behalten. Ich muss zugeben, eine unbestimmte Angst hielt mein Herz gefangen. Wie du schon sagtest, stürmte die Erinnerung an meinen Aufenthalt im Hexenturm auf mich ein. Es war eine schlimme Zeit in der düsteren, muffigen Zelle gewesen. Und im Jahre 1636 war es bestimmt noch viel schlimmer, dort gefangen zu sein.
Ich beobachtete also das Treiben vor dem Gefängnistor und sperrte Augen und Ohren auf. Es herrschte ein reges Kommen und Gehen, kaum zu glauben, wie viele ehrbare Bürger mit dem Gefängnis zu tun hatten. Da wurden Kisten- und Säckeweise Lebensmittel gebracht. Handwerker und Händler gingen ein und aus. Ordnungshüter brachten Gefangene und einige hochgestellte Persönlichkeiten, vermutlich Richter oder Advokaten, sowie der eine oder andere Geistliche gaben sich die Klinke in die Hand.
Ein vergitterter Gefängniswagen brachte mehrere Gefangene aus den umliegenden Ortschaften herbei. Da Aschaffenburg die bedeutendste Stadt im Umkreis war, spielte sich auch die gesamte Gerichtsbarkeit hier ab. In solch einem Gefängnis, dachte ich, wird doch bestimmt noch eine helfende Hand gebraucht. Ich ging also entschlossen auf die Pforte zu und fragte einfach nach Arbeit.
Der Pförtner betrachtete mich von oben bis unten. Scheinbar taxierte er, was ich wohl zu leisten imstande wäre. Dann zuckte er die Schulter und schickte mich zum Zimmer des Schultheißen weiter. Dort, so sagte er mir, würde ich erfahren, ob Leute gebraucht wurden. Der Schultheiß, der oberste Polizist der Stadt, war nicht da. Aber sein Stellvertreter durfte ebenfalls über die Einstellung von Personal entscheiden.
Er schaute mich prüfend von oben bis unten an. Dann fragte er: „Welchen Posten hast du dir denn vorgestellt? Für die leichteren Aufgaben habe ich genug Leute. Was ich brauche sind kräftige Wärter. Aber wenn ich dich so anschaue, kommst du mir nicht besonders stark vor. Nein, ich glaube, ich kann dich nicht gebrauchen.“ Wärter war genau der Posten, den ich haben wollte. Auch wenn ich tatsächlich nicht die idealen körperlichen Voraussetzungen dazu besaß. Dennoch, ich wollte die Stelle haben. Unauffällig ging ich näher an den Mann heran und als er zu mir aufblickte, hielt ich seinen Blick gefangen. Ich konnte nur hoffen, dass ich mein hypnotisches Talent nicht während der Zeitreise eingebüßt hatte. Ausprobiert hatte ich es jedenfalls noch nicht. Als der Mann jetzt nicht mehr fähig war, den Blick von meinen Augen abzuwenden, wusste ich, dass ich die Gabe noch besaß. Erleichtert konzentrierte ich mich auf mein Gegenüber.
Kurze Zeit später hielt ich eine amtliche Beglaubigung in Händen, die mir fortan den Zutritt zu allen Zellen gewähren würde. Ich hatte kurzerhand beschlossen, mich anstatt zum Wärter, zum Gehilfen des Kerkermeisters machen zu lassen. Als solcher war es unter anderem meine Aufgabe, den Folterungen beizuwohnen und dafür zu sorgen, dass die Delinquenten nicht zu schnell bewusstlos wurden oder gar unter der Folter starben.
Ich wusste natürlich, welch eine enorme seelische Belastung ich mir da aufhalste. Ich war mir noch nicht einmal sicher, ob ich es überhaupt aushalten konnte, bei diesen sinnlosen Quälereien zuzusehen.
Mich einzumischen würde mir nur indirekt erlaubt sein, etwa, um einen Ohnmächtigen ins Bewusstsein zurückzuholen. Ansonsten wäre ich nur stummer Beobachter.
Trotz dieser wenig erbaulichen Aussichten, war ich überzeugt, als Foltergehilfe am meisten zu erreichen. Wenn sich Erasmus unter den Unglücklichen befand, die durch Folter zu einem Geständnis gebracht werden sollten, so kam ich wenigstens an ihn heran. Außerdem war ich fest entschlossen, das schreckliche Los der Gefangenen so gut ich konnte zu erleichtern. Das musste natürlich unauffällig und in aller Heimlichkeit geschehen. Doch in meinem Kopf reifte schon ein Plan.