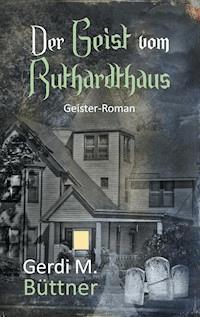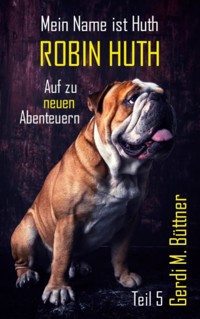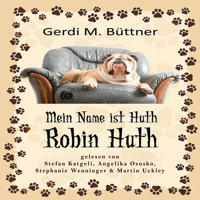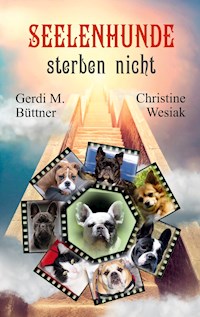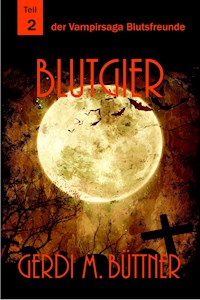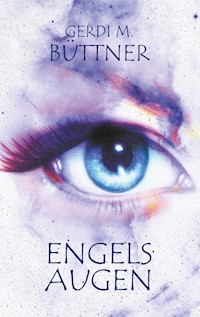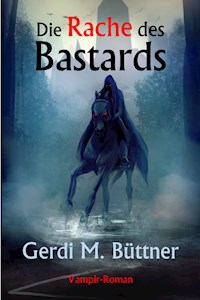
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Der Fürstensohn Malamir Dimitroff verliebt sich in die junge Schönheit Riana. Während der einjährigen Verlobungszeit soll sich Malamir den Haiduken anschließen, um sich im Kampf gegen die osmanischen Besatzer zu bewähren. Boril, sein Halbbruder, ist ebenfalls von Riana betört, es kommt deshalb zu einem heftigen Streit. Boril schwört Malamir Rache und verlässt wutentbrannt das Elternhaus. Auf dem Kriegsfeld treffen die feindlichen Brüder wieder aufeinander und Malamir gerät in Borils Gewalt. Vom Bruder versklavt soll Malamir am Tag der Hochzeit von Riana und Boril sterben. Einzig Malamirs geheimnisvoller Freund Dimitri kann ihn noch retten. Denn Dimitri ist ein Vampir...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 529
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Die Rache des Bastards
Kapitel 01: Gemeinsame Kindheit
Kapitel 02: Riana
Kapitel 03: Der Bastard
Kapitel 04: Borils Rache
Kapitel 05: Der Vampir
Kapitel 06: Bekenntnisse
Kapitel 07: Gespräch mit dem Vampir
Kapitel 08: Dimitris Geschichte
Kapitel 09: Viele Fragen
Kapitel 10: Ankunft bei den Haiduken
Kapitel 11: Der erste Kampf
Kapitel 12: Kampf für die Freiheit
Kapitel 13: Flucht von der Truppe
Kapitel 14: In Gefangenschaft
Kapitel 15: Versklavt
Kapitel 16: Hoffnungslose Lage
Kapitel 17: Folgenschwere Entscheidung
Kapitel 18: Rianas Ankunft
Kapitel 19: Die Bestrafung
Kapitel 20: Rianas Versprechen
Kapitel 21: Gefährliche Leidenschaft
Kapitel 22: Der Verräter
Kapitel 23: Zwischen Leben und Tod
Kapitel 24: Tod und Leben
Kapitel 25: Ein neues Leben
Kapitel 26: Heimkehr
Impressum
Die Rache des Bastards
Kapitel 01: Gemeinsame Kindheit
Ich bin Malamir und ich will euch eine Geschichte erzählen. Fürwahr eine ungewöhnliche, ja unglaubliche Geschichte. Aber ich schwöre, jedes Wort daran ist wahr, denn ich habe sie selbst erlebt...
Ich sitze hier in der dunklen Stube, einen frisch angespitzten Federkiel in der Hand, vor mir auf dem Tisch ein Bogen Papier. Das geöffnete Tintenfass harrt der Feder. Um mich herum ist es still, einzig meine eigenen Atemzüge dringen in mein Bewusstsein. Nachdenklich streicht die Feder mein Kinn, leicht wie der Flügel eines Falters. Der Schein einer einzigen Kerze versucht vergeblich die Finsternis zu durchdringen. Mir reicht er aus, meine Augen sind scharf wie die einer Eule. Die flackernde Flamme dient eher meiner Inspiration, denn meiner Sehkraft.
Ich lehne mich bequem in meinem Stuhl zurück und lasse meinen Blick durchs Zimmer gleiten. Alles hier ist mir so vertraut. Die schweren dunklen Möbel ebenso wie die dicken Teppiche, die jeden Schritt lautlos ertragen. Das alte Schloss bot schon meinen Urahnen Zuflucht, Sicherheit und Geborgenheit. Seit Jahrhunderten im Familienbesitz ist es das Erbe meiner Väter. Nach langer Abwesenheit bin ich endlich hierher zurückgekehrt. Es nahm mich gleichgültig auf, so gleichgültig wie es zuvor auch meinen schlimmsten Feind aufgenommen hatte. Doch nun ist es wieder mein, ich werde es niemals mehr einem anderen überlassen.
Die große Standuhr in der Ecke schlägt die dritte Morgenstunde. Die Dienstboten liegen noch schlafend in ihren Betten. Diejenigen, die Frühdienst haben, werden sich erheben sobald das erste Grau den nahenden Morgen anzeigt. Bis dahin bleibt mir noch Zeit, der erste Hahnenschrei ist mir Signal, mein Schlafgemach aufzusuchen.
Ich tauche die Feder in das Tintenfass und führe sie zum Blatt. An welcher Stelle meiner Geschichte soll ich beginnen? Am besten ganz am Anfang, dem Zeitpunkt meiner Geburt...
Ich wurde Anno 1436 in der bulgarischen Stadt Plovdiv geboren. Ich war das erste Kind meiner Eltern, der erhoffte männliche Erbe, der einst das Geschlecht der Fürsten Dimitroff weiterführen sollte. Nach mir wurden im Laufe der Jahre noch etliche Geschwister geboren. Vier Brüder und drei Schwestern, von denen nur der jüngste Junge und zwei Mädchen überlebten. Meinen Vater berührte der frühe Tod seiner Kinder wenig, einzig mir, seinem zukünftigen Erben galt seine ganze Fürsorge.
Meine Eltern hatten nicht in Liebe zueinander gefunden, ihre Ehe entsprang den Plänen meiner Großeltern, die ihre Kinder schon in jungen Jahren einander versprochen hatten. Auf diese Weise sollte gewährleistet werden, dass zwei alte, fürstliche Blutlinien nicht ausstarben. Gefühle spielten dabei keine Rolle und sowohl mein Vater als auch meine Mutter unterwarfen sich klaglos der elterlichen Forderung.
Das Leben meiner Mutter bestand nach der Hochzeit ausschließlich aus der Pflicht, dem Haushalt vorzustehen und ihrem Mann möglichst viele Kinder zu gebären. Liebe wurde nicht von ihr verlangt und schon gar nicht Leidenschaft im Ehebett. Dafür hielt sich mein Vater Mätressen, derer er sich entledigte, sobald sie seine Gelüste nicht mehr befriedigten.
Das änderte sich unvermutet, als Mutters jüngste Schwester Elena im Schloss einzog. Als Kind war sie so unglücklich von ihrem Pony gestürzt, dass ihr Bein gleich zweimal brach. Der Leibarzt ihrer Eltern muss ein rechter Pfuscher gewesen sein, es gelang ihm nicht das Bein so zu richten, dass die Bruchstellen gerade zusammenwuchsen. Elenas Bein blieb verkrümmt und war zudem um einige Zentimeter kürzer als das andere. Deshalb musste sie ihr restliches Leben als humpelnder Krüppel fristen. Dabei war sie ansonsten eine wunderschöne junge Frau, groß, gertenschlank mit rabenschwarzem Haar und leuchtenden blauen Augen. Doch wenn sie lief, wurde ihr Erscheinungsbild durch den watschelnden Entengang stark beeinträchtigt.
Weil sie wegen ihres Gebrechens nicht standesgemäß verheiratet werden konnte, sollte Elena eigentlich ins Kloster eintreten, wo viele ähnlich unglückliche Frauen Zuflucht vor der Welt fanden. Doch Elena weigerte sich hartnäckig eine Braut Christi zu werden. So schickten ihre Eltern sie schließlich nach Schloss Drachenfels, sie sollte ihrer Schwester als Zofe dienen und ihr bei der Kindererziehung behilflich sein.
Als mein Vater die schöne Elena sah, die mit ihren siebzehn Lenzen geradezu erblühen begann, war es um ihn geschehen. Er sah nicht ihr verkrüppeltes Bein, gewahrte nicht ihren hinkenden Gang, er verliebte sich auf der Stelle in ihr schönes Gesicht und ihr liebreizendes Wesen.
In Gegenwart meiner Mutter, die, was das Aussehen betraf ihrer jüngeren Schwester nicht das Wasser reichen konnte gebärdete er sich stets mürrisch und kurz angebunden. Wenn er es einrichten konnte, so traf er sie nur des Nachts im Ehebett, wo er ihr einen Nachkommen nach dem anderen in den Leib pflanzte. Ansonsten ging er ihr aus dem Wege und sie war ihm nicht gram deswegen. Ihre Interessen galten ausschließlich Mutterschaft, Kindererziehung und ihren langen Gebeten in der Schlosskapelle. Ciril, den jungen Kaplan, sah sie weitaus öfter und auch lieber als ihren Ehemann. Mit ihm verbrachte sie viele Stunden, vertieft in Gebete und Litaneien.
So bemerkte sie gar nicht, wie sich eine zarte Liebesbeziehung zwischen ihrer Schwester und ihrem Gatten entspann. Elena packte die Gelegenheit, doch noch einen Mann abzubekommen beim Schopfe, sie war ein leidenschaftliches Wesen, das nicht zum Verzicht auf körperliche Freuden taugte. Und da sie wusste, wie es um die Ehe ihrer Schwester bestellt war, machte sie sich auch keine Gewissensbisse daraus, deren Mann in ihre Kammer und in ihren Schoß einzulassen. Erst als sie nach mehreren Monaten das Anschwellen ihres Leibes nicht mehr verbergen konnte, beichtete sie zuerst dem Kaplan und danach ihrer Schwester den Fehltritt.
Meine Mutter verzieh ihr großmütig, wusste sie doch, dass bereits etliche Bastarde ihres Mannes im Schloss umherliefen. Vater sorgte zwar dafür, dass seine unehelichen Kinder weder zu hungern, noch zu frieren brauchten, ansonsten kümmerte er sich jedoch nicht um sie und sie besaßen auch keinerlei Rechte. Bei Elena und ihrem noch ungeborenen Kind verhielt er sich jedoch anders. Er umsorgte die Schwangere wie ein liebender Ehemann, befreite sie von sämtlichen Pflichten und stellte ihr sogar Dienerschaft zur Verfügung, die ihr jeden Wunsch von den Augen ablesen sollten.
Das hingegen wurmte meine Mutter gewaltig, so fürsorglich hatte er sich ihr gegenüber nie verhalten. Nachdem ich, sein Stammhalter, geboren war es für ihn nicht mehr interessant, ob sie eine Schwangerschaft austrug oder etwa das Kind verlor. So war ihm auch gleichgültig, dass sie bis zu meinem dritten Lebensjahr nur ein einziges lebendes Kind geboren hatte, alle anderen hatte sie bereits in den ersten Schwangerschaftsmonaten verloren. Sobald ihr Körper nach der Fehlgeburt ausgesegnet war, schwängerte er sie bald erneut.
Zum großen Kummer meines Vaters starb Elena im Kindbett, nachdem sie ihm einen kräftigen Sohn geboren hatte. Er nannte den Jungen Boril und brachte ihn zu meiner Mutter, die nur wenige Wochen zuvor einer Tochter das Leben geschenkt hatte. In barschem Ton befahl er ihr den Jungen an ihrer Brust zu nähren und, sollte ihre Milch nicht für zwei Säuglinge ausreichen, das Mädchen einer Amme zu überlassen. Eingeschüchtert stillte sie fortan Boril zuerst und ihre Tochter musste sich mit der wenigen Milch begnügen, die er übrig ließ. Als nächtelang das Gebrüll meiner hungrigen Schwester durchs Schloss hallte, nahm Vater sie kurzerhand meiner Mutter weg und brachte sie einer Magd, die kurz zuvor ein totes Kind geboren hatte.
Mutter wagte nicht, dagegen aufzubegehren, doch sie begann Boril zu hassen. Nur widerwillig nährte sie ihn und gab ihn danach eilig in die Hände ihrer Zofen. So kam es, dass Boril in seinem ersten Lebensjahr keinerlei Liebe erhielt, er wurde gefüttert und gewickelt und dann in seiner Wiege abgelegt. Nur wenn Vater nach ihm sah, spielte Mutter ihm die fürsorgliche Amme vor, die sich liebevoll des Kindes ihrer toten Schwester annahm.
Als Boril älter wurde, änderte sich sein Leben nur geringfügig. Er wuchs zwar inmitten der kleinen Kinderschar auf, die im Laufe der Jahre hinzu geboren wurde, doch Mutter konnte sich nicht überwinden, ihm auch nur ein gutes Wort zu schenken. Was ihre Abneigung gegen ihn noch verstärkte, war seine fast unheimliche Ähnlichkeit mit mir. Zwar war ich drei Jahre älter, doch sah er aus wie ein zu klein geratener Zwillingsbruder von mir. Einzig seine Haar- und Augenfarbe wich geringfügig von meiner ab. Sowohl meine Augen als auch meine Haare waren von tiefstem Schwarz, während sein Haar dunkelbraun und seine Augen von dunklem Blau waren.
Obwohl Mutter ihre Kinder mit ihrem Hass auf Boril zu beeinflussen suchte, gelang es ihr in meinem Fall nur unzureichend. Ich hing mit brüderlicher Liebe an dem Kleinen und kümmerte mich sehr gerne um ihn. Es machte mir Spaß, mit ihm zu spielen und später, als wir älter wurden, heckten wir gemeinsam so manchen Streich aus. Er war mein einziger Spielkamerad, die anderen Geschwister waren viel jünger als ich und zudem fast alle Mädchen. Es war mir verboten, mit den Kindern der Dienstboten zu spielen, obwohl einige davon meine Halbgeschwister waren. Vater achtete stets streng darauf, dass sein Erbe nicht mit dem Pöbel, wie er sich ausdrückte, verkehrte. Als er mich einmal bei einer harmlosen Rauferei mit einem der jungen Pferdeknechte erwischte, setzte es für mich eine schlimme Tracht Prügel. Was mit dem Jungen geschah, der es gewagt hatte, dem Fürstensohn ein blaues Auge zu schlagen weiß ich bis heute nicht, ich habe ihn nie mehr gesehen.
Wie gesagt, Boril und ich wurden zusammen groß und drückten später gemeinsam die Schulbank. Vater achtete streng darauf, dass seine Söhne eine gute Schulbildung erhielten. Extra zu diesem Zwecke heuerte er mehrere Lehrer an, die uns in allem unterrichteten, was Fürstensöhne nach Vaters Meinung wissen mussten. An den Sonntagen mussten wir gemeinsam mit den Mädchen, zusätzlich den Religionsunterricht des Kaplans über uns ergehen lassen, - auf dringenden Wunsch meiner Mutter, die sich damit zum ersten und einzigen Mal bei Vater durchsetzte.
Obwohl wir fast den ganzen Tag gemeinsam verbrachten, blieb Boril mir gegenüber meist reserviert. Er war ein stiller, in sich gekehrter Knabe, dessen intensiver Blick Löcher in die Gesichter seiner Gegenüber zu brennen schien. Die jahrelange Ablehnung meiner Mutter und ihre steten Versuche, ihn von ihren eigenen Kindern abzukapseln, hatte längst Früchte getragen. Außer unserem gemeinsamen Vater traute Boril niemandem auf der Welt, auch mir nicht. Obwohl ich ihm immer wohlwollend gegenüber stand schien ihn eine unterschwellige Wut auf alle seine Halbgeschwister zu beherrschen. Schon öfter hatte ich ihn heimlich dabei beobachtet, wie er die Kleinen piesackte bis sie weinten. Ich ging dann zwar dazwischen, verriet ihn aber bei meiner Mutter nie, ich wollte nicht, dass sie ihn noch öfter züchtigte. Das tat sie bereits, seit er ein kleiner Junge war, für jede kleinste Verfehlung schlug sie ihn mit dem Rohrstock.
Boril war schon von klein auf von einer fast unheimlichen Disziplin beherrscht. Er weinte nie wenn er bestraft wurde und verriet es auch nie an Vater, obwohl der es sofort unterbunden hätte. Fast gleichmütig ertrug er die Schläge und auch die Beschimpfungen, die aus Mutters Mund auf ihn hernieder prasselten. Nur seine Augen zogen sich zu Schlitzen zusammen, so dass sie die Wut nicht sehen konnte, die in ihm tobte.
Auch ich ahnte lange Zeit nichts von dem sengenden Zorn, der ihn beherrschte. Noch weniger wusste ich darum, dass dieser Zorn sich bald ausschließlich auf mich konzentrieren würde. Als mir der tödliche Hass meines Halbbruders endlich bewusst wurde, war es längst zu spät. Seine Rache an mir für die Demütigungen, die ihm meine Eltern zugefügt hatte, sollte mein Leben für immer zerstören...
Kapitel 02: Riana
Die Jahre unserer Kindheit waren längst vorüber und aus Boril und mir junge Männer geworden. Noch immer sah er mir zum Verwechseln ähnlich, die drei Jahre, die uns trennten fielen kaum noch ins Gewicht. Inzwischen war er einundzwanzig und ich vierundzwanzig Jahre alt.
Wir hatten lange Jahre Schul- und Studienzeit zusammen gemeistert und waren gemeinsam intensiv in der Kriegs- und Waffenkunst unterrichtet worden. Vater war sehr stolz auf seine Söhne und achtete stets streng darauf, dass wir beide gleich zuvorkommend behandelt wurden. Keiner der Bediensteten hätte es gewagt, Boril wegen seiner unehelichen Herkunft nachteilig oder gar abfällig gegenüberzutreten.
Mit meiner Mutter hatte ich kaum noch Kontakt, nachdem sie ihm keine Kinder mehr gebären konnte hatte Vater sie mitsamt ihren Töchtern in ein weit entferntes klösterliches Stift geschickt. Dort konnte sie sich endlich voll und ganz ihren Gebeten widmen. Meine Schwestern wurden von den Nonnen erzogen und würden im Kloster bleiben bis Vater passende Ehemänner für sie gefunden hätte.
Einzig mein jüngerer Bruder Aleko lebte noch bei uns im Schloss. Mit seinen zwölf Jahren war er noch zu jung, um von Vater als vollwertiges Familienmitglied akzeptiert zu werden. In seinen Augen schien er nur eine Art Reserve zu sein, falls mir, seinem Erben etwas zustoßen sollte. Aleko war für ihn ansonsten kaum existent. Den größten Teil des Tages bekam er Unterricht von seinen Lehrern oder dem Waffenmeister und des Abends musste er zeitig zu Bett gehen. So fristete er ein ziemlich einsames Dasein und insgeheim tat er mir leid.
Aleko war als Kleinkind oft krank gewesen und für sein Alter recht klein und zart gebaut. Das missfiel Vater und er hielt damit nicht hinterm Berg. Es interessierte ihn kaum, wie sehr der Junge unter seiner Strenge und Nichtachtung litt.
Ich mochte meinen Bruder sehr gerne und fürchtete insgeheim, er würde unter Vaters strenger Erziehung zerbrechen. So oft ich konnte schlich ich mich deshalb zu ihm um mich mit ihm zu unterhalten und ihn ein wenig aufzuheitern. Aleko hungerte nach Zuneigung und Wärme und war jedes Mal den Tränen nahe wenn ich ihn wieder verließ.
Seit Tagen waren wir schon unterwegs. Ziel unserer Reise war Varna eine wichtige Hafenstadt an der Schwarzmeerküste. Man schrieb das Jahr 1460 und unser Land wurde von den Osmanen beherrscht. Die Knechtschaft unter den türkischen Besatzern hielt bereits über sechs Jahrzehnte an und kein Ende war abzusehen. Das Volk litt Hunger, die meisten Bauern arbeiteten als Leibeigene auf dem Land, das nun dem Sultanat gehörte. Sie wurden Rajas genannt, was Untertan bedeutete. Geringschätzig wurden sie auch als folgsame Herde beschimpft. Immerhin bekam jeder Bauer ein Stück Boden zugewiesen, das er für den eigenen Bedarf bewirtschaften konnte. Somit erging es den meisten Rajas besser als den Menschen in den Städten, die höchstens niedere Handwerkerdienste verrichten durften. Alle wichtigen und einträglichen Tätigkeiten wurden von Türken, Griechen, Armeniern oder Juden ausgeübt. Da die Türken besonders gerne in den Städten wohnten, wuchs die Bevölkerung dort massenhaft an. Doch die Osmanen besetzten nicht nur unsere Städte, sie brachten auch ihre eigene Kultur und den islamischen Glauben mit. Immer mehr Moscheen wurden erbaut und die Menschen gezwungen, ihrem christlichen Glauben abzuschwören und dafür den mohammedanischen Glauben anzunehmen. Wer sich weigerte wurde versklavt oder getötet. Familien, die an ihrer Religion festhielten, wurden die Kinder geraubt, die Mädchen in Harems verschleppt und die Knaben zu Janitscharen, fanatischen Kämpfern erzogen, die später gegen ihre eigenen Landsleute zogen. Nur wer seinem Glauben abschwor und zum Islam übertrat, durfte auf Milde hoffen. Diese Glaubensabtrünnigen wurden sogar durch allerlei Vorteile belohnt.
Die Vernichtung der Bojaren, Großbauern und Landadeligen war oberstes Ziel der türkischen Besatzer. Adelige Familien wie die unsere waren ihnen besonders ein Dorn im Auge. Vater als strenggläubiger Christ, zeigte sich jedoch nicht gewillt den islamischen Glauben anzunehmen und kämpfte verbissen dagegen an. Das hatte ihn bereits seinen angestammten Familiensitz mitsamt den dazugehörenden Ländereien gekostet.
Der Stammsitz meiner Familie befand sich einst in Plovdiv, das mittlerweile jedoch stark von den Türken besetzt war. Meine Eltern sahen sich kurz nach meiner Geburt gezwungen, Hals über Kopf zu fliehen, wollten sie wenigstens unser nacktes Leben retten. Zuflucht fanden wir in Schloss Drachenfels, das meine Mutter als Brautgabe in die Ehe eingebracht hatte. Es lag in der Nähe von Vraza, war also ein gewaltiges Stück von unserer ehemaligen Heimat entfernt. Zudem war es sehr viel kleiner und es gehörte auch nur wenig Land dazu. Doch war der Besitz immerhin groß genug, unsere Familie standesgemäß zu erhalten.
Bislang hatte Vater Glück und einflussreiche Freunde gehabt, die verhinderten, dass ihm auch dieses Schloss und die wenigen Ländereien abgenommen wurden. Vermutlich spielte auch die nur schlecht zugängliche Lage von Schloss Drachenfels inmitten felsiger Berge und weitab der Stadt eine nicht unbedeutende Rolle. Bislang waren die osmanischen Truppen noch nicht bis dorthin vorgedrungen, es lag einfach zu abgelegen und versteckt. Doch in letzter Zeit drängten die türkischen Truppen weiter ins Hinterland vor, somit wurde die Bedrohung auch für uns immer relevanter.
Um Rat und eventuell Hilfe zu bekommen befanden wir uns deshalb auf dem Weg zu Fürst Georgi Terter IV., einem alten Freund meines Vaters. Georgi entstammte einem sehr alten und noch immer einflussreichen Adelsgeschlecht, weshalb Vater seine ganze Hoffnung in ihn setzte. Georgi besaß ein ausgezeichnetes diplomatisches Geschick und hatte es bisher stets gut verstanden, mit den Türken zu verhandeln. Vater war sich sicher - wenn uns überhaupt jemand vor der drohenden Vertreibung und Enteignung retten konnte, dann er.
Die Unterredung dauerte schon seit Stunden an und noch immer war kein Ende abzusehen. Mein Kopf schwirrte von den vielen Ratschlägen und Erklärungen. Boril und ich saßen stumm dabei und hörten zu. Obwohl auch unsere Zukunft auf dem Spiel stand, besaßen wir kein Mitspracherecht.
Immer wieder wanderte mein Blick zum Fenster. Draußen schien die Sonne und heizte durch die geschlossenen Fenster den Raum auf. Ich schwitzte in meiner Uniform und fuhr mir verstohlen mit dem Finger unter den engen Kragen in der vergeblichen Bemühung, ihn etwas zu lockern. Außerdem verspürte ich das immer dringender werdende Bedürfnis meine Blase zu entleeren.
Mit knappem Kopfschütteln lehnte ich den mit Wasser vermischten Wein ab, den mir ein Diener anbot. Bereits der Anblick der Flüssigkeit verstärkte den Druck, der meine Blase zu sprengen drohte.
Endlich beschlossen Georgi und mein Vater eine Pause einzulegen um eine Kleinigkeit zu essen. Boril schloss sich ihnen an. Ich war nicht hungrig und verzog mich eilig nach draußen, wo sich neben den Pferdeställen die Toilettengrube befand. Nachdem ich mich erleichtert hatte, fühlte ich mich sogleich besser. Ich beschloss die kurze Pause im Freien zu verbringen und schlug den Weg zu dem ausschweifenden Parkgelände ein, das sich vor dem Schloss erstreckte.
Es war ein wunderschöner, warmer Frühlingstag und ich dachte bei mir, wie schön es doch wäre, ihn auf dem Rücken eines feurigen Pferdes zu verbringen. Viel lieber wäre ich in gestrecktem Galopp über Wiesen und durch Wälder geritten, als nochmals endlose Stunden der Krisensitzung zu lauschen.
Wie von selbst lenkte sich mein Schritt zu einem kleinen Hain aus blühenden Obstbäumen. Inmitten der Bäume stand ein Springbrunnen umringt von mehreren Bänken. Erst beim Näherkommen erkannte ich die zierliche Gestalt, die, ganz in Gedanken versunken, auf einer Bank saß und in die Weite des Gartens blickte. Einem Impuls folgend wollte ich mich zurückziehen, bevor sie mich bemerkte. Aber irgendetwas faszinierte mich sofort an ihr und leise trat ich näher.
Es war ein junges Mädchen, erkannte ich, fast noch ein Kind. Langes dunkles Haar floss ihr den Rücken herab, das Sonnenlicht ließ winzige rotgoldene Funken darin aufleuchten. Ein leichter Windhauch bewegte ihre zarten Locken wie Wellen auf dem Meer.
Als spüre sie meinen Blick, drehte sie sich zu mir um. Für einen Moment zogen sich schmale, dunkle Augenbrauen misstrauisch zusammen, dann erhellten sich ihre Gesichtszüge und sie lächelte mich an. „Ihr habt mich erschreckt“, sagte sie mit leisem Tadel, jedoch ohne erschrocken zu klingen. „Schleicht Ihr euch immer so an andere Menschen heran?“
„Nur wenn es sich um bezaubernde junge Damen handelt“, konterte ich und trat näher um ihr meine Hand zu reichen. Ich hauchte einen flüchtigen Kuss auf ihren kokett dargebotenen Handrücken und stellte mich mit einer Verbeugung vor. „Gestatten, Malamir Dimitroff aus Vraza.“
Über ihre Züge glitt ein heiteres Lächeln. „Malamir! Was für ein ungewöhnlicher Name...“
Ich seufzte. „Ja, leider hat mein Vater darauf bestanden. Er interessiert sich sehr für die Geschichte unseres Landes und fand, sein erstgeborener Sohn müsse unbedingt den Namen eines alten Herrschers tragen. Warum es ihm Malamir besonders angetan hat, ist mir bis heute ein Rätsel.“
„Also mir gefällt der Name. Er scheint zu Euch zu passen. Warum soll ein so ungewöhnlicher junger Mann nicht auch einen ungewöhnlichen Namen tragen.“
Ihre Offenheit machte mich erst einmal sprachlos. Dann fragte ich argwöhnisch: „Wollt Ihr mich auf den Arm nehmen? Was ist ungewöhnlich an mir?“
Sie lachte und ihre blauen Augen, die übrigens wunderschön waren, blitzten schalkhaft. „Alles an Euch, beginnend bei Eurer imponierenden Größe bis hin zu Euren edlen Gesichtszügen. Ihr seht ganz anders aus, als die meisten Männer, die ich kenne...“
Nun erst wurde ihr offenbar bewusst, was sie sagte. Verlegen senkte sie den Blick und murmelte. „Entschuldigt, ich sollte nicht so kühne Worte sprechen. Vater sagt immer, ich trüge mein Herz auf der Zunge und müsse endlich lernen, nicht auszuplappern was mir durch den Kopf geht...“
„Nun, es war ja keine Beleidigung, die Ihr ausgesprochen habt. Macht Euch also keine Gedanken“, wiegelte ich ab und trat noch dichter zu ihr hin. Sie hob den Kopf und schaute mir in die Augen. So nahe waren wir uns, ich konnte jede winzige Einzelheit ihres perfekten Gesichtes sehen. Sie war die schönste Frau, die mir jemals begegnet war. Nein, Frau konnte man eigentlich noch nicht sagen, sie war aber auch kein Mädchen mehr. Ihre Augen, von tiefem Blau und von langen, dunklen Wimpern umsäumt blickten offen und neugierig zu mir hoch. Auf ihren Wangen lag noch zarte Röte - Scham über ihre forschen Worte. Eine hübsche kleine Nase und üppige geschwungene Lippen rundeten das Bild ab. Lippen, die dazu geschaffen schienen sie zu küssen. Meine Hände legten sich wie selbstverständlich auf ihre schmalen Schultern, zogen sie an mich und mein Kopf neigte sich zu diesen Lippen herab. Fast schon lag mein Mund auf ihrem, da besann ich mich endlich und trat abrupt einen Schritt zurück. Jetzt war es an mir, verlegen zu sein.
„Verzeiht mir bitte meine ungebührliche Anwandlung. Aber Eure Nähe übt eine seltsame Anziehung auf mich aus. Dabei kenne ich noch nicht einmal Euren Namen...“
„Ich bin Riana, die jüngste Tochter Fürst Georgis.“
Riana! Der Name gefiel mir. Und sie war die Tochter unseres Gastgebers. Schrecken durchfuhr mich. Hoffentlich verriet sie ihrem Vater nicht, wie unziemlich ich mich ihr gegenüber verhalten hatte. Dass ich sie in meine Arme gerissen und fast geküsst hatte, als wäre sie eine Dirne oder Mätresse. Das war unverzeihlich und konnte unter Umständen zu einem schweren Zerwürfnis zwischen unseren Vätern führen. Sicher war Riana bereits einem Mann versprochen, vielleicht sogar verlobt. Wilderte ich etwa gar im Revier eines hohen Herrn? Der Schweiß brach mir aus, beim Gedanken an die Standpauke, die mir mein Vater halten würde, sollte er davon erfahren.
„Ich bitte Euch nochmals inständig, mir mein schlechtes Benehmen zu verzeihen. Ich wollte Euch keinesfalls beleidigen und kann Euch nur bitten, nichts Eurem Vater sagen...“ Vor Aufregung über die möglichen Zwistigkeiten, die ich so leichtsinnig heraufbeschworen hatte, klopfte mir mein Herz bis zum Hals.
Riana war mein plötzliches schlechtes Gewissen nicht entgangen. Beruhigend legte sie mir ihre Hand auf die Brust. „Seid ohne Sorge, Malamir. Wieso sollte ich etwas zu meinem Vater sagen? Es ist doch nichts geschehen. Zumal es meine Schuld war, ich habe Euch verwirrt mit meiner Offenheit. Lasst uns einfach nicht mehr davon reden. Geht Ihr mit mir ein Stück im Park spazieren? Es ist ein so herrlicher Tag heute. Und Ihr seht blass aus, die frische Luft wird Euch guttun...“
Sie wandte ihre Schritte bereits von mir ab und ging den gepflegten Kiesweg entlang. Ich folgte ihr eilig, froh, dass sie mir nicht böse war. Langsam schlenderten wir an den blühenden Bäumen vorbei, atmeten tief den Duft der Blüten und des jungen Grases ein. Wir schwiegen beide lange, bis Riana wieder zu sprechen begann.
„Mein Vater und der Eure sind gute Freunde. Zumindest hat er schon öfter von Simeon Dimitroff erzählt. Die beiden haben früher gemeinsam gegen die osmanischen Landbesatzer gekämpft. Erst als Beide Familien gründeten, verloren sie sich aus den Augen. Wie steht es mit Euch, habt Ihr bereits eine Familie?“
Ich schüttelte den Kopf. „Nein, es sollte wohl nicht sein. Zwar wurde ich bereits im Kinderalter mit der Tochter eines benachbarten Fürsten verlobt, doch sie starb nur ein halbes Jahr vor unserer Hochzeit an einem Fieber. Das ist nun fast drei Jahre her...“
„Oh, das tut mir leid. Sicher habt Ihr Eure Braut sehr geliebt und Euch aus Trauer noch nicht nach einer anderen umgesehen.“
Ich sah zu ihr hinüber und schüttelte abermals den Kopf. „Ich habe meine zukünftige Frau kaum gekannt, sah sie zum einzigen Mal bei unserer Verlobung. Damals war ich zwölf und sie sieben Jahre alt. Wir wussten beide nicht, was mit uns geschah und ich erinnere mich, dass wir uns noch nicht einmal mochten. Deshalb bin ich eigentlich froh, dass aus der Ehe nichts geworden ist. Wobei ich natürlich ihren allzu frühen Tod bedaure. Aber ich denke, wir wären nicht besonders glücklich miteinander geworden.“
„Ist eine glückliche Ehe denn Euer Ziel? In unseren Kreisen werden Ehen geschlossen, damit das Familienerbe weitergetragen wird. Liebesheiraten, wie sie die Barden besingen, gibt es höchstens beim gemeinen Volk. Da muss niemand darauf achten, dass der hochadelige Stammbaum keinen Knick bekommt.“
„Ihr seid also dafür, dass wir Fürstensprösslinge nur untereinander heiraten dürfen? Wünscht Ihr euch nicht einen Mann, der Euch gefällt, den Ihr liebt und der Euch liebt?“ Ich blieb stehen und drehte mich zu ihr hin damit ich ihr besser in die Augen schauen konnte.
„Ich“, fuhr ich fort, „würde lieber eine Frau heiraten, der ich in Liebe zugetan bin. An der Ehe meiner Eltern konnte ich zur Genüge erkennen, wie schrecklich es ist, an einen Partner gebunden zu sein, den man nicht liebt. Für den Mann geht es ja noch, er kann sich nebenher Mätressen halten, die sein Leben versüßen. Für die Frau kann solch eine Ehe allerdings die Hölle bedeuten. Das beste Beispiel ist meine Mutter. Für Vater war sie nur dazu da, ihm Nachkommen zu gebären. Daran ist sie sowohl körperlich als auch seelisch zerbrochen. Erst jetzt, nachdem sie von ihm keine Kinder mehr empfangen kann, hat sie im Kloster ein wenig Frieden gefunden.“
Riana schaute mich lange nachdenklich an. Ihre Gesichtszüge waren weich, als sie leise antwortete: „Ihr macht Euch sehr viele Gedanken über die Ehe. Ich wünsche Euch wirklich, dass Ihr eines Tages die Frau findet, die Ihr lieben könnt und die Euch liebt.“
Die habe ich bereits gefunden schoss es mir durch den Kopf, sie steht direkt vor mir. Die Eingebung verwirrte mich, bisher hatte ich noch kaum einen Gedanken daran verschwendet, mir eine Ehefrau zu suchen. Verlegen von meinen plötzlich aufwallenden Gefühlen, bemühte ich mich, das Gespräch von mir abzulenken. „Wie verhält es sich bei Euren Eltern?“ fragte ich. „Sie wurden sicher ebenfalls miteinander verheiratet ohne nach ihrem Willen gefragt zu werden.“
Riana schaute einen Moment zu den Bäumen hoch, dann blickte sie mir wieder in die Augen. „Bei meinen Eltern war es ebenso, aber sie haben einander trotzdem gut verstanden. Als Mutter kurz nach meiner Geburt starb, war Vater untröstlich. Doch, ich glaube sie haben sich geliebt.“
„Und Ihr?“, platzte ich wider Willen heraus. „Sicher seid Ihr bereits verlobt...? Entschuldigt, es gehört sich nicht, Euch das zu fragen.“
Abermals war Riana nicht böse über meine unziemlichen Worte. Sie schüttelte lächelnd den Kopf. „Nein, ich bin noch keinem Mann versprochen. Mir erging es ähnlich wie Euch, bloß dass der Knabe, der einmal mein Ehemann werden sollte gar nicht das Erwachsenenalter erreichte. Er starb mit sechs Jahren an den Pocken. Und bislang konnte ich Vater davon abhalten, mir einen Gatten zu suchen.“
Sie lächelte plötzlich rätselhaft und in ihren Augen blitzte es auf. „Obwohl ich es inzwischen gar nicht mehr so schlimm finden würde, sollte ein Mann um meine Hand anhalten.“
Sie drehte um und lief den Weg zurück. Über die Schulter rief sie mir zu. „Ihr solltet Euch beeilen, zurückzukehren. Vater kann sehr ungehalten werden, wenn man nicht pünktlich ist...“
Von den weiteren Beschlüssen, die gefasst oder auch wieder verworfen wurden bekam ich kaum etwas mit. Meine Gedanken kreisten ausschließlich um Riana. Beim Abendessen traf ich sie wieder, zu meiner Freude wurde sie mir als Tischdame zugeteilt und ich war so damit beschäftigt, ihr jeden Wunsch von den Augen abzulesen, dass ich kaum daran dachte, selbst einen Bissen zu mir zu nehmen. Boril, der mir gegenüber saß grinste mich spöttisch an. Doch hinter seinem Spott konnte ich Neid erkennen, seine Tischdame war ein pummeliges junges Mädchen, das unablässig plapperte. Er würdigte sie kaum eines Blickes, starrte immer nur Riana an.
Dem Essen folgte ein geselliger Abend mit Tanz. Georgi hatte es sich nicht nehmen lassen, für seinen alten Freund ein Fest zu geben und dazu auch seine Verwandten und einige Geschäftspartner eingeladen. Während er Vater von einem zum anderen führte um ihn vorzustellen, erbat ich mir von Riana jeden Tanz. Zu meiner Freude gewährte sie ausschließlich mir ihre Gunst, obwohl etliche andere junge Männer ebenfalls um sie warben.
Es wurde ein verzauberter Abend. Leicht wie eine Feder lag sie in meinen Armen, passte sich so vollendet meinen Tanzschritten an, als hätten wir lange dafür geübt. Ich konnte nichts anderes ansehen als immer nur ihr liebreizendes Gesicht und noch ehe der Abend vorüber war wusste ich, ich hatte mich unsterblich in sie verliebt. Ihr schien es genauso zu ergehen, ihre Augen verrieten es mir.
Unseren Vätern war ebenfalls aufgefallen, wie es um uns stand, ihr wohlwollendes Grinsen machte mir Mut. Während einer Tanzpause begleitete ich Riana an die frische Luft. Draußen führte ich sie zu einer Nische, in der man uns von drinnen nicht beobachten konnte. Ich nahm sie in die Arme und sie ließ es geschehen. Vertrauensvoll schmiegte sie sich an mich und schaute voller Erwartung zu mir hoch. Ich redete nicht lange drum herum. „Willst du meine Frau werden, Riana?“ fragte ich und wurde mit einer ebenso direkten Antwort belohnt. „Ja, natürlich will ich das. Schon seit ich dich heute Mittag im Garten traf.“
Schalk trat in ihre Augen und sie forderte: „Und jetzt küss mich endlich. Das will ich ebenfalls schon seit heute Mittag...“
In dieser Nacht machte ich kein Auge zu. Alle Sorge um die ungewisse Zukunft verblasste hinter meiner Verliebtheit. Ich malte mir in rosigen Farben aus, wie mein Leben mit Riana verlaufen würde. Gleich am nächsten Morgen, noch vor dem Frühstück sprach ich bei ihrem Vater vor und bat ihn um Rianas Hand. Er zeigte sich kein bisschen erstaunt und hieb mir seine kräftige Pranke auf die Schulter. „Bist du dir sicher, mit einem so vorlauten Gör wie meiner Riana fertig zu werden? Mir ist es in den ganzen sechzehn Jahren ihres Lebens nicht gelungen, ihr den Wildfang auszutreiben.“
„Ich bin mir nicht sicher, ob ich das überhaupt möchte“, antwortete ich ehrlich. „Mir gefällt ihre direkte Art.“
„Sie ist wie ihre Mutter“, sagte er mit einem wehmütigen Seufzer. „Wahrscheinlich habe ich deshalb nie versucht, sie umzuerziehen. Und ich habe ihr bisher keinen Ehemann ausgesucht, weil ich wollte, dass sie jemanden heiratet, der sie so schätzt und liebt wie sie ist.“
„Mir gefällt sie, wie sie ist. Und ich verspreche Euch, ich werde alles tun um sie glücklich zu machen.“
Er klopfte mir abermals auf die Schulter. „Ich nehme dich beim Wort. Dann soll sie also die Deine werden. Vor eurer Abreise werde ich die Familie zusammenrufen um die Verlobung bekanntzugeben. Ich nehme doch an, dein Vater weiß Bescheid und ist ebenfalls einverstanden.“
„Ich habe ihm noch in der Nacht von meinem Vorhaben erzählt und er ist begeistert...“
„Na, dann steht einer Ehe zwischen euch ja nichts mehr im Wege. Ihr müsst euch jedoch noch gedulden. Ein Jahr Brautzeit halte ich für angemessen. Im Mai des nächsten Jahres soll die Hochzeit stattfinden. Bis dahin wirst du auch - so Gott will - wieder von deiner ehrenvollen Mission zurück sein.“
Ein Jahr Verlobungszeit! Das gefiel mir überhaupt nicht, am liebsten hätte ich Riana vom Fleck weg geheiratet. Aber ihr Vater besaß natürlich das alleinige Recht, den Zeitpunkt der Hochzeit zu bestimmen. Im Grunde pflichtete ich ihm auch bei, eine überstürzte Heirat würde keinen guten Eindruck machen. Ein Jahr Brautzeit war durchaus üblich, manchmal sogar noch länger, ich musste deshalb froh sein, dass er nur auf die mindeste Zeitspanne bestand. Also verbeugte ich mich zustimmend vor ihm und verabschiedete mich.
Ein ganzes Jahr, ging es mir immer wieder durch den Kopf. Eine lange Zeit, in der ich Riana kaum einmal sehen würde. Wie sollte ich das nur überstehen? Fast kam es mir wie ein Glück vor, dass ich schon bald aufbrechen würde um die Mission zu erfüllen, wie es Georgi genannt hatte.
Auch das war am Tag zuvor beschlossen worden. Während mein Vater für ungewisse Zeit zu Verwandten nach Ungarn ins Exil gehen würde, sollten Boril und ich uns den Haiduken anschließen. Die Haiduken waren eine Gruppe von Widerstandskämpfern, die es sich zum Ziel gesetzt hatten, Bulgarien von der verhassten Türkenherrschaft zu befreien. In waghalsigen Aktionen griffen die oft nur aus wenigen Männern bestehenden Rebellengruppen den übermächtigen Gegner an. Ihr Ziel war es, die Truppen zu zersprengen oder auch den Nachschub an Lebensmitteln zu verhindern, indem sie Karawanen angriffen. Das musste in der Regel aus dem Hinterhalt geschehen und endete oft mit dem Tod der Partisanen. Trotzdem fanden sich immer wieder Männer bereit, dem osmanischen Heer die Stirn zu bieten.
Georgi war einer der heimlichen Anführer der Haidukenüberfälle. Er und auch Vater sahen es als ehrenvolle Pflicht an, dass Boril und ich unserem Land dienten, indem wir uns für einige Zeit den Freischärlern anschlossen. Dass wir dabei durchaus den Tod finden konnten war ihnen bewusst, hinderte sie aber nicht in ihrem Ansinnen. Und sowohl Boril als auch ich dachten genauso.
Schließlich war, auch wenn wir nicht kämpften, unser Leben in steter Gefahr. Als Söhne eines Adeligen, der sich weigerte dem Islam beizutreten waren wir ständig von Entführung oder Schlimmerem bedroht. Denn wie unser Vater waren wir nicht bereit unser Leben zu erkaufen indem wir dem Christentum abschworen.
Der Tag meiner Verlobung mit Riana war gekommen. Die Zeremonie hatte schon am Morgen mit einer Messe in der Familienkapelle begonnen. Georgi hatte mir seine Tochter vor dem Altar zugeführt und wir hatten uns gegenseitig feierlich die Ehe versprochen. Als Pfand steckte ich Riana den Verlobungsring an den Finger, danach gab uns der Priester seinen Segen.
Am Abend wurde uns zu Ehren ein großes Fest gefeiert. Um die vielen geladenen Gäste angemessen zu beköstigen hatte Georgi einen Ochsen, zwei Schweine und etliches Federvieh schlachten lassen. Es wurde üppig gegessen und immer wieder auf unser Wohl die Gläser erhoben. Nachdem wir die vielen Glück- und Segenswünsche der zahlreichen Gäste entgegengenommen hatten, stahlen Riana und ich uns heimlich davon. Es blieb uns nur noch wenig Zeit miteinander. Morgen in aller Frühe würden Vater, Boril und ich uns auf die Heimreise machen.
Auch dort würden wir nur noch kurze Zeit sein. Vater würde den Haushalt auflösen, alle wertvollen Gegenstände in ein Versteck bringen lassen und danach sämtliche Bedienstete entlassen. Dann würde er mit Aleko nach Ungarn reisen und Boril und ich uns zu den Haiduken aufmachen. Wir konnten nur hoffen, wenn wir eines fernen Tages zurückkamen, nicht nur noch die Ruine unseres Schlosses vorzufinden.
Riana führte mich zu den Pferdeställen, die in tiefer Dunkelheit lagen. Sie lauschte nach allen Seiten, doch niemand war zu sehen. Die Stallburschen schliefen längst in ihrer Unterkunft neben den Ställen. Leise öffnete sie die Türe und zog mich ins Stallinnere. Auch hier war es finster, nur in der hintersten Ecke brannte ein kleines Licht. Dort befand sich der winzige Verschlag, in dem des Nachts ein Knecht Stallwache abhielt.
Es war still einzig das leise Rumoren der Pferde war zu hören. Riana zog mich zu einem Verschlag, in dem ein Pferd döste. Als wir näher kamen hob es den Kopf und kam neugierig heran. Ein schwarzer Kopf schob sich über die Absperrung und dunkle Augen musterten uns misstrauisch.
„Das ist Placidus, du kannst ihn aber auch Placi rufen. Komm zu mir, Placi, ich habe dir einen Apfel mitgebracht.“
Das riesige Pferd machte den Hals lang und nahm den Apfel sehr vorsichtig aus Rianas Hand. Er kaute ihn geräuschvoll und prustete dann auffordernd. Riana drückte mir einen weiteren Apfel in die Hand, den ich dem Hengst hinhielt. Nachdem er zuerst an meiner Hand gerochen hatte, nahm Placi den Apfel huldvoll an. Er ließ sich von mir die samtenen Nüstern streicheln und schnaubte dabei leise.
Riana schlug entzückt die Hände zusammen als sie es sah. „Er mag dich, das ist gut. Ich will ihn dir nämlich schenken...“
„Du willst mir dieses prächtige Pferd schenken?“ unterbrach ich sie erstaunt. „Aber er ist ein Vermögen wert. Was wird dein Vater dazu sagen?“
„Placi ist mein Pferd, ich habe ihn schon als Fohlen bekommen und per Hand großgezogen. Seine Mutter wurde kurz nach seiner Geburt von einem Blitz getötet. Wie durch ein Wunder hat er überlebt. Vater wollte ihn töten lassen, weil er meinte, er käme ohnehin nicht durch. Aber ich habe so lange gebettelt, bis ich es versuchen durfte, ihn aufzuziehen. Es hat sich doch gelohnt, oder? Placi ist ein prächtiges Tier geworden.“
„Das ist er ohne Zweifel. Aber warum willst du ihn mir schenken?“
„Ich denke, er ist bei dir gut aufgehoben. Mit seinen vier Jahren ist er voller Kraft und Übermut. Und Vater meint, er wäre zu groß und zu stark für mich. Er hat mir verboten, ihn zu reiten. Und Placi lässt kaum einen anderen als mich an sich heran. Da er sich so spontan von dir streicheln ließ, wird er sich auch von dir reiten lassen. Bitte nimm ihn an. Er ist sehr schnell und du brauchst ein schnelles Pferd wenn du mit den Haiduken reistest, außerdem wird er dich immer an mich erinnern.“
„Ich werde auch so in jeder Minute an dich denken. Aber ich nehme Placi gerne an, wenn dir so viel daran liegt. Er und ich werden uns sicher prächtig verstehen. Aber sag, wie kommst du auf diesen ungewöhnlichen Namen? Placidus ist lateinisch, wenn ich mich recht besinne und heißt so viel wie der Sanfte, Friedfertige. Dabei ist er doch gar nicht so friedlich, wenn ich deinen Worten glaube.“
Sie lachte und tätschelte den glänzenden Hals des Hengstes. „Das war er, sanft und ruhig, zumindest solange er ein Fohlen war. Er lief mir auf Schritt und Tritt hinterher und blickte mich mit seinen großen schwarzen Augen so sanftmütig an als könne er kein Wässerchen trüben. Aber schon als Einjähriger entpuppte er sich als ungebärdiger Teufel, dem kein Koppelzaun zu hoch war. Außerdem scheuchte er immer die Stallburschen vor sich her und zwickte sie in die Waden. Aber da hatte er seinen Namen bereits weg.“
„Du beschämst mich mit deinem großartigen Geschenk“, sagte ich leise und nahm sie in die Arme. „Ich würde dir gerne ein Gegengeschenk machen. Doch leider weiß ich nicht, was ich dir schenken könnte...“
„Das du so unvermutet in mein Leben getreten bist, ist das schönste Geschenk für mich. Vor wenigen Tagen wusste ich nicht einmal, dass es dich gibt und heute bin ich mit dir verlobt. Ist das nicht ein wahres Wunder?“
Ich konnte ihr nur aus ganzem Herzen zustimmen. Wir waren hierhergekommen, weil wir um unsere Zukunft fürchten mussten und ich hatte unvermutet die Liebe meines Lebens gefunden. Riana schmiegte sich eng an mich und ich konnte nicht anders. Ich senkte den Kopf um sie leidenschaftlich zu küssen.
Ein Schlurfen, das schnell näher kam, ließ uns auseinander fahren. Es war der Stallwächter, der von Verschlag zu Verschlag ging und mit seiner Laterne hinein leuchtet ob mit den Pferden alles in Ordnung war. Als er uns entdeckte zuckte er erschrocken zusammen, fing sich jedoch schnell wieder. „Ach Ihr seid es, gnädiges Fräulein...“, murmelte er und warf mir einen neugierigen Blick zu.
„Es ist schon in Ordnung, Anjo. Ich wollte meinem Verlobten nur sein neues Pferd vorstellen. Er nimmt Placi morgen früh mit. Sieh zu, dass der Hengst dann geputzt und aufgezäumt ist.“
„Sehr wohl, gnädiges Fräulein“, murmelte der Knecht und schlurfte an uns vorbei. Aus den Augenwinkeln schielte er zu mir und schüttelte missmutig den Kopf. Anscheinend war ihm nicht recht, dass ich den Hengst mitnehmen wollte. Aber er sagte natürlich nicht, was ihm im Kopf herum ging.
„Er missbilligt deine Entscheidung, mir Placi zu schenken“, wisperte ich in Rianas Ohr. „Willst du es dir nicht noch einmal überlegen?“ Aber sie schüttelte lächelnd den Kopf. Gemeinsam verließen wir den Stall und traten in die klare Nachtluft. Ich brachte Riana zum Haus zurück und blieb vor der Eingangstüre stehen.
„Möchtest du nochmals in den Ballsaal zurück?“ fragte ich, doch sie schüttelte den Kopf.
„Nein, ich werde mich zu Bett begeben. Der Tag war lange und aufregend, ich werde mir von meiner Zofe ein Lavendelbad anrichten lassen.“
„Ich nahm ihre Hand und küsste sie leicht. „Dann möchte ich dir eine angenehme Nachtruhe wünschen...“
„Kommst du mich später besuchen?“ fragte sie unvermittelt und ich sah sie verwundert an. Was meinte sie?
„Wenn alle zu Bett gegangen sind“, erklärte sie, meinen verwirrten Gesichtsausdruck richtig deutend. „Wir sind verlobt und werden uns wahrscheinlich längere Zeit nicht sehen. Deshalb will ich wenigstens noch eine kurze Weile mit dir alleine verbringen. Und diese Nacht ist unsere einzige Gelegenheit.“
Sie blickte mich mit so unschuldigem Augenaufschlag an, dass ich bezweifelte, es wäre ihr bewusst, welch ein Angebot sie mir gerade gemacht hatte.
„Es ist nicht schicklich, dich in deinem Schlafgemach zu besuchen“, gab ich zu bedenken. Obwohl mich der Gedanke reizte und ich ein erregtes Ziehen in den Lenden verspürte. Zudem war es zwar nicht ehrenhaft, doch keineswegs ungewöhnlich, dass Verlobte schon vor der Hochzeit miteinander schliefen. Auf diese Weise konnte ein Mann schnell herausfinden, ob seine Zukünftige überhaupt in der Lage wäre, ihm Nachkommen zu schenken. Viele nahmen es deshalb lieber in Kauf übereilt zu heiraten, als später die Ehe wegen fehlenden Kindersegens annullieren lassen zu müssen.
Dennoch, Riana war ein unschuldiges junges Mädchen und ich wollte sie auf keinen Fall kompromittieren. Immerhin zog ich in einen Krieg und es konnte durchaus sein, dass ich nicht wiederkam. Wenn ich Riana entehrt und womöglich auch noch schwanger zurückließ, würde das ihr ganzes weiteres Leben äußerst negativ beeinträchtigen. Kein Mann von Stand würde sie dann mehr heiraten wollen, geschweige denn, den Bastard eines anderen aufziehen.
„Ich wünsche es mir so sehr“, meinte sie ernst und legte mir die Hand auf die Brust. „Ich möchte deine Nähe spüren, solange es uns noch vergönnt ist. Wir kennen uns zwar nur kurz, doch es ist mir, als würde ich dich schon ewig lieben. Und morgen verlässt du mich für lange Zeit. Deshalb wünsche ich mir, dass etwas von dir bei mir bleibt. Und wenn es nur die Erinnerung an ein paar gemeinsame Stunden ist.“
„Ich werde kommen“, versprach ich fest. Obwohl mein Ehrgefühl mich mahnte. Aber ich fühlte genau wie sie, - auch mir war bewusst, wir waren füreinander bestimmt.
Kapitel 03: Der Bastard
Zwei Stunden später klopfte ich leise an ihre Türe. Im ganzen Haus war es still und dunkel. Das Fest war vorüber, einige der Gäste nach Hause gefahren, die anderen schliefen in den bereitgestellten Gästezimmern. Aus den unteren Wirtschaftsräumen erklang noch gedämpftes Rumoren und entferntes Töpfeklappern. Die Küchenmägde waren noch mit Spülen beschäftigt und ein paar Diener räumten den Ballsaal auf.
Nur mit einer Kerze als Lichtquelle war ich durch die Gänge und die Treppe hinauf zu Rianas Schlafgemach geschlichen. Mit klopfendem Herzen wartete ich nun vor ihrer Türe. Schlief sie etwa bereits, von den Anstrengungen des Tages erschöpft? Vielleicht hatte sie auch gedacht, ich käme nicht mehr und sich enttäuscht niedergelegt.
Während ich noch grübelte, öffnete sich lautlos die Türe und Riana zog mich schnell hindurch und verriegelte sie hinter mir. Das leise Klicken kam mir überlaut vor. Im Zimmer verbreiteten wenige Kerzen ein sanftes, gedämpftes Licht. Noch immer hing der Duft des Lavendelbades in der Luft. Er beruhigte und betörte gleichzeitig meine Sinne. Immer noch kämpfte die Sorge um Rianas Zukunft mit meiner steigenden Erregung. Die Aussicht auf ein paar intime Stunden mit ihr siegten schließlich.
Dabei war ich jedoch immer noch entschlossen sie nicht zu entehren, dazu bedeutete sie mir einfach zu viel. Aber eine kurze gemeinsame Zeit, vielleicht ein paar Küsse und Liebkosungen, konnten keine allzu schlimme Verfehlung sein. Zu mehr würde ich es nicht kommen lassen. Schließlich war ich kein unerfahrener Jüngling mehr, den alleine die Nähe einer schönen Frau aus der Fassung brachte. Körperliche Freuden hatte ich außerdem schon des Öfteren genossen, die jungen Mägde auf Schloss Drachenfels waren meist willig und gewährten mir gerne ihre Gunst.
Riana trug einen Morgenmantel aus Seide und darunter ein langes weißes Nachtgewand, das züchtig bis zum Hals geschlossen war. Sie schien etwas verlegen, so wie sie jetzt mit über der Brust verschränkten Armen auf ihrem Bett saß. Ihr Haar, das sie den ganzen Tag zu einem kunstvoll geflochtenen Zopf um den Kopf getragen hatte, floss ihr nun in weichen Wellen über den Rücken. Ich war versucht es durch meine Finger gleiten zu lassen und verschränkte deshalb meine Hände hinter dem Rücken.
„Setz dich zu mir“, bat sie leise und errötete dabei sanft. Ihre Hand strich über den Platz neben ihr. Ich zögerte nur kurz und kam ihrer Aufforderung nach. Um sie besser ansehen zu können setzte ich mich seitlich auf die Bettkante. Sie tat es mir nach, so dass wir uns von Angesicht zu Angesicht gegenüber saßen. Unsere Augen suchten den Blick des anderen und schon war es um uns geschehen. Alle meine guten Vorsätze waren vergessen, als sich unsere Lippen trafen.
So weich und anschmiegsam lag sie in meinen Armen und ihr süßer Mund erwiderte unschuldig und fordernd zugleich meinen hungrigen Kuss. Wie von selbst fand meine Hand zu der festen Rundung ihrer Brust und legte sich sachte darum. Riana drängte sich mir entgegen, ihre Lippen öffneten sich und ließen meine Zunge ein. Sie stieß einen kleinen Seufzer aus, dann fühlte ich ihre Zungenspitze, die ihrerseits neugierig auf Erkundung ging. Ohne dass es uns recht zu Bewusstsein kam, sanken wir auf die Matratze nieder, noch immer eng aneinander geschmiegt.
Während wir uns küssten und liebkosten nestelten meine Finger an den Schleifen ihres Nachthemdes, öffneten eine nach der anderen. Ich löste mich von ihrem Mund und stützte mich auf meinen Ellenbogen auf.
„Darf ich?“ fragte ich leise und schob das Nachtgewand auf ihr Nicken auseinander. Sachte fuhren meine Fingerspitzen über ihre kleinen festen Brüste, die Brustwarzen, die sich zusammenzogen und aufrichteten und glitten weiter über die samtene Haut ihres Leibes.
Mein Gott, wie schön sie ist, fuhr es mir durch den Kopf. Ich konnte mich gar nicht satt sehen an diesem jungen, wundervollen Körper. Mein Geschlecht schwoll unter dem weit geschnittenen Stoff meiner Beinkleider an, drängte an ihren Oberschenkel. Meine Lippen suchten erneut ihren Mund und glitten dann ihren Hals herab und über ihre Brüste. Meine Hand auf ihrem Bauch wanderte langsam weiter, bis meine Finger an das Fließ seidiger Löckchen stießen. Die Verlockung sie dort zu streicheln war übermächtig und Riana kam meinen suchenden Fingern entgegen. Sie bäumte ihren Unterkörper auf, drängend und voller unschuldiger Begierde. Ihre Arme hielt sie um meinen Hals geschlungen und sie zog mich mit erstaunlicher Kraft näher zu sich. Nur allzu bereitwillig gab ich ihr nach, der Drang nach Befriedigung trieb mich dazu, mich an ihrem Körper zu reiben.
Wir verloren uns völlig in unserer Leidenschaft, ich spürte ihre Nässe an meinen Fingern, immer intensiver rieben sie ihre empfindlichste Stelle, so lange bis sich Riana leise stöhnend unter meiner Hand wand. Ihre Lust übertrug sich auf mich, ich ergoss mich mit einem unterdrückten Aufschrei in meine Beinkleider.
Eine Weile lagen wir schwer atmend nebeneinander, noch immer innig ineinander verschlungen. Langsam nur klärten sich meine Gedanken und mir wurde bewusst, was ich getan hatte. Obwohl ich mir fest vorgenommen hatte, Riana nicht anzurühren, hatte ich mich vergessen. Scham überflutete mich und ich rückte ein wenig von ihr ab. Sie öffnete die Augen und blickte mich mit noch immer verklärtem Blick an. Als wisse sie, woran ich dachte, hob sie ihre Hand und legte sie zärtlich an meine Wange.
Ich schüttelte niedergeschlagen den Kopf. „Bitte verzeih mir meine unbeherrschte Begierde. Es ist unverzeihlich, was ich getan habe...“
„Du hast nichts getan, was mir geschadet hätte. Im Gegenteil, du hast mich glücklich gemacht. Ich hatte nicht geahnt, dass es solche intensiven Gefühle gibt. Es war wunderschön.“
„Aber ich habe dich entehrt“, murmelte ich beschämt. „Das hätte nicht passieren dürfen...“
„Du hast mich nicht entehrt und das weißt du besser als ich. Nichts ist passiert, ich bin noch immer Jungfrau. Warum grämst du dich also?“
Ja, warum grämte ich mich? Trotz der Leidenschaft, die mich und sie mitgerissen hatte, war es nicht zur Vereinigung zwischen uns gekommen. Auch meine Finger hatten nur ihren äußeren Schambereich berührt. Wie sie schon sagte, war ihre Jungfräulichkeit noch intakt, ich konnte mir also höchstens vorwerfen, meinen primitiven Gelüsten nachgegeben zu haben. Trotzdem fühlte ich mich noch immer schlecht.
Riana schien nicht von Zweifeln geplagt, so wie ich. Sie zog nachlässig ihr Nachtgewand über der Brust zusammen und setzte sich auf. Liebevoll strich sie mir die feuchten Haare aus der Stirn und beugte sich dann zu mir herab um mich zu küssen. „Hat es dir nicht gefallen?“ fragte sie leise und sah mich lächelnd an. So viel Natürlichkeit strahlte sie aus, dass ich mein Tun nicht mehr gar so verwerflich fand. Ihre weiteren Worte vertrieben meine Zweifel noch mehr.
„Wir sind verlobt und lieben uns“, sagte sie und küsste mich erneut leicht auf den Mund. „Und du wirst lange fort sein. Die Erinnerung an diese Nacht wird mir helfen, wenn die Sehnsucht nach dir mich unglücklich macht. Deshalb vergälle sie mir nicht mit deinen Schuldgefühlen. Es gibt nichts, dessen wir uns schämen müssen.“
Sie legte sich wieder dicht neben mich, kuschelte sich in meinen Arm. Ihre Augen waren meinen so nahe, genau wie ihr Körper. Lust überflutete mich aufs Neue und sie lachte leise, als sie den Beweis spürte. „Siehst du, dein Körper findet auch nicht, dass wir Unrecht getan haben. Also denk nicht mehr darüber nach, sondern küss mich noch einmal...“
Als wir am nächsten Morgen aufbrachen war es noch finster. Ich gähnte verhalten, war ich doch in der Nacht kaum zum Schlafen gekommen. Kurz vor dem Morgengrauen hatte ich Riana, die schlafend in meinen Armen lag, einen letzten Kuss gegeben und mich dann vorsichtig erhoben. Sie war nicht aufgewacht, was mich zum einen erleichterte. Es ersparte mir die Qual ihre Tränen sehen zu müssen. Andererseits hätte ich ihr nur zu gerne nochmals meine Liebe erklärt und unseren gemeinsamen Treueschwur mit einem letzten innigen Kuss besiegelt.
Als ich in das Zimmer kam, das ich gemeinsam mit Boril bewohnte, saß er aufrecht in seinem Bett. Er sah übernächtigt aus, so als habe auch er in der Nacht kein Auge zugemacht. Seine Augen blickten mich düster an und er meinte gehässig. „So, so, du hast also die Nacht bei der süßen Riana verbracht. Nun ist sie wohl keine unschuldige Jungfer mehr. Was meinst du wird Vater dazu sagen? Du kennst seine Prinzipien...“
„Erzähl es ihm, wenn dir das ein Bedürfnis ist“ unterbrach ich ihn gleichgültiger als mir zumute war. Dennoch meinte ich eine Erklärung abgeben zu müssen. „Ich habe nichts getan, was meine Braut und ich bereuen müssten. Das werde ich notfalls vor dem Priester beschwören.“
„Deshalb siehst du auch so zerzaust und müde aus. Und deine Kleidung solltest du tunlichst wechseln, darin kannst du Vater nicht unter die Augen treten.“ Er grinste anzüglich als er mich von oben bis unten musterte.
„Ich muss sie sowieso gegen Reisekleidung tauschen“, brummte ich, drehte mich rasch um und begann mich auszuziehen. Ich hoffte, Boril hatte mein Erröten nicht bemerkt. Eilig schlang ich die Kleider zu einem Packen zusammen und ging zum Schrank um mir frische herauszunehmen. Als ich mich neu angekleidet umdrehte, hatte ich auch meine Verlegenheit überwunden.
„Und was ist mit dir? Du hockst in deinem Nachtgewand im Bett, so als hättest du alle Zeit der Welt. Vater will früh aufbrechen, damit wir eine möglichst große Wegstrecke schaffen.“ Ich hielt einen Moment inne, musterte ihn nachdenklich. Er sah aus, als würde er sich überhaupt keine Sorgen um die Zukunft machen.
„Wenn wir erst zu Hause sind, wird sich unser Leben gewaltig verändern“, gab ich zu Bedenken. „Fragst du dich nicht auch, was uns die Zukunft bringt? Mir scheint, dir macht es keine Angst, was auf uns zukommen könnte.“
Boril schwang die Füße aus dem Bett und stand auf. Mit einem Ruck zog er sich das Nachthemd über den Kopf und warf es in die Ecke. Nackt stand er vor mir und dehnte sich den Schlaf aus den Gliedern. Während er zum Schrank ging und in den Kleidern wühlte, meinte er über die Schulter: „Wieso Angst? Ich habe keine Angst, mir ist alles lieber, als auf dem Schloss zu versauern. Wir haben jahrelang das Kriegshandwerk erlernt, es wird Zeit, auszuprobieren, wie es ist, richtig zu kämpfen. Möchtest du nicht auch endlich wissen, wie es sich anfühlt ein Schwert in einen lebendigen Leib zu stoßen? Immer nur Strohpuppen zu durchbohren ist doch auf Dauer langweilig.“
„Du brennst darauf Menschen zu ermorden?“ fragte ich fassungslos. „Das kann nicht dein Ernst sein. Jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes...“
„Türken nicht, schließlich glauben sie nicht an Christus. Selbst der Papst sagt sie wären Feinde, die vernichtet werden müssen. Wenn wir sie nicht aus unserem Land vertreiben, so werden wir uns bald alle fünfmal täglich auf Knien gegen Mekka wenden und einen Gott anbeten, der nicht der unsere ist. Bevor ich das tue jage ich den Kerlen doch lieber mein Schwert in den Wanst.“
Unser Disput wurde durch lautes Klopfen an der Türe unterbrochen. Gleich darauf trat Vater ein. Er musterte uns streng und brummte: „Seid ihr fertig? Unten steht schon die Frühmahlzeit auf dem Tisch und die Pferde sind bereits gesattelt. Trödelt nicht herum, sobald die Sonne aufgeht werden wir reiten.“ Er erwartete keine Antwort, drehte sich um und verließ das Zimmer. Er war sich sicher wir würden ihm unverzüglich folgen, was wir auch taten.
Die Pferde standen gesattelt und gezäumt bereit als wir das Haus verließen. Am Sattelhorn meines Reittieres war Placidus angebunden und tänzelte nervös. Ich konnte ihm seine Unruhe nachfühlen, wie er wäre auch ich lieber hiergeblieben bei der Frau, der unser beider Herz gehörte. Aber das war leider unmöglich.
Ich ging zu ihm und legte meine Hand auf seine bebenden Nüstern. Er scheute zuerst, dann schien er mich zu erkennen und blieb ruhig stehen. „Wir werden Beide zu ihr zurückkehren“, versprach ich ihm leise. „Und dann wird uns niemand mehr von ihr trennen.“ Während meiner Worte glitt meine Hand an meine Brust und umfasste das Medaillon, dass Riana mir in der Nacht gegeben hatte. Es ließ sich aufklappen und in seinem Inneren befand sich ihr Bildnis, winzig klein von Künstlerhand geschaffen.
„Es soll dich daran erinnern, möglichst schnell zu mir zurückzukehren“, hatte sie gesagt als sie mir die Kette überstreifte. In Ihren Augen konnte ich Tränen erkennen und hatte sie ihr fortgeküsst.
„Ich werde wiederkommen, sobald es meine Mission zulässt“, hatte ich mit erstickter Stimme geantwortet. Und ihr den silbernen Anhänger als Gegengeschenk gemacht, den ich seit meiner Kindheit trug. Auf ihm war das Wappen meiner Familie eingeprägt, es sollte bald auch das ihre werden.
Der Abschied von Georgi verlief knapp. Mein Vater umarmte ihn kurz, dann schwang er sich auf sein Pferd und ritt an. Boril und ich hoben die Hand zum Gruß und folgten ihm rasch nach. Ich warf einen letzten Blick hinauf zu dem Fenster hinter dem Rianas Stube lag. Sie stand am offenen Fenster und winkte mir zu. Ihr loses Haar wurde von einem Windhauch erfasst, er spielte übermütig damit, so dass es ihr Gesicht verbarg. Dann waren wir vorüber und mir würde für lange Zeit nur noch die Erinnerung an ihr Antlitz bleiben.
Auf dem Heimweg wurden wir von schlechtem Wetter überrascht, was unsere Reise um Tage verzögerte. Die ausgefahrenen Wege waren glitschig und unsere Pferde kamen nur mühsam durch den Schlamm, der ihnen oft bis an die Fesseln reichte. Zudem sogen sich unsere Kleider und die Gepäckstücke mit Wasser voll, was den Tieren zusätzliche Last auflud. Dadurch ermüdeten sie rasch, so dass wir öfter Pausen einlegen mussten. Als wir Schloss Drachenfels endlich erreichten, waren Pferde und Reiter gleichermaßen erschöpft.
Nach einem ausgiebigen Bad ging ich erholt nach unten um mit Vater und Bruder das Abendessen einzunehmen. Da sich Placi vehement geweigert hatte, dem Pferdeknecht in den ihm unbekannten Stall zu folgen, war mir nichts anderes übrig geblieben als ihn selbst einzustellen, zu putzen und zu füttern. Der Stallknecht hatte daneben gestanden und hin und wieder auf meine Anweisung das Pferd berührt. Schließlich hatte der Hengst ihn geduldet und sich dann sogar von ihm striegeln lassen. Endlich konnte ich beruhigt den Stall verlassen, ich war mir sicher, Placi würde es fortan dulden, von dem Knecht versorgt zu werden.
Hungrig und frohgemut betrat ich die Stube und merkte sofort, dass Streit in der Luft lag. Ein Blick auf Vaters geduckte Haltung genügte mir zu sagen, dass Vorsicht angebracht war. Rasch warf ich einen Blick zu Aleko, der eingeschüchtert auf seinem Platz saß. Aber er schien ausnahmsweise einmal nicht der Verursacher von Vaters Zornausbruch zu sein. Also konnte es nur Boril sein, denn sonst befand sich niemand im Raum.
Gerne hätte ich mich wieder zurückgezogen, ich hatte mich nach den Strapazen der Reise auf einen ruhigen Abend vor dem Kamin gefreut. Nach Streitereien stand mir absolut nicht der Sinn. Doch Vaters finsterer Blick zwang mich zum Bleiben. Also setzte ich mich wortlos neben Aleko und drückte ihm unter dem Tisch beruhigend das Bein. Ich wusste, wie sehr er immer unter den Wutausbrüchen unseres Vaters litt, selbst wenn sie nicht ihm galten.
Was hatte Boril getan? fragte ich mich, was Vater so in Rage brachte. Normalerweise gelang es ihm stets gut sich bei ihm beliebt zu machen. Ich hütete mich jedoch eine diesbezügliche Frage zu stellen, ich wollte nicht zwischen die Fronten geraten.
„Warum ist es ausgeschlossen, dass ich mir ebenfalls eine Frau von Adel suche?“ rief Boril gerade aufgebracht. Entweder hatte er in seinem Zorn gar nicht bemerkt, dass ich das Zimmer betreten hatte. Oder aber es war ihm gleichgültig, was ich von dem Streit mitbekam. Ohne die Stimme zu senken schimpfte er weiter:
„Ich bin Euer zweitgeborener Sohn, mir steht es zu standesgemäß zu heiraten. Falls ihm“, er deutete auf mich, „etwas zustößt, dann liegt es an mir, den Namen der Familie weiterzutragen. Das kann ich nicht, wenn ich mit einer Frau niederen Adels Vorlieb nehmen muss. Oder wollt Ihr, dass Eure Enkel aus einem minderwertigen Stall stammen?“
Vater übersah seine wütend blitzenden Augen und blickte ihn eine Weile kalt an. Dann sagte er mit leiser, aber gnadenlos deutlicher Stimme: „Ich denke, es ist an der Zeit dir zu sagen, wo dein Platz in der Familie ist. Du bist nicht mein zweitgeborener Sohn, sondern nur ein Bastard. Ich habe dich in die Familie aufgenommen, weil es der Wunsch deiner Mutter auf dem Sterbebett war. Ich habe sie geliebt und ich liebe auch dich da du ihrem Leib entstammst. Zweifellos wurdest du von mir gezeugt, das ist nicht zu übersehen. Aber dennoch bist du ein Bastard, so wie noch etliche mehr hier im Schloss herumlaufen. Und als Bastard kannst du niemals den Namen der Familie weitertragen. Deshalb ist es auch unnötig dir eine Braut von edler Herkunft zu suchen, kein hochgestellter Adeliger würde seine Tochter einem Bastard zur Frau geben. Nimm dir eine von niederem Adel oder meinetwegen auch eine Bürgerliche. Es ist mir gleich. Du erbst von mir ein Haus und ein Stück Land, von dem du gut leben kannst. Ansonsten hast du keinerlei Ansprüche.“
Boril war während seiner Worte weiß geworden wie eine Wand. Er schnappte nach Luft wie ein Fisch auf dem Trockenen und fand keine Worte, die das ausdrücken konnten was er empfand. Tränen der Enttäuschung standen in seinen Augen, er wischte sie zornig weg. Endlich begann er zu reden, ebenso leise und entschlossen, wie Vater zuvor. Er ging ganz nahe zu ihm, so dass sie sich von Angesicht zu Angesicht gegenüberstanden.
„Ich bin also nur Euer Bastard, nicht wert, Euren Namen weiterzutragen. Nicht wert, Eurem wertvollen, hochgeborenen Erben das Wasser zu reichen. Seht mich an, ich bin Euer Fleisch und Blut, Eurem Erben zum Verwechseln ähnlich. Aber ich bin es nicht wert, den Namen fortzutragen, sollte Malamir etwas zustoßen. Morgen zieht er in den Krieg, was tut Ihr wenn er nicht wiederkommt? Wollt Ihr Euch dann auf diese kleine Missgeburt verlassen, die Ihr mit Eurem letzten Tropfen Samen gezeugt habt? Schaut ihn doch an, den Wurm, welche edlen Nachkommen kann er Euch wohl bringen?“
Vater erwiderte mit unbewegtem Gesicht seinen Blick und als Boril einmal stockte um tief Luft zu holen unterbrach er ihn grob: „Malamir wird aus dem Krieg zurückkommen und er wird unseren Namen weitertragen. Ebenso wird mir auch noch gelingen aus Aleko einen rechten Mann zu machen. Wenn er mit mir aus Ungarn zurückkehrt, wirst du ihn nicht wiedererkennen. Und jetzt ist Schluss mit diesem Unsinn. Bescheide dich in dein Los, so schrecklich ist es schließlich nicht. Du wirst nach meinem Tod dein Auskommen haben und ein durchaus angesehener Mann sein. Aber du wirst niemals der Herr dieses Schlosses sein und auch nie meinen Namen tragen.“
In Borils Augen lag jetzt eine fast unheimliche Ruhe. Er musterte Vater lange schweigend, dann verbeugte er sich vor ihm. Doch anstatt klein beizugeben, sagte er tonlos: „Das werden wir ja sehen - Vater!“
Er drehte sich auf dem Absatz um und ging mit großen Schritten durch die Türe. Weder mich noch Aleko würdigte er noch eines Blickes. Als die schwere Haustüre hinter ihm zufiel, klang es merkwürdig endgültig. Kurz darauf ertönte das Geklapper von Pferdehufen, das sich schnell entfernte.
Ich sagte eine Weile nichts, zu befangen war ich von dem, was sich da vor meinen Augen und Ohren abgespielt hatte. Erst als Alekos leises Schluchzen in mein Bewusstsein drang erwachte ich aus meiner Erstarrung. Fürsorglich legte ich meinen Arm um seine mageren Schultern um ihn zu beruhigen.
„Er kommt schon wieder!“ brummte Vater barsch und funkelte Aleko wütend an. „Und du hör auf zu flennen wie ein altes Weib. Boril sprach die Wahrheit, mit dir habe ich wirklich nichts Rechtes gezeugt. Ich sollte dich zu deiner Mutter ins Kloster schicken, vielleicht taugst du ja als Betbruder.“
Ich spürte wie Aleko unter den harten Worten zusammenzuckte und drückte ihn kurz an mich. Doch es gelang mir nicht, seinen Tränenfluss zu stoppen. Aufheulend wand er sich aus meinem Arm und sprang auf. Wie von Teufeln gehetzt wischte er aus dem Zimmer. Ich erhob mich ebenfalls um ihm nachzugehen.
„Bleib hier!“ herrschte Vater mich an. „Sind denn alle meine Söhne verrückt geworden? Boril ist anmaßend und Aleko eine verweichlichte Memme. Zeig du mir wenigstens, dass du mir ebenbürtig bist.“
„Ich denke, Ihr seid ungerecht, Vater. Sowohl was Boril als auch was Aleko betrifft. Warum seid Ihr bloß so hart?“
„Fällst du mir auch noch in den Rücken?“ tobte er. „Wo bleibt dein Respekt, deinem Vater gegenüber?“
„Respekt muss man sich verdienen, auch den von seinen Kindern. Ihr habt Boril gedemütigt. Und Ihr habt ihm die ganzen Jahre etwas vorgegaukelt. Selbst ich dachte, er wäre mir gleichgestellt. Das habt Ihr ihn sein ganzes Leben glauben gemacht und nun lasst Ihr ihn fallen. Kennt Ihr ihn wirklich so wenig? Er wird diese Demütigung nicht auf sich sitzen lassen, sondern sich dafür rächen. Ich sah es seinen Augen an.“
„Ach, dummes Zeug“, knurrte er unwirsch. „Er wird eine Zeitlang durch die Gegend reiten und sich danach in einer Schänke besaufen. Und sich irgendwann besinnen, dass er es nirgends so gut haben wird wie hier. Wo sonst hat ein Bastard derart viele Privilegien? Die kann er ja auch weiter genießen, schließlich habe ich ihn nicht verstoßen. Glaube mir, er wird zurückkommen und sich in sein Los fügen.“
Da war ich mir ganz und gar nicht sicher, aber ich schwieg.
Kapitel 04: Borils Rache
Nach der Abendmahlzeit, die Vater und ich in dumpfem Schweigen zu uns genommen hatten stand ich wortlos auf um nach Aleko zu suchen. Ich brauchte nicht lange nachdenken, wo ich ihn suchen musste und erklomm gleich die Holztreppe, die in die kleine, unbewohnte Kammer direkt unter dem Giebel des Daches führte. Sie war schon immer Alekos Zufluchtsort gewesen wenn er unglücklich war. Ich hatte ihn schon oft hier oben aufgesucht um ihn zu trösten.
Die Kammertüre war nur angelehnt und schon auf den letzten Stufen hörte ich sein verzweifeltes Schluchzen. Meine Kehle wurde eng als ich daran dachte, wie viel Unrecht dieser sensible Junge schon über sich ergehen lassen musste. Vater wird ihn mit seiner Härte noch zerbrechen, dachte ich voller Ingrimm und trat durch die Türe. Warum nur war er seinen Kindern gegenüber so grausam und feindselig eingestellt? Das hatte ich mich schon oft gefragt ohne je eine Antwort zu finden. Seine Töchter schienen für ihn überhaupt nicht zu existieren, ebenso wenig seine zahlreichen Bastarde. Und Aleko erging es nicht viel besser, einzig dass er in der Familie geduldet wurde und eine strenge Erziehung bekam. Ansonsten war er für Vater eher ein Born ständigen Ärgernisses.