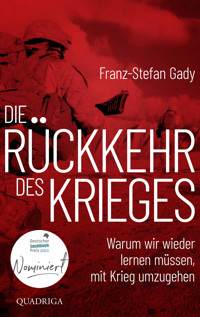
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Quadriga
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Wer wissen will, warum es zum Krieg kommt, wie er geführt wird und was er mit den Beteiligten macht, der kommt an diesem exzellent geschriebenen Buch von einem der führenden europäischen Militäranalysten und Militärhistorikern nicht vorbei. Ein Standardwerk.«
Prof. Dr. Carlo Masala
Die Kriege in der Ukraine und in Nahost sind Symptom einer sich seit Jahrzehnten anbahnenden Zeitenwende: Militärische Konfrontation wird zunehmend wieder als legitimes Mittel zur Fortsetzung der Politik angesehen. Ausgehend von diesem Moment, aber auch vorangegangene Konflikte mit einbeziehend, analysiert Franz-Stefan Gady die konstante Natur des Krieges sowie den sich wandelnden Charakter der Kriegsführung. Er beschreibt, warum Kriege in naher Zukunft immer wahrscheinlicher sind, warum der Mensch trotz aller technischen Dimensionen immer im Zentrum der Kriegsführung stehen wird und wie wir uns auf kommende Konflikte vorbereiten können − falls wir sie nicht verhindern können.
»Ein Buch für alle, die sich sachlich und unaufgeregt mit einem schweren Thema befassen möchten. Gady gelingt die seltene Kunst, zu erklären und gleichzeitig kurzweilig zu sein.«
Dr. Florence Gaub, Forschungsdirektorin der NATO-Verteidigungsakademie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 435
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber den AutorTitelImpressumWidmungVerseVorbemerkungEinleitungErster Teil: Warum der Kriegwieder zurück istKapitel 1: Fehleinschätzungen als KriegsgrundIndividuelle FehleinschätzungenHybris als der KriegsgrundHybris schlägt StaatsräsonPersönliches Ehrverständnis und FurchtAutokraten und Diktatoren als potenzielle GegnerKapitel 2: Technologische FehleinschätzungenWunderwaffen und TechnologiekultKriegsführung und KIGaza und der TechnologiekultDie Gefahr der KomplexitätInduktive versus abduktive LogikDie Gefahr der KI im NuklearkriegDie Gefahr der KI im InformationskriegKapitel 3: Strukturelle FehleinschätzungenDas Ende des sicherheitspolitischen Konsenses in WashingtonNachfolgekriege werden zunehmenZweiter Teil: Was wir über Krieg wiederlernen müssenKapitel 4: Die konstante Natur des KriegesKrieg ist GewaltKrieg ist ein Wettbewerb des WillensKrieg ist DialektikKrieg ist ZufallKapitel 5: Der wechselnde Charakter der KriegsführungKriegsführung ist beinflusst durch DoktrinKriegführung ist beinflusst von Struktur und Designder StreitkräfteKriegsführung ist beeinflusst durch GeografieKriegsführung ist beeinflusst von den Domänen, in denen gekämpft wirdKriegsführung ist beeinflusst durch RessourcenKriegsführung ist beeinflusst durch TechnologieDritter Teil: Kriege der ZukunftKapitel 6: Was tun, wenn Kriege wahrscheinlicher werden?Planungen für einen ZweifrontenkriegDie Rolle DeutschlandsKapitel 7: Mit welchen Kriegen ist zu rechnen?Ein NATO-Krieg gegen Russland (und China)SchlussDankAusgewählte LiteraturAnmerkungenÜber dieses Buch
»Wer wissen will, warum es zum Krieg kommt, wie er geführt wird und was er mit den Beteiligten macht, der kommt an diesem exzellent geschriebenen Buch von einem der führenden europäischen Militäranalysten und Militärhistoriker nicht vorbei. Ein Standardwerk.« Prof. Dr. Carlo Masala Die Kriege in der Ukraine und in Nahost sind Symptom einer sich seit Jahrzehnten anbahnenden Zeitenwende: Militärische Konfrontation wird zunehmend wieder als legitimes Mittel zur Fortsetzung der Politik angesehen. Ausgehend von diesem Moment, aber auch vorangegangene Konflikte mit einbeziehend, analysiert Franz-Stefan Gady die konstante Natur des Krieges sowie den sich wandelnden Charakter der Kriegsführung. Er beschreibt, warum Kriege in naher Zukunft immer wahrscheinlicher sind, warum der Mensch trotz aller technischen Dimensionen immer im Zentrum der Kriegsführung stehen wird und wie wir uns auf kommende Konflikte vorbereiten können? falls wir sie nicht verhindern können. »Ein Buch für alle, die sich sachlich und unaufgeregt mit einem schweren Thema befassen möchten. Gady gelingt die seltene Kunst, zu erklären und gleichzeitig kurzweilig zu sein.« Dr. Florence Gaub, Forschungsdirektorin der NATO-Verteidigungsakademie
Über den Autor
Franz-Stefan Gady ist unabhängiger Analyst und Militärberater. Darüber hinaus ist er Senior Fellow am Institute for International Studies in London und Adjunct Senior Fellow am Center for New American Security in Washington DC. Er berät Regierungen und Streitkräfte in Europa und den Vereinigten Staaten in Fragen der Strukturreform und der Zukunft der Kriegsführung. Feldforschungen und Beratungstätigkeiten führten ihn mehrmals in die Ukraine, nach Afghanistan und in den Irak, wo er die ukrainischen Streitkräfte, die afghanische Armee, sowie NATO-Truppen und kurdische Milizen bei verschiedenen Einsätzen begleitete. Er ist auch Reserveoffizier.
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Copyright © 2024 byBastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- undData-Mining bleiben vorbehalten.
Textredaktion: Ludger Ikas, Ulrike Strerath-Bolz
Umschlaggestaltung: Massimo Peter-Bille
Einband-/Umschlagmotiv: © Gorodenkoff/shutterstock
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-6020-1
quadriga-verlag.de
lesejury.de
Für meine Eltern, Franz und Ingrid, die mich immer unterstützt haben.
The Sinister Spirit sneered: ›It had to be!‹
And again the Spirit of Pity whispered, ›Why?‹
Aus »And There Was a Great Calm«von Thomas Hardy; Gedicht zur Unterzeichnung des Waffenstillstands, 11. November 1918
Die Rückkehr des Verdrängten, des Unfassbaren, rüttelt uns wach. Schauderhafte Realität [zer]stört
unsere [Traum]Welt, penetriert uns in unserer präpotenten Bequemlichkeit. Wie gedankenlos
angenehm war das Verharmlosen und das einfach Ignorieren.
Winfried Franz Ganster (2024)
Vorbemerkung
Die Idee für dieses Buch entstand in den Jahren 2022 und 2023. In dieser Zeit, nach Beginn der russischen Vollinvasion der Ukraine, beriet ich verstärkt amerikanische, britische, deutsche und österreichische politische Entscheidungsträger über die militärische Lage im umkämpften Land. Während dieser Briefings kamen auch immer wieder grundlegende Fragen zu Krieg und Kriegsführung, zur Struktur von Streitkräften, der Signifikanz von Militärdoktrinen oder zur Effektivität einzelner Waffensysteme zur Sprache. Im Herbst 2023 durfte ich dann auf Einladung von Prof. Dr. Johannes Pollak, Rektor der Webster Universität in Wien, einen Einführungskurs zur Militärtheorie und Militärgeschichte halten. Meine Vorlesungen strukturierte ich entlang der Grundsatzfragen aus den Briefings. Anfang 2024 begann ich damit, die Aufzeichnungen zu den Vorlesungen in eine Art Handbuch zu Krieg und Kriegsführung zu verwandeln. Teile des Textes wurden in abgeänderter Form bereits in verschiedenen Publikationen veröffentlicht.
Einleitung
Die Wahrscheinlichkeit
des Eintretens des Unerwünschten,
des Verdrängten, ist groß,
denn,
was du verdrängst,
das sucht dich,
findet dich
nimmt dich gefangen.
In der Betrachtung
der Ereignisse des Vergangenen
wird das wiederkehrende Wechselspiel
der Geschichte sichtbar.
Winfried Franz Ganster (2024)
»Zieh deine Ausrüstung an und lauf in den Bunker«, hörte ich jemanden rufen. Schnell griff ich nach Helm und Splitterschutzweste und rannte zum Bunker vor meiner Unterkunft. In der Ferne konnte ich zwei Detonationen hören. Nur ganz leicht spürte ich die Schockwellen. Dann setzte Maschinengewehrfeuer ein, das aber nach wenigen Garben verstummte. Eine eigenartige Stille folgte.
Ich hatte gerade den ersten Artillerieangriff mit Mörsern in meinem Leben erlebt. Es war der Sommer 2012 in Ostafghanistan. Ich befand mich auf einem kleinen Kampfvorposten der US Army in der Provinz Paktia auf etwa 2400 Metern Höhe über dem Meeresspiegel. Die Stimme, die mich gewarnt hatte, gehörte einem amerikanischen Unteroffizier: einem Hundeführer, der mit seinem Vierbeiner in der fensterlosen Kammer neben meiner einquartiert war. Einige Tage später sollte uns der Hund gute Dienste leisten, als er eine Sprengfalle auf einem unserer Patrouillenwege aufspürte.
Zum Zeitpunkt des Angriffs war ich erst seit etwa 24 Stunden auf dem Stützpunkt. Dieser wurde, wie ich dann feststellte, fast täglich von einem mobilen Mörserteam der Taliban, die auf Motorrädern unterwegs waren, beschossen.
Tage zuvor hatte ich in einer amerikanischen Transportmaschine gesessen, die mich von der Luftwaffenbasis Bagram, etwa 50 Kilometer nördlich von Kabul, auf einen US-Stützpunkt in der Provinz Khost im Osten Afghanistans fliegen sollte, und von dort im Hubschrauber weiter nach Paktia zu reisen. Wegen des Lärms im Laderaum der Maschine setzte ich mir Kopfhörer auf und flog zu Neil Diamonds »Solitary Man« in die afghanische Nacht. Mit dem Ende des Liedes war ich plötzlich im Krieg – zumindest kam es mir so vor. Denn sobald die C-130 auf der staubigen Landebahn aufsetzte, sah ich mich mit dem konfrontiert, was ich bis dahin nur aus Büchern und Filmen kannte: mit Gefallenen und Verwundeten, Hinterhalten und Feuerüberfällen, Sprengfallen und Kriegsgefangenen.
Noch heute denke ich oft an diesen Flug, den ich als einen zugleich fließenden und abrupten Übergang zwischen Frieden und Krieg erlebte. Ebenso ist mir ein Satz besonders in Erinnerung geblieben, den ich damals im Osten Afghanistans in einem mitgebrachten Buch las. »Mein Interesse war abstrakt, betraf die Theorie und Philosophie der Kriegsführung, vor allem ihre metaphysische Seite«, schrieb T. E. Lawrence in Die Sieben Säulen der Weisheit über seine militärische Bildung. »Jetzt im Feld war alles konkreter.« Das Abstrakte mit dem Konkreten zu verbinden – das sollte zur Leitlinie in meinem Beruf als Militäranalyst werden.
Es ist auch der Faden, der sich durch dieses Buch zieht, denn es handelt von der abstrakten Theorie des Krieges und von der konkreten Art und Weise, wie Krieg geführt wird. Der Titel Die Rückkehr des Krieges meint vor allem eine Rückkehr der Idee des Krieges in unseren Köpfen. Es ist ein Plädoyer dafür, dass wir uns als Gesellschaft mit diesem Thema im 21. Jahrhundert wieder verstärkt auseinandersetzen sollten, um die tatsächliche Rückkehr militärischer Konflikte aktiv verhindern zu können.
In diesem Buch versuche ich einerseits, zu erklären, warum Kriege in Zukunft global und damit auch in Europa wieder wahrscheinlicher werden, und andererseits, warum es wichtig ist, Grundprinzipien wie die permanente Natur des Krieges und den wechselnden Charakter der Kriegsführung zu verstehen. Nicht zuletzt will ich skizzieren, was die Hauptaufgabe von Streitkräften in Europa, den USA und anderen mit uns verbündeten Teilen der Welt in Zukunft sein sollte und welche Form zukünftige Kriege haben könnten.
Das Buch gliedert sich in drei unterschiedlich lange Teile. Im ersten Teil erläutere ich, warum wir uns in einem neuen Zeitalter der Fehleinschätzungen befinden, die Kriege wieder wahrscheinlicher machen. Der zweite Teil des Buches erklärt, angelehnt an den preußischen Offizier und Kriegsphilosophen Carl von Clausewitz, einzelne Faktoren, die den Krieg bestimmen, sowie Faktoren, die die Kriegsführung beeinflussen. Der dritte und letzte Teil des Buches geht auf konkrete Kriegsszenarien ein, die vor allem für Europa und den gesamten Westen relevant sein dürften, und stellt die Frage, wie sich unsere Streitkräfte darauf vorbereiten sollen. Vor allem Deutschland mit seinem Potenzial, die führende Militärmacht Europas zu werden, kommt hier eine besondere Rolle zu.
Dieses Buch ist ausdrücklich keine wissenschaftliche Abhandlung über Militärtheorie oder Militärgeschichte, wenngleich natürlich Beispiele und Gedanken aus beiden Bereichen herangezogen und, so hoffe ich, verständlich erläutert werden. Das Buch ist auch keine vollständige Studie der modernen Kriegsführung. Luft-, See- und vor allem nukleare Kriegsführung werden eher am Rande gestreift. Das Hauptaugenmerk liegt auf der hoch intensiven Landkriegsführung, die in meinen Augen nach wie vor die wichtigste Domäne der Kriegsführung ist.
Bis vor Kurzem herrschte innerhalb der politischen Klasse Europas und vor allem im deutschsprachigen Raum ein ausgeprägtes Desinteresse an allem, was mit den Themen Krieg und Kriegsführung zu tun hat. Die Mehrheit der politischen Entscheidungsträger träumte den gerechten Traum von einer Welt ohne Krieg und Konflikt – zumindest auf eigenem Staatsgebiet. Sich mit militärischen Themen auseinanderzusetzen schien im Europa des 21. Jahrhunderts ebenfalls nicht mehr vonnöten zu sein. Leider war dieser sicherheitspolitische Dornröschenschlaf mit dem 24. Februar 2022 – dem Tag, an dem Russland die Vollinvasion der Ukraine startete – vorbei, wenngleich diese Tatsache noch immer nicht in allen Köpfen angekommen zu sein scheint.
Eine beachtliche Anzahl an Aktivisten, Politikern, Wirtschaftstreibenden hält es vielmehr nach wie vor für klüger, an einer Politik festzuhalten, die sich damit begnügt, auf die Einhaltung internationaler Normen wie des Völkerrechts zu pochen und mehr oder weniger abstrakt zum Frieden und allgemeiner Abrüstung aufzurufen. Die Forderung »Die Waffen nieder!«, so der Titel eines Buches der Friedensaktivistin und Nobelpreisträgerin Bertha von Suttner aus dem Jahr 1889, mag moralisch richtig klingen. Pazifismus ist ein überaus nobler Gedanke. Eines meiner Lieblingslieder ist Reinhard Meys »Nein, meine Söhne gebe ich nicht«. Darin heißt es unter anderem:
Sie werden nicht in Reih’ und Glied marschieren,
nicht durchhalten, nicht kämpfen bis zuletzt,
auf einem gottverlass’nen Feld erfrieren,
während ihr euch in weiche Kissen setzt.
Ich mag das Lied, weil es eine schlichte Wahrheit beinhaltet. Welcher Vater, zumal einer, der wie ich in einer Armee gedient hat oder gar im Krieg gewesen ist, möchte denn seine Kinder »zum Abschlachten« freigeben? Diese Formulierung verwendete Mey einmal bei einem Live-Konzert in den 1980er-Jahren, und irgendwo muss ich sie ein paar Jahre später gelesen haben. Sie beeindruckte mich so, dass ich sie in den frühen 1990er-Jahren in mein Tagebuch notierte. Die Feststellung des antiken griechischen Geschichtsschreibers Thukydides (um 454 bis 396–399 v. Chr.), wonach es nun mal so sei, dass im Frieden Söhne ihre Väter begraben, im Krieg aber die Väter ihre Söhne, ist so gesehen an grausamer Nüchternheit nicht zu überbieten.
Doch leider ist Pazifismus keine praktische, zielführende Antwort auf die Frage, wie sich Krieg vermeiden lässt. Erst recht nicht jener anhaltende parasitäre Pazifismus, der noch sehr stark im deutschsprachigen Europa verbreitet ist. Er baut insgeheim darauf, dass andere die schmutzige Arbeit des Krieges erledigen, und leugnet gleichzeitig die Grundprämisse jeder effektiven Sicherheitspolitik: Die Einsatzbereitschaft von Streitkräften muss zum Zweck der militärischen Abschreckung und Friedenssicherung glaubhaft gewährleistet sein. Pazifisten und Friedensaktivisten sind naiv oder zumindest schlecht informiert, wenn sie glauben, militärische Stärke sei per se etwas Schlechtes und könne nur in einer Eskalationsspirale des Wettrüstens enden. Eine solche Eskalation geschieht nämlich nur dann, wenn die Verteidigungspolitik von der Außenpolitik (zusammengefasst als Sicherheitspolitik eines Landes) entkoppelt wird beziehungsweise diese bestimmt, wie es etwa im Deutschen Reich vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs der Fall war. Diese Gefahr sehe ich im 21. Jahrhundert in Europa nicht. Die militärische Einsatzfähigkeit von Europas Streitkräften ist im Übrigen auf einem so niedrigen Niveau, dass wir auf Jahre hinaus nicht von Aufrüstung, sondern von Nachrüstung reden werden, und dass sie in nur sehr begrenztem Maße potenzielle Aggressoren abschrecken kann.
Dabei ist gerade die militärische Abschreckung die Grundvoraussetzung für eine umfassende, wirksame Verteidigung Europas. In der Theorie bedeutet dies, dass man durch die Bildung gut ausgebildeter, hochgerüsteter Streitkräfte einem möglichen Aggressor zu verstehen gibt, dass jede Aggression für ihn selbst mit erheblichen Kosten verbunden wäre. Gleichzeitig gilt es, die richtige Balance zwischen Nachrüstung und Dialog mit potenziellen Gegnern zu finden, um ein Wettrüsten zu vermeiden. Eine nachhaltige Sicherheitspolitik versucht dieses Gleichgewicht den geopolitischen Umständen entsprechend immer wieder neu zu kalibrieren. Tatsächlich ist diese Maxime aber seit den Zeiten des Römischen Reiches bekannt. »Wer den Frieden will, der bereite sich auf den Krieg vor«, meinte einst der römische Feldherr Vegetius. Trotzdem setzen viele immer noch die militärische Abschreckung in Deutschland und anderen Teilen Europas mit Kriegstreiberei gleich und verbinden sie mit der Urkatastrophe Europas, dem Ersten Weltkrieg, sowie dem nuklearen Wettrüsten während des Kalten Krieges.
Eine ausbalancierte Integration des Abschreckungsprinzips war nie wirklich Teil der europäischen strategischen Kultur. In Europa haben wir aus diesem Grund auch nie so ganz gelernt, mit Krieg umzugehen. Zwei Weltkriege, die beide ihren Ursprung in Europa – allen voran im deutschsprachigen Europa – hatten, brachten diesen Kontinent an den Rand des Ruins. Die Antwort großer Teile Europas auf diese Erfahrung bestand freilich darin, den Krieg selbst zu ächten und ein postkriegerisches beziehungsweise postheroisches Weltbild als identitätstiftendes Ideal anzunehmen.
Was jedoch vor allem im deutschsprachigen Raum häufig übersehen wurde und wird: Die friedliche Entwicklung nach 1945 verdankt sich letztlich amerikanischen nuklearen und konventionellen Waffen und einer von den USA formulierten strategischen Abschreckungspolitik, mittels eines prekären nuklearen Schreckensgleichgewichts, das Europa ohne heißen Krieg durch die Jahre des Kalten Krieges brachte. Nach dessen Ende suchten wir Europäer im Schatten der amerikanischen militärischen Hegemonie Schutz, um ungestört das Friedensprojekt – die Europäische Union (EU) – zu vertiefen und zu erweitern.
Diese Zeit der amerikanischen Hegemonie, oft auch »unilaterarer Moment« genannt, ist jedoch vorbei. Die USA müssen ihre Militärmacht in jedem Krisenfall, in den China und/oder Russland involviert sind, zwischen zwei Kontinenten – Asien und Europa – aufteilen, weil sie immer damit rechnen müssen, dass eine der beiden Großmächte die Gunst der Stunde einer Krise für eigene Militärabenteuer ausnutzt. Selbst für die stärkste Militärmacht der Welt ist ein Zweifrontenkrieg gegen Peking und Moskau zu viel. Hinzu kommt, dass in den USA selbst inzwischen der lange bestehende sicherheitspolitische Konsens über die eigene Rolle in der Welt nicht mehr existiert. Wie lange werden die USA noch bereit sein, Europa zu schützen? Bei US-Präsidentschaftswahlen können 300 000 Wechselwähler jedenfalls mehr Einfluss auf die Zukunft der NATO und damit der europäischen Sicherheitspolitik haben als alle Staats- und Regierungschefs Europas zusammen. Daher geht dieses Buch auch ausführlich auf die amerikanische Innenpolitik und ihren Einfluss auf die Sicherheitspolitik Washingtons ein.
Wie ich zeigen werde, ist der Schutz Europas für die USA nicht allein eine Frage des politischen Willens, sondern vor allem eine der militärischen Kapazitäten, die auch in den USA nicht unendlich sind. Ihre Rolle als Weltpolizist werden sie jedenfalls nicht weiter ausüben können. Das wiederum wird unweigerlich weltweit zu mehr Konflikten führen, die obendrein auch schwieriger zu beenden sein werden.
Wir Europäer müssen deshalb wieder lernen, dass Krieg und militärische Macht in vielen Teilen der Welt als legitime Mittel gelten, die eigenen nationalen Interessen durchzusetzen. Entsprechend gilt es, auch im deutschsprachigen Europa eine strategische Kultur zu etablieren, in der militärische Optionen, also die Option, die eigenen Streitkräfte zur Erhaltung des europäischen Wertesystems und Wohlstands einzusetzen – auch gegen Großmächte –, Bestandteil einer nachhaltigen und gut auf die jeweiligen Umstände kalibrierten Sicherheitspolitik sind. Eine klug formulierte und implementierte Sicherheitspolitik, die auf militärischer Stärke beruht, könnte zukünftig mögliche Aggressoren abschrecken und somit auch die Gefahr eines Krieges verringern.
Für manch einen mag dieses Plädoyer für eine Sicherheitspolitik, die auf Abschreckung basiert, trotzdem wie plumpe Kriegstreiberei klingen. Diese liegt mir aber völlig fern. Meine Arbeit als Militäranalyst und Berater ist im Gegenteil durchzogen von einer tiefen Sehnsucht nach dem Frieden, gerade weil mir der Krieg wie nahezu kein anderes Phänomen mein Leben lang Angst gemacht hat. Diejenigen, die möchten, dass unsere Lebensweise, unsere politischen Institutionen und unser wirtschaftlicher Wohlstand erhalten bleiben, sollten alles dafür tun, um zukünftige kriegerische Auseinandersetzungen zu verhindern. Genau das habe ich mir zur Aufgabe gemacht.
Vielleicht eine persönliche Note. Woher meine Urangst vor Krieg rührt, die sich dann ausgerechnet in einer Faszination für Streitkräfte und Kriegsführung äußern sollte, weiß ich nicht. Seit ich denken kann, war sie jedoch da. Ein Auslöser waren mit Sicherheit die Balkankriege. Ich wuchs in der südlichen Steiermark nahe der Grenze zum damaligen Jugoslawien auf und kann mich noch gut an den slowenischen Unabhängigkeitskrieg im Juni und Juli 1991 erinnern und daran, wie an der Grenze gekämpft wurde. Das österreichische Bundesheer rückte aus, und wir »Buam« (Buben, Jungs, Sie verstehen schon) durften »Panzer schauen gehen«, also die gepanzerten Fahrzeuge der österreichischen Streitkräfte, die damals Position entlang der Grenze bezogen, besichtigen. Wenige Jahre darauf, im Juli 1995, ereignete sich das Massaker von Srebrenica, bei dem die Armee der Republika Srpska, serbische Polizei und paramilitärische Einheiten mehr als 8000 Bosniaken, fast ausschließlich Buben und Männer, ermordeten. Auch dieses Ereignis hinterließ bei mir, damals zwölf Jahre alt, einen bleibenden Eindruck. Ich verstand nicht, wie ein solches Kriegsverbrechen in unmittelbarer Nachbarschaft Österreichs geschehen konnte, ohne dass Europa und vor allem Österreich in irgendeiner Weise einschritten. In meinem Heimatdorf Lebring Sankt-Margarethen gab und gibt es einen »Heldenfriedhof«, auf dem 805 Bosniaken des bosnisch-herzegowinischen Infanterie-Regiments Nr. 2 der österreich-ungarischen Armee begraben waren, die, wie in einer Inschrift dort zu lesen war, »im Ersten Weltkrieg das gemeinsame österreichische Vaterland bis zum letzten Tag heldenmütig verteidigten«. Als Kind fühlte ich deshalb eine besondere Verbundenheit, wann immer Bosniaken in der Zeitung oder im Fernsehen erwähnt wurden.
Vielleicht ist dies eine Erklärung. Woher meine Urangst vor und die Faszination für Krieg aber genau kamen, kann ich bis heute nicht sagen. »Der Himmel hat mir diese Dinge irgendwie eingegeben«, erklärt der Held Odysseus in Homers Odyssee, als er versucht, sein Verlangen nach militärischem Abenteuer und Ruhm zu rechtfertigen. Für mich war auch immer klar, dass ich Soldat werden wollte. Als ich es dann wurde, musste ich feststellen, dass mich der Alltag und die Routine wenig interessierten. So wurde ich ein schlechter Soldat, weil ich, wie in der Schule, die Dinge, die mich nicht interessierten, einfach nicht lernen wollte. Statt zu lernen, wie ich meinen kleinen Aufklärungstrupp richtig im Gelände einsetzte, brütete ich als 19-jähriger Offiziersanwärter lieber darüber, wie man die Kräfte einer mechanisierten Brigade trotz mangelnder Luftüberlegenheit schnell und effektiv für einen Gegenangriff formieren konnte.
Fast zwei Jahrzehnte später hatte ich dann die Möglichkeit, meine Lerndefizite auf der unteren Ebenen der Truppenführung im Rahmen militärischer Fortbildungen zu beheben. Schon damals erkannte ich, dass meine wahre Berufung in der Analyse und nicht im Führen von Soldaten lag. Ich wollte also Militäranalyst werden und damit Teil einer Berufsgruppe, die selbst in Washington, D. C., sehr überschaubar ist. Dort war ich 2008 und 2009 an der National Defense University tätig, die sich auf dem Militärstützpunkt Fort McNair im Süden der Hauptstadt befindet.
Von Anfang an war mir klar, dass ich kein reiner Schreibtischanalyst sein wollte, sondern ein Verständnis für Krieg und Kriegsführung direkt vor Ort entwickeln musste, um einen so objektiven Einblick wie nur möglich zu erhalten. Inspiriert hat mich hierzu auch der sich selbst als »Friedensreporter« bezeichnete österreichische Kriegsreporter Fritz Orter. In seinem 2014 erschienenen Buch Ich weißnicht, warum ich noch lebe, schreibt Orter, dass der eigentliche Krieg dort stattfindet, wo die Bomben einschlagen, nicht dort, »wo medienwirksame Abschüsse gefilmt werden«.1 Auf meinen eigenen Beruf umgemünzt bedeutet der Fokus auf den Einschlag statt auf den Abschuss, dass der Mensch und das menschliche Leid im Krieg immer im Vordergrund stehen sollten. Konkret heißt das: Wenn ich eine neue Taktik oder ein neues Waffensystem analysiere, darf der eigentliche Zweck dieser Dinge bei mir nie in Vergessenheit geraten: Sie wurden dafür konzipiert, junge gesunde Menschen, im »Idealfall« überwiegend Männer, zu töten oder zu verwunden, beziehungsweise dafür, genau solche Gewalt anzudrohen, um abzuschrecken und von der politischen Führung vorgegebene militärische Ziele zu erreichen. Wenn ich also zum Beispiel versuche, die genaue Anzahl von BMP-3-Schützenpanzern zu berechnen, die Russland im Jahr produzieren kann, oder der Frage nachgehe, wie viele Marschflugkörper und ballistische Raketen die chinesische Volksbefreiungsarmee braucht, um die taiwanesische Flug- und Raketenabwehr zu übersättigen, habe ich diesen Gedanken immer im Hinterkopf.
Mir war und ist es deshalb immer sehr wichtig, die menschliche Dimension der Kriegsführung nie außer Acht zu lassen; das, was der britische Lyriker Wilfred Owen, der nur eine Woche vor Ende des Ersten Weltkriegs an der französischen Front fiel, in einem Gedicht »the pity of war« genannt hat – das Leid oder Mitleid des Krieges.
Was der Krieg mit den Menschen macht, konnte ich in den vergangenen zehn Jahren im Rahmen längerer Aufenthalte und Einsätze in Kriegsgebieten genau studieren. Trotz meiner Zeit in Afghanistan, dem Irak und der Ukraine war ich bis vor Kurzem fest davon überzeugt, ich hätte Krieg zwar gesehen, aber nie wirklich erlebt. Aus dem einfachen Grund, weil ich quasi immer selbst entscheiden konnte, wann ich genug vom Krieg hatte. Im Gegensatz zu den meisten anderen Menschen in einem Krieg gab es für mich, wenn es zu brenzlig wurde, immer ein Auto, einen Zug, einen Helikopter oder ein Flugzeug raus aus der Gefahrenzone. Oder meine Zeit in einem Kriegsgebiet war ohnehin so begrenzt, dass der Aufenthalt nicht der Rede wert war.
Seit einer Weile belehren mich mein Körper und mein Geist aber eines Besseren. Denn natürlich hinterlassen Extremsituationen von Todesangst unter Beschuss und menschlichem Leid Spuren, selbst wenn man nicht permanent damit konfrontiert ist. Mal kann ich damit besser umgehen, mal schlechter. Zweifellos ist Krieg dadurch aber erst recht ein fester Teil von mir geworden. Damit muss ich und muss auch mein Umfeld leben, was manchmal sehr herausfordernd sein kann. Ich schöpfe aus meinen Erfahrungen und Erlebnissen in Kriegsgebieten allerdings auch viel Kraft für meine analytische Arbeit.
Die Freiheit, kommen und gehen zu dürfen und so objektiv wie nur möglich zu analysieren, betrachte ich als immenses Privileg. Es spornt mich vor allem an, mein Wissen an militärische und politische Entscheidungsträger in Europa und den USA weiterzugeben, in der Hoffnung, dass ein besseres Verständnis von Krieg und Kriegsführung am Ende zu einer ausgewogenen Sicherheitspolitik des Westens führt, die das Risiko eines katastrophalen militärischen Konflikts verringert.
Dazu ist es freilich paradoxerweise notwendig, dass der Krieg überhaupt erst wieder in unsere Köpfe zurückkehrt, auch wenn das nicht sehr angenehm ist. Anders gesagt: Wir müssen uns dem Phänomen Krieg wieder stellen und wissen, wie wir ihn im Ernstfall so führen können, dass wir eine Chance haben, ihn zu gewinnen. Wenn wir klug handeln, wird der Krieg in Europa hoffentlich nur ein Szenario in unseren Köpfen bleiben und nie Realität werden.
Erster TeilWarum der Krieg wieder zurück ist
Kapitel 1.Fehleinschätzungen als Kriegsgrund
Kriege sind oft das Resultat von Fehleinschätzungen der politischen und militärischen Führung. Die Geschichte kennt unzählige Beispiele dafür, dass die Kampfkraft der eigenen Armee überschätzt und/oder der Widerstandswille des Gegners unterschätzt wurde: von den antiken Persern, die 490 v. Chr. bei Marathon von den Athenern geschlagen wurden, bis hin zu dem russischen Präsidenten Wladimir Putin mit seinem im Februar 2022 losgetretenen Angriffskrieg gegen die Ukraine.
Ein Hauptgrund für diese und viele weitere Fehleinschätzungen ist schlicht die enorme Komplexität von Krieg. Sie macht es – zumal in Friedenszeiten – schwer bis unmöglich, verlässlich vorherzusagen, wie lange eine militärische Auseinandersetzung dauern, auf welche Weise und mit welcher Intensität sie geführt und wie sie am Ende ausgehen wird. Der britische Militärhistoriker Michael Howard sprach deshalb einmal von einem »Nebel des Friedens«, der eine klare Sicht auf Krieg verhindere und Prognosen über zukünftige Kriegsführung erschwere.2
Im Grunde kann man sagen: Es lässt sich im Frieden nahezu unmöglich sagen, wie sich eine Armee oder ein Staat als Ganzes im Falle eines Krieges wirklich verhalten würde. Es ist, als würde man über die relativen Stärken und Schwächen einer Fußballmannschaft urteilen, die man über Jahre oder gar Jahrzehnte immer nur im Trainingscamp beobachten konnte und nie in einem echten Spiel gegen ein anderes Team. Analog dazu kann nur der reale Kampf irgendwelche konkreten Rückschlüsse auf die Qualität der eigenen Truppe liefern. Eine allzu lange Pause zwischen solchen realen »Auseinandersetzungen« wirkt sich insofern natürlich negativ auf die Einsatzbereitschaft der Truppe aus. Genau das dürfte einer meiner militärischen Ausbilder in Österreich, der unter dem Spitznamen »Ranger Gustl« in der gesamten Armee bekannt war, gemeint haben, als er nach einer Nahkampfausbildung trocken kommentierte: »Fünfzig Jahre Frieden machen eine jede Armee kaputt!«
Militärische und politische Entscheidungsträger versuchen zwar regelmäßig, sich auf der Basis von Militärübungen und jeder Menge Datenanalysen ein Bild zu machen. Doch jeder Fußballkenner weiß: Ein Trainingsspiel bleibt immer nur ein Trainingsspiel. Wenn es wirklich einmal darauf ankommt, sind viele Prognosen und Annahmen Makulatur, denn die Realität erweist sich stets als komplexer und dynamischer. Und das Gleiche gilt in der Kriegsführung. Keine Militärübung kommt annähernd an die Realität eines militärischen Ernstfalls heran. Oft stellt sich auch erst nach Ausbruch eines Krieges heraus, wie die Bevölkerungen und Armeen des eigenen Landes und des Gegners, aber auch wie etwaige Verbündete und andere Länder auf diese Extremsituation reagieren. Weder der Widerstandswille eines Gegners noch die Motivation der eigenen Truppe lassen sich vorab messen. Ebenso wenig lässt sich vorhersagen, wie Menschen reagieren, wenn sie plötzlich im Kugelhagel oder unter Artilleriebeschuss stehen. Nicht selten bricht dann Panik aus. So erzählten mir mehrere ukrainische Soldaten, viele ausländische Freiwillige hätten im März 2022 gleich bei der ersten Explosion russischer Artillerie Reißaus genommen. Als jemand, der 2023 das Pech hatte, einen russischen Artillerieangriff mit schwerer 152mm-Munition mitzuerleben, kann ich das nur zu gut verstehen.
Als Faustregel gilt letztlich: Wie gut die eigene Truppe für den Krieg trainiert ist und ob sie über die richtige Ausrüstung verfügt, um ihre Ziele zu erreichen, zeigt sich immer erst nach dem ersten Schuss. Fast schlimmer noch als diese allgemeine Ungewissheit über die eigene Truppe in Friedenszeiten ist häufig allerdings die Unfähigkeit, sich in den Gegner hineinzuversetzen, um dessen Handeln zu verstehen. Dabei heißt es schon bei dem chinesischen Militärstrategen und Philosophen Sunzi (ca. 544 bis ca. 496 v. Chr.): »Wenn du dich und den Feind kennst, brauchst du den Ausgang von hundert Schlachten nicht zu fürchten.« Umgekehrt bedeutet das aber auch: Wenn du weder dich selbst noch den Gegner gut kennst, erhöht sich das Risiko von Fehlkalkulationen.
Leider begünstigt gerade die heutige Zeit politische und militärische Fehleinschätzungen, was Kriege und Kriegsführung betrifft. Das hat mehrere Gründe. Erstens ist unter politischen und militärischen Entscheidungsträgern ein gewisses Grundverständnis dafür abhandengekommen, warum es überhaupt zu Kriegen kommt. Zweitens wecken immer komplexere Technologien die Illusion, Kriege ließen sich schnell, mit geradezu »chirurgischer« Präzision und damit weitgehend unblutig führen und gewinnen. Diese Illusion verleitet wiederum dazu, militärische Abenteuer einzugehen. Drittens befinden wir uns strukturell in einem allmählichen Wandel der globalen Ordnung – von einem System, das von der Ordnungsmacht USA dominiert ist, hin zu einem System, in dem die amerikanische Militärmacht nicht mehr die gleiche abschreckende Wirkung wie früher besitzt, da in den USA selbst kein innenpolitischer Konsens mehr über die eigene globale Rolle besteht. Damit dürfte auch die Gefahr von militärischen Fehleinschätzungen aufseiten der Rivalen der USA wachsen – mit potenziell fatalen Konsequenzen.
Die Summe all dieser Faktoren erhöht nicht nur das Risiko, dass neue Kriege tatsächlich ausbrechen werden, sondern auch das Risiko, dass sowohl die Streitkräfte als auch die Gesellschaften der westlichen Staaten insgesamt die Art und Weise, wie Kriege künftig geführt werden, falsch einschätzen.
Kurz ein Wort zur Struktur der folgenden Kapitel im Teil 1. Ich liste auf den folgenden Seiten auf drei unterschiedlichen Ebenen Faktoren auf, die politische und militärische Fehleinschätzungen in Bezug auf Kriege und Kriegsführung wahrscheinlicher machen. Diese Fehleinschätzungen wiederum erhöhen das Risiko auf künftige militärische Konflikte.
Die wichtigste Ebene hierbei ist die individuelle Ebene, denn letztendlich wird die Entscheidung zum Krieg von Individuen, politischen Entscheidungsträgern, bewusst getroffen. Die Hauptgründe, warum sich Individuen zum Krieg entschließen und warum Kriege falsch eingeschätzt werden, wird in Kapitel 1 diskutiert. Die technologische Ebene, die in Kapitel 2 behandelt wird, will vor allem zeigen, welchen Einfluss Technologie auf Entscheidungen von politischen Entscheidungsträgern hat. Wir klammern uns im »Westen« gern an eine Art technologischen Lösungsglauben, der uns dazu verleitet, zu glauben, wir könnten Kriege, die wir anfangen, mithilfe neuer Technologien schneller und unblutiger beenden, während Technologie andererseits die Gefahr verringert, von Krieg überrascht zu werden. Beide Annahmen erweisen sich als große Irrtümer.
Im dritten Kapitel führe ich dann die Diskussion auf globaler Ebene weiter. Das globale System, gern auch wertebasierte Weltordnung genannt, wird nach wie vor von den USA, der führenden Militärmacht und gleichzeitig Europas Schutzmacht, dominiert. Wegen dieser Vormachtstellung haben Entscheidungen über Krieg und Frieden in den USA die größten systemischen Konsequenzen für den Rest der Welt. Die Sicherheitspolitik Washingtons wird für Partner wie Gegner zunehmend schwer einschätzbar, was auf allen Seiten die Gefahr gravierender militärischer Fehleinschätzungen erhöhen dürfte. Daher versucht dieses Kapitel vor allem, ein besseres Verständnis für die amerikanische Sicherheitspolitik zu vermitteln.
Individuelle Fehleinschätzungen
»Jede Lösung ist besser als Krieg«, erklärte mein leider schon verstorbener Vater, Franz Gady, immer dann, wenn das Thema Krieg, meistens von mir losgetreten, in der Familie diskutiert wurde. Geboren 1937 in Bachsdorf im Süden Österreichs gehörte er der Generation an, die im Zweiten Weltkrieg aufwuchs. Was er in jenen Kindheitsjahren erlebt hatte, prägte ihn sehr und machte ihn zu einem überzeugten Pazifisten. Als ich noch ein Kind war, erzählte er mir immer wieder von »Christbäumen«, die er damals am Himmel gesehen habe, woraufhin ich wissen wollte, ob denn auch das Christkind in den Wolken geflogen sei. Erst später habe ich verstanden, dass er von deutschen Leuchtgranaten sprach, die zum Einsatz gekommen waren, um alliierte Bomber auch in der Nacht sichten und abschießen zu können. Außerdem berichtete er davon, dass er häufig auf einem rotierenden Fliegerabwehrgeschütz der Luftwaffe, das im Garten hinter dem Haus stand, Karussell hatte fahren dürfen. Auch das hörte sich für mich als Kind ganz toll an.
Schlimm waren für ihn andere Erinnerungen, etwa die an die Kolonnen deutscher Kriegsgefangener, die von Jugoslawen mit Peitschenhieben und Schlägen am elterlichen Haus vorbei Richtung Süden getrieben wurden. Oder an die Plünderungen im Dorf und an den Moment, als plötzlich ein sowjetischer Soldat in der Stube stand und meine Großmutter nur deshalb einer Vergewaltigung entkam, weil mein Vater und sein jüngerer Bruder sich so fest an sie klammerten, dass der Soldat schließlich »nur« in die Decke schoss und unverrichteter Dinge wieder abrückte.
Obwohl ich diese und andere bedrückende Schilderungen sehr wohl kannte, zitierte ich als siebzehnjähriger Teenager gegenüber meinem Vater einmal Winston Churchill, der 1941 gesagt hatte, dass Sklaverei und Entehrung schlimmer seien als Krieg. Dementsprechend, so meine Schlussfolgerung, könne Krieg zumindest unter gewissen Umständen eine Lösung sein. Mein Vater antwortete darauf nur lapidar, ich solle mich doch einmal mit meinen beiden »Onkel Hans« darüber unterhalten, die hätten mit Krieg mehr Erfahrung als er.
Sowohl Hans Stoisser als auch Hans Url – der eine mit uns verwandt, der andere nicht – hatten im Zweiten Weltkrieg in der Luftwaffe gedient. Hans Url war als Jagdflieger einer ME-109 im Kampfeinsatz gewesen, Hans Stoisser wiederum war in der Schlacht um Berlin im April 1945 als einfacher Soldat zum Einsatz gekommen. Der eine war schließlich in französischer Kriegsgefangenschaft gelandet, der andere in sowjetischer.
Beide hielten mein Churchill-Zitat unabhängig voneinander für veritablen Unsinn. Wie mein Vater waren auch sie der Überzeugung, dass der Krieg das Schlimmste aller Übel sei. Hans Url drückte mir außerdem ein Buch mit historischen Vignetten aus dem französischen Russlandfeldzug von 1812 in die Hand, mit dem Kommentar: »Da kannst du lesen, wie eine halbe Million Männer für die Ehre eines Mannes erschlagen wurden oder erfroren. Wer Krieg für die Ehre führt, ist ein Trottel.«
Doch vor allem in einem Punkt waren sich die drei einig: Heutzutage ergibt es einfach wirtschaftlich keinen Sinn mehr, Krieg zu führen. Damit reihten sie sich unbewusst in eine lange Denktradition ein, die glaubt, dass Krieg ohne wirtschaftliches Kalkül unwahrscheinlicher wird. So veröffentlichte der britische Journalist – und Träger des Friedensnobelpreises von 1933 – Norman Angell, schon 1909 und damit fünf Jahre vor Beginn des Ersten Weltkrieges, sein Buch The Great Illusion, in dem er argumentiert, die wirtschaftlichen Schäden eines europäischen Krieges wären so groß, dass sie einen solchen für rationale Menschen faktisch unmöglich machten.3
Nun, historisch betrachtet war das freilich mal anders. Das frühe Wirtschaftssystem der römischen Republik profitierte enorm von den Plünderungen durch das eigene Heer wie auch von den Tributzahlungen, die besiegte Gegner in Form von Naturalien oder Soldaten zu leisten hatten. Obwohl sich die Situation in den späten Jahren der Republik und des Kaiserreichs in den Jahrzehnten vor Christi Geburt mit der Etablierung von Provinzen und einem gemeinsamen Wirtschaftsraum rund um das Mittelmeer ändern sollte, war das Verhältnis Roms zum Rest des Reiches weiterhin stets von einem ausbeuterischen Charakter geprägt.
Und das Römische Reich sollte in dieser Hinsicht kein historischer Einzelfall bleiben. Plünderungen, Versklavungen und Tributzahlungen bildeten jenseits des regulären Handels mit seinen Zoll- und Steuereinnahmen die drei Säulen, auf denen in den folgenden Jahrhunderten kleinere Stadtstaaten, aber auch Großreiche bis zum Ende des 18. Jahrhunderts ihre Wirtschaftspolitik aufbauten. Wie ein Wirtschaftsredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung kurz nach Ausbruch des Ukrainekrieges 2022 schrieb: »Der Wunsch nach Reichtum und Wohlstand ist als Auslöser von Kriegen in der Geschichte der Menschheit eher der Normalfall als die Ausnahme.«4
Es überrascht daher nicht, dass in der Zeit des Merkantilismus, also vom 17. Jahrhundert bis etwa zur Mitte des 19. Jahrhunderts, Staaten durchschnittlich zwei Drittel ihrer Einnahmen für das Militär ausgaben.5 Krieg war ein Geschäft, und eine starke Armee beziehungsweise eine schlagkräftige Flotte garantierte eine gute Kapitalrente. Die britische East Indian Company, eine Kaufmannsgesellschaft, eroberte mithilfe ihrer Privatarmee in dieser Zeit große Teile Indiens, um sie wirtschaftlich auszubeuten, und wurde so zum wohl mächtigsten Unternehmen der Geschichte. Das Urdu- und Hindi-Wort für Plünderung, »loot«, ging im Zusammenhang mit den Aktivitäten der »ehrenwerten Firma« in den englischen Wortschatz ein. Im Jahr 1803, auf dem Höhepunkt seiner Macht, unterhielt die honorable company eine Privatarmee von 260 000 Mann, die fast zweimal so groß wie die reguläre britische Armee.6
Die heutige Politikwissenschaft sieht im Streben nach wirtschaftlicher Stärke allerdings nicht zwangsläufig einen Kriegsgrund oder einen besonderen Drang zum militärischen Raubkapitalismus, wie sie überhaupt skeptisch ist gegenüber monokausalen Erklärungen für militärische Gewalt zwischen Staaten.
Es war auch schon in der Vergangenheit keineswegs immer klug, Kriege aus wirtschaftlichen Gründen zu führen. »Jeder Krieg ist eine Form erhöhten und letztlich unproduktiven Ressourcenverbrauchs«, schreibt etwa der deutsche Historiker Herfried Münkler in seinem Buch über den Dreißigjährigen Krieg.7 Dieser religiös und machtpolitisch motivierte Konflikt galt Münkler zufolge bis zu den beiden Weltkriegen als das größte deutsche Trauma, sogar Mitteleuropas. Nicht nur forderte er Millionen von Menschenleben, er verwüstete auch weite Teile des deutschsprachigen Wirtschaftsraums. Wer die Schrecken dieses Krieges besser verstehen will, der lese den Schelmenroman Simplicius Simplicissimus von Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen aus den 1660er-Jahren.
Heute, im 21. Jahrhundert, erscheint es erst recht absurd, Kriege für irgendwelche wirtschaftlichen Vorteile zu führen. Beispielsweise hätte ein Krieg zwischen der Volksrepublik China und den USA um die Inselrepublik Taiwan dramatische Folgen für die Weltwirtschaft. China selbst würde im Falle einer Blockade Taiwans fast 9 Prozent und bei einem erweiterten militärischen Konflikt an die 17 Prozent seiner Wirtschaftsleistung einbüßen. Laut einer Studie würde die Weltwirtschaft um bis zu 10 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts schrumpfen. Zehn Billionen US-Dollar würden sich in Luft auflösen,8 globale Lieferketten würden zusammenbrechen. Besonders gefährdet wäre die Produktion von Halbleitern, jenen Hauptbestandteilen von Mikrochips, die in unzähligen elektronischen Produkten von iPhones bis zu Flugzeugen zu finden sind. Taiwan ist nämlich der mit Abstand wichtigste Lieferant dieses so wertvollen Produkts. Nahezu jeder zweite Halbleiter weltweit wird hier produziert, bei den modernsten Halbleitern liegt der Anteil je nach Schätzungen sogar bei 80 bis 90 Prozent.9 Im Falle eines Krieges um die Insel würde die globale Wirtschaft also zumindest für eine gewisse Zeit stark in Mitleidenschaft gezogen.
Auch Wladimir Putins Angriffskrieg in der Ukraine ist aus wirtschaftlicher Perspektive sinnlos. Abgesehen von der steigenden Inflation, die jeder Krieg mit sich bringt, und dem wachsenden Druck auf die russische Rohstoffindustrie, wird Russland in den kommenden Jahren vor allem mit einer schrumpfenden erwerbstätigen Bevölkerung zu kämpfen haben. Allein 500 000 Russen und Russinnen sind kurz nach dem Beginn des Krieges im Februar 2022 ins Ausland geflüchtet.10 Ende 2023 waren es bereits über eine Million, die ihrer Heimat den Rücken gekehrt haben. Hunderttausende Russen sind zudem inzwischen auf den Schlachtfeldern in der Ukraine getötet oder verwundet worden. Dazu kommt, dass in Russland schon vor dem Krieg ein akuter Arbeitskräftemangel herrschte. Bedenkt man, dass in der globalen Wirtschaft des 21. Jahrhunderts Humankapital als eine der wichtigsten Komponenten für nachhaltiges Wirtschaftswachstum gilt, so zerstört Russland mit dem Krieg in der Ukraine eine zentrale Grundlage seiner zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit.
Vor dem Krieg hatte es häufig geheißen, ein Angriff auf die Ukraine ergebe aus russischer Sicht ökonomisch keinen Sinn, weshalb sich Putin letztlich zurückhalten werde. Vor allem wurde immer wieder auf Moskaus wirtschaftliche Abhängigkeit von Rohstoffexporten in den Westen verwiesen. Erdgas, Erdöl, und Kohle machten über 70 Prozent der Gesamtexporte Russlands aus; davon gingen vor dem Krieg drei Viertel der Erdgas- und 40 bis 45 Prozent der Erdölexporte nach Europa.11 Viele österreichische und deutsche Wirtschaftstreibende, mit denen ich im Januar 2022 gesprochen habe, wähnten sich deshalb in Sicherheit.
Trotz allem verweisen politische Analysten, Entscheidungsträger und Kommentatoren in ihrem Bemühen, der Sorge vor einem möglicherweise drohenden Krieg zu begegnen, nach wie vor immer wieder auf wirtschaftliche Abhängigkeiten und auf absehbare ökonomische Nachteile eines militärischen Konflikts. Dieser Ansatz mag zwar einseitig sein, ist aber durchaus verständlich. Angesichts des Aufstiegs Europas zur Wirtschaftsgroßmacht und der prosperierenden Europäischen Union – deren Vorgänger, die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, oft auch Montanunion genannt, 1951 mit dem Ziel gegründet wurde, durch die gemeinsame Kontrolle kriegswichtiger Güter den innereuropäischen Frieden zu fördern –, schien es keinen Grund mehr zu geben, sich mit dem Thema Krieg auseinanderzusetzen. Mantrahafte Beschwörungen von »Niemals wieder« standen oft am Anfang und am Ende der politischen und gesellschaftlichen Diskussionen über Krieg und Kriegsführung. Im Grunde waren diese Diskussionen von vornherein verpönt, und das nicht nur, weil man sie als nicht relevant empfand, sondern weil man insgeheim glaubte, allein schon das Reden über Krieg würde das Risiko erhöhen, dass es tatsächlich zu einem bewaffneten Konflikt käme. Die Folge war de facto eine kollektive Amnesie unter politischen Entscheidungsträgern auf dem Kontinent: Niemand wusste mehr zu sagen, warum Kriege überhaupt stattfinden.
Vor allem die Bundesrepublik Deutschland setzte seit den 1960er-Jahren mit ihrer Strategie von »Wandel durch Annäherung« beziehungsweise »Wandel durch Handel« stark auf ein ökonomisch motiviertes Sicherheitskonzept im Verhältnis zu den Ostblockstaaten. Die dahinter stehende Idee besagte, dass potenzielle Gegner wie die Sowjetunion im Kalten Krieg oder China durch die wirtschaftliche Öffnung auch politisch und gesellschaftlich aufgeschlossener werden und sich früher oder später womöglich sogar der Demokratie zuwenden. Der Export zunächst von Waren und dann von westlichen Werten sollte Frieden bringen.12 Nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine stellte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock nüchtern fest, die Idee vom »Wandel durch Handel« sei »falsch« und eine »Illusion« gewesen.13
Diese so lang gehegte Illusion sollte sich als schweres Handicap für Europas politische Klasse im Umgang mit Wladimir Putin und dem Kreml erweisen. Der Schock saß jedenfalls tief, als am Morgen des 24. Februar die ersten russischen Panzer in die Ukraine rollten und der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz nur wenige Tage später eine »Zeitenwende« – den Beginn einer neuen Ära auf dem europäischen Kontinent – konstatierte.14
Scholz und andere politische Entscheidungsträger in Europa hätten vielleicht weniger geschockt gewirkt, wäre die Überraschung darüber, dass Russland einen Angriffskrieg startete, der ihrer Ansicht nach nicht im nationalen Interesse Moskaus sein konnte, nicht so groß gewesen. Mit anderen Worten: Sie hatten die Lage schlicht falsch eingeschätzt. »Eine militärische Aggression gegen die Ukraine würde schwerwiegende politische wie auch wirtschaftliche Konsequenzen nach sich ziehen«, hatte Scholz beispielsweise im Januar 2022 erklärt.15 Vor allem die wirtschaftlichen Konsequenzen – der Westen drohte schließlich mit strengen Sanktionen – sollten Russland von einem Angriff abschrecken.
Ähnliche Äußerungen waren immer wieder aus – nicht nur deutschen – Regierungskreisen zu hören. Dass Sanktionen oft mehr Brandbeschleuniger als Brandlöscher sind, schien man vergessen zu haben. So hatten die harten amerikanischen Wirtschaftssanktionen gegen das japanische Kaiserreich 1941 wesentlich dazu beigetragen, dass sich die japanische Regierung noch im selben Jahr zum Krieg gegen die USA entschloss.
Scholz und seine Berater, aber auch andere politische Entscheidungsträger in den europäischen Hauptstädten, lagen freilich nicht ganz falsch mit ihrer Annahme, dass ein Krieg nicht im wirtschaftlichen, politischen oder militärischen Interesse Russlands läge. Aus einer reinen interessenspolitischen Perspektive gibt es für Russland in der Tat nur wenige Gründe, die dafür sprechen, die Ukraine zu überfallen. Dieser Fokus auf Interessenpolitik, gestützt von einer wirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Analyse, ließ jedoch andere Beweggründe des Kremls fatalerweise völlig außer Acht.
Hybris als der Kriegsgrund
Welche anderen Beweggründe dazu führen können, einen Krieg zu beginnen, hat meines Erachtens niemand besser herausgearbeitet als der antike griechische Stratege und Geschichtsschreiber Thukydides in seinem Werk Der Peloponnesische Krieg. Das Buch wurde und wird immer wieder als eine Art Anleitung zur nüchternen Machtpolitik zitiert. Thukydides zufolge zogen die zwei rivalisierenden Großmächte Sparta, eine Landmacht, und Athen, eine Seemacht, im Wesentlichen aus drei Motiven gegeneinander in den Krieg, der von 431 bis 404 v. Chr. dauerte: Furcht, Ehre und Interessen.
So kann »Furcht« vor einem möglichen gegnerischen Angriff einen Staat dazu bewegen, dem Gegner zuvorzukommen und ihn zuerst anzugreifen. Mit dem Begriff »Ehre« verbindet Thukydides vor allem die persönlichen Ambitionen einzelner Staatsmänner und Heerführer, die Krieg auslösen können. Mit »Interessen« ist schließlich ein über die Ziele einzelner Protagonisten hinausgehender gesamtstaatlicher Nutzen einer politischen Handlung gemeint.
Obwohl Thukydides diese drei Punkte als die Hauptbeweggründe für Krieg an sich versteht, wird in der Regel vor allem jene Passage aus seinem Werk zitiert, in der er den »letzten wahren Grund« für den Ausbruch des Konflikts »im Machtzuwachs der Athener« sieht, »der den Lakedamoniern [Spartanern, FSG] Furcht einflößte und sie zum Krieg zwang«.16 Der bekannte amerikanische Politikwissenschaftler Graham T. Allison hat primär auf Basis dieses Satzes das Konzept der »Thukydides-Falle« entwickelt. Demnach steigt die Wahrscheinlichkeit eines Krieges, wenn ein aufstrebendes Land, wie zum Beispiel China, eine etablierte Großmacht, etwa die USA, als führende Macht in einer Region oder gar in der gesamten Welt verdrängen will.17 Tatsächlich sind einige Politiker und Militärs in den USA und in China – teilweise unter dem Einfluss dieser These – fest davon überzeugt, dass ein militärischer Konflikt zwischen den beiden Großmächten unausweichlich ist. Allisons Interpretation hat aber auch viel Kritik hervorgerufen und bedauerlicherweise dazu beigetragen, dass manche Kommentatoren und Politikwissenschaftler Thukydides als einen für das 21. Jahrhundert irrelevanten Geschichtsschreiber betrachten.18
Die Reihenfolge der von Thukydides genannten Kriegsmotive ist jedoch kein Zufall. Im Text ist zunächst von Furcht und Ehre die Rede, erst danach von Interessen. Der Grund dafür ist meines Erachtens, dass für Thukydides die beiden ersten Motive enger miteinander verbunden sind als Furcht und Interessen. Furcht resultiert aus einer persönlich empfundenen Bedrohung; Ehre definiert sich durch einen persönlich empfundenen Anspruch auf Achtung. Interessen hingegen lassen sich nicht fühlen oder empfinden, sondern nur kalkulieren. Thukydides will also unterstreichen, dass Persönlichkeiten – und nicht der Staat an sich – Entscheidungen über Krieg und Frieden fällen und dass diese Entscheidungen in der Regel auf persönlichen Emotionen basieren und eben nicht auf einem kühl kalkulierten gesamtstaatlichen Interesse.
Liest man den Text genauer, wird deutlich, dass Furcht für Thukydides am Ende nicht das wichtigste Motiv für einen Krieg war. Für ihn standen vielmehr Stolz und Hochmut einzelner politischer und militärischer Entscheidungsträger im Vordergrund, erst recht, wenn sie in Hybris ausarteten. Damit bezeichneten die antiken Griechen ursprünglich eine Arroganz gegenüber den Göttern. Hybris lässt sich in moderner Sprache als eine extreme Selbstüberschätzung beschreiben, die durch Arroganz und Hochmut (oder ein falsch verstandenes Ehrgefühl) gespeist wird und zu Fehlkalkulationen führt.19
Zusammengefasst lässt sich also festhalten: Auslöser für einen Krieg sind laut Thukydides in der Regel persönliche Motive, vielleicht getrieben von Furcht und einem Verlangen nach Anerkennung, aber nicht zwangsläufig beeinflusst von Staatsinteressen.
Und das ist auch die quintessentielle Aussage dieses Kapitels.
Dieser Exkurs in das antike Griechenland ist daher für das vorliegende Buch aus zwei Gründen von Belang. Zum einen soll er deutlich machen, dass der moderne Hang, gesamtstaatliche Interessen, seien sie wirtschaftlicher oder allgemeiner machtpolitischer Natur, als Hauptmotivation für Krieg zu betrachten, allzu kurzsichtig ist. Zum anderen unterstreicht Thukydides durch seine bewusste Reihung der Motive, dass die Ursachen von Krieg auch und gerade in von Hybris getriebenen Emotionen zu suchen sind und dass diese sich wiederum oft, aber keineswegs immer mit wirtschaftlichen, politischen, und militärischen Interessen verbinden lassen. Hybris, gepaart mit Eros, war schon der Hauptgrund für den Trojanischen Krieg, den Homer in seinem Epos Ilias beschreibt. Kein anderes fiktives Werk der Antike hat griechische und römische Heerführer, Strategen und Staatsmänner stärker bei ihrem kriegerischen Tun inspiriert. Unter anderem soll Alexander der Große mit einer Kopie der Ilias unter seinem Kissen geschlafen haben. Und Homers Tiefblick, warum Kriege beginnen, ist bis heute aktuell. Denn Hybris gepaart mit Eros spielt auch heute noch eine zentrale Rolle, wenn Individuen sich dazu entschließen, Nationen abseits der Staatsräson in den Krieg zu treiben.
Hybris schlägt Staatsräson
Eine umfassendere, differenziertere Sicht auf die Gründe, aus denen Kriege stattfinden, vermag das Risiko von individuellen Fehleinschätzungen zu senken. Gesamtstaatliche Interessen oder Staatsräson spielen durchaus immer wieder eine Rolle, wenn es um die Entscheidung geht, einen Krieg zu beginnen. Ein klassisches Beispiel ist die ägyptische Strategie während des Jom-Kippur-Krieges vom Oktober 1973. Ihr Ziel war die Rückeroberung der Sinai-Halbinsel, die das Land im Sechstagekrieg von 1967 an Israel verloren hatte. Hierfür war man zu einer begrenzten militärischen Operation bereit, die über mehrere Monate von der militärischen und politischen Führung Ägyptens unter Präsident Anwar el-Sadat vorbereitet wurde. Die Wiedereingliederung der Sinai-Halbinsel lag eindeutig im Interesse Ägyptens und sollte Ende der 1970er-Jahre als unmittelbare Konsequenz des Krieges Wirklichkeit werden.
Man darf gesamtstaatliche Interessen jedoch nie isoliert von persönlichen Bestrebungen, Motiven, ja sogar Kränkungen politischer und militärischer Entscheidungsträger betrachten. So hatte zum Beispiel der preußische König Friedrich II. klare wirtschaftliche Beweggründe, als er im Dezember 1740 Schlesien überfiel, eine der reichsten Provinzen des Habsburgerreiches. Für ihn war die Provinz der Schlüssel, um Preußen zu einer Großmacht zu machen. Das Machtstreben Preußens war dabei hauptsächlich Friedrichs Ambition geschuldet, dem französischen Sonnenkönig Ludwig XIV. und seinen ruhmreichen Generälen nachzueifern, die Frankreich zur größten Kultur- und Militärmacht Europas gemacht hatten. Im Falle Friedrichs II. deckten sich im Grunde also persönliche Bestrebungen mit gesamtstaatlichen Interessen. Die Kriege, die er führte, schufen die Basis für den Aufstieg Preußens als führender Macht im deutschen Raum.
Der Sieg Friedrichs II. 1763 am Ende des Siebenjährigen Krieges legte gleichzeitig das Fundament für eine militarisierte Außenpolitik. Nach dem Untergang des alten Preußens, der durch die vernichtenden Niederlagen gegen Napoleon bei Jena und Auerstedt 1806 eingeleitet wurde, sollte sie im Zuge der sogenannten Einigungskriege – mit »Eisen und Blut« – zur Gründung des zweiten Deutschen Reiches 1871 führen. Auch in den erwähnten Einigungskriegen (Deutsch-Dänischer Krieg von 1864, Österreichisch-Preußischer Krieg von 1866 und Deutsch-Französischer Krieg von 1870/71) deckten sich die persönlichen Ambitionen von Otto von Bismarck, dem Hauptarchitekten der Reichsgründung, mit den gesamtstaatlichen Interessen Preußens.
Ebendiese Ambitionen des neuen deutschen Reichskanzlers sollten dann allerdings langfristig schwerwiegende Konsequenzen für die Hohenzollern-Monarchie haben. Bismarck und die Politik Preußens in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verband nämlich vor allem ein tiefes Gefühl der Unsicherheit. Diese hatte wenig mit der relativen wirtschaftlichen und militärischen Stärke Preußens und später des Deutschen Kaiserreiches gegenüber Drittstaaten zu tun, sondern vielmehr mit dem Unterlegenheitsgefühl, das entsteht, wenn man als Emporkömmling betrachtet wird. Bismarck innerhalb der preußischen Gesellschaft und das Deutsche Reich im Kreis der Großmächte waren die Neureichen, die Protzer, denen die bessere Gesellschaft in Gestalt des alten preußischen Adels (Bismarcks Mutter stammte aus bürgerlichem Haus) beziehungsweise der etablierten Monarchien wie England, Russland und Österreich stets mit einer gewissen Herablassung begegneten. Entsprechend leicht reagierten beide gekränkt. Bismarck gelang es gleichwohl, dieses Unterlegenheitsgefühl in Realpolitik zu verwandeln (vor allem mit seiner Annäherung an Russland) mit der Absicht, einen größeren europäischen Krieg zu vermeiden. Ohne Bismarck, der im März 1890 sein Entlassungsgesuch einreichte, endete dieser Drahtseilakt, und übrig blieben in den Augen der Hohenzollern und der deutschen Führungselite nur die Kränkung, als Neureiche abgekanzelt zu werden, und der daraus resultierende Geltungsdrang gepaart mit maßloser Selbstüberschätzung. Mit der tragischen Figur des letzten deutschen Kaisers sollte diese Politik der Hybris, gepaart mit einer ordentlichen Portion Fatalismus, ihren traurigen Höhepunkt erreichen. Der Geltungsdrang und das übertriebene Gefühl verletzter Ehre waren zumindest zum Teil für den übermäßigen Militarismus der wilhelminischen Gesellschaft verantwortlich. Er sollte keine geringe Rolle für den Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 spielen, eines Krieges, der in keinster Weise im gesamtstaatlichen Interesse des Deutschen Kaiserreiches lag. Winston Churchill brachte diese Politik der Hybris, die deutschen Interessen eigentlich zuwiderlief, in seiner Beschreibung von Kaiser Wilhelm II. auf den Punkt: »Wenn man auf dem Gipfel eines Vulkans steht, ist das Letzte, was man tun sollte, zu rauchen.«
Der vielleicht schlimmste Auswuchs von Hybris ist ihre Kombination mit Fatalismus, in der die Staatsräson so gut wie keinen Platz mehr hat und Krieg aus den irrationalsten Gründen vom Zaun gebrochen wird.
So lässt sich mit historischen Quellen relativ gut belegen, dass der Chef des Generalstabs von Österreich-Ungarn vor dem und im Ersten Weltkrieg, Conrad von Hötzendorf, unter anderem der Liebe einer Frau wegen den Krieg forderte, obwohl er der Ansicht war, dass die Habsburgermonarchie einen solchen Krieg am Ende wahrscheinlich verlieren würde.20 Hötzendorf hatte sich unsterblich in die bereits verheiratete Gina von Reininghaus verliebt. 1908 fingen die beiden eine Affäre an, die für die Wiener Gesellschaft und das erzkatholische Kaiserhaus einen Skandal darstellte und unter anderem dazu führte, das Hötzendorf kurzzeitig als Generalstabschef abgesetzt wurde. Hötzendorf hegte nun die romantische Vorstellung, wonach er nach gewonnener Schlacht als siegreicher Feldherr zurückkehren und allen sozialen Konventionen der Zeit zum Trotz seine Geliebte heiraten würde. Er betrachtete also, zugespitzt formuliert, den Krieg als Schlüssel zu seinem Eheglück. Nach Millionen von Toten und Verwundeten und mehreren verlorenen Schlachten durfte er seine Gina im Oktober 1915 tatsächlich heiraten. In diesem Jahr beendete er auch sein »Tagebuch meiner Leiden«, das aus 3000 an Gina adressierten, aber nie abgeschickten Briefen bestand.
Die Idee vom Krieg als Erlösung fand im frühen 20. Jahrhundert durchaus breitere Zustimmung. So wird der Krieg im 1909 veröffentlichten Manifest des Futurismus, einer aus Italien stammenden avantgardistischen Kunstbewegung, als die »einzige Hygiene der Welt« bezeichnet. Der Weltkrieg wurde dann auch von vielen europäischen Künstlern und Intellektuellen als eine Chance zur Regeneration einer dekadenten und morschen Gesellschaft gefeiert. In diesem Sinne erklärte etwa der deutsche Philosoph und Literatur-Nobelpreisträger von 1908, Rudolf Eucken: »Der Einzelne gewinnt im Krieg einen hohen Adel seiner Seele, die eine unsagbare Größe und Weihe verleiht.«21
Persönliches Ehrverständnis und Furcht
Jenseits aller Staatsräson trugen vor allem Ehre und Furcht auch zum Ausbruch des amerikanischen Bürgerkrieges (1861–1865) bei. Die Sklaverei und die Sorge vor den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Konsequenzen, die deren Abschaffung für den amerikanischen Süden bedeuten würde, waren mit Sicherheit die Hauptgründe für den blutigsten Krieg in der amerikanischen Geschichte. Der Schriftsteller Mark Twain machte jedoch einen weiteren Schuldigen für den Ausbruch des Konflikts aus: den schottischen Schriftsteller Sir Walter Scott und das übertriebene Ehrgefühl, mit dem dieser die Oberschicht der Südstaaten indoktriniert hatte. Scott schrieb eine Reihe von historischen Romanen, darunter den 1819 veröffentlichten Roman Ivanhoe, der eine romantisierte Version des Mittelalters und vor allem des Rittertums schilderte. Twain machte Scott für die Hybris der Südstaaten verantwortlich, denn dessen Werke legitimierten seiner Meinung nach die archaische und rassistische Ideologie der dortigen sklavenbesitzenden Oberschicht, der sogenannten Plantagenaristokratie, wie man sie aus Vom Winde verweht oder Fackeln im Sturm kennt. Hierzu schrieb er: »Es war Sir Walter, der vor dem Krieg jeden Herrn im Süden zum Major oder Oberst, zum General oder zum Richter machte (…). Sir Walter hatte einen so großen Anteil an der Gestaltung des Südstaatencharakters, wie er vor dem Krieg existierte, dass er zu einem großen Teil für den Krieg verantwortlich ist.«22





























