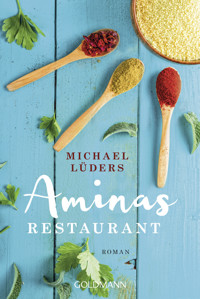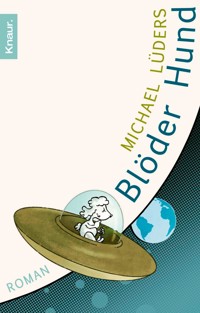12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
MACHT UND MEDIEN - EINE SCHONUNGSLOSE ANALYSE VON MICHAEL LÜDERS
Die USA sind kein selbstloser Hegemon, sondern ein Imperium – auch wenn hiesige Meinungsmacher gerne das Gegenteil behaupten. Donald Trump aber war kein bloßer Betriebsunfall. Unter Joe Biden wird sich vieles ändern, doch es wird weiterhin gelten: «America First». Michael Lüders warnt vor transatlantischen Illusionen und zeigt, warum Europa aus dem Schatten Washingtons heraustreten muss.
Die USA gelten als Garant für Demokratie und Menschenrechte. Doch für «Werte» einzutreten, ist nur die eine Seite der Medaille. Auf der anderen steht eine brutale Machtpolitik. Dennoch verfängt die amerikanische Mär vom selbstlosen Hegemon. Auch deswegen, weil unsere Medien viel zu oft mit zweierlei Maß messen. Michael Lüders zeigt, wie leicht die Öffentlichkeit durch gezieltes Meinungsmanagement zu manipulieren ist. Gestern im Irak-Krieg, heute in der Konfrontation mit dem Iran, mit Russland und China. Doch die USA sind eine Weltmacht im Niedergang – Europa muss lernen, seine Interessen selbst wahrzunehmen. Wir können uns die Rolle als Juniorpartner Washingtons auf Dauer nicht mehr leisten.
- Wie soll sich Europa in einer Zeit der Machtverschiebungen positionieren?
- Wir können uns die Rolle als Juniorpartner der USA nicht mehr leisten
- Meinungsmanagement - warum wir die Welt in Gut und Böse einteilen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 349
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Michael Lüders
Die scheinheilige Supermacht
Warum wir aus dem Schatten der USA heraustreten müssen
C.H.Beck
Zum Buch
Die USA sind kein selbstloser Hegemon, sondern ein Imperium – auch wenn hiesige Meinungsmacher gerne das Gegenteil behaupten. Donald Trump aber war kein bloßer Betriebsunfall. Unter Joe Biden wird sich Vieles ändern, aber es wird weiterhin gelten: «America First». Michael Lüders warnt vor transatlantischen Illusionen und zeigt, warum Europa aus dem Schatten Washingtons heraustreten muss.
Die USA gelten als Garant für Demokratie und Menschenrechte. Doch für «Werte» einzutreten, ist nur die eine Seite der Medaille. Auf der anderen steht eine brutale Machtpolitik. Dennoch verfängt die amerikanische Mär vom selbstlosen Hegemon. Auch deswegen, weil unsere Medien viel zu oft mit zweierlei Maß messen. Michael Lüders zeigt, wie leicht die Öffentlichkeit durch gezieltes Meinungsmanagement zu manipulieren ist. Gestern im Irak-Krieg, heute in der Konfrontation mit dem Iran, mit Russland und China. Doch die USA sind eine Weltmacht im Niedergang – Europa muss lernen, seine Interessen selbst wahrzunehmen. Wir können uns die Rolle als Juniorpartner Washingtons auf Dauer nicht mehr leisten.
Über den Autor
Michael Lüders was lange Jahre Nahost-Korrespondent der Wochenzeitung DIE ZEIT. Er ist Präsident der Deutsch-Arabischen Gesellschaft, in Nachfolge des verstorbenen Peter Scholl-Latour. Als Nahost-Experte und Bestsellerautor ist er häufiger Gast in Hörfunk und Fernsehen. Bei C.H.Beck sind von ihm erschienen: «Tage des Zorns» (2011) über die arabische Revolution, «Iran: der falsche Krieg» (2012), «Wer den Wind sät» (2015), «Die den Sturm ernten» (2017), «Armageddon im Orient» (2018) sowie die Thriller «Never Say Anything» (2016) und «Die Spur der Schakale» (2020).
Inhalt
Vorwort
Schattenkrieger: Warum Politiker und Journalisten die Entführung eines iranischen Tankers schönreden
Sanktionen als Waffe
«Ausgezeichnete Nachrichten»
Piraten auf Hoher See
Die Deutschen an die Front!
Gehört alles uns
Auf den Putsch folgt die Revolution
Trump hier, Dschingis Khan dort
Der Westen und seine Werte
«Fackeln der Freiheit»: Big Business bewährt sich als Meister der Manipulation
Nieder mit den Hunnen!
Machteliten folgen ihren eigenen Bilderwelten
Marktideologie um jeden Preis
Wie eine Elitendemokratie funktioniert
Rauchen ist gesund!
Alles eine Frage des Lifestyles
Bananen sind gesund?
Big Business bestimmt die Spielregeln, die CIA setzt sie um
Die Brutkasten-Lüge
Das Propaganda-Modell: Wie Medien unsere Wahrnehmung filtern
Die Grenzen der Vielfalt
Krawall ist gut fürs Geschäft
Herrschaft der Freiheit?
Familienwerte
Die Dinge beim Namen nennen? Lieber sie weichspülen
Alle Wege führen nach Moskau
Demokratie? Nicht für das gemeine Volk
Eine Hand wäscht die andere
Verschwörung!
Nichts geht ohne Amerikas ordnende Hand
Weg mit dem Vietnam-Syndrom!
Nie wieder Völkermord!
Eine Zeitung mit Format: Die Geschichte der Whistleblowerin Katharine Gun
Bagdad im Visier
Das Drama nimmt seinen Lauf
Schmutzige Tricks
Freedom Fries
Freispruch!
Irak-Krieg? Ja, aber …
Der gute Hegemon
Menschenrechte? Nicht für die Bösen
Kissinger veranlasst den Sturz Allendes
Willkommen im Schloss Bellevue
Wer die Strippen zieht
Macht und Meinungsmanagement: Die Guten gegen die Bösen
Kommunisten überall
Beste Freunde: Israelische Militärs und iranische Revolutionsgardisten
Über die Wahrheit in der Politik
Besser nicht das Imperium kritisieren
Über den Nutzen von Framing
Hier die Guten, da die Bösen
Ein schmissiger Willkommensgruß in San Diego
Die Welt gehört uns: Von der «Bürde des weißen Mannes» bis zum Einsatz für Freiheit und Demokratie
Bilderwelten
Aus dem Orient das Licht?
Mit Napoleon fing es an
Staatsverschuldung als Programm
Die Iraner wehren sich
Beste Feinde
Beste Freunde
Worum es wirklich geht am Golf
Zur Kasse bitte
Was zählt, sind die richtigen Worthülsen
Schurkenstaat Iran: Gesinnung zählt, nicht Fakten – auch bei Mord
Klare Verhältnisse
Prost Neujahr!
Fanatiker überall?
«Alles ist gut»
Pompeo – ein Gentleman allerhöchster Güte
George Orwell lässt grüßen
Legal, illegal – uns doch egal
Sachlich statt schwarzweiß? Lieber nicht
Iraner töten!
Investigative Ohnmacht
Der Terrorfürst – ein Sendbote Satans?
Staatskunst? Oder das Werk von Inspektor Clouseau?
Und der Gewinner ist: China
Keine Vergeltung unter dieser Nummer …
Das Wahre ist das Ganze: Die Welt neu denken
Schöne neue Welt
Das Runde muss ins Eckige
Nowitschok und die Spuren des Bösen
Morden, foltern, vergewaltigen? Bitte nur dienstlich
«Greifen Sie China an»
Ein Virus als Waffe
Werteorientierung und blinde Gewalt
Wie die Weichen in Richtung Zukunft stellen?
Think big
Ein neuer Weltethos
Es geht auch anders
Anmerkungen
Schattenkrieger: Warum Politiker und Journalisten die Entführung eines iranischen Tankers schönreden
«Fackeln der Freiheit»: Big Business bewährt sich als Meister der Manipulation
Das Propaganda-Modell: Wie Medien unsere Wahrnehmung filtern
Eine Zeitung mit Format: Die Geschichte der Whistleblowerin Katharine Gun
Macht und Meinungsmanagement: Die Guten gegen die Bösen
Die Welt gehört uns: Von der «Bürde des weißen Mannes» bis zum Einsatz für Freiheit und Demokratie
Schurkenstaat Iran: Gesinnung zählt, nicht Fakten – auch bei Mord
Das Wahre ist das Ganze: Die Welt neu denken
Für meinen Sohn Marlon Nichts ist leichter, als Menschen zu manipulieren
«Kümmert ihr euch um die Fotos, ich werde mich um den Krieg kümmern.»
William Randolph Hearst (1863–1951), US-amerikanischer Medien-Tycoon
«Das Minarett weinte, als der Fremde kam. Er kaufte es ohne Not – machte daraus einen Schlot.»
Adonis, einer der bedeutendsten arabischen Lyriker der Gegenwart, syro-libanesischer Herkunft. Dieses Gedicht, «Das Minarett», gehört zu seinen bekanntesten.
«Es ist unklug, immer den Sieg davontragen zu wollen.»
Niccolò Machiavelli (1469–1527), Staatsphilosoph und Machtpolitiker
«Wahr ist, was morgen in der Zeitung steht.»
Axel Springer (1912–1985), deutscher Medien-Tycoon
Vorwort
«Hoffnung» titelte eine deutsche Zeitung nach dem Wahlsieg des Demokraten Joe Biden in Großbuchstaben, rechts auf der Seite unterlegt von einem Grauton-Porträtfoto des künftigen Präsidenten. Sein staatsmännischer Gesichtsausdruck wäre einer Verewigung im berühmten Mount Rushmore National Memorial würdig – in Stein gemeißelt, an der Seite der Büsten von George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln und Theodore Roosevelt. Die linke Hälfte der Zeitungsseite füllt das sepiafarbene Gesicht der ersten Vizepräsidentin in der Geschichte der USA, Kamala Harris. Erwartungsvoll sieht sie in eine unbestimmte Ferne, ebenso entschlossen wie offenbar klug abwägend, so die unterschwellige Botschaft. Er blickt nach links, sie nach rechts – gemeinsam können beide es schaffen: ihr zutiefst gespaltenes Land wieder zu vereinen.
Eine durchaus ikonische Darstellung. Nach vier Jahren Donald Trump, nach vier Jahren Unberechenbarkeit, «alternativen Fakten» und America first haben die Amerikaner sich selbst und die Welt von einem furchtbaren Irrtum erlöst. Daher auch die Farbwahl der Ikonografie, wie auf alten Fotos – sie steht für die Rückkehr zum wahren, dem vertrauten, dem historisch verbrieften Amerika. Trump war der Antichrist, jetzt aber finden die USA wieder zu sich selbst, zu ihrer vertrauten Rolle als «unersetzliche Nation», als unentbehrliche «Ordnungsmacht».
«Amerika» ist nicht allein in Deutschland Glaubenssache. In Politik und Medien, ebenso in kleiner werdenden Teilen der Öffentlichkeit gelten die USA als Sehnsuchtsort, als Garant der Demokratie, vor allem aber als werteorientierter Verbündeter, als «Schutzmacht» Europas im Rahmen der NATO. Doch das Freiheitsversprechen der Vereinigten Staaten war stets und zu allen Zeiten immer nur die eine Seite der Medaille. Auf der anderen findet sich seit Anbeginn eine skrupellose Machtpolitik. Im Kalten Krieg etwa stürzte Washington auf mehreren Kontinenten fortschrittliche Regierungen, mit verheerenden Folgen für die Menschen in den betreffenden Ländern. Allen voran im Iran 1953, in Guatemala 1954, in Chile 1973. Dieses Buch erzählt davon. Der Krieg in Vietnam, der 1975 endete, war nicht weniger ein Verbrechen als der Irak-Krieg 2003, geführt auf der Grundlage von Lügen und dem vorsätzlichen Bruch internationaler Rechtsnormen. Hunderttausende Iraker starben, das Land stürzte ins Chaos, der «Islamische Staat» wurde geboren.
Die USA sind kein selbstloser Hegemon, sondern ein Imperium. Und ein Imperium betreibt grundsätzlich eine imperiale Politik. Das bedeutet, dass machtpolitische Widersacher oder Konkurrenten nach Möglichkeit zu schwächen oder auszuschalten sind, auch mit Hilfe von Subversion, Sanktionen oder militärischen Interventionen. Die Erhöhung Bidens und seiner Stellvertreterin – «Hoffnung» – ist verständlich, insoweit sie die Erleichterung über die Abwahl Trumps spiegelt. Doch war nur Trump allein das Problem? Fällt denn der Schaden, den die Regierung Bush mit ihrem «Krieg gegen den Terror» angerichtet hat, tatsächlich geringer aus als jener, der von der Regierung Trump zu verantworten ist? Hat die Regierung Obama nicht den Drohnenkrieg salonfähig gemacht, unbeschadet seiner vielen zivilen Opfer? Und die Cyber-Spionage auch gegenüber den Verbündeten, bis hin zum Telefon der Bundeskanzlerin, in neue Höhen geführt? Von Cyberangriffen ganz zu schweigen, etwa gegen den Iran? Hat sie nicht unmissverständlich klargestellt, dass die USA selbst mit einem ausgeprägten Sympathieträger als Präsidenten über dem Völkerrecht stehen, aus ihrer Sicht?
Daher sei die Prognose gewagt: Auch Präsident Biden wird, wie jeder seiner Vorgänger seit dem Zweiten Weltkrieg, Militär und Geheimdienste weltweit einsetzen, nötigenfalls Kriege führen zur Wahrung der eigenen Vormachtstellung. Dem übergroßen Einfluss des «militärisch-industriellen Komplexes» wird er sich schwerlich entgegenstellen, der fortschreitenden Oligarchisierung US-amerikanischer Politik nicht entgegenwirken (können). Und gegenüber den maßgeblichen Widersachern Washingtons, Russland und verstärkt China, ebenso wenig auf Deeskalation setzen wie die Präsidenten vor ihm.
Europäische und deutsche Transatlantiker dürfte das kaum erschüttern. So sehr haben sie ihre Rolle eines Juniorpartners an der Seite der USA verinnerlicht, dass sie nur selten darüber nachdenken, ob die Richtungsvorgaben des Bündnispartners tatsächlich auch hiesigen Interessen dienen, ihnen möglicherweise nicht sogar widersprechen. Der Öffentlichkeit gegenüber betonen sie die gemeinsamen Werte, den Einsatz für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte. Die andere Seite der Medaille nehmen sie nicht wahr oder relativieren sie. Was auch geschehen ist oder noch geschehen mag: Wir sind und wir bleiben die Guten. Da Transatlantiker in Politik und Medien und darüber hinaus, etwa in den zahlreichen «Denkfabriken», tonangebend sind, ist diese Haltung nicht irgendeine. Vielmehr ein Leitmotiv hiesiger (Außen-)Politik, wenn nicht gar ihr Fundament.
Nibelungentreue aber ist niemals eine gute Option. Auf die USA bezogen auch aus den beiden folgenden Gründen nicht. Zum einen war der Wahlsieg der Demokraten 2020 alles andere als ein Kantersieg über die Republikaner. Trump mag Vergangenheit sein, der Trumpismus ist es nicht. Wer garantiert, dass in vier Jahren nicht erneut ein unberechenbarer Populist ins Weiße Haus einzieht? Oder ein sendungsbewusster evangelikaler Christ? Sollten die Europäische Union und Deutschland weiterhin darauf verzichten, ihr Eigengewicht gegenüber Washington zu stärken, machen sie sich strategisch von ein paar Hundert oder Tausend Wählerstimmen in den maßgeblichen «Swing-Staaten» abhängig.
Zum anderen wandelt sich die Welt unaufhörlich. Die USA werden vorerst eine Supermacht bleiben, haben aber ihren historischen Zenit überschritten. Die Zeit, in der Washington stark genug war, um, zumindest vordergründig, auch europäische (Sicherheits-)Interessen wahrzunehmen, ist vorbei. Die kommende Supermacht ist China, und die Europäer müssen, ob sie wollen oder nicht, für ihre Interessen selbst einstehen. Andernfalls riskieren sie, zum Spielball im geopolitischen Ringen um Macht und Einfluss zu werden.
Was in Deutschland fehlt, sind meinungsoffene, streitbare Auseinandersetzungen über außenpolitische Grundsatzfragen. Somit entfallen Debatten jenseits vertrauter Stromlinien um dieses zentrale Thema weitgehend: Welches Verhältnis wollen, welches benötigen wir zu den USA? Überzeugte Transatlantiker sind durchaus bereit, Exzesse oder Versäumnisse amerikanischer Politik zu kritisieren. Die rote Linie allerdings ist die Benennung des Verbündeten als imperiale Großmacht. Die Geißelung der Machenschaften von «Schurkenstaaten», allen voran Russland, China und dem Iran, zeugt demzufolge von aufgeklärtem Geist, dem rechten Demokratie-Verständnis und ist garantiert sanktionsfrei. Wer jedoch in Richtung USA nicht den vermeintlich richtigen Ton trifft, sieht sich schnell an den Pranger gestellt und des «Anti-Amerikanismus» bezichtigt. Da hilft dann auch nicht der Hinweis, dass etwa die amerikanischen «Selbsthasser», die für die Serie House of Cards verantwortlich zeichnen, gleichwohl ein sehr realitätsnahes Bild der Ära Trump filmisch vorweggenommen haben. Und wäre der vielleicht beste Antikriegsfilm aller Zeiten, Apocalypse Now von Francis Ford Coppola (1979), tatsächlich «anti-amerikanisch»? Zeigt er nicht vielmehr ein künstlerisch verfremdetes, doch psychologisch überzeugendes Porträt der USA, wie sie in Vietnam im moralischen und politischen Morast versinken?
Imperien kommen und gehen, wie in einer Wellenbewegung, lehrte der arabische Historiker Ibn Khaldun schon im Mittelalter. Von ihm wird noch die Rede sein, ebenso von geschichtlichen Ereignissen, die das Wirken kolonialer wie imperialer Mächte nachzeichnen, damals wie heute. Den USA sind andere «Weltenlenker» vorausgegangen, weitere werden folgen. Gemeinsam ist ihnen, dass sie Macht auf Kosten Dritter ausüben. Einem Imperium geht es in den seltensten Fällen um Werte. Im Vordergrund steht die Durchsetzung und Wahrung eigener Interessen, insbesondere die Verteidigung gegebener Vorherrschaft. Das zugrundeliegende Geschäftsmodell, über alle Jahrhunderte, ist die Mehrung des Reichtums einer Minderheit auf Kosten der Mehrheit. Gerechtigkeit gerinnt in diesem Modell zu einem Privileg derer, die, modern gesprochen, den richtigen Reisepass besitzen.
Die Ausübung von Macht geht immer auch einher mit Manipulation, insbesondere der öffentlichen Meinung. Das ist in einer Demokratie nicht grundsätzlich anders. Das Buch erzählt die Geschichten der beiden US-Pioniere auf diesem Gebiet, Walter Lippmann und Edward Bernays, die nach dem Ersten Weltkrieg das «Meinungsmanagement» maßgeblich vorangetrieben haben. Es erklärt, wie Medien unsere Wahrnehmung filtern, aus Weltbildern Feindbilder werden. Und es zeigt, wie leicht eine Kluft entstehen kann zwischen dem, was tatsächlich geschieht, und dem, wie Meinungsmacher es darstellen. Die Art und Weise, wie die Entführung eines iranischen Tankers oder die Ermordung eines ranghohen iranischen Generals in deutschen Leitmedien kommentiert und dargestellt wurde, legt davon exemplarisch Zeugnis ab. Die Schlüsselfrage aber lautet: Wie halten wir Europäer es mit den USA, einer Weltmacht im Niedergang? Darüber eine öffentliche Debatte anzustoßen, jenseits der üblichen Gewissheiten, ist das Anliegen dieses Buches. Nicht in der Absicht, abschließende Antworten zu finden. Sondern die richtigen Fragen zu stellen. Solche, die neue Horizonte eröffnen.
Schattenkrieger: Warum Politiker und Journalisten die Entführung eines iranischen Tankers schönreden
Am 4. Juli 2019 fuhr der in Panama registrierte iranische Supertanker Grace 1, 330 Meter lang und beladen mit 2,1 Millionen Tonnen Rohöl im Wert von 140 Millionen US-Dollar, durch die Straße von Gibraltar, die Meerenge am westlichen Ende des Mittelmeeres. Nach Angaben des indischen Kapitäns, der sich später von der BBC unter der Bedingung interviewen ließ, dass sein Name nicht genannt wird, war der Ablauf der folgende: Im Morgengrauen erhielt er über Funk eine Mitteilung der Polizei von Gibraltar, eine Leiter die Bordwand herunterzulassen. Ein Polizeiteam wolle an Bord gehen. Doch stattdessen landete ein Militärhubschrauber auf dem Schiff, «auf sehr gefährliche Weise». 30 britische Marinesoldaten, ihrerseits unmittelbar zuvor aus Großbritannien eingeflogen, sprangen an Deck. Der Kapitän habe sich zu erkennen gegeben, wurde aber von den Soldaten ignoriert. Sie richteten ihre Gewehre auf die Besatzung und riefen: «Guckt nach vorne, guckt nach vorne!» Der Kapitän weiter: «Es war ihnen egal, dass ich der Verantwortliche war. Sie machten, was sie wollten. Die Besatzung bestand aus 28 Mann, alle unbewaffnet. Ich stand unter Schock, wir alle waren unter Schock. Wieso entert jemand ein Schiff wie dieses mit bewaffneten Soldaten und roher Gewalt?»
Natürlich wies das britische Verteidigungsministerium diese Darstellung zurück. Das Vorgehen der Soldaten entspreche «den üblichen Maßnahmen beim Betreten eines Schiffs». Im Übrigen seien die britischen Streitkräfte «bekannt für ihr Höchstmaß an Professionalität».[1] Die Grace 1 jedenfalls musste Kurs nehmen auf Gibraltar und wurde dort sechs Wochen festgehalten. Der Kapitän wurde verhaftet, gegen Kaution aber auf freien Fuß gesetzt, ohne Gibraltar verlassen zu dürfen.
Die offizielle Begründung der britischen Regierung für ihr Vorgehen lautete, die Grace 1 sei auf der Fahrt zur syrischen Hafenstadt Banyas gewesen, um dort ihre Ladung zu löschen. Das aber sei ein Verstoß gegen die von der Europäischen Union 2012 gegen Syrien verhängten Wirtschaftssanktionen, die sich als Antwort auf die brutale Kriegsführung des Assad-Regimes verstehen. Zwar gehört der Iran bekanntlich nicht zur EU, doch ließ sich Brexit-Außenminister Jeremy Hunt davon nicht beirren. Die «entschlossene Aktion» der Behörden in Gibraltar und der britischen Marine würden dem «mörderischen Regime» in Damaskus «wichtige Ressourcen» vorenthalten.[2] Dieser Linie, der zufolge das Aufbringen der Grace 1 allein der Umsetzung geltenden EU-Rechts geschuldet sei, haben weder westliche Leitmedien noch maßgebliche Politiker widersprochen. Selbst dann nicht, als die Zweifel an dieser Version immer größer wurden.
Seit die Grace 1 im Mai 2019 ihre Fahrt in der iranischen Hafenstadt Bandar Abbas angetreten hatte, war sie von US-Satelliten beobachtet worden. Zu groß für eine Passage durch den Suezkanal, musste sie den Umweg um Südafrika, um das Kap der Guten Hoffnung, nehmen, bevor sie schließlich die Straße von Gibraltar erreichte. In der Zwischenzeit hatten sich US-Behörden mit der spanischen Regierung in Verbindung gesetzt, offenbar in der Absicht, sie zu drängen, das Schiff festsetzen zu lassen. Der entscheidende Strippenzieher in Washington war John Bolton, der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump und einer der maßgeblichen Scharfmacher amerikanischer Konfrontationspolitik gegenüber Teheran. Ob Madrid sich zögerlich zeigte oder Spanien von Anfang an nur eine passive Rolle zugedacht war, ist unklar. Jedenfalls kontaktierte Bolton zusätzlich auch die britische Führung. Zu dem Zeitpunkt lag Theresa May politisch in ihren letzten Zügen als Premierministerin, zeichnete sich die Ernennung von Boris Johnson zum Regierungschef inmitten des Brexit-Chaos bereits ab. «Der Verdacht liegt nahe, dass konservative Politiker, abgelenkt vom Brexit, verstrickt in Machtspiele … in eine von den Amerikanern gestellte Falle gestolpert sind,»[3] kommentierte die britische Zeitung The Guardian.
Sanktionen als Waffe
Im Sommer 2019 hatte die Politik des «maximalen Drucks», den die USA auf den Iran ausüben, einen gefährlichen Höhepunkt erreicht. Seit der einseitigen, gegen den Willen der übrigen Signatarstaaten erfolgten und rechtswidrigen Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran durch die Regierung Trump im Mai 2018 setzte Washington auf eine wirtschaftliche Kriegsführung gegen Teheran. Dieses Abkommen war drei Jahre zuvor, 2015, zwischen den USA, Russland, China, Frankreich, Großbritannien, Deutschland und der Außenbeauftragten der Europäischen Union einerseits sowie dem Iran andererseits geschlossen worden, um eine nukleare Bewaffnung der Islamischen Republik auszuschließen. Die offizielle Begründung Washingtons für den Ausstieg lautete, man wolle ein umfassenderes und «besseres» Abkommen erzielen, gegen dessen «Geist» Teheran verstoßen habe.
Um ihre Ziele zu erreichen, verhängte die Regierung Trump strangulierende Wirtschaftssanktionen gegen die Islamische Republik – neben den Sanktionen gegen den Irak unter Saddam Hussein nach dessen Einmarsch in Kuweit (in Kraft von 1990 bis zu dessen Sturz 2003) und Syrien seit 2012 die härtesten, denen sich jemals ein Mitgliedsstaat der Vereinten Nationen ausgesetzt sah. Nicht nur kam damit der ohnehin geringe Außenhandel zwischen den USA und dem Iran faktisch zum Erliegen, sofern er nicht weiterhin über Zwischenhändler abgewickelt wird. Vor allem die amerikanische Computerindustrie bedient sich gerne des Umwegs über Dubai. Gleichzeitig verhängten die USA sogenannte «Sekundärsanktionen». Sie untersagen auch Drittstaaten und dort ansässigen Unternehmen mittels eines Konvoluts an juristischen Bestimmungen de facto jede Geschäftsbeziehung mit dem Iran, unter Androhung von Strafverfolgung. Gleichzeitig werden Firmen, die diese Direktive nicht befolgen, vom amerikanischen Markt faktisch ausgeschlossen, sofern sie keinen Wert auf jahrelange und meist exorbitant teure Verfahren vor US-Gerichten legen. Da dieser Markt ungleich bedeutender ist als der iranische, haben sich tatsächlich alle großen westlichen Unternehmen, etwa Autohersteller, aus dem Iran zurückgezogen.
Formal sind die US-Sekundärsanktionen, auch extraterritoriale Sanktionen genannt, der Exportkontrolle zuzuordnen. Deutsches und EU-Recht kennt ebenfalls solche Exportkontrollen, die, siehe Syrien, auf ein Embargo aus politischen Gründen hinauslaufen können. Doch kein Land setzt die eigene Wirtschaftsmacht mit Hilfe der Justiz dermaßen konsequent als politische Waffe ein wie die USA.[4] Peking steht im Begriff, gleichzuziehen und seinerseits Sekundärsanktionen anzuwenden, hat aber die seit 2017 vorliegenden entsprechenden Gesetzesvorlagen, die sich weitgehend an den amerikanischen Regelungen orientieren, bis Ende 2020 nicht ratifiziert. In Washington haben Sekundärsanktionen seit dem Zweiten Weltkrieg einen regelrechten Boom erlebt und werden bei internationalen Konflikten regelmäßig eingesetzt – doch nie so aggressiv wie im Fall Irans. Übrigens treffen diese Sanktionen nicht allein «Schurkenstaaten», sondern auch wirtschaftliche Konkurrenten wie Deutschland: Manager und Mitarbeiter von Firmen beispielsweise, die am Bau oder dem Betrieb der von Washington seit Dezember 2019 ebenfalls sanktionierten Gaspipeline Nord Stream 2 beteiligt waren und sind. Diese durch die Ostsee führende Pipeline soll ab 2021 russisches Erdgas nach Deutschland befördern.
Maßgeblich fußen Sekundärsanktionen auf «Gummiband-Paragrafen» und bewegen sich in juristischen Grauzonen, kennen zahlreiche Vorstufen und werden auch nicht immer als solche bezeichnet. Solche «Flexibilität» ist selbstverständlich gewollt. Deswegen haben die USA auch gar nicht erst versucht, ein Mandat der Vereinten Nationen für ihre völkerrechtswidrige Sanktionspolitik gegenüber Teheran einzuholen. Wo genau die völkerrechtlichen Grenzen von Sanktionspolitik verlaufen, ist unter Juristen umstritten. Die US-Sanktionen gegen Teheran gelten aber außerhalb der USA und einiger weniger ihrer Vasallenstaaten unzweideutig als völkerrechtswidrig, weil sie auf anlassgegebene Begründungen jenseits politischer Forderungen weitgehend verzichten und in ihrer Totalität die staatliche Souveränität Irans bewusst und vorsätzlich angreifen. Die Sanktionen hebeln, anders gesagt, höhere Rechtsgüter aus: Das Völkerrecht steht über nationalem Recht – theoretisch jedenfalls.
Offenbar glaubten die Hardliner in Washington, die sich als Folge des Embargos verschärfende Wirtschaftslage im Iran würde zu einem Aufstand der unzufriedenen Bevölkerung gegen die Machthaber führen, zu einer Implosion des Regimes. Das allerdings ist nicht geschehen, ist übrigens noch nirgendwo geschehen infolge von Sanktionspolitik. Im Juni 2019 endeten alle Sondergenehmigungen, die Washington unter anderen der Türkei, Indien, Südkorea oder Japan gewährt hatte, um zunächst weiterhin ungestraft Erdöl aus dem Iran beziehen zu dürfen. Damit verlor Teheran einen Großteil seines Außenhandels, der maßgeblich auf dem Export von Erdöl und Erdgas beruht. Die Politik des «maximalen Drucks» erreichte ihren vorläufigen Höhepunkt – in der irrigen Annahme, die iranische Führung werde gewissermaßen kapitulieren, sich mindestens aber zu erneuten Atomverhandlungen mit den USA bereiterklären, selbstverständlich zu den Bedingungen Washingtons.
Welche Regierung würde das tun? Angesichts der Rhetorik aus Trumps Umfeld war der iranischen Führung bewusst, dass Neuverhandlungen ihre Lage kaum zum Besseren wenden, möglicherweise aber den Weg zu weiteren «Strafmaßnahmen» ebnen könnten. Gänzlich unbeschadet der Einsicht, dass von Washington unterzeichnete Verträge offenbar das Papier nicht wert sind, auf dem sie geschrieben stehen. Die Haltung Teherans lautete daher sinngemäß: Wir können über alles reden, sofern die Sanktionen gegen uns wieder aufgehoben werden.
Parallel verschlechterte sich 2019 die Sicherheitslage im Persischen Golf. Im Mai kam es erstmals zu Sabotageakten gegenüber Handelsschiffen im Umfeld der Straße von Hormus – jenem Nadelöhr von 60 Kilometer Breite, zwischen dem Iran und Oman sowie den Vereinigten Arabischen Emiraten gelegen, das nahezu alle Erdölexporte aus der Golfregion passieren müssen. Rund ein Fünftel des weltweit geförderten Erdöls nimmt diesen Weg. Für die wiederholten Angriffe auf Tanker verschiedener Nationalitäten, die meist begrenzte Schiffsbrände zur Folge hatten, machten die USA und ihre Verbündeten den Iran verantwortlich. Beweise gibt es dafür keine, doch ist der Verdacht nicht abwegig: Wer sich mit dem Iran anlegt, riskiert die sichere Erdölversorgung, so könnte die Botschaft Teherans lauten. Allerdings ist ebenso wenig auszuschließen, dass die amerikanischen Juniorpartner in der Region, Israel und Saudi-Arabien, vereint in ihrer Gegnerschaft zum Iran, für die Zwischenfälle verantwortlich sind – um die Konfrontation anzuheizen. Immer in der Hoffnung, dass die USA sich endlich zum Waffengang gegen die verhasste Islamische Republik entschließen.
«Ausgezeichnete Nachrichten»
Diese Hintergründe sind wesentlich, um die nachfolgenden Ereignisse einordnen zu können. An jenem 4. Juli 2019, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag, twitterte John Bolton: «Ausgezeichnete Nachrichten: GB hat den Supertanker Grace 1 festgesetzt, der in Verletzung der EU-Sanktionen mit iranischem Öl für Syrien beladen ist.»[5]
Damit erweckte er den Eindruck, London habe auf eigene Initiative gehandelt, im Sinne der EU, nicht etwa auf Drängen der USA. Allerdings war das Gegenteil richtig, wie der spanische Außenminister Josep Borrell noch am selben Tag klarstellte: Die Festsetzung der Grace 1 sei «nach einer entsprechenden Aufforderung der USA an Großbritannien erfolgt».[6] Es ging also offensichtlich mehr um die Durchsetzung der amerikanischen Politik des «maximalen Drucks» gegenüber Teheran als um die EU-Sanktionen.
Die iranische Seite verwies darauf, dass diese gegen Syrien verhängten Sanktionen der EU für Teheran gegenstandslos seien, und verlangte die sofortige Freigabe des Schiffes. Das allerdings wies London zurück. Zwar hielt die britische Regierung offiziell am Atomabkommen mit dem Iran fest, doch andererseits war sie für die Zeit nach dem Brexit verstärkt auf gute Beziehungen zu den USA angewiesen. Dieser Spagat zwischen Europa und Amerika konnte nicht gutgehen, und die Reaktion der Iraner ließ nicht lange auf sich warten. Zwei Wochen später, am 19. Juli, kaperten Revolutionsgardisten den unter britischer Flagge fahrenden Tanker Stena Impero am östlichen Ausgang der Straße von Hormus. Mit 30.000 Tonnen Nutzlast ein Zwerg, gemessen an der Grace 1, doch die Botschaft verstand sich von selbst. Die offizielle Begründung lautete, das Schiff habe gegen geltende maritime Bestimmungen verstoßen, was immer das bedeuten mochte. Außenminister Hunt bezeichnete die Aktion umgehend als «einen Akt staatlicher Piraterie».[7]
Das war sie auch. Doch was hatten die Briten erwartet? Dass die Iraner die Festsetzung der Grace 1 in Gibraltar lediglich zur Kenntnis nehmen?
Nach dem Zweiten Weltkrieg haben die USA Großbritannien als dominante Ordnungsmacht im Nahen und Mittleren Osten abgelöst. Seither begnügen sich die Briten (nicht nur) dort mit der Rolle eines imperialen Juniorpartners. Vom Putsch gegen den demokratisch gewählten iranischen Präsidenten Mossadegh 1953 bis hin zum Irak-Krieg 2003 und dem seit 2015 andauernden Krieg im Jemen – London war stets der Pudel an Washingtons Seite, wie Spötter anmerkten. Oft genug haben die Briten dafür einen hohen Preis bezahlt. So hält etwa der 2016 veröffentlichte, regierungsamtliche Chilcot-Bericht über die britische Beteiligung am Irak-Krieg unter anderem fest, London habe in den Jahren 2003 bis 2009 politisch maßgeblich dieses eine Ziel verfolgt: die eigenen Soldaten ohne Gesichtsverlust und ohne die Amerikaner zu verärgern möglichst schnell wieder abzuziehen. Infolgedessen wurden mehr und mehr britische Soldaten vom Irak nach Afghanistan verlegt. 400 von ihnen haben diesen Wunsch nach Größe und Bedeutung mit ihrem Leben bezahlt.
Nichts lag auch den Brexiteers ferner, als die Amerikaner herauszufordern. Die wiederum hatten ihren Coup gegen die Grace 1 gut vorbereitet. Am 29. Mai 2019 entzog die Schifffahrts-Behörde in Panama ihren Eignern auf amerikanischen Druck das Recht, unter der Flagge Panamas zu fahren, wie auch rund 60 weiteren iranischen Schiffen in den Monaten zuvor.[8] Das Timing war kein Zufall: Gerade erst hatte die Grace 1 ihre Reise angetreten. Die Begründung des panamaischen Außenministeriums ist nicht ohne Charme, mit Blick etwa auf die 2016 veröffentlichten Panama-Papers, und hier insbesondere den auf Steuerbetrug spezialisierten panamaischen Offshore-Dienstleister Mossack Fonseca. Panama bekämpfe seit Jahren konsequent Geldwäsche und die Finanzierung von Terrorismus. Es bestehe der Verdacht, die Grace 1 sei an solcher Finanzierung beteiligt, namentlich «den destabilisierenden Aktivitäten in einigen Regionen, die von terroristischen Gruppen angeführt werden».[9] Gemeint war die Revolutionsgarde, die militärische Elitetruppe Teherans, die Präsident Trump im April 2019 offiziell als ausländische Terrororganisation gebrandmarkt hatte.
Besagter «Flaggenentzug» hat zur Folge, dass sowohl das entsprechende Schiff wie auch dessen Ladung seinen Versicherungsschutz verliert, sofern es nicht anderswo versichert wird. Um das zu verhindern, wies der im US-Außenministerium zuständige Beamte für die Sanktionspolitik gegenüber Teheran, Brian Hook, ausdrücklich darauf hin, dass sich die US-Sanktionen auch auf Versicherungsleistungen für iranische Schiffe in Drittstaaten erstreckten. Und für den Fall, dass die Iraner ihre Schiffe selbst versichern, warnte Hook: «Sollte es zu einem Unfall mit einem iranischen Tanker kommen, werden iranische Versicherungsgesellschaften schlichtweg nicht in der Lage sein, den Schaden zu begleichen.»[10]
Entgegen den Behauptungen aus Washington und London ist mehr als fraglich, ob die EU-Sanktionsbestimmungen gegenüber Syrien für die Grace 1 tatsächlich galten. Diese Bestimmungen, erstmals festgehalten im Ratsbeschluss der EU Nummer 36 vom 18. Januar 2012, sind laut Artikel 35 nur innerhalb des Territoriums der EU-Mitgliedsstaaten rechtsgültig oder aber im Kontext «nationaler oder geschäftlicher Entitäten», darunter Flugzeuge und Schiffe, insoweit sie «der Rechtsprechung eines EU-Mitgliedstaates unterliegen».[11] Nach britischer Darstellung hatte sich das iranische Schiff freiwillig in die Küstengewässer Gibraltars begeben, für einen Versorgungsstopp. Der Iran dagegen behauptet, der Tanker sei in internationalen Gewässern aufgebracht worden. Doch selbst wenn sich die Grace 1 tatsächlich in den von Gibraltar beanspruchten Hoheitsgewässern aufgehalten haben sollte und damit innerhalb der EU, bleibt deren Festsetzung juristisch heikel. Denn völkerrechtlich ist höchst umstritten, ob einseitig verhängte Sanktionen, in diesem Fall der EU gegenüber Syrien, auch zulasten Dritter gehen können. Ist Brüssel befugt, Rechtsnormen zu setzen, die etwa für den Iran gelten? Die meisten Völkerrechtler würden das verneinen, aus guten Gründen. In dem Fall wären auch andere berechtigt, nach demselben Rechtsprinzip zu verfahren. Was sollte dann beispielsweise China daran hindern, Taiwan zu sanktionieren und alle Schiffe festzusetzen, die Kurs auf die aus Pekings Sicht abtrünnige Insel nehmen?
Doch die Briten standen im Fall der Grace 1 noch vor einem weiteren Problem. Denn woher wollten sie wissen, dass der Tanker überhaupt die Absicht hatte, Syrien anzulaufen? Vermutlich gab es geheimdienstliche Informationen aus Washington, aber zweifelsfrei beweisen ließ sich die Absicht nicht. London entschied sich daher für einen Taschenspielertrick. Einen Tag vor dem Aufbringen der Grace 1, am 3. Juli 2019, verabschiedete die Regierung von Gibraltar die Sanktionsregulierung LN.2019/131. Sie erteilt dem Chief Minister, dem Gouverneur von Gibraltar, die Befugnis, jedwedes Schiff festzusetzen, bei dem «berechtigte Gründe» Anlass geben zu dem «Verdacht», dass es gegen bestehende EU-Bestimmungen verstoßen hat oder es «möglicherweise» tun könnte.[12] Das sind immerhin drei Eventualitäten in sehr kurzer Abfolge.
Piraten auf Hoher See
Dazu muss man wissen, dass Gibraltar rechtlich als britisches Überseegebiet gilt. Die Regierung von Gibraltar besitzt nicht mehr Befugnisse als etwa eine deutsche Landesregierung. Ausdrücklich obliegen Fragen der Verteidigung, der Außenpolitik und der inneren Sicherheit nicht den Verantwortlichen vor Ort, sondern ausschließlich der Regierung in London. Hätten die Behörden in Gibraltar also besagte Sanktionsregulierung in Eigeninitiative getroffen, wären sie der Amtsanmaßung schuldig geworden, hätten sie gegen britisches Recht verstoßen. Nein, Gibraltar hat ganz eindeutig eine Regieanweisung aus London umgesetzt.[13]
Eine gar nicht befugte Exekutive setzt also neues Recht, bezeichnenderweise einen Tag vor dessen erstmaliger Anwendung, und erklärt die sofortige Gültigkeit dieses Rechts im Namen der Europäischen Union, ohne jede Absprache mit Brüssel. Das verstößt, gelinde gesagt, gegen jede Geschäftsordnung. Letztendlich ging es dabei auch gar nicht um die Durchsetzung von EU-Recht. Vielmehr benutzten die Drahtzieher in London, also Brexiteers, die EU, um sich den Amerikanern anzudienen. Das mag erklären, warum es der Europäische Auswärtige Dienst (European External Action Service), zuständig für die Umsetzung außen- und sicherheitspolitischer Beschlüsse Brüssels, während der gesamten Krise um die Beschlagnahme der Grace 1 vorzog, eisern zu schweigen. Auch die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini äußerte sich nicht zu diesem Thema. Erst, nachdem die Iraner als Vergeltung die britische Stena Impero festgesetzt hatten, warnte sie vor «gefährlichen Entwicklungen» in der Region.[14] Sie meinte allerdings nicht das Mittelmeer, sondern den Persischen Golf.
Da ihre juristischen Hilfskonstruktionen völkerrechtlich nicht haltbar sind, hat die britische Regierung zwangsläufig auch gegen das Seevölkerrecht verstoßen. Dieses, kodifiziert im Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen, garantiert die freie Fahrt auf den Weltmeeren, sofern nicht ein Schiff die völkerrechtlichen Grenzen des Rechts auf friedliche Durchfahrt verletzt. Dazu gehört etwa Waffen- oder Menschenschmuggel. In solchen eng begrenzten Fällen darf ein Schiff von Anrainer- oder auch Drittstaaten aufgebracht werden. Für internationale Meerengen gilt darüber hinaus, dass die Transitdurchfahrt grundsätzlich nicht behindert werden darf. Das Festsetzen eines Schiffes innerhalb einer Meerenge oder eines Kanals wäre nur dann gerechtfertigt, wenn sich der Staat, der das Schiff aufbringt, im Krieg befindet mit dem Land, dem es zuzuordnen ist. Im Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages vom 2. August 2019 heißt es auf Anfrage der Linksfraktion unmissverständlich: «Nach gegenwärtigem Kenntnisstand ist daher davon auszugehen, dass die Festsetzung des iranischen Öltankers ‹Grace 1› am 4. Juli 2019 durch britische Marinekommandos in der Straße von Gibraltar keine Rechtsgrundlage im Seevölkerrecht findet.»[15]
Deutlicher lässt sich eine schallende Ohrfeige kaum in Worte fassen. Andererseits – wen interessiert das? Weder deutsche, allgemein westliche Qualitätsmedien noch hiesige Politiker haben es für notwendig erachtet, das britische Vorgehen zu kritisieren, geschweige denn zu verurteilen. Möglicherweise auch deswegen nicht, weil das Völkerrecht aus Sicht der USA und der EU spätestens seit dem Kosovo-Krieg 1999 nur noch eine untergeordnete Rolle spielt – sofern westliche Akteure dagegen verstoßen. Damals kam es zum ersten NATO-Einsatz out of area überhaupt, also zum Zweck einer militärischen Intervention, die nicht der Verteidigung eines NATO-Mitgliedsstaates dient. Eine völkerrechtliche Grundlage für diesen Einsatz gegen Serbien und Montenegro, ein UN-Mandat, war nicht gegeben.
Die Causa Kosovo markiert auch den Beginn eines zunehmend offensiv vertretenen NATO-Selbstverständnisses, demzufolge nicht allein die Landesverteidigung deren Aufgabe sei, sondern auch, unter anderem, die Sicherung von Rohstoffen oder Verkehrswegen. Eine solche Zielsetzung erfordert nötigenfalls eine flexible Auslegung internationaler Rechtsnormen. Das von Bundespräsident Joachim Gauck auf der Münchener Sicherheitskonferenz 2014 vorgetragene und zum geflügelten Wort gewordene Diktum, Deutschland müsse künftig «mehr Verantwortung übernehmen», bezeichnet dabei den Weg – auch und gerade in Richtung von Militäreinsätzen. Der deutschen Öffentlichkeit allerdings ist dieser «robuste» Einsatz für Freiheit und Frieden nur schwer zu vermitteln. 78 Prozent der Deutschen sind gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr, so etwa das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts TNS Emnid im Auftrag der Wochenzeitung der Freitag von 2014.[16] Jüngere Umfragen kommen zu ähnlichen Ergebnissen: 60 bis 80 Prozent der Bevölkerung lehnen dergleichen Engagement konstant ab.
Die Deutschen an die Front!
Die Festsetzung des iranischen Tankers durch die britische Marine wurde seitens hiesiger Politik wie auch der Medien zur Kenntnis genommen, mehr nicht. Doch als zwei Wochen später Revolutionsgardisten das britische Schiff kaperten, war die Empörung groß. Zwar bestritt Außenminister Hunt, dass es irgendeinen Zusammenhang zwischen der Festsetzung der Grace 1 und jener der Stena Impero geben könnte. Er bezeichnete die Aktion der Revolutionsgardisten als «in jeder Hinsicht inakzeptabel» und «feindseligen Akt».[17] Hunts Nachfolger, Außenminister Dominic Raab, schloss die wechselseitige Freilassung beider Schiffe aus: «Es gibt kein Quidproquo. Es geht hier nicht um einen Tauschhandel.»[18] Denn nach britischer Logik war ja das eigene Tun gesetzeskonform, das iranische hingegen nicht. Natürlich gab es diesen Tauschhandel am Ende doch. Jedenfalls hat sich London hinter den Kulissen um eine politische Lösung der Krise bemüht und die US-Regierung ersucht, auf jede eskalierende Rhetorik zu verzichten – was in der Tat auch geschah.[19] In gewisser Weise war das der britische Griff zur Notbremse, um nicht unverhofft als «Pudel» der USA in einen Krieg gegen den Iran hineingezogen zu werden.
Dessen ungeachtet warb London im Zuge dieser Konfrontation für eine europäische Marinemission zur Sicherung des Seeverkehrs entlang der Straße von Hormus. Parallel dazu bemühten sich aber auch die USA, ihre eigene Militärpräsenz vor Ort zu «internationalisieren» und somit aufzuwerten, nachdem sie bereits im Mai 2019 zusätzlich einen Flugzeugträger, eine Bomberstaffel und mehrere Kriegsschiffe in die Golfregion entsendet hatten. Auch die Bundesregierung sah sich mit dem Ersuchen Washingtons konfrontiert, sich an einer solchen, US-geführten Marinemission zu beteiligen. In der deutschen Innenpolitik entspann sich ein wochenlang geführter Disput, ob Berlin mitmachen sollte oder nicht. Der Tenor lautete: Wenn der Einsatz europäisch geführt ist, ja, unter amerikanischem Befehl, nein. Das erscheint zunächst salomonisch, ist es aber nicht wirklich, denn im Kriegsfall spielen solche Feinheiten keine Rolle mehr. Am Ende kam es zu keinem EU-Einsatz. Stattdessen ließ London den eigenen Vorschlag eines europäischen Marineeinsatzes fallen und schloss sich der im August 2019 eingeleiteten, US-geführten «Operation Sentinel» («Wächter») zur «Überwachung der Gewässer am Golf» an. Mit von der Partie: Australien, Bahrein und Israel, letzteres Land im Bereich der militärischen Aufklärung.