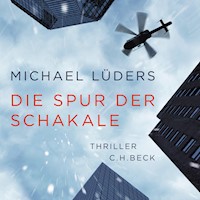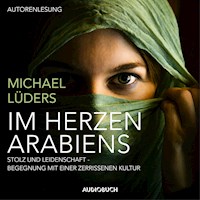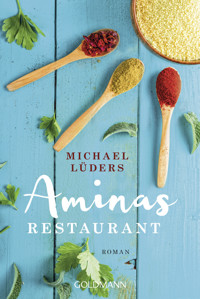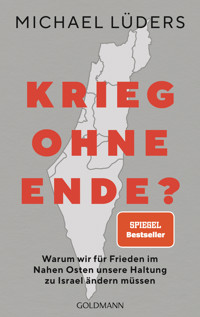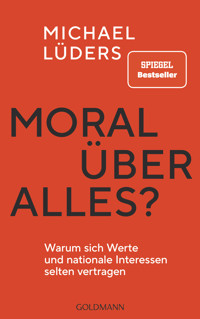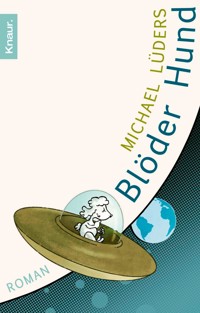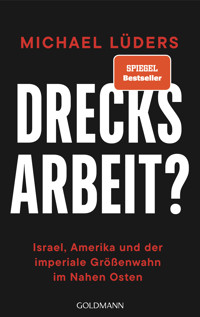
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der gefährliche Kampf um die Vorherrschaft im Nahen Osten
»Das ist die Drecksarbeit, die Israel macht für uns alle.« Mit seinen Äußerungen zum israelischen Angriff auf die Islamische Republik Iran im Juni 2025 solidarisierte sich Bundeskanzler Friedrich Merz klar mit der Regierung Netanjahu. Auch der US-Angriff auf die Produktionsstätten des iranischen Atomprogramms wenige Tage später stieß auf die Zustimmung der Bundesregierung.
Nahostexperte und SPIEGEL-Bestsellerautor Michael Lüders wirft einen kritischen Blick auf vermeintliche Wahrheiten im Nahen Osten und stellt wichtige Fragen:
• Greift der Iran tatsächlich nach der Atombombe?
• Will er Israel »vernichten«, wie stets behauptet wird?
• Wie kam es zur Iranischen Revolution?
• Welchen Anteil trägt der Westen an der Gründung der Islamischen Republik 1979?
• Ist der von Israel und den USA angestrebte Sturz des Regimes im Iran realistisch, und was käme danach?
• Was geschieht im Gazastreifen?
• Droht der Region ein ewiger Krieg?
Dabei wird klar: Im Nahen Osten offenbart sich zunehmend die große Heuchelei und eine gefährliche Kurzsichtigkeit westlicher Außenpolitik. Wenn wir nicht zum politischen Realismus zurückkehren, kann sich der Konflikt in der Region zum Flächenbrand ausbreiten – mit unabsehbaren Folgen auch für Europa und Deutschland.
Das Must-read für alle, die das komplexe Machtgefüge im Nahen Osten verstehen wollen – erklärt vom renommierten Nahostexperten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 286
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buch
»Das ist die Drecksarbeit, die Israel macht für uns alle.« Mit seinen Äußerungen zum israelischen Angriff auf die Islamische Republik Iran im Juni 2025 solidarisierte sich Bundeskanzler Merz klar mit der Regierung Netanjahu. Auch der US-Angriff auf die Produktionsstätten des iranischen Atomprogramms wenige Tage später stieß auf die Zustimmung der Bundesregierung.
Nahostexperte Michael Lüders wirft einen kritischen Blick auf vermeintliche Wahrheiten im Nahen Osten und stellt wichtige Fragen: Greift der Iran tatsächlich nach der Atombombe? Welchen Anteil trägt der Westen an der Gründung der Islamischen Republik 1979? Ist der von Israel und den USA angestrebte Sturz des Regimes im Iran realistisch, und was käme danach? Was geschieht im Gazastreifen?
Dabei wird klar: Im Nahen Osten offenbart sich die große Heuchelei und eine gefährliche Kurzsichtigkeit westlicher Außenpolitik. Wenn wir nicht zum politischen Realismus zurückkehren, kann sich der Konflikt in der Region zum Flächenbrand ausbreiten – mit unabsehbaren Folgen auch für Europa und Deutschland. Das Must-read für alle, die das komplexe Machtgefüge im Nahen Osten verstehen wollen!
Autor
Michael Lüders studierte Politik- und Islamwissenschaften in Berlin und Damaskus und war lange Jahre Nahostkorrespondent der Hamburger Wochenzeitung DIEZEIT. Er war Präsident der Deutsch-Arabischen Gesellschaft in Nachfolge des verstorbenen Peter Scholl-Latour und Mitglied im Afghanistan-Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestags. Auf YouTube äußert sich Michael Lüders regelmäßig zu aktuellen politischen Themen. Zuletzt erschienen von ihm bei Goldmann die SPIEGEL-Bestseller Moral über alles? und Krieg ohne Ende?.
www.michael-lueders.de
YouTube: @michaelluders1787
Außerdem von Michael Lüders im Programm
Moral über alles? Warum sich Werte und nationale Interessen selten vertragen
Krieg ohne Ende? Warum wir für Frieden im Nahen Osten unsere Haltung zu Israel ändern müssen
auch als E-Book erhältlich
MICHAEL LÜDERS
DRECKSARBEIT?
Israel, Amerika und der imperiale Größenwahn im Nahen Osten
Wir haben uns bemüht, alle Rechteinhaber ausfindig zu machen, verlagsüblich zu nennen und zu honorieren. Sollte uns dies im Einzelfall aufgrund der schlechten Quellenlage bedauerlicherweise einmal nicht möglich gewesen sein, werden wir begründete Ansprüche selbstverständlich erfüllen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Originalausgabe Oktober 2025
Copyright © 2025: Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)
Redaktion: Peter Hammans
Karten: Peter Palm
Umschlag: Uno Werbeagentur, München
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
Printed in Germany
EB ∙ CF
ISBN 978-3-641-34309-5V002
www.goldmann-verlag.de
Für meinen Sohn Marlon
Wirf den Blick weg, dann gewinnst Du freie Sicht.
»Wenn alle das Gleiche denken, denkt keiner richtig.«
Georg Christoph Lichtenberg
»Mut ist die Tugend, die für Gerechtigkeit eintritt.«
Cicero
»Untergehenden Völkern verschwindet meist das Maß.«
Adalbert Stifter
»Man muss die Tatsachen kennen, bevor man sie verdrehen kann.«
Mark Twain
»Besser mit Klugen in die Hölle als mit Narren ins Paradies.«
Bulgarisches Sprichwort
Inhalt
Narren regieren die Welt: Zur Einführung
»Bilderwelten« im Iran: Wie die Amerikaner dem Schah zum Thron verhalfen
Macht und Vorherrschaft im Nahen Osten: Wer will wen »vernichten«?
Die Mullahs und die Bombe: Warum Atomverhandlungen so schwierig sind
Ein Nihilismus der Werte: Der Völkermord im Gazastreifen
Eine »absurde Doktrin«: Großisrael und der »ewige Krieg«
Das Recht auf Selbstverteidigung: Zeitenwende von Gaza bis Teheran
Ausblick: Nichts wird gut, außer wir handeln selbst
Anmerkungen
Narren regieren die Welt: Zur Einführung
Man gewöhnt sich an das Sterben, an die Bilder – vordergründig. Der Gazastreifen liegt in Trümmern, die Menschen verhungern. Das Massensterben folgt einem Plan, die Palästinenser müssen verschwinden. Ganz Palästina soll aufgehen in Großisrael. Und es fehlt nicht an noch größeren Plänen. Etwa die Küstenenklave in eine »Riviera des Nahen Ostens« zu verwandeln. Israels Premier Netanjahu schlägt vor, US-Präsident Trump den Friedensnobelpreis zu verleihen. Weil Washington den engen Verbündeten gewähren lässt. Weil beide darin übereinstimmen, den Nahen und Mittleren Osten neu zu formatieren, ihren eigenen Interessen zu unterwerfen. Deswegen der gemeinsame Krieg gegen den Iran.
Das alles geschieht zeitgleich zu den »Hungerspielen«, bei denen Hunderttausende Walking Dead durch eine Trümmerwüste irren, auf der Suche nach Essbarem. Stets im Visier von Scharfschützen an den wenigen Verteilstellen für Lebensmittel. Mit dem Ziel, sie in die »humanitäre Stadt« in Rafah zu zwingen, die nur zwei Ausgänge kennt: Friedhof oder Exodus. Die Genozid-Forschung ist sich übrigens einig, dass Völkermord stets mit einer beschönigenden Sprache einhergeht.
Das angestrebte Großisrael ist ohne »ewigen Krieg«, auch mit den Nachbarstaaten, nicht zu haben. Warum das so ist, erklärt das vorliegende Buch. Iran und Gaza sind die beiden Antipoden jenes imperialen Größenwahns, der die Region bis zur Unkenntlichkeit erschüttern wird. Das zu erkennen, setzt allerdings voraus, die »Bilderwelten« zu erweitern, die unsere Wahrnehmung prägen. So geht es etwa in der Causa Iran nicht wirklich um die Atombombe in den Händen »fanatischer Mullahs«. Vielmehr um Fragen von Macht und Vorherrschaft – wie eigentlich immer auf globaler Ebene, sobald sich rivalisierende wirtschaftliche und imperiale Interessen überkreuzen. Dergleichen Einsichten sind offenkundig nicht Teil des politischen oder medialen Mainstreams und gerade deswegen erhellend.
Es ist fast schon eine kulturelle Leistung, nicht wohlfeiler Propaganda zu erliegen. Dazu gehört auch das Messen mit zweierlei Maß. Den Angriff Russlands auf die Ukraine zu Recht als völkerrechtswidrig zu geißeln, denjenigen Israels und der USA auf den Iran dagegen für ebenso rechtmäßig wie geboten zu halten, zeugt von Heuchelei. Und nicht zuletzt gehört auch die Instrumentalisierung des Völkerrechts dazu, das offenbar nur dann etwas gilt, wenn es als politische Waffe gegen Widersacher von Nutzen ist. Der angestrebte Regimewechsel in Teheran ist erst einmal vertagt. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben. Der nächste Waffengang ist nicht eine Frage des Ob, sondern des Wann.
Der von der israelischen Führung zu verantwortende Massenmord im Gazastreifen, die systematische Zerstörung der Lebensgrundlagen, zunehmend auch der Palästinenser im Westjordanland, sind für sich genommen bereits Menschheitsverbrechen. Die keinesfalls durch den Großangriff der Hamas auf Südisrael am 7. Oktober 2023 zu rechtfertigen sind. Um »Terrorbekämpfung« geht es längst nicht mehr. Das erkennen zunehmend auch westliche Staaten, bislang Verbündete Israels, und ziehen die Notbremse. Immerhin beruht das eigene Selbstbild wesentlich auf der Annahme, besser wohl Fiktion, man stehe weltweit für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte.
Die uneingeschränkte Solidarität mit dem jüdischen Staat löst sich zunehmend in Luft auf – abgesehen von den USA.
Selbst in Deutschland, dem zweitwichtigsten Verbündeten Tel Avivs, erlebt die vielbeschworene »Staatsräson« ihre Götterdämmerung. Insbesondere abzulesen an der Entscheidung von Kanzler Friedrich Merz im August 2025, die Waffenlieferungen an Israel teilweise auszusetzen. Militärisch wird das die Regierung Netanjahu nicht ausbremsen, den Amerikanern sei Dank, doch ist diese Entscheidung auf symbolischer Ebene eine für hiesige Verhältnisse nicht zu unterschätzende Zäsur. Allen voran in den Reihen von CDU und CSU hat sie großen Unmut ausgelöst. Phantomschmerzen, die sich verlässlich einstellen, sobald verinnerlichte Glaubensgewissheiten nicht mehr gelten sollen: Israel, die einzige Demokratie im Nahen Osten. Die jüngere deutsche Geschichte. Das Wunder der Versöhnung und so weiter.
Doch lässt sich ein Völkermord in der Gegenwart nicht durch einen anderen in der Vergangenheit beschönigen oder relativieren. Ganz gleich, wer ihn begeht: Es gilt, die eigene Stimme lautstark zu erheben und alles zu tun, um ihn zu beenden. Nicht erst morgen, sondern heute. Wer im Gazastreifen keine Hungersnot zu erkennen vermag oder Fotos von bis auf das Skelett abgemagerten Kleinkindern unter Verweis auf »Vorerkrankungen« als propagandistisch abtut, dem wäre zu anderen Zeiten eine glänzende Laufbahn beschieden gewesen.
Das vorliegende Buch sucht Zusammenhänge aufzuzeigen, die üblicherweise nicht im Fokus stehen, für ein Verständnis des größeren Ganzen aber unerlässlich sind. Doch will es ebenso denen eine Handreichung sein, die angesichts des mörderischen Unrechts in der Region fast verzweifeln und sich diesem Land zunehmend entfremden. Auch wegen der zahlreichen polizeilichen und juristischen Keulen rund um den »israelbezogenen Antisemitismus«. Der Völkermord im Gazastreifen wird die »Erinnerungskultur« in diesem Jahrhundert weltweit prägen. Wer schweigt, macht sich mitschuldig. Ebenso diejenigen, die dafür die Waffen liefern oder dessen Urhebern als Sprachrohr dienen. Sie sind die willigen Vollstrecker und Hintermänner der nahezu täglich eskalierenden »Drecksarbeit«.
Möge dieses Buch Halt und Empfehlung sein, wo Menschen als Menschen denken und handeln, nicht als Marionetten der Macht.
»Bilderwelten« im Iran: Wie die Amerikaner dem Schah zum Thron verhalfen
»Bilderwelten«, die kollektiven, identitätsstiftenden Versuche, eine gegebene Wirklichkeit so zu erklären, dass der Einzelne sich darin wiederzufinden vermag, prägen auch die politische und mediale Wahrnehmung unserer und anderer Kulturen. »Bilderwelten« sind nicht statisch, sie unterliegen wechselnden Moden, Idealen, Interessen. Die »Guten« von heute können die »Bösen« von morgen sein und umgekehrt. So war beispielsweise Saddam Hussein aus westlicher Sicht ein »Guter«, solange er, maßgeblich unterstützt von den USA, Krieg gegen den Iran führte (1980–1988), nicht zuletzt mit dem Ziel, die aus der iranischen Revolution hervorgegangene Islamische Republik zu schwächen. In Ungnade fiel er erst, als er 1990 Kuweit überfiel, gewissermaßen eine US-Tankstelle. Damit hatte der irakische Diktator eine rote Linie überschritten und avancierte in kürzester Zeit zum »zweiten Hitler«, der brutal sein eigenes Volk unterdrückt – was zuvor niemanden ernsthaft interessiert hatte, jedenfalls nicht in westlichen Regierungskreisen. Ganz im Gegenteil: Das Giftgas, das Saddam Hussein an der iranischen Front einsetzte und 1988 auch gegen aufständische Kurden im eigenen Land, wurde aus den USA, aus Frankreich und (West-)Deutschland geliefert.
Dergleichen »Bilderwelten« zielgerichtet zu steuern und zu lenken, sie in den Dienst übergeordneter Interessen zu stellen, ist die wesentliche Aufgabe von Propaganda, neudeutsch: Öffentlichkeitsarbeit. Dazu gehört auch das politisch-mediale Framing globaler Konflikte, die fast schon normative Festlegung von »gut« und »böse«. Aus dieser, der »offiziellen« westlichen Perspektive, ist beispielsweise der Angriff Russlands auf die Ukraine im höchsten Maß verbrecherisch, derjenige Israels auf den Iran hingegen Ausdruck legitimer Selbstverteidigung (»Präventivkrieg«).
Den wenigsten ist bewusst, dass sich kollektive Identitäten wesentlich aus der mentalen Ablehnung des Unbekannten speisen. Das betrifft heute, in westlichen Gesellschaften, insbesondere den Islam und Muslime – zu anderen Zeiten waren es Juden. Sigmund Freud zufolge ist der zentrale Mechanismus bei der Entstehung des Fremden die Projektion. Aus »Bilderwelten« werden Feindbilder, die wiederum die legitimatorische Grundlage zur Durchsetzung machtpolitischer Ansprüche bilden, etwa in Gestalt von Kolonialismus und Imperialismus. Die Versklavung ganzer Völker, die Eroberung und Ausbeutung anderer Länder und Kulturen ist immer mit der Dämonisierung der Unterworfenen einhergegangen, die entweder als minderwertig oder als bedrohlich galten.
Imperiale Mächte sind nie darum verlegen, den Einsatz eigener Gewalt bis hin zu Massenmord und Terror schönzureden, um sie zu rechtfertigen. Früher gerne dargestellt, neudeutsch: geframed, als zivilisatorische Mission, White Man’s Burden, als selbst auferlegte Bürde des weißen Mannes. Mit dem Ziel, den Wilden, Primitiven und Minderwertigen, kurz: den entrechteten Einheimischen mit Bibel und Kreuz den himmlischen Weg zu weisen. Es galt, die nunmehr herrschende Ordnung als vermeintlich gottgewollt in den Köpfen und Herzen der überwiegend Zwangsbekehrten zu verankern – parallel zu Mord und Totschlag. Heute sind die »Bilderwelten« vielschichtiger: Die »regelbasierte Ordnung« gehört ebenso dazu wie etwa die Propagierung von Demokratie und Menschenrechten, in deren Namen, verstärkt seit 9/11, das Projekt Regimewechsel betrieben wird, von Libyen bis nach Afghanistan.
Kolonialisierung bedeutet zweierlei: die Ausbeutung natürlicher Ressourcen und Arbeitskräfte vor Ort sowie die Einbindung regionaler Wirtschaftsstrukturen in das jeweilige Empire. Bis 1900 hatte eine kleine, aus Europa eingefallene Minderheit die Herrschaft über den größten Teil des Globus erlangt und zwang auch den hauptsächlich agrarisch geprägten islamischen und asiatischen Gesellschaften die Imperative einer kapitalistisch geprägten Wirtschaftsdynamik auf, unter Einbeziehung von Militärstützpunkten und Kanonenbooten. Sofern einheimische Eliten versuchten, die Modernisierung ihrer Länder nach europäischem Vorbild voranzutreiben, landeten sie, mit Ausnahme Japans, beinahe zwangsläufig in der Schuldenfalle.
Ein Paradebeispiel dafür ist das Osmanische Reich. Die auf Verwestlichung bedachten osmanischen Sultane und Minister investierten etwa in Infrastruktur und die Modernisierung der Armee. Zur Finanzierung nahmen sie Kredite bei europäischen Banken auf, die in Konstantinopel (1930 offiziell in Istanbul umbenannt) seit dem frühen 19. Jahrhundert wie Pilze aus dem Boden schossen. Es dauerte nur wenige Jahrzehnte, bis die Hohe Pforte vor dem Staatsbankrott stand. Um weitere Kredite zu erhalten, musste sie den Europäern unter anderem sogenannte Handelskapitulationen gewähren. Das bedeutete, dass deren Kaufleuten erhebliche Steuervorteile gegenüber einheimischen Konkurrenten eingeräumt wurden. Vielfach zahlten die Fremden gar keine Steuern mehr. Gleichzeitig erhielten westliche Ausländer, maßgeblich Briten, Franzosen und Russen, einen weitreichenden Schutz vor Strafverfolgung seitens osmanischer Behörden. Diese Ungleichbehandlung führte wiederholt zu Aufständen und Protesten der einheimischen Bevölkerung. Vor diesem Hintergrund erwuchs in den 1830er Jahren die Reformbewegung der Jungosmanen – Vorläufer der Jungtürken, aus denen wiederum Atatürks Nationalbewegung und, 1923, die moderne Türkei hervorgegangen sind. Alles hängt mit allem zusammen.
Dergleichen Zusammenhänge zu kennen, ist Voraussetzung dafür, eigene, westlich-europäische »Bilderwelten« auf den Prüfstand zu stellen. Der radikale Islamismus der Gegenwart beispielsweise, bis hin zu Al-Qaida und dem »Islamischen Staat«, kann nur gedeihen in Gesellschaften, die zuvor ganz oder in Teilen zerstört worden sind, wie verstärkt nach 9/11 geschehen, insbesondere in Afghanistan und im Irak. Der Selbstwahrnehmung westlicher Werteorientierung stehen mehr als zwei Jahrhunderte gegenüber, in denen große Gebiete der Welt durch ebenjenen Westen unterworfen worden sind. Das löst Gegenreaktionen aus, die sich seit geraumer Zeit auch in Form islamistischen Terrors oder als Gewalt im Namen des Islam entladen. Die koloniale und (neo-)imperiale Politik ist, wohlgemerkt, nicht der einzige Grund für das insgesamt wenig gedeihliche Erscheinungsbild des arabisch-islamischen Raumes – wohl aber ein wesentlicher. Andere Faktoren kommen hinzu, darunter Klientelismus und Vetternwirtschaft, Korruption und Inkompetenz seitens der jeweiligen Machteliten oder die fehlende gesellschaftliche Pluralität in einem sozialen Umfeld, in dem sich moderne und vormoderne, feudale und kapitalistische Lebenswelten überlagern.
Tabak und Revolte
Anders als sein osmanischer Nachbar war der Iran zunächst von europäischen Übergriffen verschont geblieben. Auch deswegen, weil es im Land zu dem Zeitpunkt keine zur Kapitalakkumulation geeigneten Rohstoffe wie etwa Baumwolle gab – das dortige Erdöl wurde erst in den 1890er Jahren entdeckt. (Der Baumwollanbau war, neben dem Bau des Suezkanals und somit der Sicherung des Seeweges in die Kronkolonie Indien, das zentrale Motiv für Großbritannien, Ägypten zu unterwerfen: zum Nutzen der Textilindustrie im englischen Lancashire.) Ausländische Investoren begannen sich erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts für den Iran zu interessieren. Die Zünfte und der Basar bestimmten weiterhin das Leben in den Städten und auf dem Land, im Bündnis mit dem schiitischen Klerus. Noch war der Rhythmus des sozialen und wirtschaftlichen Lebens nicht vom vordringenden Kapitalismus zerstört worden, der sich vor allem für den Außenhandel und individuelle Eigentumsrechte interessierte. Ähnlich dem Sultan der Osmanen verstand auch der Schah Persiens unter Modernisierung in erster Linie die Modernisierung des Überwachungs- und Herrschaftsapparates sowie der Armee.
Die überaus wirkmächtige schiitische Geistlichkeit verfolgte den allmählichen Zustrom von Ungläubigen in den Bereich der Wirtschaft mit großem Unbehagen. Seit den 1870er Jahren lag fast der gesamte Im- und Export in den Händen von Russland und Großbritannien, die beide um Macht und Einfluss im Iran wetteiferten. Vor allem die Briten kontrollierten in der Region um Isfahan den Anbau von Opium, das sie anschließend äußerst profitabel in China verkauften. Gleichzeitig führten ihre telegrafischen Überseeleitungen in Richtung Indien über iranisches Gebiet.
Um das massive Staatsdefizit aufzufangen, verkaufte Schah Naser ad-Din profitable Konzessionen an europäische Finanziers – obwohl er damit wissentlich den Weg in die Abhängigkeit beschritt, wie vor ihm das Osmanische Reich. 1891 gewährte er dem britischen Major und Geschäftsmann Gerald F. Talbot ein auf 50 Jahre angelegtes Monopol für den Kauf, Verkauf und Export von Tabak, eines der wichtigsten Handelsgüter. Daraufhin entwickelten sich im Untergrund Geheimgesellschaften, die wütende Proteste und Massendemonstrationen in mehreren Städten organisierten – durchaus vergleichbar den Unruhen, die der iranischen Revolution 1979 vorangingen. Auch Frauen beteiligten sich daran.
Dieser Aufruhr, als Tabak-Revolte 1891/92 in die Geschichte eingegangen, markiert den Beginn des iranischen Widerstandes gegen die westliche Expansion im eigenen Land und bewirkte die Politisierung einflussreicher Strömungen innerhalb der traditionell eher quietistisch eingestellten Geistlichkeit. Schiitische Kleriker wurden zu Wortführern der antikolonialen Bewegung und somit zu Widersachern erst der Briten, später der USA. Schah Naser ad-Din, vollkommen überrascht von den Entwicklungen, die er selbst ausgelöst hatte, kapitulierte vor dieser Allianz aus Meinungsführern, Geistlichen und Kaufleuten und widerrief die Konzession.
Jamal ad-Din al-Afghani, der führende muslimische Intellektuelle jener Zeit, hielt sich damals im Iran auf und war ein wichtiger Ideengeber der Proteste. Er beklagte, wie es der indische Autor Pankaj Mishra zusammenfasst, »dass die britische Presse iranische Demonstranten als religiöse Fanatiker darstellte, obwohl es sich in Wirklichkeit um den berechtigen Wunsch nach Reformen und einem Gesetzbuch handelte. Er verwies auf die einseitige Berichterstattung der Nachrichtenagentur Reuters (die sich natürlich im Besitz eines britischen Staatsbürgers befand, der immer noch über Banklizenzen und Schürfrechte im Iran verfügte).«[1] Ob gestern oder heute: Wer sich gegen westliches Dominanzstreben zur Wehr setzt, wird zum Gegner oder Feind.
Es versteht sich von selbst, dass die »Bilderwelten« in nichtwestlichen Kulturen und Gesellschaften in der Regel ganz andere sind als die bei uns vorherrschenden. Die vermeintliche »Werteorientierung« westlicher Politik beispielsweise vermögen die wenigsten dort wahrzunehmen, wo es eine lange Geschichte kolonialer oder imperialer Unterwerfung und Ausbeutung gegeben hat. Das hat unmittelbare Auswirkungen auf geopolitische Gegebenheiten in der Gegenwart und erklärt wesentlich, warum sich kaum ein Land des Globalen Südens an den westlichen Sanktionen gegen Russland beteiligt, auch das Votum eines »unprovozierten russischen Angriffskrieges auf die Ukraine« nicht teilt. Gesellschaftliche Traumata oder prägende Erfahrungen können Generationen überdauern und sind aus gegebenem Anlass, wie wir noch ausführlich sehen werden, vor allem im Iran mehr als präsent. Die Tabak-Revolte 1891/92 war da lediglich der Auftakt, und sie ist bis heute im kollektiven Gedächtnis vieler Iraner präsent, etwa in Gestalt von Volksliedern.
Revolutionsführer Ayatollah Khomeini greift die leidvollen Erfahrungen Irans mit zunächst britischem, dann US-amerikanischem Dominanzstreben in seinem Traktat Der islamische Staat wiederholt auf. An einer Stelle heißt es: »Ich war in Hamadan (eine Stadt im Westen Irans, ML). Einer der gelehrten Geistlichen, der nicht mehr die Kleidung der Geistlichen trug, aber seinen Charakter nicht verloren hatte, zeigte mir ein großes Blatt, auf dem mit Rotstift etwas eingezeichnet war. Wie er erzählte, markierten die roten Zeichen die Bodenschätze Irans, die von ausländischen Experten entdeckt worden waren: … Gold, Kupfer, Erdöl … Sie haben auch die Mentalität unserer Menschen studiert; und sie kamen zu dem Schluss, dass der einzige Faktor, der sie daran hindert, ihre Pläne zu verwirklichen, die einzige Barriere, der Islam und die Geistlichkeit sind.«[2]
Nach dem Ersten Weltkrieg und dem Untergang des Osmanischen Reiches wetteiferten die Kolonialmächte Großbritannien und Frankreich um Macht und Einfluss im Nahen Osten. Bereits 1916 hatten London und Paris in dem nach ihren Unterhändlern benannten, geheimen Sykes-Picot-Abkommen die Region untereinander aufgeteilt. Die Franzosen erhielten den Libanon und Syrien, die Briten Palästina, Transjordanien (das heutige Jordanien) und den Irak. Die Grenzen ihrer Einflusssphären wurden dabei mit dem Lineal gezogen und haben die heutigen Landesgrenzen weitgehend vorbestimmt – ohne jede Rücksprache mit der einheimischen Bevölkerung. Die Araber wurden somit um ihre Unabhängigkeit betrogen, die nachfolgenden, wiederholten Aufstände niedergeschlagen.
Die Briten verfolgten dabei drei strategische Ziele: den Zugriff auf die Erdölreserven im Irak und im Iran (da waren sie weitsichtiger als die Franzosen), die Kontrolle Palästinas als Pufferzone des Suezkanals und die Sicherung aller See- und Landverbindungen nach Indien. Die geostrategische Bedeutung Palästinas führte 1917 zur Balfour-Deklaration, in der die britische Regierung den Juden »eine nationale Heimstätte« in Palästina versprach: Teile und herrsche. Diese Deklaration, benannt nach dem damaligen Außenminister, war der erste Schritt zur Gründung Israels 1948.
Der Mann des Jahres
Nach dem Zweiten Weltkrieg verlagerte sich das geopolitische Kräftemessen in die Golfregion, wo die weltweit größten Erdöl- und Erdgasvorkommen lagern. Lange vor deren Entdeckung hatten die Briten bereits in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts auf der arabischen Seite des Persischen Golfs Fuß gefasst – damals bekannt als »Piratenküste«. Bis Ende der 1940er Jahre blieben sie der maßgebliche Hegemon unter den dortigen Stammesführern. Dabei ging es wesentlich, auch in der damals bitterarmen, aber verkehrstechnisch günstig gelegenen Golfregion, um die für London alles entscheidende Kontrolle sämtlicher Verkehrswege nach Indien über Land und zur See.
Die während des Zweiten Weltkrieges geschlossene strategische Allianz zwischen den USA und Saudi-Arabien – Washington sorgt für die Sicherheit des Landes, im Gegenzug erhalten die USA saudisches Erdöl zu Vorzugsbedingungen – änderte die Machtverhältnisse. Spätestens mit dem Suezkrieg 1956 hatten die USA Großbritannien als regionale Hegemonialmacht endgültig abgelöst. London, Paris und Tel Aviv hatten als Reaktion auf Präsident Gamal Abdel Nassers Verstaatlichung des Suezkanals Ägypten angegriffen, mussten den Krieg aber nach Intervention Washingtons beenden. Es war dies das erste und bislang letzte Mal, dass sich die USA offen gegen die Interessen Israels stellten. Während Frankreich daraufhin seine (neo-)kolonialen Ambitionen auf Algerien und das französische Westafrika fokussierte (Indochina ging 1954 verloren) und sich strategisch aus dem Nahen Osten zurückzog (auch wenn sich Paris bis heute als »Schutzmacht« der christlichen Maroniten im Libanon versteht), ging Großbritannien einen anderen Weg. Nach 1945 erfand sich London neu, zusätzlich motiviert durch das Suez-Debakel: als verlässlicher Juniorpartner der USA in globalen Konflikten – auch bei militärischen Einsätzen.
Angefangen mit dem Iran. Die Briten besaßen das Monopol auf die iranische Erdölförderung seit deren Anfängen 1909. Aus der Anglo-Persian Oil Company, APOC, wurde 1935 die Anglo-Iranian Oil Company, AIOC, 1953 schließlich British Petroleum, BP. Bis zum Zweiten Weltkrieg waren etwa 800 Millionen Pfund Sterling Gewinn nach Großbritannien geflossen, während der Iran lediglich 105 Millionen Pfund erhielt. Premierminister Winston Churchill bezeichnete die AIOC als einen »Preis aus einem Märchenland, jenseits unserer kühnsten Träume«. Gleichzeitig herrschte in der Ölförderstadt Abadan am Persischen Golf, de facto eine britische Kolonie, ein Apartheid-Regime. »Nicht für Iraner«, hieß es etwa an Trinkwasserbrunnen. Die schlechten Arbeitsbedingungen führten immer wieder zu Protesten und Streiks, die gewaltsam niedergeschlagen wurden. Ende der 1940er Jahre formierte sich der politische Protest. Eine Gruppe von Parlamentariern forderte, die Explorationsverträge mit Großbritannien neu auszuhandeln. Ihr Wortführer war der in Frankreich und der Schweiz ausgebildete Rechtsanwalt Mohammed Mossadegh. Um die britische Vorherrschaft zu beenden und die Autokratie des Schahs zu bekämpfen, gründeten er und seine Mitstreiter die Nationale Front. Unter anderem forderten sie Pressefreiheit, freie Wahlen ohne Wahlfälschungen und eine konstitutionelle Monarchie.
Der Schah: 1921 hatte Reza Khan, ein Offizier der Kosakenbrigade, ursprünglich eine Elitetruppe aus russischen und ukrainischen Reiterverbänden im Sold Teherans, die seit 1796 herrschende Qadscharen-Dynastie gestürzt, sich selbst 1926 zum »Schah« (»König«) krönen lassen und damit die Pahlevi-Dynastie begründet. »Pahlevi«, ein anderes Wort für Mittelpersisch, war die Sprache des Sassanidenreichs, des zweiten persischen Großreichs der Antike (224–641). 1941 wurde er wegen seiner Sympathien für Nazi-Deutschland zum Rücktritt und ins Exil nach Südafrika gezwungen. Sein Sohn Mohammed Reza beerbte ihn als Schah und blieb es bis zur Iranischen Revolution 1979.
Mithilfe des Schahs und dessen loyaler Gefolgschaft, die aufgrund von Wahlmanipulationen im Parlament stark vertreten war, suchten die Briten den politischen Aufstieg der Nationalen Front zu verhindern. Dennoch wurde sie bei den Parlamentswahlen 1950 eine der stärksten Parteien und unterbreitete der AIOC einen Vorschlag zur angemesseneren Aufteilung der Erdöleinnahmen. Die aber lehnte Verhandlungen ab, woraufhin es landesweit zu Protesten und Streiks kam. Weite Teile der Bevölkerung verlangten nunmehr die Verstaatlichung der Erdölindustrie. Die Nationale Front, die sich von Großbritannien provoziert fühlte, schloss sich dieser Forderung an, wie auch ein Großteil der einflussreichen Geistlichen.
Im März 1951 wurde Mohammed Mossadegh Premierminister, noch im selben Monat machte die neue Regierung ihre Ankündigung wahr und nationalisierte die iranische Erdölindustrie. Die britische Regierung war empört – keineswegs hatte sie die Absicht, diese Entscheidung lediglich zur Kenntnis zu nehmen: Rund 90 Prozent des damals in Westeuropa gehandelten Erdöls stammten aus der Raffinerie in Abadan. Die US-Regierung unter Präsident Harry S. Truman vertrat anfangs eine vorsichtige Linie gegenüber Mossadegh und hoffte, das bröckelnde britische Empire auch im Iran als Hegemonialmacht beerben zu können. Entsprechend löste die Verstaatlichung in Washington zunächst keine größeren Irritationen aus. Das US-Magazin Time kürte Mossadegh 1951 gar zum »Man of the Year« und sah in ihm einen mutigen Reformer.
Doch hatten Premierminister Churchill und sein Außenminister Anthony Eden längst den Entschluss gefasst, Mossadegh zu stürzen. Dafür aber waren sie zwingend auf die Unterstützung Washingtons angewiesen – ähnlich wie später die israelische Führung bei ihrem »Präventivkrieg« gegen den Iran. Zu einem Kurswechsel in der US-Politik kam es jedoch erst 1953, nach Amtsübernahme des republikanischen Präsidenten Dwight D. Eisenhower. Zu jener Zeit erlebten die antikommunistische Hysterie und die Paranoia des Kalten Kriegs ihren ersten Höhepunkt, auch abzulesen am McCarthyismus. Hatte der Demokrat Truman noch gewarnt, eine gewaltsame Lösung des Irankonfliktes würde »eine Katastrophe nach sich ziehen«, sahen die Republikaner in Mossadegh in erster Linie einen »Kommunisten« und Parteigänger der Sowjetunion und in der Verstaatlichung einen gefährlichen Präzedenzfall. Entsprechend zeigte sich die neue Regierung für Londons Putschpläne empfänglich. Mehr noch, die Amerikaner übernahmen selbst die Federführung. Die »Drecksarbeit«, so Bundeskanzler Friedrich Merz in heutigem Kontext, erledigten dabei die CIA und der britische Auslandsgeheimdienst MI6.
Der Staatsstreich gegen den demokratisch gewählten Premierminister Mossadegh war minutiös geplant und über Monate vorbereitet worden. Nichts hatten die CIA (Codewort: »Operation TPAJAX« – TP bezieht sich auf deren Länderkennung für den Iran, AJAX auf ein bekanntes Reinigungsmittel) und der MI6 (»Operation Boot«, deutsch: Rauswurf) dem Zufall überlassen. Erst auf den Tag genau 60 Jahre nach dem erfolgten Putsch, am 19. August 2013, stellte das National Security Archive der George-Washington-Universität in der US-Hauptstadt die unter dem »Freedom of Information Act« erlangten, damaligen CIA-Dokumente ins Internet, soweit sie nicht weiterhin als »streng geheim« unter Verschluss gehalten werden. Die umfangreiche Lektüre ist beeindruckend, weil sie von bemerkenswerter Kaltschnäuzigkeit, aber auch von beängstigender Professionalität zeugt. Im Zuge der Veröffentlichung sah sich die CIA veranlasst, erstmals öffentlich anzuerkennen, dass der US-Geheimdienst maßgeblich am damaligen Staatsstreich beteiligt war.[3] Präsident Barack Obama hatte dies bereits 2009 in einer Grundsatzrede an die islamische Welt in Kairo eingeräumt, womit er nach dem verheerenden Irak-Krieg 2003 (erfolglos) ein neues Kapitel in den Beziehungen der USA zu der Region aufzuschlagen suchte: »Mitten im Kalten Krieg spielten die Vereinigten Staaten eine Rolle beim Sturz einer demokratisch gewählten iranischen Regierung.« Ein Satz nur, bewusst vage, doch wird sich Obama, anders als sein Nachfolger Donald Trump, darüber im Klaren gewesen sein, dass der Putsch vom 19. August 1953 bis heute weit über den Iran hinaus tief im kollektiven Gedächtnis verankert ist.
»Gerissen und provokant«
In Großbritannien ist die Beteiligung an diesem Staatsstreich offiziell bis heute kein Thema. In den 1970er Jahren überredeten ranghohe britische Beamte Washington, keine Dokumente zu veröffentlichen, die für London »überaus peinlich« wären. Einzig Justizminister Jack Straw räumte 2009 ein, als Reaktion auf Obamas Rede, dass es im 20. Jahrhundert »viele Einmischungen« Großbritanniens in iranische Angelegenheiten gegeben habe. Die Veröffentlichungen des National Security Archive kommentierte das Außenministerium in London mit den Worten, man könne eine Beteiligung am Putsch »weder bestätigen noch dementieren«.[4]
Der Putsch 1953 zeigt ein Grundmuster, das die USA und ihre Verbündeten bis heute bei angestrebten oder erhofften Regimewechseln anwenden: die Dämonisierung des Gegners im Vorfeld der eigenen Operation. Der britische Außenminister Eden verglich Mossadegh wiederholt mit Hitler. Dieser Vergleich ist noch immer überaus beliebt und ereilte den ägyptischen Präsidenten Nasser, der 1956 den Suezkanal verstaatlichte, ebenso wie zuletzt den russischen Präsidenten Putin oder den iranischen Revolutionsführer Khamanai. Eines der 2013 veröffentlichten CIA-Dokumente beschreibt Mossadegh in einer Sprache, die sich später fast wortgleich gegenüber Diktatoren wie Saddam Hussein, Muammar al-Gaddafi oder Baschar al-Assad wiederfindet, als »unberechenbar, irre, gerissen, provokant … Einer der gefährlichsten Führer, mit denen wir es je zu tun hatten.« Er habe das iranische Volk gegen die Briten aufgehetzt, indem er sie als »böse« bezeichnet habe: »Er und Millionen seiner Landsleute glauben, dass Großbritannien ihr Land seit Jahrhunderten für britische Interessen missbraucht.«
Die Schlüsselfigur des Umsturzes im Iran war der CIA-Mann Kermit »Kim« Roosevelt, ein Enkel des vormaligen US-Präsidenten Theodore Roosevelt. »Kim« war ein wichtiger Vertreter der »Arabisten«, die damals im US-Außenministerium sehr einflussreich waren, nach einigen Jahren aber von der entstehenden Israel-Lobby verdrängt wurden. Gleichzeitig galt er als romantisierender Orient-Liebhaber. Das hinderte den Harvard-Absolventen allerdings nicht daran, als Mastermind eine historische Zäsur einzuleiten, die bis heute fortwirkt. Erfinden musste der Präsidenten-Enkel den Ablauf des Putsches nicht – er kopierte jenen des ersten CIA-Putsches überhaupt, 1949 in Damaskus. Da tatsächlich alles mit allem zusammenhängt, sei hier ein kurzer Blick auf die »Gefechtslage« damals in Syrien erlaubt.
Im Zuge der Unabhängigkeit der arabischen Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg entstand in den jeweiligen Ländern eine neue Machtelite aus den Reihen des Militärs, des Offizierskorps und der Generalität. So auch in Syrien, das 1946 von Frankreich unabhängig wurde und nunmehr seine Armee aufbaute. Bereits drei Jahre später, 1949, erfolgte dort der erste Putsch in der arabischen Welt, orchestriert von der CIA. Er war gleichzeitig der Auftakt einer ganzen Reihe von Staatsstreichen und rotierenden Regierungen, bis 1970 Hafis al-Assad die Macht an sich riss und 2000 von seinem Sohn Baschar beerbt wurde. Da die Militärs zunächst kaum über eine soziale Machtbasis verfügten, wurden deren Machtkämpfe gerne über Umsturzversuche ausgetragen. Gleichzeitig begannen die USA, die Region nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten. Dabei ging es vor allem um Erdöl, die Sicherheit Israels und den Kalten Krieg. Direkt und indirekt mischten sie sich in die innenpolitischen Verhältnisse im Nahen und Mittleren Osten ein und entdeckten ihrerseits den Putsch als Mittel zum Zweck.
Seinen Anfang nahm diese Entwicklung in Syrien. 1947 hatte die Arabisch-Amerikanische Ölgesellschaft ARAMCO mit dem Bau einer transarabischen Erdöl-Pipeline von Saudi-Arabien in die libanesische Hafenstadt Sidon begonnen. Nach der Staatsgründung Israels im Jahr darauf musste diese TAPLINE jedoch einen nicht geplanten Umweg über die syrischen Golanhöhen nehmen. Und damit begann der Showdown. Der demokratisch gewählte Präsident Schukri al-Quwatli und die Mehrheit der Parlamentsabgeordneten weigerten sich, dem Pipeline-Bau auf syrischem Gebiet zuzustimmen. Der Grund waren die gewalttätigen Proteste gegen die USA und Israel, die im November 1948 Damaskus erschüttert hatten. Die Vertreibung von mehr als 750000 Palästinensern aus ihrer Heimat im Zuge der Staatsgründung Israels empörte die Menschen, die Flüchtlinge untergruben überdies die ohnehin schwachen arabischen Volkswirtschaften.
Da der Pipeline-Bau auf solche Befindlichkeiten keine Rücksicht nehmen konnte, entsandte die CIA zwei Agenten nach Damaskus, die sich Ian Fleming nicht besser hätte ausdenken können. Der eine, Stephen Meade, war eine Figur wie aus einem James-Bond-Film: athletisch, gutaussehend, von grenzenloser Skrupellosigkeit. Der andere, Miles Copeland, war ein Multitalent: Trompeter bei Glenn Miller, Geschäftsmann und eben Agent. Nach seinem Ausscheiden aus der CIA schrieb er eine autobiografisch gefärbte Darstellung amerikanischer Spionage im Nahen Osten: Das Spiel der Nationen. Über die Amoralität von Machtpolitik (The Game of Nations. The Amorality of Power Politics, New York 1970). Und er entwarf ein gleichnamiges Spiel, in dem es keine Sieger oder Besiegten gibt, nur Überlebende – ein Visionär?
Mindestens sechsmal traf sich Meade im November und Dezember 1948 mit Generalstabschef Husni Zaim, »um die Möglichkeiten einer von der Armee unterstützten Diktatur zu erörtern«, wie es in einem freigegebenen CIA-Dokument heißt. Der Kurde Zaim, übergewichtig und aufgedunsen, »ein Diktatorentyp wie aus einer Bananenrepublik«, sei »ein Vollidiot, der nicht mal den Verstand eines französischen Korporals hat«. Aber: »Er ist ganz klar antisowjetisch eingestellt.« Und, besser noch: Er hatte keine Einwände gegen die Pipeline.[5]
Inmitten einer schweren Staatskrise und anhaltender Proteste der Bevölkerung ging Zaims Coup unter der Regie von Copeland und Meade, logistisch und finanziell vorbereitet von der CIA, in der Nacht zum 30. März 1949 nahezu unblutig über die Bühne. Eine Armeeeinheit nahm den Präsidenten gefangen, eine andere den Premierminister, eine dritte übernahm Radio Damaskus, eine vierte das Polizei-Hauptquartier, eine fünfte das der paramilitärischen Gendarmerie, eine sechste schließlich die Telefon-Schaltzentrale. Copeland schreibt in seinem Buch, dass diese präzise Operation zum Vorbild amerikanischer Regimewechsel in anderen Ländern der Dritten Welt wurde: »In den folgenden zwei Jahrzehnten gehörten dieser Putsch und seine Abläufe zum Ausbildungsprogramm von CIA-Agenten.« Entsprechend folgte der Staatsstreich in Teheran 1953 weitgehend dem Ablauf, wie er sich zuvor in Damaskus bewährt hatte – ebenso, ein Jahr später, der Coup 1954 in Guatemala.
Hirnlose machen mobil
Doch ließ sich Kermit Roosevelt nicht lumpen und setzte noch einen drauf: Er verteilte Geldsummen in Millionenhöhe an die Getreuen des Schahs, vor allem aber kaufte er die Gefolgschaft von Soldaten und Straßengesindel. Sie sorgten für den notwendigen Gewaltpegel auf den Straßen, wie er zur Durchführung eines Regimewechsels hilfreich ist. Dutzende Journalisten erhielten Geld, damit sie Mossadegh als Agenten der Sowjetunion anschwärzten.
Die CIA unterteilte den entscheidenden Tag, den 19. August 1953, in vier operative Phasen:
»Phase I: Die große Demonstration. 6.00 Uhr bis 10.30 Uhr.« Vier »Banden aus Raufbolden«, bestehend aus mehreren Hundert Männern, eine unter Führung eines Gangsters mit Namen Schaban Dschafari Bimuch (»Schaban der Hirnlose«), marschieren ins Basarviertel Teherans und verbreiten Angst und Schrecken.
»Phase II: Bewaffnete Kräfte und Undercover-Agenten greifen ein. 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr.«
Das Innen- sowie das Außenministerium werden besetzt, ebenso weitere Regierungsgebäude. Mossadegh nahestehende Zeitungsverlage werden angegriffen und in Brand gesetzt, schließlich werden auch verschiedene Parteizentralen, das Rathaus, das Telegrafenamt, die Hauptquartiere von Polizei und Militärpolizei besetzt.
»Phase III: Panzer riegeln das Stadtzentrum ab. 5.00 Uhr bis 14.30 Uhr.«
»Phase IV: Die Ziele werden erreicht. 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr.«
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr: Radio Teheran wird übernommen.
16.00 Uhr bis 17.00 Uhr: Zahedi, der neue Premierminister und Schah-Vertraute, hält eine Rede an die Nation, von Radio Teheran ausgestrahlt.
14.00 Uhr bis 19.00 Uhr: Mossadeghs Haus ist umstellt.
19.00 Uhr: Mossadegh »gelingt die Flucht«.
Der letzte Eintrag bedeutet, dass Mossadegh Gelegenheit gegeben wurde zu »fliehen«, um ihn anschließend als Feigling darzustellen. Später wurde er in einem Schauprozess zu drei Jahren Gefängnis verurteilt und bis zu seinem Lebensende 1967 unter Hausarrest gestellt.
Mossadegh ist sicher die tragischste Figur in diesem Drama: Er war ein überzeugter Anhänger des Parlamentarismus, ein Bewunderer Mahatma Gandhis, Abraham Lincolns und der amerikanischen Demokratie. Heute hieße es wohl: Er teilte die westlichen Werte. Was ihm allerdings nichts nutzte, im Gegenteil. Drei Tage zuvor, am 16. August 1953, vereitelten seine Anhänger einen ersten Putschversuch. Mossadegh machte sofort die ihm verhasste britische Regierung dafür verantwortlich. Doch wollte er nicht glauben, dass auch die Amerikaner involviert sein könnten. So groß war seine Naivität, dass er ausgerechnet den amerikanischen Botschafter um Unterstützung bat. Der riet ihm, für Ruhe und Ordnung zu sorgen, was er auch tat, indem er die nach dem gescheiterten Putsch von der Tudeh-Partei, den Kommunisten, organisierten Proteste für illegal erklärte und der Polizei auftrug, sie zu beenden.
Nach dem Staatsstreich kehrte Schah Mohammed Reza Pahlevi aus seinem kurzzeitigen italienischen Exil zurück, die Nationale Front und die Tudeh-Partei wurden verboten, zwei Minister hingerichtet, ebenso zahlreiche Kommunisten. »Ich verdanke meinen Thron Gott, meinem Volk, meiner Armee – und Ihnen«, sagte der Schah zu Kermit Roosevelt.[6] In den folgenden 26 Jahren bis zur Revolution spürte Washington die Dankbarkeit des