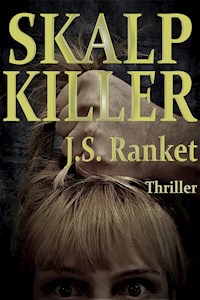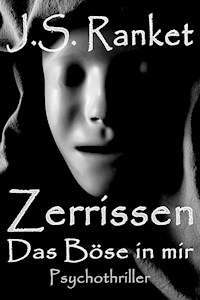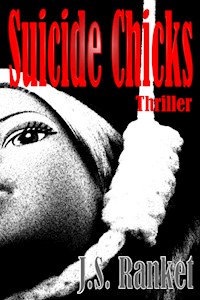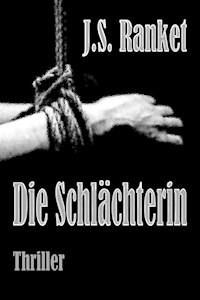Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Schlächterin
- Sprache: Deutsch
"Töten ist wie Bungee-Jumping", stellte die kleine Killerin mit einem Augenzwinkern fest. Dann schwenkte sie demonstrativ ihre riesige Neunmillimeter. "Wenn man einmal damit angefangen hat, kann man einfach nicht mehr aufhören." Die Selbstverständlichkeit, mit der die junge Frau diese Bemerkung von sich gab, ließ Erik Wagners Nackenhaare zu Berge stehen. Aus reiner Neugier hatte sich der brillante Analyst und Ex-Soldat bereiterklärt, mehr über Hintergründe eines äußerst brutalen Mordfalles im Freundeskreis seines Chefs herauszufinden. Doch bereits am ersten Tag seiner Nachforschungen muss er feststellen, dass das Opfer keineswegs so unbescholten war, wie er anfangs gedacht hatte. Denn plötzlich steht er selbst auf der Abschussliste und schlittert in ein blutiges Abenteuer, bei dem die Grenzen zwischen Gut und Böse immer mehr verwischen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
J.S. Ranket
Die Schlächterin - Vergeltung
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Prolog
-1-
-2-
-3-
-4-
-5-
-6-
-7-
-8-
-9-
-10-
-11-
-12-
-13-
-14-
-15-
-16-
-17-
-18-
-19-
-20-
-21-
-22-
-23-
-24-
-25-
-26-
-27-
-28-
-29-
-30-
-31-
-32-
-33-
-34-
-35-
-36-
-37-
-38-
Epilog
Anmerkung des Autors und Danksagung
Impressum neobooks
Prolog
Verwirrt starrte Pieter Dollenberg auf seine rechte Wade. Dorthin, wo ihn beim Joggen durch die Dünen einer dieser fiesen Moskitos gestochen hatte. Doch statt eines saugenden Insekts, steckte da ein kleiner, glänzender Pfeil in seinem Fleisch.
Vorsichtig versuchte er sein Bein zu bewegen. Es lag im feuchten Sand und die ersten, seichten Wellen der herannahenden Flut leckten an seinem Schuh. Er wusste auch nicht so recht, wie er hier her gekommen war. Nur dass ihn auf seiner täglichen Runde plötzlich dieses dämliche Vieh gepiesackt hatte und er danach mit brummenden Schädel in die schmale Bucht gestolpert war.
Natürlich war so ein kleiner Stich an Südafrikas Dolphin Coast nicht ungewöhnlich, doch Dollenberg hasste Mücken und badete deshalb vorsichtshalber vor dem Laufen geradezu in Insektenschutzmittel. Denn er lief nördlich von Shakas Rock auch an einer seichten Lagune vorbei, in der sich die kleinen Blutsauger äußerst wohl fühlten.
Zum Glück lichtete sich langsam der Nebel in seinem Kopf, denn es war höchste Zeit, von hier zu verschwinden. Doch zuerst musste er diesen blöden Pfeil loswerden. Wenn er die dämlichen Zulu-Jungs erwischte, die hier ständig mit ihren Luftdruckgewehren herumballerten, dann würde er ihnen ordentlich die Hammelbeine langziehen.
Entschlossen beugte er sich nach vorn, doch irgendetwas riss ihn sofort zurück. Reflexartig schossen seine Hände nach oben. Und als er an den Draht stieß, der seinen Hals umschloss, gefror ihm das Blut in den Adern.
Nur mit Mühe gelang es Dollenberg, sich ein wenig umzudrehen. Seine Finger fuhren hektisch an dem Seil entlang, bis er den Kopf einer Schraube und ein kleines Schloss ertaste. Aber die Ecken des Sechskants waren so glatt gefeilt, dass es ihm auch mit einem Werkzeug nicht gelingen würde, sie herauszudrehen.
Innerhalb eines Augenblickes überrollte ihn die tödliche Erkenntnis:
„Ich bin an einen Felsen gekettet!“
Panisch zerrte er an der Fessel. Wenn die Flut ihren Höchststand erreicht haben würde, wäre er längst ertrunken. Bereits jetzt umspülte das schaumige Wasser seine Beine und die warmen Böen schickten immer höhere Wellen heran. Denn die See plätscherte an diesem Teil der Küste nicht gemächlich an das Ufer, sondern überrannte den Strand wie eine Herde Wildpferde.
„Hilfe!“ Dollenbergs erster Schrei klang noch zaghaft und er räusperte sich. Auch ohne das Drahtseil war seine Kehle wie zugeschnürt.
„Hiiilfe!“ Das Schreien wurde lauter.
Wenn nicht zufällig jemand über die Felsen in die schmale Bucht blicken würde, dann wäre er geliefert. Der Weg führte zwar unmittelbar an der Abbruchkante entlang, doch das Dröhnen der Brandung löschte alle anderen Geräusche aus.
„Hiiilfeee!“, schrie er in nackter Todesangst, während er sich seine Hände an den rauen Felsen blutig schürfte.
Die Adern an Dollenbergs Hals traten dabei so unnatürlich stark hervor, als wären es prall gefüllte Wasserschläuche. Und beim Einatmen wirbelten bereits die feinen Wassertröpfchen der aufpeitschenden Gischt in seinen Mund.
Verzweifelt versuchte sein Gehirn zu ergründen, warum das gerade mit ihm geschah und wer ihm das angetan haben könnte. Doch letzten Endes war das auch egal, denn das stürmische Meer hatte jetzt fast seine Brust erreicht. Mit unwiderstehlicher Gewalt wurde sein Körper in den Rhythmus der See gezogen, die ihn immer wieder gegen die Klippen schleuderte.
Das Knacken der eigenen Knochen klang unnatürlich laut in seinen Ohren und das Atmen war nur noch in den Wellentälern möglich. Wenn jetzt keine Hilfe kam, dann würde der Ozean seinen Leib zu Staub zermahlen.
„Hi … Hilfeee!“, röchelte er.
Die schäumenden Kämme der Wellen leckten an seinen Lippen und zwangen ihn zu einem Dauerhusten. Immer tiefer drang das Wasser in seine Lungen und machte so das Atmen fast unmöglich. Mit einem letzten Aufbäumen warf er seinen Kopf in den Nacken und blickte nach oben.
Und das, was Dollenberg dort sah, überschwemmte seinen Körper mit einer nie gekannten Euphorie. Er wischte sich mit seinen zerschundenen Händen die Augen, um sicherzugehen, dass ihn kein Trugbild an der Nase herumführte.
Doch über ihm kletterte tatsächlich eine junge Frau den Abhang herab. Ihr langes, braunes Haar wehte im Wind, wie das einer mythischen Sagengestalt, und in wenigen Sekunden würde sie ihn erreicht haben.
Aber statt ihm zu helfen, setzte sie sich ein wenig oberhalb auf den rauen Fels, schlang ihre Arme um die nackten Beine und hielt ihr Gesicht in die warmen Böen. Gedankenversunken strich sie ihre Mähne immer wieder in den Nacken, bis sie schließlich zu ihm herabsah.
In ihren Augen lag ein Ausdruck, als würde sie gerade eine lästige Küchenschabe zertreten.
-1-
Knapp unter der zulässigen Höchstgeschwindigkeit jagte Taylor Edwards mit ihrem Nissan X-Trail auf der N3 Richtung Norden. Denn dass sie die blitzefreudigen Südafrikaner aus dem Verkehr zogen, konnte sie sich nicht leisten. Sobald Dollenbergs Leiche entdeckt werden würde, brach mit Sicherheit die Hölle los. Und dann wollte sie schon einen gehörigen Abstand zwischen sich und dem wütenden Clan gebracht haben.
Der Familie gehörte ein weitverzweigtes Konglomerat aus Einkaufszentren, Restaurants und Weingütern und sie ging mit denen, die ihnen im Weg standen, nicht gerade zimperlich um. Genau deshalb nahm Taylor auch die über fünfhundert Kilometer bis Johannesburg in Kauf, anstatt einfach über den King Shaka Airport in Durban zu verschwinden. Es war zwar ziemlich unwahrscheinlich, dass jemand ihre Spur aufnahm, doch im Fall der Fälle konnte sie viel leichter auf einem Flughafen untertauchen, der fast fünfmal so viele Passagiere durch seine Terminals schleuste.
Ohne auf die beeindruckende Silhouette der Drakensberge zu achten, die sich am Horizont wie ein urzeitliches Reptil schlängelten, erreichte sie Harrismith und damit den Free State. Wahrscheinlich hatten sich die ersten Buren hier so wohl gefühlt, weil es sie an das flache Land ihrer holländischen Heimat erinnerte. Doch für Taylor war es einfach nur einschläfernd.
Zum Glück meldete sich die Tankanzeige mit einem nervigen Gong und bewahrte sie so vor einem Flug in den Straßengraben. Kurz vor Kafferstad entdeckte sie eine kleine Tankstelle, in der sie ihre Benzin- und vor allem ihre Koffeinvorräte auffüllen konnte. Keine zehn Minuten später war Taylor wieder auf der Nationaltrasse.
Sie klemmte sich das Lenkrad zwischen die Knie und stopfte sich die Reste eines Hot Dogs in den Mund, während im Getränkehalter der Mittelkonsole frisch gebrühter Kaffee dampfte. Mit der Zeit hatte sie sich sogar an das Fahren auf der linken Spur gewöhnt und konnte herzlich darüber lachen, wenn ein Tourist beim Abbiegen statt zu blinken, den Scheibenwischer betätigte.
Hätte ihr Rachel vor über einem Jahr prophezeit, in welche Richtung sich der kleine Freundschaftsdienst entwickeln würde, dann hätte sie ihre Freundin glatt für verrückt erklärt.
Damals hatte Taylors alte Schulkameradin mit jugendlicher Naivität in Las Vegas einen gutaussehenden Herzensbrecher geheiratet und war böse auf die Nase gefallen. Denn anstatt in die gemeinsame Zukunft zu investieren, entwickelte Rachels Noch-Ehemann eine unheimliche kriminelle Energie, die sie fast an den Rand des finanziellen Ruins gebracht hatte. Zwar erhielt sie als Abteilungsleiterin einer IT-Firma ein sehr üppiges Gehalt, doch das wurde vom luxuriösen Lebensstil des Heiratsschwindlers fast aufgefressen.
Wenn nicht bald ein Wunder geschah, oder Joshua Williams von den Trümmern eines abstürzenden Satelliten erschlagen werden würde, dann sehe es für ihre weitere Zukunft sehr schlecht aus. Von einer neuen Beziehung und dem Wunsch nach Kindern ganz zu schweigen.
Mehr aus Verzweiflung hatte Rachel ihr die Scheidungspapiere und eine Verzichtserklärung anvertraut.
Taylor besaß ein Diplom in Kommunikationsmanagement und arbeitete als freie Mitarbeiterin in derselben Firma. Ihre schrägen Aktionen und ihre höllisch guten Einfälle, die sie meist sehr innovativ in die Tat umsetzte, qualifizierten sie offenbar in Rachels Augen als ultimatives Werkzeug. Auch, weil sie sich selbst für einen halbnackten Lapdance nicht zu schade war. Denn zum einen musste sie sich mit ihrer sportlichen Figur und dem fein geschnittenen Gesicht nicht verstecken. Und zum anderen heiligte ihrer Meinung nach allein der Zweck die Mittel.
Also hatte Taylor sich ein paar Tage später mit Rachel in einem kleinen Café an San Diegos Mission Beach verabredet. Allerdings wollte sie ihre Freundin noch etwas auf die Folter spannen. Deshalb ließ sie es vorerst offen, ob sie es geschafft hatte, Joshuas Unterschrift zu ergaunern.
Gerade als zwei Skateboarder auf dem warmen Asphalt vorbeirauschten, klatschte Taylor den braunen Umschlag auf den Tisch.
„Erledigt!“, stellte sie nüchtern fest.
Überrascht starrte Rachel auf das Päckchen. Dann hob sie den Kopf und blickte ungläubig mit offenem Mund auf ihre Freundin.
Taylor hatte sich ihre braune Mähne zu einem straffen Zopf gebunden und grinste über das ganze Gesicht. Lässig schob sie mit ihrem Fuß einen Stuhl zurück und setzte sich langsam Rachel gegenüber.
„Du kannst den Mund ruhig wieder zumachen und mir ein Bier spendieren“, lachte sie. Dann stippte sie mit dem Finger in den Schaum von Rachels Cappuccino und leckte ihn genüsslich ab. „Selbstverständlich darfst du dich vorher davon überzeugen, dass die Unterschriften auf den Papieren echt sind.“
Immer noch skeptisch öffnete Rachel den Umschlag. Natürlich hatte sie nichts unversucht gelassen, um die Sache gütlich zu regeln, und Joshua sogar eine unverschämt hohe Summe in Aussicht gestellt, sollte er in die Scheidung einwilligen. Doch der gab sich verständlicherweise nicht mit der Milch zufrieden, wenn er die ganze Kuh haben konnte. Sein durchtriebener Anwalt unterstützte das betrügerische Treiben auch noch und begab sich damit auf dasselbe Niveau wie ihr Ehemann. Er hatte ihr auch schon mit einer einstweiligen Verfügung gedroht, sollte sie ihn oder seinen Mandanten weiterhin belästigen. Wie es ihre Freundin geschafft haben könnte, dass Joshua in die Beendigung der sehr lukrativen Beziehung eingewilligt hatte, war ihr rätselhaft.
Natürlich stellte sich Rachel in ihren Tagträumen seit Längerem die verschiedensten Szenarien vor. Meist war sie selbst dabei in schwarze Lederklamotten gekleidet und hielt ihrem Verflossenen eine Kanone an den Schädel. Doch im realen Leben hasste sie Gewalt, auch wenn Joshua wirklich einen Denkzettel verdient hatte.
Bereits zwei Wochen nach der verhängnisvollen Fahrt in die Spielermetropole erhielt Rachel einen Anruf von ihrem Bankberater, der sie über ungewöhnlich hohe Abbuchungen von ihrem Konto informierte. Und eine Stunde später stand fest, dass sie nicht mehr die alleinige Kontrolle über ihre Finanzen hatte. Im Gegenteil. Sie haftete auch mit ihrem zukünftigen Gehalt für die windigen Geschäfte ihres Ehemannes, einschließlich üppiger Unterhaltszahlungen.
Logisch, dass man da nach mehreren Tagen an eine eher blutige Lösung dachte.
Mit spitzen Fingern fischte Rachel die Unterlagen aus dem Umschlag, der vor ihr auf dem Tisch lag, und unterzog sie einer eingehenden Prüfung. Sie erkannte den schwungvollen Krakel sogar im Schlaf, denn sie wäre schon mehr als einmal fast der Versuchung erlegen, die Unterschriften einfach zu fälschen. Aber natürlich würde eine so dilettantische Aktion sofort auffliegen.
Skeptisch hielt Rachel die Scheidungsunterlagen gegen das Licht. Doch der leichte Abdruck auf dem Papier stammte eindeutig von einem Kugelschreiber und nicht von einem Laserdrucker. Außerdem schien er mit einer einzigen fließenden Bewegung ausgeführt worden zu sein.
„Und, Miss Marple“, lachte Taylor, „wie lautet Ihr fachmännisches Urteil?“
Die Gesichtsfarbe ihrer Freundin wechselte innerhalb einer Sekunde in schlaganfallrot.
„Sorry!“, presste Rachel ertappt hervor. „Ich … also …“ Sie schluckte. „Wie hast du das nur geschafft?“
„Tja …“, wollte Taylor gerade zu einer Erklärung ansetzen, als die Kellnerin auftauchte.
„Bringen Sie ihr, was immer sie will!“, forderte Rachel von der jungen Frau.
„Ein Bier wäre echt toll“, präzisierte Taylor die Bestellung und wartete einen Augenblick bis die Bedienung außer Hörweite war. „Du glaubst gar nicht, was manche Leute alles machen, wenn sie in den Lauf einer Neunmillimeter schauen“, fuhr Taylor an ihre Freundin gewandt fort. Dann presste sie krampfhaft ihre Lippen zusammen, als müsse sie einen Lachanfall unterdrücken.
„Ist schon klar“, prustete stattdessen Rachel los. Sie stützte sich mit den Ellenbogen auf den Tisch und schüttelte demonstrativ ihre dunkle Lockenpracht in den Nacken. „Verarschen kann ich mich selbst. Na sag schon, wie hast du das angestellt?!“
Taylor lehnte sich zurück und verschränkte langsam die Arme. „Neunmillimeter“, antwortete sie trocken.
Rachel wusste nicht so recht, ob sie loslachen oder davonrennen sollte. Doch zum Glück tauchte gerade die junge Kellnerin mit dem eiskalten Miller auf und verschaffte ihr so ein bisschen Zeit zum Nachdenken.
„Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, warum du dich überhaupt nicht verändert hast, nachdem du dieser perversen Darknet-Community entkommen bist“, begann Rachel mit großen Augen. „Und jetzt wird mir einiges klar.“
„Ach so?“, entgegnete Taylor mit großen Augen. „Was denn?“
„Du bist auf die dunkle Seite der Macht gewechselt“, mutmaßte Rachel scherzhaft und schwang ein imaginäres Laserschwert über ihrem Kopf. „So wie der junge Darth Vader“, fügte sie grinsend hinzu, weil sie nicht im Entferntesten ahnte wie nah sie der Wahrheit damit kam. „Jetzt solltest du nur noch diese komischen Geräusche beim Atmen machen!“
„Du hast wie immer den Nagel auf den Kopf getroffen“, musste Taylor zugeben. Dann lachte sie lauthals los, griff sich das Bier und prostete ihrer Freundin zu. „Was weißt du eigentlich über Opfer von Entführungen?“, schob sie möglichst unverfänglich nach. „Also was so in ihnen vorgeht, während sie sich in der Gewalt der Kidnapper befinden? Und ob und wie sie es zurück ins normale Leben schaffen?“
Rachel verhielt sich zum Glück erfrischend normal und steckte sie nicht in die Schublade der traumatisierten Suizidgefährdeten. Denn in die gehörte sie weiß Gott nicht.
„Das was so allgemein bekannt ist“, begann Rachel sachlich. „Am Anfang wehren sie sich logischerweise und versuchen vielleicht auch zu fliehen. Aber spätestens wenn die eigene Hilflosigkeit übermächtig wird, buhlen die meisten um die Gunst des Entführers, weil sie ja überleben wollen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass manche ihrem Kidnapper vor Dankbarkeit die Füße küssen, wenn er sie nach einem halben Tag endlich mal aufs Klo lässt.“ Dann nippte sie an dem Rest ihres Cappuccinos und verdrehte nachdenklich die Augen. „Schließlich kommt es dann irgendwann zu einer Wahrnehmungsverzerrung und die Geisel entwickelt eine Art Wir-Gefühl, weil sie sich von der Polizei und der übrigen Welt im Stich gelassen fühlt“, fuhr sie fort. „Das Ganze gipfelt dann in einer krankhaften Sympathie für den Geiselnehmer. Ich habe da Sachen gelesen …“ Rachel schüttelte verständnislos den Kopf. „Einige sollen die Arschlöcher später wirklich geheiratet haben. Und das alles hat sogar einen wissenschaftlichen Namen, nämlich Helsinki-Syndrom.“
„Das heißt Stockholm-Syndrom“, berichtigte Taylor mit ernster Miene und tippte sich bedeutungsvoll mit dem Finger an die Lippen. „Du scheinst dich damit ja richtig gut auszukennen“, stellte sie kurz darauf fest.
„Hmmm … es war jedenfalls irgendwas mit Skandinavien.“ Rachel beobachtete die flachen Wellen des Pazifiks, die sich auf den weißen Strand schoben und schien nach den richtigen Worten zu suchen. „Als ich das mit dir erfahren habe, wollte ich natürlich Genaueres wissen und habe mich ein bisschen kundig gemacht. Schließlich sind wir doch Freundinnen und ich wusste nicht so recht, wie ich mich jetzt verhalten sollte. Denn die meisten Entführungsopfer brauchen Jahre und unzählige Sitzungen bei einem Trauma-Therapeuten, um darüber hinwegzukommen. Aber bei dir scheint das irgendwie anders zu laufen.“ In Rachels Gesicht spiegelte sich echte Besorgnis. „Oder kommt der große Hammer vielleicht noch?“
„Ach Süße …“ Taylor beugte sich nach vorn und legte sanft ihre Hand auf den Arm ihrer Freundin. „Das ist ja richtig lieb von dir, aber deine Befürchtungen sind unbegründet.“
Jetzt war sie es, die nach den richtigen Worten suchte.
Wie auf ein geheimes Kommando schob sich eine dünne Wolke vor die tiefstehende Sonne und tauchte den Strand in ein gespenstiges Rot. Die Veränderung, die in der jungen Frau vor sich ging, jagte Rachel eine Gänsehaut über den Rücken. Und die Stelle an der sie ihren Arm berührte brannte plötzlich, als würde glühendes Metall darüber fließen.
„Möchtet ihr noch etwas?“, unterbrach die junge Kellnerin die stumme Unterhaltung der beiden.
Taylor blickte auffordernd zu ihrer Freundin.
„Tequila!“, krächzte sie. Doch die Bestellung klang eher wie eine Frage.
„Zwei Corralejo“, bestätigte Taylor. „Am besten doppelte.“
„Scheiße …, was hast du angestellt?“ flüsterte Rachel, nachdem die Kellnerin außer Hörweite war und ihre Augen wurden groß. „Du nimmst doch nicht irgendwelche Drogen oder so? Du weißt sicher, dass das Zeug nur die natürlichen Verarbeitungsmechanismen unterdrückt und es dich dann umso stärker auf die Bretter haut.“
Taylor holte tief Luft. Rachels rührende Besorgnis war wirklich herzerweichend. Doch jetzt musste sie ihr reinen Wein einschenken, wenn sie ihre Freundschaft nicht gefährden wollte.
„Etwas anderes als Drogen fällt dir wohl nicht ein?“, raunte sie geheimnisvoll.
„Aber natürlich …“, antwortete Rachel aufbrausend und hob theatralisch die Hände. „Da fallen mir sogar sehr viele Sachen ein.“ Dann atmete sie geräuschvoll aus. „Du könntest zum Beispiel auf so einem irren Rachetrip sein und scharenweise Perverse umlegen. Das Ganze verschafft dir dann so einen Kick, dass du gar nicht auf die Idee kommst, dass du eigentlich auf eine Couch beim Psychiater gehörst.“
Taylor verkniff sich eine deftige Bemerkung, weil gerade der Tequila serviert wurde, und klatschte stattdessen applaudierend in die Hände.
„Nein …, das kann unmöglich dein Ernst sein!“ Rachels Augen drohten aus dem Kopf zu fallen. „Du willst mir, deiner aller allerbesten Freundin, weismachen, dass du glaubst, nur weil du genug Rache-Thriller gesehen hast, kannst du jetzt selbst eine Hauptrolle übernehmen?“
„Neunmillimeter“, antwortete Taylor lakonisch und grinste.
„Du hast sie echt nicht mehr alle.“ Rachel schüttelte entgeistert den Kopf.
„Ich möchte weiß Gott nicht, dass du vor mir auf die Knie fällst, aber ein einfaches Danke wäre wirklich nicht schlecht“, stellte Taylor gespielt beleidigt fest.
Die Erwiderung blieb Rachel im Hals stecken. Vor nicht einmal zehn Minuten hatte sie sich eine blutige Lösung ihres Problems gewünscht und jetzt benahm sie sich ihrer Freundin gegenüber wie eine undankbare Zicke. Auch wenn die offensichtlich nicht auf ganz legalem Wege an Joshuas Unterschrift gelangt war.
„Du bist die Beste“, raunte Rachel deshalb im Brustton der Überzeugung. „Du hast mir im wahrsten Sinne des Wortes mein altes Leben zurückgegeben.“ Sie zog einen Tequila zu sich und schob den anderen in Taylors Richtung über den Tisch. Dann stupste sie einen Limettenschnitz in das kleine Salznäpfchen, das zusammen mit der Bestellung serviert wurde, und hob ihr Glas. „Cheers …!“
Bereits nach wenigen Sekunden breitete sich in Rachel eine angenehme Ruhe aus. Doch als sie Taylors Gesicht sah, musste sie sofort loslachen. Ihre Freundin mochte Tequila, genau wie sie selbst, aber mit den Limetten schien sie ein echtes Problem zu haben.
„Puhhh, … ist der gut.“ Taylor sog hörbar die Luft ein und spülte die Säure sofort mit dem kalten Bier hinunter.
„Jetzt bin ich auf alles vorbereitet“, stellte Rachel fest, „und will die ganze Geschichte hören!“ „Aber wenn du noch einmal Neunmillimeter sagst, dann renne ich schreiend davon.
„Na dann …“ Taylor zog ihr Smartphone aus der Tasche, öffnete eine Videodatei und schob es zu Rachel. „Da du ja gewissermaßen meine Auftraggeberin bist, hast du schließlich ein Recht auf sämtliche Informationen“, grinste sie und beobachtete gespannt die Reaktion im Gesicht ihrer Freundin.
„Wo zum Teufel ist denn das?“ Rachel ließ sich keine Sekunde der makaberen Vorführung entgehen.
„In einer alten Industrieruine“, antwortete Taylor wahrheitsgemäß. „Ich habe eine Kopie des Videos bereits bearbeitet und werde das Original löschen, wenn du fertig bist.“ „Da sieht man dann nur noch wie dein Ex die Papiere unterschreibt“, grinste sie hintergründig. „Okay, er ist ein bisschen aufgeregt, aber das ist halb so schlimm.“
„Du bist tatsächlich auf die dunkle Seite gewechselt“, stellte Rachel ungläubig fest, als sie die ganze Datei gesehen hatte. „Was ist nur aus meiner lieben, netten Freundin geworden?“ In ihrem Gesicht spiegelte sich echte Sorge.
„Die sitzt genau vor dir.“ Taylor nahm Rachels Hand und drückte sie beruhigend. „Aber es gibt Situationen im Leben, in denen du dich entscheiden musst, ob du Jäger oder Gejagter sein willst.“ Sie machte eine kurze Pause. „Und glaube mir, dieses eine Mal auf der falschen Seite hat mir gereicht.“
„Das ist echt heftig“, presste Rachel hervor. „Also ich brauche jetzt definitiv noch einen kleinen Mexikaner.“ Sie wedelte auffordernd mit ihrem leeren Glas der Kellnerin zu, die gerade vorbeieilte.
„Zwei!“, ergänzte Taylor und knuffte ihre Freundin. „Na komm schon, eigentlich bist du doch nur ein bisschen sauer, weil du es diesem Idioten nicht selbst heimzahlen konntest.“ „Außerdem steht mir das böse Mädchen eindeutig besser als dir“, fügte sie nach einer kurzen Pause hinzu.
„Wie bitte …?“ Rachel musste sich ein Lachen verkneifen. Offensichtlich war die junge Frau, die ihr gegenübersaß, doch ihre alte Freundin.
„Ja klar … am Ende ruinierst du dir noch deine Frisur oder brichst dir einen Fingernagel ab.“ Taylor blies theatralisch ihre Wangen auf.
„Du bist dämlich“, prustete Rachel los. „Wo lernt man eigentlich solche Sachen?“, wollte sie wissen, als sie wieder normal atmen konnte. „Ich meine gibt es da eine Killer-Akademie oder so?“
„Na ja …“ Taylor verdrehte ihre Augen.
„Halt … ich weiß“, beantwortete sich Rachel selbst die Frage und schnippte mit den Fingern. „Das war diese komische Freundin von deiner Tante“, fügte sie hinzu, während sie die Stirn in Falten zog. „Die kam mir schon früher äußerst verdächtig vor.“
„Zum Wohl“, flötete die junge Kellnerin, als sie erneut die großzügig gefüllten Gläser auf den Tisch stellte. „Möchtet ihr vielleicht auch eine Kleinigkeit essen?“, erkundigte sie sich anschließend besorgt. In der Hitze des späten Nachmittags konnten zwei doppelte Tequila leicht ins Auge gehen.
Taylor drehte sich langsam zu der schlanken Blondine und musterte sie übertrieben von oben bis unten.
„Im Moment nicht“, hauchte sie mit einem verheißungsvollen Augenaufschlag, „aber vielleicht bekommen wir ja später Appetit.“
Der jungen Kellnerin wich schlagartig die Farbe aus dem Gesicht. Schützend drückte sie sich die Speisekarte an die Brust, bevor sie in Richtung Küche davoneilte.
„Eins zu null für dich“, kicherte Rachel und hob ihr Glas. „Na dann Cheers, du kleines Miststück!“
„Selber Miststück“, gab Taylor zurück und kippte den Tequila hinunter.
Auch diesmal kam sie mit den Limetten nicht besser zurecht, doch ihre Freundin schien sich kaum mehr für ihre Grimassen zu interessieren. Stattdessen hatte Rachel ihr Kinn auf die Hand gestützt und starrte irgendwie durch sie hindurch.
„Weißt du was mir gerade durch den Kopf geht?“, raunte Rachel nachdenklich.
„Sobald ich über telepathische Fähigkeiten verfüge, gebe ich dir Bescheid“, versprach Taylor.
„Du glaubst gar nicht, wie viel Scheiße auf der Welt passiert“, fuhr Rachel fort, als hätte sie die dämliche Bemerkung nicht gehört.
„Ach …“, warf Taylor ein, „wie bist du denn zu dieser Erkenntnis gelangt?“
„Kannst du nicht einmal ernst bleiben?“ Rachel bedachte ihre Freundin mit einem vernichtenden Blick, der jede Erwiderung im Keim erstickte. „Das ist ja wie im Kindergarten!“
„Sorry“, murmelte Taylor peinlich berührt. „Ich benehme mich nicht gerade altersentsprechend.“
„Ich fasse das als Entschuldigung auf“, stellte Rachel wohlwollend fest, bevor sie fortfuhr. „Also was ich eigentlich sagen wollte ist, dass es auf der Welt schon sehr ungerecht zugeht.“
„Genau, das stimmt“, musste Taylor zugeben.
„Und damit meine ich nicht nur die globalen Sachen“, fuhr Rachel fort und machte eine ausladende Handbewegung. „So wie die immer größer werdende Schere zwischen Arm und Reich. Oder der uneingeschränkte Zugang zu den Ressourcen, wie zu sauberem Trinkwasser zum Beispiel.“
Taylor nickte und hatte trotzdem keine Ahnung, worauf ihre Freundin eigentlich hinauswollte.
„Ich meine so eher die kleinen Gemeinheiten“, kam Rachel schließlich zum Punkt. „Der Hausbesitzer, der sich nicht gegen die großen Immobilienhaie zur Wehr setzen kann, und so sein Grundstück verkaufen muss. Und das meist zu einem Spottpreis. Ganz zu schweigen von den vielen anderen Arschlöchern, die sich mit Hilfe von Winkeladvokaten oder Bestechung ihrer Verantwortung entziehen.“ Rachel ballte ihre Fäuste, so dass ihre Knöchel weiß hervortraten. „Wie zum Beispiel der Vergewaltiger, der das Geschrei seines Opfers irgendwie falsch interpretiert hat, und dank einer günstigen Sozialprognose mit einer milden Strafe davonkommt. Um dann natürlich weiter Frauen zu belästigen.“
„Oder auch der betrügerische Heiratsschwindler, der seiner hart arbeitenden Ehefrau jeden Cent aus der Tasche zieht“, ergänzte Taylor und hob vorsichtshalber sofort beschwichtigend die Hände. „Und bevor du etwas sagst, musst du wissen, dass ich das ernst meine. Du bist da mit Sicherheit kein Einzelfall.“
„Ich weiß“, stellte Rachel fest. „Natürlich habe ich für mein Problem auch im Netz nach Lösungen gesucht und musste feststellen, dass es da die dramatischsten Sachen gibt. Herzzerreißende Schicksale, bei denen mir plötzlich meine Sorgen richtig lächerlich vorkamen.“
„Tja“, antwortete Taylor mit einem bedauernden Schulterzucken, „es kann nun mal nicht jeder so eine Freundin haben wie du.“ Dann trank sie langsam den Rest ihres Bieres.
Rachel legte den Kopf schief, zog ihre Augenbrauen nach oben und grinste vielsagend.
Taylor verschluckte sich an ihrem Miller. „Das ist jetzt nicht dein Ernst“, hustete sie. „Weißt du, was du mir da gerade vorschlägst?“
„Iiich …? Rachel machte große Augen. „Ich schlage gar nichts vor“, antwortete sie abwehrend. „Ich wollte dich bloß ein bisschen zum Nachdenken bringen. Denn irgendwie hatte ich den Eindruck, dass dir die Sache mit Joshua richtig Spaß gemacht hat.“
„Das hast du sicher missverstanden“, stellte Taylor energisch fest. Sie atmete tief durch und klackte aufgeregt mit ihren Fingernägeln auf der Tischplatte. „Nur mal so rein hypothetisch …“, begann sie schließlich. „Wie sollte das denn deiner Meinung nach ablaufen?“ Sie spitzte die Lippen. „Hätten Sie etwas dagegen, wenn ich ihrem Vergewaltiger kurz ins Knie schieße?“, presste sie mit verstellter Geheimagenten-Stimme hervor.
„So ähnlich“, antwortete Rachel euphorisch und strahlte. „Sieh mal, als freie Mitarbeiterin hast du jede Menge Zeit“, stellte sie fest. „Außerdem spricht du fast eine Million Sprachen …“
„Ich spreche gerade einmal Englisch und Spanisch, wie fast alle in San Diego“, korrigierte Taylor ihre Freundin. „Okay, ein bisschen Deutsch geht auch. Und Italienisch ähnelt ja dem Spanischen ganz verblüffend. Nur mit dem ganzen asiatischen Zeugs habe ich überhaupt nix am Hut.“ „Außerdem schieße ich hundsmiserabel“, log sie. „Du siehst also, dass ich nicht gerade die perfekte Kandidatin für dein Programm bin.“
„Aber …“, versuchte es Rachel noch einmal.
„Na dann vielen Dank für das Bier und den Tequila, aber ich muss jetzt los“, verabschiedete sich Taylor fast schon etwas überstürzt. „Am besten du fragst mich so in zehn Jahren noch einmal.“
Doch als sie mit ihrem kleinen Nissan vom Parkplatz rollte, musste sie sich eingestehen, dass sie bereits an Rachels Angel hing.
„Dieses scheinheilige, kleine Luder!“
An Schlaf war in dieser Nacht wirklich nicht zu denken, denn selbst nach einem Joint und zwei doppelten Wodka rotierte Taylors Gehirn noch immer wie ein Brummkreisel. Selbstjustiz ist zwar der erste Schritt zur Anarchie, doch manchmal gab es eben keine Alternative, um der Gerechtigkeit zum Sieg zu verhelfen. Außerdem war die Vorstellung einfach zu verlockend.
Noch sehr genau erinnerte sie sich an den Abend, an dem sie ihre Unschuld verlor und zum ersten Mal getötet hatte. Das Gefühl der Unbesiegbarkeit hatte sie in ungeahnte Höhen katapultiert und dummerweise süchtig werden lassen. Süchtig nach dem Adrenalin, das ihre Adern flutete, und süchtig nach der warmen Welle der Befriedigung, in der sie danach schwerelos davontrieb.
Entschlossen schnappte sich Taylor ihren Autoschlüssel und stürmte aus ihrem Appartement.
„Scheiß auf den Wodka!“
Mit quietschenden Reifen schoss der kleine Nissan auf die Straße in Richtung Osten. Taylors Finger trommelten nervös auf das Lenkrad, während die Laternen wie Leuchtspurgeschosse an ihrem Fenster vorbeirasten.
Was könnte sie nicht alles mit Rachels Hilfe erreichen?!
Die brillante Informatikerin müsste nur die richtigen Tools entwickeln, um die wirklich ernsten Fälle von dem ganzen Schwachsinn zu trennen. Denn nur weil jemand glaubte, dass er das Opfer einer Verschwörung geworden war, entsprach das natürlich nur in den seltensten Fällen den Tatsachen.
Erst als eine rote Ampel sie stoppte und sie versonnen aus dem Fenster grinste, erschrak Taylor vor sich selbst. Beschämt musste sie zugeben, dass ihre Freundin gar nicht so unrecht hatte und es ihr irgendwie Spaß machte. Das dämliche Gesicht von Rachels Ex war aber auch wirklich zu komisch gewesen. Was war denn schon dabei, wenn sie ihre Talente nutzte und dabei das Angenehme mit dem Nützlichen verband? Wer sagte denn eigentlich, dass Robin Hood unbedingt ein Mann sein musste? Außerdem standen ihr ein kurzer Rock und Strumpfhosen eindeutig besser.
Mit einer entschlossenen Handbewegung wischte Taylor ihre Bedenken beiseite und gab Gas. Sie hielt nur noch kurz an einem Starbucks, um sich mit zwei riesigen Kaffee Americano und Schokoladenmuffins zu bewaffnen, und klingelte wenige Minuten später ihre Freundin aus dem Bett.
„Weißt du eigentlich wie spät es ist?“, nuschelte Rachel durch die Sprechanlage, nachdem sie sich gemeldet hatte.
„Früh …“, korrigierte Taylor sie euphorisch, „… es ist früh, Süße.“ „Und jetzt mach auf, wir haben viel zu besprechen!“
-2-
„Also ich hätte echt nicht gedacht, dass die Leipziger die Bundesliga derart aufmischen“, stellte Erik Wagner fest und grinste schelmisch in die Runde.
„Na ja“, gab sein Freund Daniel Lüders zu bedenken, „das ist ja im Prinzip genauso ein Kunstklub wie Hoffenheim.“ „Nix Gewachsenes und nur mit einem Haufen Geld aufgepumpt.“
„Aber trotzdem haben die Bayern Schiss“, mischte sich jetzt auch Paul Jansen, der Dritte im Bunde, ein. „Die Roten Bullen sind nur sieben Punkte hinter ihnen und können das locker aufholen.“
„Stimmt, eine kleine Klatsche wäre wirklich nicht schlecht“, bestätigte Wagner und hob sein Glas. „Na dann Prost!“
Die drei hatten es sich in ihrer Stammkneipe am Schulterblatt, mitten in Hamburgs trendigem Schanzenviertel, gemütlich gemacht und beobachteten gespannt, wie die aktuellen Spielergebnisse die Tabelle veränderten.
„Ha …!“, stieß Jansen ein bisschen schadenfroh hervor und hieb mit der flachen Hand auf den Tisch. „Wer sagt’s denn. Jetzt sind sie nur noch fünf Punkte im Rückstand.“
Da ihr eigener Verein, der HSV, im hinteren Mittelfeld herumdümpelte, waren natürlich die Sympathien der drei Männer bei der Mannschaft, die dem Rekordmeister am ehesten gefährlich werden konnte.
„Das wird auf jeden Fall noch spannend“, mutmaßte Lüders, bevor er den Rest seines Bieres hinunterkippte. „Noch drei Astra“, murmelte er lautlos in Richtung Tresen, als Hannes, der Wirt, gerade herüberschaute. Denn wenn er den Lärm in der Gaststube übertönen wollte, dann bräuchte er glatt ein Megafon.
„Ich muss mal kurz an die frische Luft“, teilte Wagner seinen Freunden mit, noch bevor die neue Bestellung eingetroffen war. Er wedelte mit seinem vibrierenden Smartphone und kämpfte sich durch die lärmenden Gäste bis zur Tür. Erst im Freien nahm er das Gespräch an. Doch er wusste bereits seit dem kurzen Blick auf das Display, wer der Anrufer war.
Denn alles begann bereits eine halbe Ewigkeit zuvor als relativ harmloser Winterurlaub in den Österreichischen Alpen.
Wagner hatte sich zusammen mit seinen beiden Freunden in einer Pension im idyllischen Hochgurgl einquartiert, um mit ihnen ein paar entspannte Tage zu genießen. Eigentlich wollten die drei schon seit Langem auf die bedeutend cooleren Snowboards umsteigen, doch das knappe Budget der jungen Männer ließ dies einfach nicht zu. Also kamen sie auf die naheliegende Idee, abseits der markierten Pisten die besondere Herausforderung zu suchen. Und dafür gab es hier jede Menge Möglichkeiten. Das hieß, wenn man früh genug aufstand, um die ersten Spuren durch den jungfräulichen Schnee zu ziehen. Und natürlich auch schon einige Erfahrung im Freeriding gesammelt hatte.
Bereits am Abend zuvor hatten sie sich für den Wurmkogel X-Drop entschieden. Der Einstieg in den Run war mit dem Lift relativ einfach zu erreichen, so dass ihnen das nervige Stapfen durch den Tiefschnee erspart blieb. Außerdem endete er auf einer regulären Piste, die sie direkt an die Talstation des Lifts bringen würde. Anschließend könnten sie sich dann die nächste Route vornehmen. Oder erst einmal etwas Vernünftiges essen. Denn Jansen hatte seine Freunde noch vor dem Sonnenaufgang aus dem Bett gezerrt. Und da sie die ersten sein wollten, blieb gerade einmal Zeit für einen heißen Kaffee.
„Das sieht ja echt geil aus“, stellte Lüders staunend fest.
Das Schneetreiben der vergangenen Nacht hatte einem tiefblauen Winterhimmel Platz gemacht, der das atemberaubende Panorama fast unwirklich erscheinen ließ. Jetzt standen die drei unterhalb des Top Mountain Star, einem architektonisch beeindruckenden Restaurant, und grinsten in die Sonne.
„Genau“, stimmte Jansen zu. „Wir fahren am besten unterhalb des Kamms entlang bis zu dieser Kuppe.“ Er deutete mit seinem Skistock in Richtung Westen. „Dahinter kommt ein Steilhang. Von dort aus können wir ja kurz checken wie es mit den Drop Offs aussieht. Erik wollte ja unbedingt einmal springen.“
„Hmmm …“, brummte Wagner skeptisch. „Aber erst wenn ich mir das aus der Nähe angesehen habe. Sonst landen wir noch mit zermatschten Knochen auf einem Felsen.“ Er blickte fragend in die Runde. „Ihr seid doch dabei, oder?“
„Aber immer“, bestätigten Lüders und Jansen wie aus einem Mund.
Sekunden später pflügten die drei durch den lockeren Schnee.
„Das scheint ja nicht allzu schwierig zu sein“, mutmaßte Jansen, nachdem sie hinter der kleinen Kuppe angekommen waren. Dann schielte er den fast senkrechten Hang hinunter. „Da hinten in Richtung des Speicherbeckens kommt man recht einfach runter und nach da drüben wird es immer steiler.“ Er rückte sich aufgeregt seine Skibrille zurecht. „Da ist bestimmt ein Zwanzig-Meter-Sprung drin.“
„Cool!“ Lüders machte bereits erste Anstalten, sich in die Steilwand zu stürzen.
Nur Wagner konnte die Euphorie seiner Freunde nicht teilen und zog ein nachdenkliches Gesicht.
„Was ist?“, wollte Jansen fast schon ein bisschen beleidigt wissen.
„Das gefällt mir nicht“, murmelte Wagner.
„Und was?“, erkundigte sich jetzt auch Lüders verständnislos.
„Alles“, gab Wagner flüsternd zurück. „Der Schnee …, die Geräusche …, die viel zu hohe Luftfeuchtigkeit.“
„Warum flüsterst du?“, zischte Jansen jetzt ebenfalls leise.
Doch statt zu antworten, drehte sich Wagner langsam herum. Keine zehn Meter oberhalb von ihnen hatte sich ein kleiner Überhang aus frischem Schnee gebildet, auf dem weiße Flocken in der Sonne tanzten.
„Weg hier!“, brüllte Wagner.
Mit ganzer Kraft stieß er seine Stöcke in das lockere Weiß und schoss Sekunden später an der Kante des Steilhangs entlang. Er achtete nicht auf das lose Geröll, das seine Ski ruinierte, sondern nur auf das dumpfe Grollen, das in seinem Rücken immer lauter wurde. Hoffentlich hatten Lüders und Jansen nicht allzu lang gezögert. Denn selbst für eine kurze Erklärung war einfach keine Zeit mehr geblieben.
Instinktiv drückte er seine Ski auf die Kante, so dass er nach links wegdriftete. Das kostete ihn zwar wertvolle Geschwindigkeit, vergrößerte aber hoffentlich den Abstand zu den heranjagenden Schneemassen.
Doch plötzlich gab der Boden unter ihm nach.
Wagner ruderte verzweifelt mit den Armen in der Luft, dann verschluckte ihn die wirbelnde Gischt. Er fühlte sich wie in einer riesigen Waschmaschine gefangen, die ihn unaufhörlich mit weißem Pulver bombardierte. Er war nur eine Frage weniger Augenblicke, bis er unter Tonnen vom Schnee begraben sein würde.
Aber mit einem Mal traf ein greller Lichtstrahl sein Gesicht.
Wagner schoss aus der weißen Wolke, als hätte ihn ein riesiger Eisbär ausgespuckt. Er torkelte noch ein paar Meter weiter und kippte schließlich zur Seite. Dann wurde es schlagartig mucksmäuschenstill. Nur noch ein paar Flocken wirbelten über ihm vor dem blauen Himmel.
„Ach du heilige Scheiße!“
Erschrocken fuhr Wagner hoch. Doch seine panische Sorge dauerte nur eine Sekunde. Keinen Steinwurf weit entfernt sah er vier Skier, die im lockeren Schnee steckten, während sich seine Freunde entschlossen zu ihm vorkämpften.
„Meine Fresse, was war das denn?“, keuchte Lüders atemlos, als er bei Wagner ankam.
„Du hast echt was gut bei uns, Alter“, stellte Jansen fest, bevor beide ihn auf die Beine zogen und die weißen Krümel von den Klamotten klopften. „Wenn du nicht so schnell reagiert hättest, dann wären wir richtig im Arsch gewesen. Mich würde wirklich interessieren, wie du das ahnen konntest?“
„Genau“, wollte jetzt auch Lüders wissen. „Schließlich bist du ja ein Nordlicht und lebst nicht in den Alpen.“
„Uhhh …“ Wagner machte ein paar kreisende Handbewegungen und rollte theatralisch mit den Augen, als wollte er die Berggeister beschwören. Aber in Wahrheit versuchte er lediglich, mit einem schrägen Scherz seinen immer noch rasenden Puls unter Kontrolle zu bringen.
„Kaum dem Tod von der Schippe gesprungen und schon wieder herumblödeln“, gluckste Jansen.
„Sorry, Männer“, gab Wagner zurück. Er öffnete seine Jacke, denn mit einem Mal war ihm sauwarm. „Das war überhaupt nix Geheimnisvolles“, klärte er seine Freunde auf, „nur ein bisschen Physik.“
Jansen und Lüders schauten sich verständnislos an.
„Na seht mal“, fuhr Wagner fort, „der Neuschnee der Nacht war noch locker und hat sich am Morgen mit Feuchtigkeit vollgesogen.“ „Dadurch wird er relativ schwer und haftet nicht so gut auf dem Untergrund.“ Er atmete tief ein bevor er fortfuhr. „Wenn die Neigung des Hangs dann noch etwas ungünstig ist, oder drei Pappnasen darauf herumturnen, rutscht das Ganze schließlich irgendwann ab.“
„Respekt, Respekt“, stieß Lüders hervor und klopfte seinem Freund anerkennend auf die Schulter.
„Hast du schon einmal darüber nachgedacht, damit Geld zu verdienen?“, brachte Jansen Wagner auf das Naheliegende. „Ich meine, es müsste doch jede Menge Leute geben, die deine Fähigkeiten zu schätzen wissen.“
Doch als sie wieder zurück in Hamburg waren, musste er feststellen, dass das leider nicht so einfach war, wie er anfangs gedacht hatte. Denn bei dem einzigen Arbeitgeber, der das wirklich tat, musste er eine Uniform tragen und sich für zwölf Jahre verpflichten. Aber das Gehalt bei der Bundeswehr war mehr als in Ordnung und mit den Zulagen für die Auslandseinsätze kam recht schnell ein hübsches Sümmchen zusammen.
Jahre später starrte Wagner missmutig auf die schneebedeckten Bergkämme des Hindukusch. Und auf die eintönige Ödnis, in der sie schon den ganzen Tag herumgurkten. Was je einen Menschen dazu veranlasst haben könnte, sich in dem kargen Landstrich niederzulassen, war ihm jedenfalls schleierhaft.
In ein paar Wochen war seine Dienstzeit offiziell vorbei und er hatte immer noch keinen blassen Schimmer, was er danach anstellen sollte. Zwar bot das Militär verschiedene Programme an, um ihren Angehörigen die Rückkehr ins zivile Leben zu erleichtern. Doch irgendwie konnte er sich nicht so recht entscheiden. Wahrscheinlich lag das auch daran, dass ihm das Ganze irgendwie gefiel.
Denn Wagner gehörte zu einem der so genannten PRTs, einem regionalen Wiederaufbauteam, und war für die Risikobewertung ihres Einsatzgebietes zuständig. Diese Einheiten unterstützten den Aufbau Afghanistans und halfen bei der Verbesserung der lokalen Infrastruktur. Außerdem sorgten sie für ein sicheres Umfeld und arbeiteten eng mit den einheimischen Sicherheitskräften, aber auch mit der Zivilbevölkerung zusammen.
Natürlich waren die einfachen Menschen den Deutschen für ihre Hilfe mehr als dankbar und belohnten die Soldaten mit einem freundlichen Lächeln oder manchmal auch mit einer Einladung auf eine Tasse Tee. Und das war in dieser krisengeschüttelten Region schon fast ein kleines Wunder.
Wenn nur nicht ständig diese dämlichen Taliban dazwischenfunken würden.
Sie dachten sich im religiösen Wahn immer neue Perversitäten aus, um ihre eigenen Landsleute, und vor allem die ausländischen Truppen, zu terrorisieren. Da kam es Wagner und seiner kleinen Truppe auch gerade recht, dass in der flachen Ebene vor ihnen ein amerikanischer Konvoi auftauchte, an den sie sich bestimmt anhängen konnten. Denn bis Khanabad waren sie mit Sicherheit noch ein paar Stunden unterwegs.
Entschlossen drückte Schröder, der in ihrer Einheit nur Atze genannt wurde, das Gaspedal ihres Dingo durch. Das auf Basis eines Unimog gebaute Patrouillenfahrzeug war zwar gepanzert, aber trotzdem eine relativ leichte Beute. Da fühlten sie sich im Schutz der Amerikaner schon bedeutend sicherer.
Bis eine gewaltige Explosion den letzten Wagen des Konvois zerriss und sie innerhalb von Sekundenbruchteilen mit einer Wolke aus Splittern und Staub überschüttete.
Reflexartig trat Schröder die Bremse durch das Bodenblech. Völlig überrascht wurde Wagner in den Fußraum geschleudert und Omar, der Dolmetscher, knallte gegen den Vordersitz.
„Verdammte Kacke“, brüllte Schröder, nachdem er ebenfalls abgetaucht war.
Dann hielten alle drei die Luft an. Es konnte nur noch wenige Augenblicke dauern, bis erneut panzerbrechende Geschosse ein anderes Fahrzeug zerfetzten. Und wie immer, wenn er in eine ähnlich gefährliche Situation geraten war, raste Wagners bisheriges Leben in atemberaubender Geschwindigkeit an ihm vorbei. Vielleicht war es doch gar nicht so schlecht, bald von hier wegzukommen. Auch wenn ihm die großen Augen der kleinen Afghanen echt fehlen würden.
Doch statt des nächsten ohrenbetäubenden Knalls passierte gar nichts. Im Gegenteil, Es wurde plötzlich still. So still wie in einem Grab.
Behutsam atmete Wagner aus. So, als ob ein zu lauter Luftzug das feindliche Feuer auf sie lenken könnte. Dann stemmte er sich nach oben und spähte vorsichtig durch die Frontscheibe.
Die Räder des demolierten amerikanischen Trucks, der langsam wieder aus der Staubwolke auftauchte, sahen aus, als seien sie einfach abgesprengt worden und die Ladefläche war seltsam verformt. Offensichtlich wurde das Fahrzeug doch nicht von einem Geschoss getroffen, sondern durch einen teuflischen Sprengsatz zerrissen.
Völlig entsetzt konnte Wagner doch tatsächlich zwischen den Trümmern ein paar menschliche Körper erkennen. Einige streckten flehentlich die Hände nach ihren Kameraden aus, die jetzt aus den vorderen Fahrzeugen zum Ende des Konvois stürmten. Auch Schröder hatte bereits seine Tür geöffnet, um ihren Verbündeten zu Hilfe zu eilen.
„Stopp!“, presste Wagner unmissverständlich zwischen seinen Zähnen hervor.
Und Schröder blieb wie angewurzelt auf dem Trittbrett stehen. Denn diesen Ton kannte er nur allzu gut. Mit zusammengekniffenen Augen blickte er auf seinen Hauptfeldwebel, der gerade ein starkes Militärfernglas aus der Mittelkonsole gezogen hatte und damit aufmerksam die karge Steppe absuchte, in der sie feststeckten.
„Da hinten …“, murmelte Wagner. Er deutete mit dem Kopf auf eine flache Düne in ungefähr einem Kilometer Entfernung, auf der ein gutes Duzend Ziegen mit ihren bärtigen Mäulern die spärlich wachsenden Gräser aus dem harten Boden zogen. „Ich könnte schwören, dass dort kurz vor dem Knall noch ein Hirte herumstand“, fügte er nachdenklich hinzu.
„Was dir so alles auffällt“, bemerkte Schröder fast ehrfürchtig. Dann rutschte er zurück auf den Fahrersitz und zog die schwere Tür zu.
„Taliban“, stellte Omar folgerichtig fest. Der drahtige Paschtune rieb sich seine schmerzende Stirn und starrte über Wagners Schulter hinweg ebenfalls auf die feindlichen Ziegen.
Bis die drei durch ein lautes Hupen aufschreckt wurden.
Schröder fuhr herum. Wenige Meter hinter ihnen stand ein amerikanischer Humvee und versuchte sich an ihrem Wagen vorbeizudrängeln. Noch während der Fahrer hektisch an seinem Lenkrad herumkurbelte, flog die Beifahrertür auf und ein stämmiger GI hastete an ihrem Dingo vorbei, um seine Landsleute zu unterstützen.
Jetzt hatte es Wagner plötzlich sehr eilig. Mit einem Satz war er draußen und sprintete los.
„Stopp, das ist ein Hinterhalt!“, versuchte er den Amerikaner vor der tödlichen Falle zu warnen. Doch der war offensichtlich mit seinen Gedanken schon bei den Verwundeten.
Außerdem war er schnell. Unheimlich schnell!
Zwar holte Wagner zügig auf, aber es waren nur noch wenige Meter bis zum Splitterradius einer vermeintlichen Bombe. Da konnte er eigentlich nur noch die Notbremse ziehen.
Entschlossen kickte er dem Amerikaner in die Fersen. Und prompt verhakte der sich in seinen eigenen Beinen und stürzte auf den staubigen Boden. Noch bevor er sich hochrappeln konnte, rammte Wagner seinem Opfer die Schulter in den Rücken und beide rollten wie außer Kontrolle geratene Rugby-Spieler in eine kleine Senke.
Gerade als sich der Amerikaner mit einem Faustschlag für die unsportliche Aktion des Deutschen bedanken wollte, flogen den beiden fast die Ohren vom Kopf und eine unsichtbare Faust presste ihnen alle Luft aus den Lungen.
Dann raste die Druckwelle über sie hinweg.