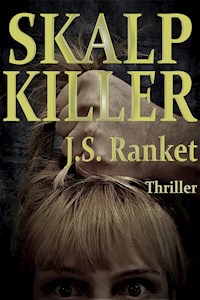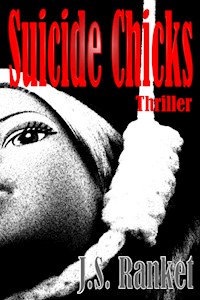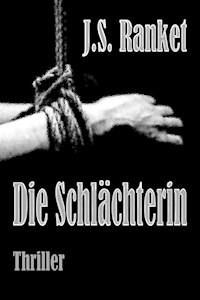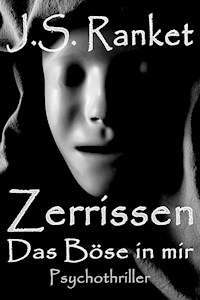
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die junge Frau zappelte wie ein Fisch am Haken und versuchte, der tödlichen Falle zu entkommen. Immer wenn ihr Mund die glitzernde Wasseroberfläche durchbrechen wollte, wurde sie an den Haaren zurückgezogen. Schließlich öffneten sich ihre Lippen zu einem letzten verzweifelten Atemzug, dann entspannte sich ihr Körper. Unendlich langsam versank sie mit ausgebreiteten Armen in der Tiefe, die sie aufzusaugen schien wie ein riesiges schwarzes Loch. Eigentlich war Alexander Bergmann ausgezogen, die Menschheit zu retten. Oder zumindest einen Teil davon. Doch seit dem bizarren Aufnahmeritual in eine Studentenverbindung steht sein Leben auf dem Kopf. Immer wieder wird der junge Arzt von Albträumen geplagt, in denen hübsche Frauen aus seiner unmittelbaren Umgebung einfach verschwinden. Zu seinem Entsetzen tauchen die Betreffenden auch im wahren Leben nie wieder auf. Um der zermürbenden Spirale zu entkommen, sucht er Hilfe bei einem Psychotherapeuten und stellt sich schließlich die unvermeidliche Frage: "Bin ich ein Mörder?"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 313
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
J.S. Ranket
Zerrissen - Das Böse in mir
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Prolog
-1-
-2-
-3-
-4-
-5-
-6-
-7-
-8-
-9-
-10-
-11-
-12-
-13-
-14-
-15-
-16-
-17-
-18-
-19-
-20-
-21-
-22-
-23-
-24-
-25-
-26-
-27-
-28-
-29-
-30-
-31-
-32-
-33-
-34-
-35-
-36-
-37-
Epilog
Anmerkung des Autors und Danksagung
Impressum neobooks
Prolog
Lisa liebte Zahlen. Und Lisa liebte die Mathematik. Aber bei der heutigen Vorlesung in Stochastik wurde ihr fast schwindelig. Dabei war die Berechnung von Wahrscheinlichkeiten eigentlich ihr Steckenpferd. Das, was dem normalen Menschen Kopfzerbrechen und schlaflose Nächte bereitete, offenbarte sich ihr mit kristallener Klarheit. Doch irgendwie schaffte sie es heute nicht, dass sogenannte Ziegenproblem in eine Formel zu fassen.
Vielleicht lag das aber auch daran, dass sie am Wochenende ihren Körper mit ein bisschen Alkohol, ein ganz klein wenig Gras und hemmungslosem Vögeln überfordert hatte. Denn anders konnte sie sich ihren Blackout an der Uni nicht erklären.
Hatte der Kandidat einer Spielshow nämlich die Wahl zwischen drei Toren, hinter denen bei zweien lediglich eine Ziege versteckt war, bei dem anderen jedoch ein Auto, so hatte er eine Ein-Drittel-Chance auf den Hauptgewinn, wenn er sich für irgendein Tor entschied.
Außer er mochte Ziegen.
Wurde jetzt durch den Moderator ein anderes Ziegentor geöffnet, so stieg seine Chance automatisch auf zwei Drittel, wenn er das Tor wechselte. Das war doch eigentlich völlig logisch, oder?
Jedenfalls hatte der Mann, der einige Meter die Straße hinunter versuchte, einen Tisch in einen Transporter zu laden, null Chancen, das Ding hineinzubekommen. Denn sein Arm steckte in einen Verband, der dazu diente, die Schulter nach einer Verletzung oder Operation ruhigzustellen. Auch wenn er zwei Holzplanken in die offene Tür gelegt hatte, auf denen er den Tisch schieben konnte, blieb er ständig an der Kante hängen.
„Damit sollten Sie wirklich nicht selbst fahren“, stellte Lisa mit einem besorgten Blick auf den Verband fest, als sie neben ihm kurz stehen blieb.
„Das geht schon“, grinste der Mann zurück. „Ist eh ein Automatik.“
Er wirkte ein wenig deplatziert. So, als hätte er sich irgendwie verkleidet. Aber er hatte ein freundliches Gesicht.
„Warten Sie, ich helfe Ihnen“, bot Lisa an.
„Das Ding hängt nur da an der Kante.“ Der Mann deutete mit einem dankbaren Lächeln auf die Tür. „Sie brauchen ihn nur ein bisschen anheben, wenn ich schiebe.“
Lisa ließ ihre Tasche neben sich plumpsen und packte die Tischplatte. Plötzlich zog sie mit schmerzverzerrtem Gesicht ihre Hand zurück. Sie hatte sich an etwas Spitzem gestochen, das in dem Holz steckte.
„Oh, sorry“, murmelte der Mann betroffen, „da stand bestimmt ein kleiner Splitter davon.“ „Warten Sie, ich hole Ihnen ein Pflaster.“
„Halb so schlimm“, wiegelte Lisa ab, während sie sich hastig einen Blutstropfen vom Finger leckte.
„Ich bestehe darauf“, entgegnete der Mann. „Sonst infiziert sich das noch und ich bin schuld.“
„Meinetwegen“, willigte Lisa ein.
Sie setzte sich in die Tür und beobachtete den Verkehr, der auf der Straße langsam an ihr vorbeirollte. Irgendwie war sie noch immer ganz schön fertig, nur konnten das eigentlich keine Nachwirkungen des heißen Wochenendes mehr sein. Vielleicht musste sie sich nur mal ein Stündchen aufs Ohr legen. Scheiß auf das Pflaster! Doch sie schaffte es einfach nicht, aufzustehen.
Im Gegenteil.
Ihre Beine fühlten sich an, als wären sie aus Blei, und ihr Kopf begann sich zu drehen wie ein Brummkreisel. Dann wurde sie von einer unsichtbaren Hand in den Laderaum gezogen.
-1-
Während des Trainings bevorzuge ich immer den Dreierzug. Das hat den Vorteil, dass man dabei ruhiger im Wasser liegt und – so seltsam das auch klingen mag – ein bisschen länger die vorbeiziehenden Fliesen beobachten kann. Erst beim Wettkampf, wenn mein Körper Unmengen an Sauerstoff benötigt, um seinen Energiestoffwechsel sicherzustellen, schalte ich auf den Zweierzug um. Doch jetzt genoss ich erst einmal die monotone Eintönigkeit, die mir mit jedem Kraulschlag meine innere Ruhe zurückgab und mich über den unglaublichen Zufall nur verwundert den Kopf schütteln ließ. Den Zufall, der mich schließlich hierher geführt hatte. In das Schwimmbecken einer der angesehensten Universitäten der Welt.
Bereits bevor ich meinem Vater irgendwie begreiflich machen konnte, dass ich meine Zukunft nicht in dem familieneignen Delikatessengeschäft in Wilmersdorf sah, wurde mir die Entscheidung förmlich aus den Händen gerissen. Als Marlene, meine ältere Schwester, nach ihrem Studium plötzlich die Mutter Teresa in sich entdeckte hatte und auszog, um die Welt zu retten, lagen sämtliche Hoffnungen meines alten Herren auf die Fortführung der Tradition bei mir, dem Nachzügler.
Zwar eignete sich die Arbeit in einem kleinen Laden ganz hervorragend zur Aufbesserung des Taschengeldes, für mehr aber auch nicht. Nicht nur, weil immer mehr Supermärkte das gehobene Feinkostgeschäft für sich entdeckten, sondern auch, weil eine unheimliche Dunkelheit nach meinem Vater griff.
Am Anfang fiel es auch nicht weiter auf, dass er die eine oder andere Bestellung vergaß. Aber als sich diese Vergesslichkeitsattacken häuften, musste selbst einem medizinischen Laie klar geworden sein, dass mein Vater professionelle Hilfe benötigte. Und zwar bevor ein Unglück geschah und er das ganze Haus abfackelte.
Zum Glück hatte Marlene zu diesem Zeitpunkt gerade halb Zentralafrika das Lesen beigebracht und kam für einige Wochen zurück nach Berlin, um sich um meinen Vater zu kümmern. Ich hatte schon befürchtet, dass ich mein Freiwilliges Soziales Jahr in den Askania-Kliniken, das ich in Vorbereitung auf mein Medizinstudium in Angriff genommen hatte, abbrechen müsste. Denn ohne nachweisliche medizinische Praktika hatte ich, trotz meines respektablen Abiturs, noch einige Wartesemester vor mir. Auch wenn mein Herz seit meinem ersten Reanimationstraining, das der Coach unseres Schwimmvereins organisierte, für die Medizin schlug.
In jugendlichem Enthusiasmus hatte ich dann wenig später das eines überfahrenen Hundes freipräpariert, um mit eigenen Augen zu sehen, wie das Klappensystem denn nun genau funktionierte, und außerdem die Prüfung zum Rettungsschwimmer abgelegt. Darüberhinaus war ich in Bezug auf meine beruflichen Pläne der Auffassung, dass gerade Akademiker zumindest die Grundkrankenpflege beherrschen sollten und nicht vor einer vollen Windel zurückschrecken dürfen. Aus diesem Grund hatte ich auch schon daran gedacht, vorerst mit einer Ausbildung zum Krankenpfleger zu beginnen. Allerdings klammerte ich mich immer noch an die Hoffnung, irgendwie trotzdem einen Studienplatz zu ergattern. Und da war ich im FSJ deutlich flexibler.
Leider wurde ich am Anfang nur im sogenannten Patientenbegleitservice eingesetzt, bei dem ich verstauchte Knöchel und ausgerenkte Schultern mit dem Rollstuhl von der Notaufnahme in die Röntgenabteilung kutschieren musste. Aber fast alle Patienten fanden nach der stundenlangen Warterei meine rasanten Fahrten, die ich meist mit Formel-Eins-Geräuschen untermalte, sehr erfrischend.
Doch mein Tätigkeitsprofil änderte sich schlagartig, als ich eines Tages in der Radiologie auf eine verschobene Kniescheibe wartete. Eine Neurochirurgin, die ich nur vom Sehen her kannte, diskutierte gerade mit dem Leiter der Intensivstation, Professor Erlenmeyer, über eine Computertomographie. Das Unfallopfer, dessen Schädelschnitte über den großen Monitor wanderten, hatte offensichtlich eine Fraktur des Scheitelbeins. Dadurch wurden Teile davon nach innen auf das Gehirn gedrückt und verursachten so eine Blutung.
Um besser sehen zu können, schob ich mich vorsichtig näher. Blöderweise stieß ich dadurch gegen den Stuhl der Neurochirurgin.
„Tschuldigung“, murmelte ich leise und trat sofort einen Schritt zurück. Doch es war bereits zu spät.
Sie fuhr herum und musterte mich etwas seltsam von oben bis unten. Für den ersten Augenblick wusste ich nicht so recht, ob sie sich einfach wieder umdrehen oder mir ihren Kugelschreiber in den Hals rammen würde.
„Und, junger Mann“, wollte sie ein wenig überheblich wissen, „was sehen Sie auf den Aufnahmen?“
Jetzt drehte sich auch Erlenmeyer zu mir herum, nahm seine Brille ab und zog die Mundwinkel nach oben. Aber es wirkte keinesfalls herablassend, sondern nur irgendwie neugierig. Fordernd deutete er mit seiner Hand auf den Monitor.
Zum Glück war es fast stockdunkel, so dass keiner meine wechselnde Gesichtsfarbe erkennen konnte. Nur durch das strahlensichere Fenster fiel etwas Licht aus dem Nachbarraum, in dem das riesige Gerät brummte, auf den Schreibtisch der Röntgenassistentin. Leider hatte die im Moment auch nichts anderes zu tun und starrte mich zu allem Überfluss ebenfalls an.
Die drei konnten natürlich nicht ahnen, dass ich seit dem schicksalhaften Hundeexperiment medizinische Veröffentlichungen aufsog wie ein Schwamm und beim ehrenamtlichen Dienst in den Berliner Freibädern schon mehr Schnittwunden versorgt hatte als eine mittelgroße Arztpraxis.
„Also …“, begann ich zögernd und räusperte mich. Dann trat ich langsam näher an den Monitor heran, um noch etwas Zeit zu schinden. Viel mehr, als mir einen dämlichen Kommentar anhören zu müssen, konnte eigentlich nicht passieren. „… die deutliche Mittellinienverschiebung weist auf einen erhöhten Hirndruck hin“, fuhr ich relativ selbstsicher fort. „Offensichtlich resultiert der aus einer subduralen Blutung, die wiederum von der Fraktur des Os parietale verursacht wurde.“
Der Oberärztin klappte der Unterkiefer nach unten, während Erlenmeyer anerkennend die Augenbrauen nach oben zog.
„Und hätten Sie auch einen Therapievorschlag?“, fuhr er mit einem kollegialen Tonfall fort.
„Bei der Größe der Blutung wird eine Drainage nicht viel bringen“, gab ich mutig zurück, weil in diesem Fall das Schädeldach entfernt werden muss. „Da kann man eigentlich nur noch entdeckeln.“
„Entdeckeln!“, stieß die Neurochirurgin völlig entgeistert hervor und kratzte sich nervös an der Stirn. „Haben Sie wirklich gerade entdeckeln gesagt?“
„Ich lese sehr viel“, gab ich lakonisch zurück.
Zwei Tage später war ich für sämtliche Ausscheidungen der Patienten der Intensivstation verantwortlich. Wenn das in dem Tempo weiterging, hatte ich sicher eine strahlende Zukunft vor mir. Doch zuerst musste ich mich durch die eher unangenehmere Seite meiner Beförderung kämpfen und mir außerdem noch einige blöde Bemerkungen anhören. Schließlich war ich ja keine Fachkraft und hatte auf der Station eigentlich nichts zu suchen. Trotzdem erfüllte ich meine neue Aufgabe nach einer ausführlichen Einweisung sehr gewissenhaft. Ich konnte mir recht gut vorstellen, dass es nicht besonders angenehm war, in seinen eigenen Exkrementen zu liegen.
Dadurch schlug ich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe.
Zum einen reduzierte sich die Geruchsbelästigung auf ein Mindestmaß und die Patienten, die noch halbwegs beieinander waren, waren über meine schnelle Hilfe mehr als dankbar. Und zum anderen konnte ich so den Nörglern richtig in die Eier treten.
Das Ganze ging schließlich nach einigen Wochen so weit, dass während einer sehr stressigen Schicht Sophie, die stellvertretende Stationsschwester, völlig vergaß, dass ich nur eine Hilfskraft war.
„Kannst du in der vier bitte mal die Jono wechseln“, rief sie mir zu, während sie mit einem Paket Spritzenpumpen unter dem Arm über den Gang hastete.
„Klar“, bestätigte ich, ohne mir etwas dabei zu denken.
Denn jeder wusste inzwischen von meinen beruflichen Plänen. Und, dass ich für mehr zu gebrauchen war, als Urinbeutel wechseln. Außerdem ist diese Lösung nur für den Ausgleich des Flüssigkeitsverlustes gedacht und enthält lediglich Elektrolyte in der gleichen Konzentration wie das menschliche Blut. Darüberhinaus kannte ich die Handgriffe dafür bereits nach ein paar Tagen wie im Schlaf.
„Hallo General!“, grüßte ich mit militärischen Tonfall beim Betreten des Zimmers und knallte gekünstelt die Hacken zusammen.
Arthur Weinert war zwar kein wirklicher General, aber irgendjemand hatte ihm den Spitznamen MacArthur verpasst. Genau wie der legendäre amerikanische Befehlshaber aus dem Zweiten Weltkrieg. Nur leider musste unserem aufgrund eines Tumors ein Großteil des Darms entfernt werden.
„Hallo Soldat“, grüßte er augenzwinkernd zurück.
Sein Zustand hatte sich soweit stabilisiert, dass er schon morgen auf eine normale Station verlegt werden sollte.
„Ich schmeiß eine neue Runde“, kündigte ich übertrieben großspurig an und zog eine neue Flasche aus dem Wärmefach.
Dann stoppte ich die Dosierpumpe, schloss den Dreiwegehahn an seinem Venenkatheter und wechselte die Infusion. Gerade als ich den Infusiomat wieder startete, kreischte Sophie hinter mir auf.
„Scheiße!“, stieß sie erschrocken hervor und schlug die Hände vor das Gesicht. „Ich bin eine Idiotin. Wenn das rauskommt gibt’s richtig Ärger. Noch hast du ja keinen Doktortitel.“ Sophie holte tief Luft. „Und sorry, aber du bist ja noch nicht mal Krankenpfleger.“
„Hey…“, versuchte ich sie zu beruhigen, „das ist doch nur eine Elektrolytlösung.“
„Elektrolytlösung, Elektrolytlösung“, äffte sie mich wütend nach. „Erlenmeyer versteht da keinen Spaß.“
„Alexander hat alles abgestellt und die neue ordentlich angeschlossen“, mischte sich jetzt MacArthur ein. „Da können sich selbst die Jungspunde von Assistenzärzten noch eine Scheibe abschneiden.“ „Die finden bei mir ja nicht einmal eine Vene“, fügte er hinzu und präsentierte seinen linken Unterarm, auf dem das bläuliche Adergeflecht deutlich zu sehen war.
Sophies Blick schoss aufgeregt zwischen MacArthur und mir hin und her. Sie war echt hübsch und ich konnte nur mit Mühe der Versuchung widerstehen, sie tröstend in den Arm zu nehmen.
„Apropos Vene“, fuhr ich um Ablenkung bemüht fort und deutete auf den transparenten Verband. „Die Punktionsstelle sieht irgendwie gerötet aus. Ich glaube der Katheter sollte gewechselt werden.“
„Ich fasse es nicht“, murmelte Sophie, während sie das Pflaster inspizierte.
„Was fasst du nicht?“
Wir schossen gleichzeitig herum.
In der Tür lehnte Martin Scholz, der Oberarzt, und warf Sophie einen fragenden Blick zu. Er war ein recht umgänglicher Typ und mit allen Schwestern und Pflegern per Du. Nur eben nicht mit mir.
„Alexander hat beim Anschließen der Infusion festgestellt, dass die Einstichstelle ein bisschen entzündet ist und der Katheter gewechselt werden sollte“, platzte es aus MacArthur heraus.
Sophie sah aus als bekäme sie gleich einen epileptischen Anfall, während sie sich haltsuchend mit hochrotem Kopf am Verbandswagen festklammerte. Doch Scholz tat so, als sei meine Aktion die normalste Sache der Welt. Mit einer lässigen Geste zog er ein Stauband von einem Edelstahltablett. Dann ließ er es fordernd vor meinem Gesicht hin und her baumeln.
„Wie ich gehört habe, Bergmann, werden wir wahrscheinlich früher oder später Kollegen“, stellte er wohlwollend fest.
„Wenn es nach der Zentralen Vergabestelle geht, eher später“, gab ich ein bisschen resigniert zurück.
„Das sind Idioten“, fuhr Scholz fort und wedelte weiter mit dem Band. „Jetzt zeigen Sie mal, was Sie drauf haben!“
Bereitwillig drückte MacArthur seine Ellenbeuge durch, während es aus Sophies Richtung so klang, als würde sie gleich ersticken.
Vorsichtig nahm ich Scholz das Stauband aus der Hand und schlang es anschließend um den vorgestreckten Unterarm. Theoretisch kannte ich ja den Ablauf. Aber meine praktische Erfahrung beschränkte sich auf die Venen meiner Kumpels, die ich mit ein paar Bier überredet hatte, Versuchsobjekte zu spielen.
Die riesige Welle, die mich gerade überrollte, glich einer heißen Sauna. In Sekunden war ich schweißgebadet und das nervige Gefiepe der Überwachungsgeräte steigerte sich in meinen Ohren zur Lautstärke eines startenden Düsenjets. Genauso gut hätte Scholz mich auffordern können, vor der gesamten Ärzteschaft einen Vortrag zu halten.
„Mein Arm platzt gleich“, erinnerte mich MacArthur grinsend.
„Sorry“, murmelte ich aufgeregt zurück.
Dann besprühte ich seinen Arm großzügig mit Desinfektionsmittel und zog vorsichtig eine große Verweilkanüle aus ihrer sterilen Verpackung.
„Welche nehmen Sie, Bergmann?“, flüsterte Scholz dicht hinter mir.
„Die Cephalica“, antwortete ich jetzt ein wenig entspannter und deutete auf die große Ader, die sich vom Daumen her über die Außenseite von MacArthurs Unterarm zog.
„Und warum?“
„Man erreicht hier relativ hohe Durchflussraten und der Patient wird durch die Gelenkferne nicht in seiner Bewegung eingeschränkt“, flüsterte ich jetzt ebenfalls und versuchte meine Nervosität hinunterzuschlucken.
„Sehr gut“, stellte Scholz fest, während ich mit zusammengekniffenen Augen und angehaltenem Atem die ledrige Haut durchbohrte.
Doch bevor ich bewusstlos nach hinten kippen konnte, füllte sich die Kontrollkammer doch tatsächlich mit Blut und flutete so meinen Körper mit einer unbeschreiblichen Euphorie. Ich sah mich bereits in einer Reihe mit Christiaan Barnard, der seinerzeit in Kapstadt das erste Herz transplantierte, und plötzlich war meine Anspannung wie weggeblasen.
„Und warum bewerben Sie sich nicht einfach im Ausland?“, wollte Scholz wissen, ohne auf meine erfolgreiche Punktion einzugehen.
„Mir geht es nicht schlecht“, stellte ich immer noch ein bisschen zitternd fest, „aber ich bin kein Millionär.“
„Es gibt Stipendien“, entgegnete Scholz.
„Hmmm …“, murmelte ich nachdenklich, während ich den Katheter fixierte. „Und an welches Land haben Sie dabei gedacht?“
„Natürlich an die Staaten“, antwortete Scholz wie aus der Pistole geschossen. „Wenn Sie erst einmal die Auswahljury von sich überzeugt haben, dann sind die Amis mit Stipendien sehr großzügig.“
„Und hätten Sie da auch einen heißen Tipp für mich?“, hakte ich ein bisschen vorlaut nach, weil ich von meinem Erfolgserlebnis noch völlig benebelt war.
„Gehen Sie doch nach Yale!“, gab Scholz in einen selbstverständlichen Tonfall zurück.
„Genau, Yale“, schloss sich auch MacArthur an und stupste mich in die Seite.
„Kann ich jetzt schon ein Autogramm haben“, kicherte Sophie aus dem Hintergrund, während sie beide Daumen nach oben streckte.
Plötzlich begann sich das Zimmer zu drehen. An so etwas hatte ich bisher noch nicht einmal im Traum gedacht. Doch jetzt, da Scholz es so leichthin ausgesprochen hatte, erschien diese Möglichkeit plötzlich äußerst real.
„Yale …?!“, krächzte ich. „Ist das Ihr Ernst?“
„Yale oder irgendeine andere von den Ivys“, bestätigte er ohne ein Anzeichen, dass er scherzte. „Das Einzige, was passieren kann, ist, dass Sie abgelehnt werden.
„Was sind Ivys?“, wollte Sophie verständlicherweise wissen.
„Acht Elite-Unis in Neuengland“, antwortete Scholz und legte sich nachdenklich den Finger auf den Mund. „Harvard, Princeton, Cornell, Columbia und natürlich Yale.“ Er machte eine kurze Pause. „Die anderen drei fallen mir gerade nicht mehr ein“, fügte er hinzu. „Und sie werden Ivys, oder richtiger Ivy League, genannt, weil die alten Gebäude mit Efeu bewachen sind und sie ursprünglich zu einer Liga des Hochschulsports gehörten.“
„Und da kann man sich einfach so bewerben?“, hakte Sophie nach.
„Natürlich“, bestätigte Scholz. „Dort ist man immer auf der Suche nach dem nächsten Bill Gates oder …“ Er zwinkerte mir zu. „… Robert Koch.“
„Aha …“, murmelte ich ungläubig.
„Sie sollten auf jeden Fall zweigleisig fahren und hier ebenfalls am Ball bleiben, denn so schnell wird das nicht gehen“, dämpfte Scholz meine Erwartungen. „Bevor sie überhaupt in die engere Wahl kommen, müssen Sie sich förmlich nackig machen.“ Er grinste. „Die Auswahlkommissionen wollen Visionen …“
„Das klingt ja ganz so, als hätten Sie das schon selbst probiert“, unterbrach MacArthur den Oberarzt.
„Wenn man jung ist, dann kommen einem die verrücktesten Ideen“, stellte Scholz lakonisch fest. „Und wie gesagt, Bergmann, Sie brauchen irgendetwas womit Sie aus der Masse Sie herausstechen oder eine durchgeknallte Geschichte.“
„Ich habe einmal bei einem überfahrenen Hund das Herz freipräpariert…“, begann ich vorsichtig.
Sophie verzog das Gesicht, als hätte sie in eine Zitrone gebissen, und Scholz verschluckte sich fast an seiner Zunge.
„… dann habe ich mit dünnen Silikonschläuchen, verdünntem Johannisbeersirup und einem kleinen Messbecher das Schlagvolumen ermittelt“, fuhr ich fort. „Da war ich allerdings noch jünger“, fügte ich entschuldigend hinzu.
„Warum der Sirup?“, wollte Scholz interessiert wissen, als er wieder normal atmen konnte.
„Wegen der Viskosität“, klärte sich ihn auf.
„Verstehe …“ Scholz nickte abwesend. „Und wie ist die Blutviskosität bei Hunden?“
„So genau weiß ich das auch nicht“, musste ich eingestehen. „Da habe ich einfach die, eines gesunden Menschen angenommen. Also vier Komma fünf, im Vergleich zu Wasser.“
„Wenn Sie nicht spätestens an Ihrem nächsten freien Tag mit der Zusammenstellung Ihrer Bewerbungsunterlagen beginnen, dann trete ich Ihnen in den Hintern“, kündigte Scholz mit ernster Mine an, während er einen prüfenden Blick auf MacArthurs Überwachungsmonitor warf.
„Ich bin übrigens Martin“, fügte er grinsend hinzu.
-2-
„Also Yale“, stellte Marlene pragmatisch fest, nachdem ich ihr von meinem Gespräch mit Scholz berichtet hatte.
Sie stand vor der großen Terrassentür, die in den etwas heruntergekommenen Garten führte, und beobachtete wie unser Nachbar seinen Rasen golfplatzkurz trimmte. Sein Grundstück entsprach schon eher dem, was man in der Nähe zum Hubertussee von einer Immobilie erwartete.
Bis zum Tod unserer Mutter hatte es mein Vater ebenso gehandhabt, doch danach irgendwie das Interesse daran verloren. Und auch ich wollte damals, neben Schule und wilden Partys, nicht allzu viel Zeit für die aufwendige Pflege aufbringen. Also mutierte das pittoreske Häuschen aus den Anfängen des zwanzigsten Jahrhunderts langsam zu einem verwunschenen Märchenschloss, hinter dessen verwilderten Büschen die Nachbarskinder Feen und Elfen vermuteten.
„Du gibst dich ja wirklich nicht mit Kleinigkeiten zufrieden“, fügte sie hinzu, während sie sich zu mir umdrehte.
Marlene war, wie ich, recht hoch gewachsen und hatte etwas Vornehmes an sich. Etwas, das alle anderen verstummen ließ, wenn sie einen Raum betrat, und mich als kleinen Jungen davon überzeugte, dass sie eine Prinzessin war.
Allerdings trug sie jetzt einen Schlabbershirt und zu große Knuddelsocken.
„Na ja …“, gab ich ein wenig skeptisch zurück. „Es ist ja zumindest eine theoretische Möglichkeit.“
„Du bist ein Idiot, Alex, weißt du das?!“, fuhr sie fort.
Marlene entschwebte in Richtung Küche und tauchte kurz darauf mit zwei Flaschen Radeberger wieder auf.
„Ich dachte, das mit diesem Underdog-Ding und deiner infantilen Opposition gegen den Industriekapitalismus hast du hinter dir gelassen.“ Sie grinste überheblich, während sie mir das Bier in die Hand drückte. „Du kannst natürlich auch gerne dein Smartphone wegwerfen, irgendwo in den Wald ziehen und dich von Wurzeln und Quellwasser ernähren“, bot sie an und riss demonstrativ meine Flasche wieder an sich.
„Hoffentlich wirst du bei deiner nächsten Mission von einem Löwen gefressen“, witzelte ich, bevor ich mir mein Bier zurückeroberte und einen großen Schluck trank. „Du warst doch früher auch immer irgendwie anti“, erinnerte ich Marlene an ihre Sturm-und-Drang-Zeit. „Anti-Atomkraft, Anti-Massentierhaltung … Hauptsache anti.“
„Tja …“, musste sie eingestehen, nachdem sie sich ebenfalls einen Zug genehmigte, „irgendwann wird jeder mal erwachsen.“ „Und nur der Zweig, der sich im Sturme biegt, wird nicht brechen.“
Ich sparte mir einen deftigen Kommentar zu Marlenes Spruch, denn mit ihrer Wortgewandtheit konnte ich es noch lange nicht aufnehmen. Sie klaute sich bei ihren Gegnern einfach die Argumente, bastelte sie für ihre Zwecke um und schoss sie zurück.
„Du hast ja recht“, gab ich schließlich zu. „Aber gesetzt dem Fall, das sollte wirklich klappen, dann wird erwartet, dass man ständig nobelpreisverdächtiges Zeug von sich gibt.“
„Das ist doch totaler Schwachsinn“, konterte Marlene. „Du hast doch nur Schiss, dass du es wirklich schaffen könntest. Die haben da jedes Jahr hunderte Absolventen. Glaubst du ernsthaft, dass da jeder ein zweiter Bill Clinton wird?“
„Natürlich nicht“, musste ich eingestehen. „Aber Yale, das klingt irgendwie ganz schön versnobt.“
„… könnte dir aber jede Menge Türen öffnen“, ergänzte Marlene. „Du weißt ja noch gar nicht, in welche Richtung du dich entwickelst.“
Sie hatte inzwischen ihr Notebook hervorgekramt und scrollte sich durch eine Liste der amerikanischen Elite-Unis.
„Und wenn dir der Name zu großspurig ist, wie wäre es denn dann mit …“ Sie zögerte kurz. „… okay, die Cornell könnte man noch kennen. Aber sagt dir Dartmouth oder Brown irgendwas.“
„Nö“, musste ich ehrlicherweise zugeben.
„Ich bin echt enttäuscht“, kicherte Marlene, dann kippte sie den Rest ihres Radeberger hinunter. „Die akademische Hoffnung unserer Familie hat noch nie etwas von Dartmouth und Brown gehört ….“
„Du bist dämlich“, unterbrach ich meine Schwester gespielt beleidigt, während sie auf ihrer Tastatur herumhämmerte.
„… und dabei haben alle Unis echt gute Sport-Teams“, fuhr sie fort. „Einschließlich Schwimmen“, flüsterte sie anschließend geheimnisvoll und drehte ihr Notebook mit einer übertriebenen Geste zu mir herum. „Ich könnte mir gut vorstellen, dass die deine Hundert-Meter-Zeit von den Socken haut.“
„Die schwimmen aber hundert Yards“, stellte ich nach einem Blick auf den Monitor fest. „Das sind knapp zweiundneunzig Meter.“
„Ich weiß, wie viel hundert Yards in Meter sind“, gab Marlene pikiert zurück. Dann murmelte sie laut vor sich hin, klickte anschließend auf eine Tabelle und tippte triumphieren auf das Display. „Hier …“, ihr Fingernagel klackte aufgeregt auf das Plastik, „… du hättest mit deiner Zeit diesen Princeton-Typ glatt vom Treppchen gekickt.“
„Ich will aber nicht …“, versuchte ich meine Bedenken zu äußern.
„Hallo!“ Marlene klopfte mir demonstrativ gegen die Stirn. „Du musst immer nehmen, was du kriegen kannst, sonst kommst du irgendwann unter die Räder.“ „Vielleicht solltest du deine Zeiten nicht gleich auf der ersten Seite erwähnen, aber irgendwie unauffällig einbauen würde ich das schon“, riet sie mir mit stolz geschwellter Brust.
„Deine Tricks waren auch schon mal subtiler“, wies ich Marlene auf das Offensichtliche hin. „Du willst doch nur mit mir angeben oder brauchst jemanden, der aufgrund seiner Verbindungen mehr Fördertöpfe für deine Projekte anzapfen kann.“
Marlene verdrehte ertappt ihre Augen. „An meiner Taktik sollte ich wirklich arbeiten“, gab sie grinsend zu.
„Wie geht es eigentlich Papa?“, wechselte ich abrupt das Thema, weil ich ihn heute noch nicht gesehen hatte und seine Demenz schneller voranschritt, als ich anfangs geglaubt hatte.
„Nicht so gut“, stellte meine Schwester betrübt fest. „Wir waren zwar über eine Stunde spazieren, aber als ich ihn zu einem Kartenspiel überreden wollte, hat er mir seinen Tee ins Gesicht geschüttet.“ Sie tupfte sich mit ihrem überlangen Ärmel eine Träne aus den Augen. „Dann hat er bis vorhin vor dem Fernseher gesessen und wollte schließlich ins Bett.“
Ich legte ihr mitfühlend meine Hand auf die Schulter und zog sie an mich. „Er kann nichts dafür, das ist diese heimtückische Krankheit.“
„Ich weiß“, schluchzte Marlene. Dann schob sie sich tapfer von mir weg. „Da habe ich schon ganz andere Sachen hinbekommen“, stellte sie trotzig fest.
Ich hoffte inständig, dass sie sich da nicht täuschte.
-3-
Eines kann man von einem Geheimnis sehr wohl behaupten: Sobald zwei Personen davon wissen, ist es keins mehr. Aber als gemeiner Verräter kam eigentlich nur MacArthur infrage. Doch der hatte sich am Morgen nach meiner letzten Schicht in Richtung Viszeralchirurgie aus dem Staub gemacht.
Dafür hatten fast alle anderen einen Heidenspaß daran, mit mir zwischen zwei Bettpfannen lustiges Diagnoseraten zu spielen. Kaum tauchte ich für einen Schluck Kaffee im Stationszimmer auf, hielt mir irgendjemand einen Laborbefund unter die Nase und wollte anhand der Werte wissen, was der Patient wohl haben könnte.
Während die veränderte Anzahl der roten und weißen Blutkörperchen auf alles Mögliche hinweisen kann, sieht es mit speziellen Markern schon anders aus. So wird zum Beispiel das kardiale Troponin nur nach einem Herzinfarkt freigesetzt.
Trotzdem lag ich mit meinen Tipps, auch wenn es oft nur Nebendiagnosen waren, meist richtig, verdarb dadurch einigen die Lust an den Spielchen und lernte jede Menge. Selbst Martin, mit dem ich ja inzwischen per Du war, hatte sichtlich Mühe, mich aus der Reserve zu locken.
„Hey Alex“, raunte er eines Tages geheimnisvoll, während ich mir die Kanne von der Warmhalteplatte der Kaffeemaschine angelte. „Guck mal!“
Auch ohne genau hinzusehen, war auf dem Monitor das Röntgenbild eines Bauchraums unverkennbar. Ich füllte mir deshalb meinen Becher langsam mit dem schalen Gebräu und bot Sophie und Eduard, unserem Stationsältesten, ebenfalls etwas von der lauwarmen Brühe an.
Während Sophie mit zusammengekniffenen Lippen zustimmend nickte, schüttelte Eduard etwas seltsam den Kopf. Martin hatte sicher irgendwo eine schräge Aufnahme aufgetrieben und wollte mich jetzt testen.
„Ein typischer Fall von retrograder Peristaltik“, stellte ich nach ungefähr zehn Sekunden fest.
„Hä …?“, stieß er verwirrt hervor.
„Na ja …“ Ich suchte krampfhaft nach einem medizinischen Fachausdruck der das Ganze irgendwie beschrieb.
Doch ich fand keinen.
„Bei dem Patient scheint die Verdauung andersherum zu verlaufen“, fuhr ich schließlich grinsend fort. „Warum sollte sich sonst jemand eine Gurke in das Arschloch schieben?“
Martin hieb lachend auf den Schreibtisch, so dass die Tastatur einen Satz nach vorn machte, und Sophie schoss der kalte Kaffee ihres letzten Schlucks durch die Nase. Gleichzeitig versuchte Eduard mit seinem Kopf den Medikamentenschrank einzuschlagen. Das Stationszimmer wirkte mit einem Mal wie ein Therapieraum in der geschlossenen Psychiatrie.
Bis es schlagartig mucksmäuschenstill wurde.
„Es ist sehr schön, dass hier alle so viel Spaß bei der Arbeit haben“, tönte Professor Erlenmeyers sonorer Bass aus Richtung Tür.
Verschämt zog Sophie ein Stück Zellstoff aus einem Spender und putzte sich damit umständlich die Nase. Eduard hatte plötzlich eine Packung Betablocker in der Hand, deren Inhalt sehr interessant zu sein schien. Nur Martin schaffte es nicht rechtzeitig, das Röntgenbild wegzuklicken.
In chefärztlicher Würde drehte Erlenmeyer eine Runde durch das Stationszimmer, warf einen kurzen Blick auf den Monitor und baute sich anschließend vor dem Schreibtisch auf.
In Erwartung eines mächtigen Anschisses zogen wir gleichzeitig die Köpfe ein.
„Nachdem sich alle Anwesenden durch einen Blick in ihre Ausweise davon überzeugt haben, dass sie erwachsen sind“, fuhr Erlenmeyer verdächtig ruhig fort, „können Sie sich hoffentlich wieder um die Patienten kümmern.“
Sophie und Eduard sprinteten auf den Gang hinaus, als wäre Feueralarm ausgelöst worden, und der Bürostuhl, auf dem Martin eben noch gesessen hatte, drehte sich verlassen vor dem Rechner.
Hoffentlich musste ich das nicht allein ausbaden! Aber eigentlich hatte ich mir ja nichts vorzuwerfen. Schließlich hatte ich ja nur ein Röntgenbild etwas frei interpretiert. Trotzdem zog ich vorsichtshalber ein säuerliches Gesicht und schlürfte bedächtig an meinem kalten Kaffee.
„Kommen Sie mit, Bergmann!“, kommandierte Erlenmeyer.
Er machte auf dem Absatz kehrt und stürmte mit wehendem Kittel in Richtung seines Dienstzimmers davon, so dass ich Mühe hatte, Schritt zu halten. Zumal ich mich noch an einem Besuchergrüppchen, das von unserer jüngsten Assistenzärztin eskortiert wurde, vorbeidrängeln musste. Ohne Personalbegleitung durfte natürlich niemand einfach auf der Intensivstation herumrennen.
„Nehmen Sie Platz“, forderte der Professor, als wir sein Refugium betraten. Er deutete überschwänglich mit der Hand auf die bequemen Stühle, die um einen kleinen Konferenztisch gruppiert waren.
Ich war noch nicht dazu gekommen, meinen leeren Kaffeebecher loszuwerden, und schob ihn deshalb behutsam auf die polierte Tischplatte. Erlenmeyer warf einen kurzen Blick hinein und machte sich anschließend an einem italienischen Hightech-Gerät zu schaffen, das auf einem kleinen Barschrank thronte. Innerhalb von Sekunden verströmte es einen wunderbaren Duft, der mich über das Gebräu aus dem Stationszimmer nur müde lächeln ließ. Und wenig später stand ein frisch gebrühtes Tässchen Espresso vor mir.
„Danke“, murmelte ich eingeschüchtert. Dass der Chefarzt den Kaffee höchstpersönlich servierte, konnte nur bedeuten, dass die eigene Hinrichtung unmittelbar bevorstand.
„Wenn man von dieser Entgleisung, die Ihrem Berufswunsch so gar nicht entspricht, einmal absieht, werden wir Sie hier echt vermissen“, stellte Erlenmeyer fest.
Er ließ sich in seinen Chefsessel fallen, öffnete die oberste Schublade seines Schreibtisches und zog eine Dokumentenmappe heraus. Dann schob er sie feierlich über den Tisch.
Vorsichtig zog ich sie an mich heran. Die Mappe bestand aus marmoriertem Karton, in den das Logo der Klinik eingeprägt war. Ein Todesurteil sah eindeutig anders aus!
Nachdem ich die darin befindlichen Seiten überflogen hatte, kippte ich meinen Espresso, der inzwischen etwas abgekühlt war, in einem Zug hinunter. Selbstreflexion war zwar noch nie meine Stärke, aber sollte der junge Mann, der darin charakterisiert wurde, tatsächlich ich sein? In dem Empfehlungsschreiben kam Erlenmeyer zu dem Schluss, dass sich jede Universität der Welt glücklich schätzen könnte, mich unter ihren Studenten zu haben.
„Ähhh … Herr Professor“, stammelte ich ungläubig, „also ich … ich weiß jetzt auch nicht was sich dazu sagen soll.“
„Ein einfaches Danke würde schon reichen“, gab Erlenmeyer in einem großzügigen Tonfall zurück.
Ich sprang auf und ergriff über den Tisch hinweg seine rechte Hand. „Danke, vielen Dank“, stieß ich überwältigt hervor.
„Schon gut, Bergmann“, wiegelte Erlenmeyer nach einer halben Minute Händeschütteln ab. „Ich habe mir das ja nicht aus den Fingern gesogen, sondern nur Ihre Arbeit und Ihren Wissensdurst ein wenig in Worte gefasst.“ Er machte eine kurze Pause. „Aber ich glaube, Sie haben etwas übersehen.“
„Übersehen …?“, ich blätterte ratlos in der Mappe, bis ich auf einen Zettel mit einer Telefonnummer stieß.
„Das ist die Nummer eines Kollegen an der Charité“, klärte mich Erlenmeyer auf. „Er ist ein Alumnus der Universität, an der Sie sich bewerben wollen, und würde Sie gern kennenlernen.“
Völlig benebelt torkelte ich über den Gang und stieß vor dem Stationszimmer fast mit einem hakennasigen jungen Mann zusammen. Er gehörte zu dem Besuchergrüppchen, an dem ich mich vorhin auf dem Weg zu Erlenmeyers Dienstzimmer vorbeigedrängelt hatte. Über sein Gesicht huschte ein erschrockenes Lächeln, dann schoss sein Blick den Gang auf und ab. Es schien ihm offensichtlich nicht gut zu gehen. Das rhythmische Zischen der Beatmungsmaschinen konnte auf Außenstehende schon sehr einschüchternd wirken.
„Kann ich Ihnen helfen?“, wollte ich deshalb freundlich wissen.
„Ich suche das Klo“, bestätigte er meine Annahme, während seine beeindruckenden Oberarme nervös zuckten.
„Ganz hinten links“, wies ich ihm den Weg. „Zu wem gehören Sie denn eigentlich, zu dem Mesenterialinfarkt?“
Der junge Mann nickte stumm, dann hastete er in die angegebene Richtung davon.
„Los, Feierabend! Die anderen sind schon weg.“ Sophie knuffte mich in den Rücken. „Was wollte denn Erlenmeyer von dir?“
„Der hat mir ein super Empfehlungsschreiben gegeben“, antwortete ich übertrieben stolz und schwenkte triumphierend die Mappe. „Jetzt muss ich nur noch ein paar Essays schreiben und eine Million Tests bestehen …“, ich ahmte mit meinen Händen ein startendes Flugzeug nach, „… dann kann es losgehen!“
„Wow!“, murmelte sie anerkennend.
„Wie ich sehe, ist dein Kopf noch drauf“, stellte Eduard fest. Er hatte sich von hinten angeschlichen und drängelte sich zwischen uns.
„Alex hat vom Prof eine spitzenmäßige Beurteilung bekommen“, klärte sie ihn auf, bevor sie mir zuzwinkerte. „Ich glaube, das sollte gefeiert werden.“
„Aber logisch“, stimmte ich Sophie zu.
Wenn es ums Feiern geht, dann rangiert medizinisches Personal unangefochten auf Platz eins. Noch vor Heavy-Metal-Bands und finnischen Holzfällern. Deshalb verschwand ich kurz im Stationszimmer, um den Dienstplan zu checken.
„Nächste Woche Donnerstag klappt’s bei den meisten“, ließ ich die beiden anschließend wissen.
„Also ich könnte jetzt schon was vertragen“, forderte Sophie mit einem übertriebenen Augenklimpern.
„Warum nicht“, ging ich auf ihren Vorschlag ein, „wir treffen uns dann gleich in der Tonne.“
Die Kneipe hieß zwar nicht wirklich „Tonne“, wurde aber von allen so genannt, weil über dem Eingang in riesiges Fass aus der Fassade ragte. Außerdem lag sie nur ein paar hundert Meter von der Klinik entfernt, bot preiswerte Gerichte an und hatte bis weit nach Mitternacht geöffnet. Also perfekte Voraussetzungen für einen Absacker – nicht nur nach dem Spätdienst.
„Sorry, Leute“, gab Eduard bedauernd zurück, „aber ich muss zur Physio.“ Er ließ demonstrativ seine Schultern kreisen. „Aber ein anderes Mal gerne.“
Ich hatte irgendwie den Eindruck, dass das Sophie gar nicht so unrecht war.
„Na dann eben nur wir zwei“, stellte sie fest und hob sofort entschuldigend die Hände. „Also nur wenn du magst.“
„Klar“, antwortete ich so gleichmütig wie möglich.
Sie hatte vor einigen Wochen mit ihrem Freund Schluss gemacht und sich danach, als Zeichen ihres neuen Status, eine kleine Veränderung gegönnt. Jetzt waren ihre Haare auf der rechten Seite rappelkurz und der Rest auf die linke frisiert, so dass man ihre ausgefallenen Ohrpiercings bewundern konnte. Zwar war Sophie ein paar Jahre älter als ich, aber genau der Typ Frau, an der ich mir mit Freude die Finger verbrennen würde. Nur hatte sich bis jetzt keine richtige Gelegenheit ergeben. Und so einfach mit der Tür ins Haus fallen, wollte ich nicht wirklich.
Wie immer musste ich warten. Als erster herbstlicher Vorbote fuhr eine heftige Böe über den Parkplatz der Klinik und rüttelte heftig an den Bäumen. Obwohl ich noch reichlich Zeit für die Zusammenstellung meiner Bewerbungsunterlagen hatte, würde ich trotzdem Gas geben müssen. Neben zwei Essays, in denen ich die Gründe für meine Bewerbung und meine Visionen darlegen sollte, warteten noch drei unterschiedliche Eignungstests und einer der englischen Sprache auf mich.
„So, fertig“, hörte ich Sophie hinter mir.
Ich drehte mich herum und musterte kurz meine hübsche Kollegin. Sie trug über ihrem Shirt eine leichte Jacke, knackige Jeans und flache Stiefel, die so aussahen als wollte sie sich gleich auf ein Pferd schwingen.
„Die paar Meter laufen wir doch, oder?“, fuhr Sophie fort.
Ohne meine Antwort abzuwarten, hakte sie sich bei mir unter und wollte mich wegziehen. Doch mein Interesse galt inzwischen dem jungen Mann, mit dem ich vorhin vor dem Stationszimmer fast zusammengestoßen wäre.
Er überquerte im Zickzack den Parkplatz und schien sein Auto zu suchen. Offensichtlich passierte so etwas auch meinen Geschlechtsgenossen und nicht nur meiner Schwester. Aber als plötzlich in der gegenüberliegenden Reihe die Blinker von Sophies kleinem Beetle aufleuchteten, wurde mir klar, was hier gerade ablief. Der Arsch hatte auf der Station ihren Schlüssel mitgehen lassen und wollte das schicke Cabrio jetzt klauen. Ohne eine Erklärung sprintete ich los.
Gerade als der Typ die Fahrertür öffnen wollte, war ich hinter ihm.
„An deiner Stelle würde ich das nicht tun“, versuchte ich es mit einer gewaltfreien Lösung.
Doch er wirbelte herum und versuchte, mir aus der Drehung heraus eins zu verpassen. Natürlich war ich inzwischen instinktiv zurückgewichen, so dass sein Schlag ins Leere ging und er sich um die eigene Achse drehte. Wutentbrannt riss er sich seine Jacke herunter, ließ kurz drohend die Brustmuskeln spielen und ging sehr professionell zum Angriff über.
Zum Glück verfügte ich über äußerst gute Reflexe. Eine Hundertstelsekunde zu lang auf dem Startblock entscheidet oft über Sieg oder Niederlage. Außerdem war das Krafttraining im Verein auch nicht zu verachten.
Bevor er einen Treffer landen konnte, krachte meine Faust auf seine Nase und schickte ihn in einem roten Sprühnebel zu Boden. Aber noch ehe ich meinen Sieg genießen konnte, kamen hastige Schritte hinter mir schnell näher.
In Erwartung eines Komplizen schoss ich herum.
„Ich ruf die Bullen“, keuchte stattdessen Sophie aufgeregt.
Sie hatte bereits ihr Smartphone hervorgekramt und tippte nervös die Nummer ein. Allerdings hatte sich der Typ schon aufgerappelt und stolperte davon.
„Lass gut sein“, riet ich ihr, „die drohen doch eh nur mit dem Zeigefinger und lassen ihn dann laufen.“ Ich schüttelte mein schmerzendes Handgelenk. „Aber die gebrochene Nase merkt er sich bestimmt.“
„Du hast ihm die Nase gebrochen?“ Sophie starrte mich ungläubig an.
„Es hat jedenfalls mächtig geknackt“, grinste ich. „Aber vielleicht kam das auch von mir.“
„Oh … hast du dich verletzt?“, stieß Sophie besorgt hervor und tastete mit ihren weichen Fingern vorsichtig über meine Hand.
„Geht schon“, wiegelte ich ab, weil sich plötzlich ein sehr angenehmes Gefühl in mir breit machte.
Doch Sophie wollte sie nicht hergeben.
Sie hielt sie sich dicht vor die Augen, um die Abschürfung an meinem Knöchel genau zu inspizieren, und es hätte wahrscheinlich nicht viel gefehlt und sie hätte die kleinen Blutstropfen abgeleckt.
„Ähhh …“ Sophie räusperte sich verlegen, als ihr bewusst wurde, was sie gerade tat. „Du bist aber auch schnell …“, fuhr sie um Ablenkung bemüht fort. Dann ließ sie meine Hand zaghaft los. „… und hast einen ganz schönen Schlag drauf. Das hätte ich dir echt nicht zugetraut.“
Ihr Gesicht war inzwischen krebsrot.
„Tja …, hundert Meter Freistil in knapp fünfzig Sekunden schüttelt man eben nicht einfach so aus dem Ärmel“, klärte ich sie auf. „Was sagt denn nun meine behandelnde Ärztin zu dieser bösen, bösen Verletzung?“, witzelte ich, weil mir Sophies Verlegenheit fast schon ein bisschen leid tat.