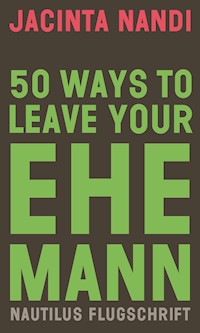Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Nautilus
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Nautilus Flugschrift
- Sprache: Deutsch
Alle wollen über Feminismus reden, über geile, coole Themen, die junge Frauen ansprechen. Über Gender-Pay-Gap zum Beispiel, oder Körperbehaarung. Was nicht geil ist: Hausarbeit. Was niemanden interessiert: die Unterdrückung der Hausfrau. Jacinta Nandi bricht das Schweigen: Sie berichtet über ihre persönlichen Fronterfahrungen in einem Haushalt mit einem Teenager, einem Kleinkind und einem meist abwesenden Mann, der sich weigert zu helfen, schließlich ist seine Partnerin Hausfrau und ja wohl zuständig für Kinder, Küche und Kotze! Sie reflektiert über unbezahlte Care-Arbeit, Armut und Schmutz und klickt sich erschöpft durch die Lifestyle-Welten von Cleanfluencerinnen, sucht Rat in Hausfrauen-Communitys und Überlebenshilfe in Putz-Podcasts. Wütend schreibt Jacinta Nandi gegen die immer noch vorherrschende Rollenverteilung an – und fragt sich, wie um alles in der Welt sie da hineingeraten ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 286
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
JACINTA NANDI wurde 1980 in London geboren und lebt seit 2000 in Berlin. Sie schreibt für die »Wahrheit«-Kolumne der taz und publiziert regelmäßig im Missy Magazine und der Jungle World. Sie war Mitglied der Lesebühnen Rakete 2000 und Die Surfpoeten. Bisher erschienen von ihr die Bücher Deutsch werden: Why German people love playing frisbee with their nana naked (2011), Fish’n’Chips & Spreewaldgurken. Warum Ossis öfter Sex und Engländer mehr Spaß hatten (mit Jakob Hein, 2013) und nichts gegen blasen (2015).
JACINTA NANDI
DIE SCHLECHTESTE
HAUS FRAU
DER WELT
Einzelne Texte aus diesem Buch sind bereits an anderer Stelle veröffentlicht worden: »Dirty Bastards« in Das Magazin und Emma, »Viel seufzen« und »Ein Lob dem Berliner Modell« in der Missy-Magazine-Internetkolumne und »MLM: Eine Alternative« in konkret.
Edition Nautilus GmbH
Schützenstraße 49 a
D - 22761 Hamburg
www.edition-nautilus.de
Alle Rechte vorbehalten
© Edition Nautilus 2020
Umschlaggestaltung:
Maja Bechert, Hamburg
www.majabechert.de
Porträt der Autorin
auf Seite 2: © Flux FM
1. Auflage Oktober 2020
ePub ISBN 978-3-96054-241-4
Dieses Buch ist Rosalie Delaney gewidmet,der zweitschlechtesten Hausfrau der Welt.
Inhalt
Über den Autor
Prolog: fast vierzig – und fast fertig!
Eine feministische Hausfrau
Feierabend
Karrierefrau versus Hausfrau (wie Alien versus Predator)
86.000 Gedanken
Der Schmutz soll drinnen bleiben
Dirty Bastards
Unabhängigkeit
How To Clean A Pushchair
59 Minuten
Viel seufzen!
Der Staubsauger
Wie ich meinen Feminismus outgesourct habe
Mental Load
Die Hausfrau und die Sexarbeiterin
Ausschlafen können
Revolution
Parenting Book Club
Die Lüge von 50/50
Ein Lob dem Berliner Modell
The Washing Machine Diaries
Dirty Bitches
Die Ehre der Mütter
Keine passive Hausarbeit
Zum Putzen zwingen
Die Cleanfluencerinnen erobern die Welt
Deutschlands neueste Cleanfluencerin
#tradwife – Kinder, Küche, Kotze
Mithelfen
Als Pegida-Kevin Zandra trifft
How to cook a fucking duck
Aufräumen ist die Hälfte der Arbeit
Einkaufen
Meal Planning
On a break
Leichter alleine?
The Tiger Who Came to Fucking Tea
Opfermentalität
Die Romantik
MLM: eine Alternative
A woman’s work is never done
Pajama-Party
Wie ich dieses Buch zu Ende geschrieben habe
Prolog: fast vierzig – und fast fertig!
Jacinta Nandi ist fast vierzig – und fast fertig.
Auf dem Papier hat sie ein tolles Leben, auf dem Papier ist sie eine Feministin, freischaffende Künstlerin, freiberufliche Autorin.
Aber ihre alltägliche Realität sieht anders aus.
In der Realität lebt sie zusammen mit einem Kleinkind, das wegen der Kitakrise immer zu Hause ist, mit einem Teenager, der Pfandflaschen und leere Chipstüten im Schlafzimmer sammelt, als ob das sein Hobby sei – und vor allem mit einem Mann, der denkt, dass er nicht putzen muss, soll oder darf.
So könnte der zusammenfassende Text über mein Leben lauten. Mein Leben als Blurb.
»Ich bin ein Wissenschaftler«, sagte mein Freund eines Morgens. »Ich werde nicht staubsaugen, das sage ich dir.«
Okay. Ich entschied, dann eben alles selbst zu machen, so gut ich kann. Und was kann ich tun, um eine gute Hausfrau zu sein?
»Das bisschen Haushalt schaffst du schon«, dachte ich mir. Mit Hilfe von bezahlten Putzkräften bei Helpling und hilfreichen Putztipps von unterschiedlichen Experten bei YouTube versuchte ich, mein Leben – und die Wäscheberge – in den Griff zu kriegen. Ich stand früher und früher auf und machte jeden Morgen die Waschmaschine an, bevor ich Kaffee kochte.
Aber kann man wirklich glücklich sein in einer Beziehung, in der der Mann nicht putzt? Weil das einzige, was er noch ekliger findet als eine schmutzige Küche, die Vorstellung ist, dass er »mit«helfen könnte?
Das Ungewöhnliche an meiner Situation ist nur die Tatsache, dass mein Freund zugibt, dass er nicht vorhat mitzumachen. In vielen deutschen Haushalten existiert der Mythos von einer 50/50-Mitarbeit, gleich aufgeteilt zwischen den Partnern. Was utopisch klingt – und auch echt utopisch bleibt. Denn Studien beweisen, dass sogar berufstätige Mütter 160 Minuten pro Tag Hausarbeit machen – ihre männlichen Partner aber nur 90 Minuten (die Frage ist, ob diese 90 Minuten auch solche Sachen beinhalten wie Gute-Nacht-Geschichte-Vorlesen)!
Eine Studie vom University College London, veröffentlicht im Journal Work, Employment and Study, bewies, dass Frauen im Durchschnitt 16 Stunden pro Woche Hausarbeit machen – ihre männlichen Partner aber nur 6 Stunden. Sogar bei Paaren, wo beide Vollzeit beschäftigt sind, machen die Frauen viel mehr – es ist fünf Mal wahrscheinlicher, dass eine vollzeitbeschäftigte Frau 20 Stunden pro Woche mit Hausarbeit verbringt, als dass ein Mann es tut. 2005 fand eine Studie des University of Michigan Institute for Social Research heraus, dass Männer ihren Frauen sogar 7 Stunden Hausarbeit pro Woche zusätzlich VERURSACHEN! Während Frauen ihren Männern eine Stunde pro Woche abnehmen!
Ich putze also und denke über Hausarbeit nach. Eine Arbeit, die eigentlich nicht als Arbeit gilt. Eine unsichtbare Arbeit. Die Männer gucken nicht hin, wenn man putzt – ihre Augen sind auf den Fernseher gerichtet! Es ist eine Arbeit, die Männer nicht machen wollen, die sie grundsätzlich ablehnen. Sie lehnen sogar die Vorstellung ab, dass Hausarbeit überhaupt gemacht werden muss. Sie finden nicht unbedingt, dass Frauen diese Arbeit machen müssen – aber es ist trotzdem sehr klar, dass sie selbst sie nicht machen werden.
Es ist eine Arbeit, die Frauen unterdrückt. Hausarbeit ist körperliche Arbeit, eine körperliche Arbeit, die viel Zeit kostet. Es ist eine Arbeit, die Frauen Zeit und Schlaf raubt. Eine Arbeit, die ihre Körper belastet, die aber trotzdem nicht als Arbeit angesehen wird, solange sie nicht bezahlt wird!
Denn das Komische ist, dass, wenn man fürs Putzen bezahlt wird, es dann doch Arbeit ist – eine Drecksarbeit, sicher, aber doch Arbeit. Man kriegt einen Stundenlohn – vielleicht ist er nicht angemessen, aber man kriegt Geld dafür, aber noch wichtiger: man hat Feierabend. Das (vielleicht) schlecht bezahlte Hausmädchen kriegt Feierabend – doch die unbezahlte Hausfrau nie!
In dieser Sammlung kurzer, lustiger, aber sehr wütender Texte beschreibe ich meinen Versuch, eine gute Hausfrau zu werden, wie sehr es mich angekotzt hat, alles alleine machen zu müssen – und warum ich gescheitert bin.
Kann man eine Beziehung haben mit einem Mann, der überhaupt nicht putzen will? Ist das überhaupt eine Beziehung? Warum denken Männer offenbar, dass sie nur putzen müssen, wenn sie keine Frau in der Wohnung haben, die das für sie machen sollte? Was ist los mit denen?
Eine feministische Hausfrau
Der Feminismus ist cool.
Der Feminismus ist geil geworden.
Alle wollen über Feminismus reden, über geile, coole Themen, die junge Frauen ansprechen. Über gleiche Bezahlung für die gleiche Arbeit, zum Beispiel, oder Körperbehaarung. So was.
Was nicht geil ist: Hausarbeit. Was niemanden interessiert: die Unterdrückung der Hausfrau.
Frauen wollen befreit werden, Frauen sollen frei sein. Jemand, der sich freiwillig entscheidet, Hausfrau zu werden? Selbst schuld! (Und auch megapeinlich.) Hausfrauen sind fast so uncool wie die Hausarbeit selbst.
Als ich eine Teenagerin war, nannte ich mich Feministin. Mit 14 liebte ich Courtney Love, den roten Lippenstift, die weißblonden Haare, die coolen Posen mit der Gitarre. Ich glaube, ich mochte auch die Lieder – aber der Look war für mich total wichtig, supercool. Ich wollte sein wie sie – ich musste Feministin werden. Ich nannte mich Feministin und ich habe es ernst gemeint. Ich habe Gedichte über Frauen mit dicken Bäuchen gelesen und Gedichte geschrieben über Frauen, die die Toilettenwand mit Menstruationsblut beschmieren. Ich war Feministin. Wie Courtney Love.
Meine Mama war Hausfrau, mein Stiefvater half nie. Na ja, vielleicht ist dieses »nie« übertrieben, vielleicht gehört ein »so gut wie« davor. Einmal pro Monat sollte er kochen, und seine Miene war dann wie in Deutschland bei den Menschen in einer langen Schlange im Postamt am Heiligen Abend. Meine Mama arbeitete am Wochenende im Altersheim – unter der Woche passte sie auf meinen kleinen Bruder auf, der nie zur Kita ging, sondern nur in playgroups, und meine Schwester und ich kamen um 16 Uhr nach Hause. Jahrelang war die Waschmaschine kaputt, unsere Kleidung sammelte meine Mama im Kinderwagen und schob sie zum Waschsalon. Sie verbrachte so viele Stunden in der Woche dort, dass sie jetzt immer noch richtig gut befreundet ist mit der Dame, die da arbeitete.
Meine Mama kämpfte mit der Hausarbeit. Sie war immer am Arbeiten, aber unser Haus sah irgendwie trotzdem immer scheiße aus. Andere Kinder hatten beige Sofas, flauschige Teppiche, gekehrte Böden. Bei uns war immer Chaos – meine Mama versank in der Arbeit, ertrank in ihren Aufgaben. Und wir halfen nicht.
Ich habe ihr nicht geholfen. Ich half nur dann, wenn sie mich zwang, ich habe sie dafür verachtet, dass sie diese Arbeit schwer fand.
»Das ist eigentlich dein Job«, sagte ich, wenn sie mich bat, die Kartoffeln zu schälen. »Du bist nur eine Hausfrau. Was machst du den ganzen Tag, wenn wir in der Schule sind? Trinkst Kaffee, stimmt’s?«
Ja, die Wut darüber, dass Frauen, die ihr Leben mit unbezahlter Arbeit füllen – Kinderbetreuung, Putzen, Wäsche, Kochen –, manchmal heiße Getränke dabei trinken, ist ziemlich alt. »Coffee Mornings?«, hat mein Stiefpapa immer gesagt. »Latte-Macchiato-Mamas«, lästert der Berliner über die Mamas in Prenzlauer Berg. In London ist es kein Latte, sondern Cappuccino, und nicht Prenzlauer Berg, sondern Primrose Hill – aber die Hausfrau als Genießerin, die nur Kaffee schlürft, diese Idee existiert da auch.
»Sie tut so, als wäre sie eine Yogalehrerin!«, erzählt mir eine Bekannte über eine andere Bekannte. »Eigentlich ist sie Hausfrau. Latte-Macchiato-Mama. Das wäre nichts für mich, so langweilig!«
Ich glaube, es macht die Menschen deswegen wütend, dass die Mütter vom Kollwitzplatz, die Hausfrauen Berlins, Kaffee trinken dürfen – obwohl die Arbeit, die sie machen, kein Geld einbringt, obwohl die Arbeit, die sie machen, keine Lohnarbeit ist –, genau deswegen, weil der Kaffee ein Symbol des Kapitalismus ist. Ein Symbol für Genuss, für Exportwaren, für viel Schaffen. Und diese faulen Frauen, die nichts beitragen zum Kapitalismus, genießen seine Früchte – wie dekadent! Wie unfair!
Für viele ist eine Mutter, die, während sie ihre Kinder betreut, einen Kaffee trinkt, automatisch eine Anti-Feministin – denn sie genießt das »Nicht«-arbeiten-Gehen, das Zu-einemreichen-Mann-Gehören, sie akzeptiert ihr leichtes Leben, ein Leben voller Luxus und Spaß. (Man sollte nicht aus dem Auge verlieren, dass nicht überall auf der Welt die Kitas so subventioniert sind wie hier in Berlin, das heißt, dass in vielen Orten eine Mutter, die nicht arbeiten geht, kein Zeichen von Luxus ist, sondern eine praktische Notlösung.)
Aber vielleicht ist auch ein Grund, ein eher unterbewusster Grund, weshalb die Kaffeeabhängigkeit so vieler junger Mütter die Menschen so zu triggern scheint, nicht nur Neid, sondern auch ein mulmiges Schuldgefühl: Kinder großzuziehen heißt: wenig Schlaf, und wir wissen, dass die männlichen Partner oft ihren eigenen Schlaf besser beschützen, als die Frauen es tun. Die Kinderbetreuung und die Hausarbeit alleine – oder fast alleine – zu schaffen, ohne seelische Unterstützung, erschöpft viele Frauen so sehr, dass sie ohne Kaffee nicht überleben können. Die Notwendigkeit des Kaffees im Alltag junger Mütter: Vielleicht erinnert sie die Gesellschaft an ihre Erschöpfung, an ihre Anstrengung, an ihre Ausbeutung? Und wird deswegen verspottet, denn der Mensch tritt gerne nach unten, oft sogar dann, wenn er glaubt, dass er gerade nach oben zielt.
Feminismus ist cool geworden in Deutschland, und ich freue mich darüber. Aber ein Feminismus, der keine Solidarität mit Hausfrauen hat, ist kein Feminismus. Sogar wenn diese Frauen selbst schuld sind, sogar dann, müssen sie befreit werden. Die Frage ist, wie?
Feierabend
Ich tropfe Lemongrass Essential Oil in eine Flasche Glasreiniger und spritze das Badezimmer voll. Ich habe nämlich gehört, dass Lemongrass gegen ADHS wirken soll. Mein großer Sohn hat eine ADHS-Diagnose, will aber die Pillen nicht nehmen, denn ihm wird davon übel. Er kotzt auf dem Weg in die Schule. Jetzt versuchen wir, sein ADHS mit Ergotherapie zu behandeln, es klappt so, naja, ein bisschen. Schaden tut es nicht. Einmal pro Woche ruft mich eine Lehrkraft aus der Schule an und sagt mir, dass es so nicht weitergeht. Ich tue, was ich kann. Heimlich ätherische Öle überall in der Wohnung verspritzen. Jetzt putze ich den Spiegel. Mein Freund kommt heute nach Hause, er ist gerade zwei Wochen weggewesen.
Ich gucke mein Gesicht im Spiegel an und seufze. Wie ist es dazu gekommen, dass ich, Jacinta Nandi, Missy-Kolumnistin, Feministin, Riotmama, dass ausgerechnet ich aus Versehen in einer Beziehung gelandet bin, in der mein Freund erwartet, dass ich 100% der Hausarbeit und Kinderbetreuung mache? Es ist irgendwie passiert, es ging total leicht, aber ich verstehe immer noch nicht wirklich wie.
Ich putze die Wasserhähne. Habe bei einem Putz-Podcast gehört, dass, wenn die Wasserhähne sauber aussehen, deine ganze Wohnung sauber aussieht. Ich gucke mich noch mal im Spiegel an. Lächele mich an. Mein Freund erwartet nicht nur, dass ich 100% mache, denke ich, sondern auch, dass ich es 100% perfekt mache.
Das Baby wird bald zwei. Es stimmt, seitdem das Baby da ist, habe ich nichts beigetragen zur Miete. Die Stromrechnung habe ich bezahlt und das Telefon, aber eigentlich habe ich nichts bezahlt. Das stimmt. Aber ich habe doch auf das Baby aufgepasst! Hätte ich das nicht gemacht, hätte mein Freund nicht arbeiten gehen dürfen und Geld verdienen können und auch die Miete nicht bezahlt.
Manchmal denke ich, er sollte mich einfach als Putzfrau einstellen. Vielleicht sollte ich ihm eine Rechnung schicken für alles, was ich tue. Vielleicht wäre er glücklicher, würde mich nicht mehr wie eine Last sehen, die ihn nur runterzieht, und ich wäre viel reicher – und ich würde nicht viel mehr putzen müssen als jetzt.
Und manchmal denke ich, so sehr ich den Kleinen auch liebe, wenn ich gewusst hätte, dass mein Freund so viel erwarten und so wenig helfen würde, hätte ich abgetrieben.
Wenn er da ist, sitzt er abends auf dem Sofa und guckt Sport. Oder schwedische Krimis. Manchmal, wenn die Küche sehr schmutzig ist und das Baby sehr müde, bringt er das Baby ins Bett – aber normalerweise mache ich alles, und er sitzt. Er hat Feierabend. Ich habe irgendwie nie Feierabend, wahrscheinlich denkt er, dass das okay ist, weil ich ja irgendwie auch nie Arbeit habe.
Wer ist schuld an meiner Situation? Bin ich schuld? Bin ich wirklich so eine schlechte Hausfrau, wie er immer sagt? Es kommt mir so unfair vor. Warum bin ich die Schmutzige, die Verplante, die Chaotin? Er sitzt auf dem Sofa, guckt fern, spielt mit dem Handy, während ich Wäsche falte – aber weil ich nicht voll Marie-Kondo-mäßig falte, bin ich die Schmutzige, und er, der merkt, dass ich die Kleidung des Babys nicht gut genug gefaltet habe, der Saubere? Kommt euch das fair vor? Mir kommt’s ein bisschen unfair vor. Kommt ihm das fair vor? Manchmal denke ich, dass es ihm fair vorkommen muss! ABER WIE KANN DAS SEIN?
Ich habe nie Feierabend, er hat immer, wenn er in der Wohnung ist, Feierabend. Diese ganze Wohnung ein Abend voller Feier für ihn – und jeder Fleck auf dem Boden, jede Nudelsalatpackung, die er im Wohnzimmer lässt und die ich nicht wegräume, ist ein Zeichen dafür, dass ich als Hausfrau versagt habe. Was ist passiert? Wie konnte das passieren? Es MUSS irgendwie meine Schuld sein.
Oder vielleicht, sagt eine kleine Stimme in meinem Kopf, vielleicht ist es doch nicht meine Schuld. Er wird einfach nie, wirklich nie und nichts in der Wohnung mithelfen und wird das immer rechtfertigen, mit Argumenten und Weisheiten.
»Ich bin so pingelig!«, sagte er neulich, als er bemerkt hatte, dass ich Babykleidung ungefaltet in einen Kasten geschmissen hatte. »Entschuldigung, ich bin Deutscher. Vielleicht ist es in England nicht so wichtig, wie man Kleidung faltet?«
Ich guckte ihn an und sagte nichts. Ich weiß nicht, was die Antwort ist. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Also mache ich weiter. Ich tue das Beste, was ich tun kann. Und ab und zu (normalerweise) schmeiße ich die Babykleidung ungefaltet in die Kiste.
Ryan, der Teenager, kommt ins Badezimmer.
»Kommt Stefan heute Abend nach Hause?«, fragt er. Er hockt auf dem Rand der Badewanne. Ich sortiere meine Shampooflaschen.
»Ja«, sage ich.
»Schade«, sagt er.
»Warum schade?«, frage ich. Ich glaube, ich weiß, warum – ich habe weniger Zeit für ihn dann, und er fühlt sich so vernachlässigt.
»Du kochst besser, wenn er nicht da ist«, sagt er. Ich bin ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. »Du kochst voll gut, wenn er weg ist. Fischstäbchen und Pommes. Eier und Bohnen und Pommes. Burger und Pommes. Fischstäbchen und Bohnen. Bratwurst und Pommes. Bratwurst und Bohnen. Champignons auf Toast. Champignons mit Käse auf Toast. Toast Hawaii. Käse auf Pommes. Wenn Stefan da ist, gibt’s immer irgendwelches Zeug mit Salat.«
»Ich mache für euch auch Salat«, sage ich.
»Gurke schneidest du, für Baby Leo«, sagt er.
»Hast du gehört, wie er Gurke Nane nennt?«, frage ich.
»Wie ein kleiner Ossi«, sagt er. »Er ist im Osten geboren. Oder? Lichtenberg ist Osten?«
Ich nicke. Ryan ist voller Klischees über den Osten, aber weiß nie, wo Osten ist. Neulich hat er mit mir gestritten darüber, ob Potsdam im Osten ist oder nicht. Besserwisser, der es doch nicht immer besser weiß.
»Erinnerst du dich, als du ein kleines Kind warst, du konntest nicht schlafen, und du bist rausgekommen aus deinem Zimmer, und ich habe das Badezimmer geputzt und du meintest: Oh, du putzt das Badezimmer, welche Großeltern besuchen uns morgen?«
Wir lachen bei der Erinnerung.
»Haben uns Großeltern besucht?«, fragt er.
»Nee«, sage ich. »Ich glaube, es war diese schwedische Feministin, erinnerst du dich an sie? Sie hat mich voll geghostet.«
»Riecht lecker hier drin«, sagt er und steht auf.
»Ist gut für dein ADHS!«, rufe ich ihm hinterher.
»Hör auf, mich heimlich mit diesen Ölen heilen zu wollen!«, sagt er. »Das ist nur der Placebo-Effekt, es klappt nur, wenn du mir sagst, dass du es machst.«
Seine Zimmertür knallt zu. Bald muss ich Baby Leo vom Mittagsschlaf aufwecken. Ich gucke mich im Fenster an. Ich sehe okay aus, wenn ich lächele.
»Du machst das toll«, flüstere ich. Ich lächele. »Du machst das okay«, sage ich. »Du machst das voll okay.«
Karrierefrau versus Hausfrau (wie Alien versus Predator)
Ich glaube, niemand denkt, dass ich eine tolle Hausfrau bin – aber die super-duper tollste ambitionierte erfolgreiche Killerkarrierefrau bin ich auch eigentlich nicht, oder? Ich bin nicht mal in die Künstlersozialkasse gekommen! Ich lebe so ein Loserleben, wo ich mal Kleinkünstlerin, mal Englisch-Nachhilfelehrerin bin – ich glaube, das ist der Hauptgrund dafür, weshalb ich die bezahlte Putzkraft nicht als ausgebeutete, unterdrückte Sklavin sehen kann. Weil ich auch keine Rente habe. Weil ich 12 Euro pro Stunde ein ganz gutes Gehalt finde. Weil ich ganz oft 12 Euro pro Stunde für Englischunterricht kriege, weil ich ganz oft nach einem Abend Lesebühne mit 30 Euro oder sogar weniger in der Tasche nach Hause gehe. Eine Karrierefrau sieht anders aus – und wenn ich »anders« sage, meine ich erfolgreicher.
Jahrelang lebte ich vom Englischunterricht. Ich finde vieles an mir peinlich, das aber nicht, wenn ich ehrlich bin. »Ist es dir nicht peinlich, so ein Klischee zu sein?«, fragte mich meine Freundin Diane, die manchmal echt bitchy sein kann. Ich wusste gar nicht, wovon sie redete. Ich hatte angefangen, im Hof von einem Club einer Gruppe Spaniern den Unterschied zwischen I have been sleeping with my boss (eine Affäre, die noch nicht vorbei ist) und I have slept with my boss (ein ONS) zu erklären.
Ich schäme mich nicht dafür, keine tolle Karrierefrau geworden zu sein. Ich werde nicht neidisch, wenn ich die Werdegänge meiner Uni-Kommilitoninnen lese. Es ist okay für mich, so wie es gelaufen ist. Eine Alleinerziehende, eine Hartz-IV-Mama, eine Englischlehrerin, eine Übersetzerin, eine Kleinkünstlerin. Ist okay. Außer, wenn ich an meine Kiddies denke. Dann denke ich: Sie haben unter der Karriere der Mama so gelitten, als ob ich die CEO von MTV wäre oder, was weiß ich, bei der World Bank fest angestellt.
Einmal, es war der 23. Dezember, der letzte Hort-Tag des Jahres. Ich hatte einen Englischkurs um 16 Uhr, was nicht besonders spät ist, oder? Es klingt nicht besonders spät. Aber wir waren um 17.10 fertig, und ich rannte wie verrückt zum U-Bahnhof, und war trotzdem erst 17.55 im Hort. Mein Sohn war damals sieben Jahre alt. Die Schule, der Hort, alles leer. Ein Zettel klebte auf der Tür zum Hortbereich: WIR SIND IM KELLER. Ich rannte runter – ich hatte High Heels an –, das Gebäude leer und leise. Keine Kinder, keine Lehrer, keine Erzieher. Leer und leise war alles. Mein Sohn und der türkische Hausmeister in einem Raum. Der Hausmeister reparierte, mein Sohn reichte ihm ab und zu ein Werkzeug. Mein Sohn, wie er es damals öfters machte, redete pausenlos – ab und zu sagte der Hausmeister »Ja« oder vielleicht »Hammer bitte.«
»Ryan«, flüsterte ich von der Tür und er drehte sich um, sein Gesicht voller Sonne.
»Ich helfe!«, rief er begeistert, und dann ein Moment Panik: »Mama, morgen ist Weihnachten«, als ob ich es vielleicht vergessen hätte.
»Andere Kind sind weg«, sagte der Hausmeister. »Beate wollte nach Haus gehen.«
»Ja«, sagte ich. Es war kein Vorwurf, und trotzdem wollte ich mich verteidigen:
»Die anderen Mütter«, sagte ich unsolidarisch, »sind alle Teilzeit arbeitend als Yogalehrerinnen!« Ich erwähnte nicht, dass ich eine Teilzeit arbeitende Englisch-Nachhilfelehrerin war. Ich war voller Wut und Neid – und Scham.
»Er ist ein guter Junge«, sagte der Hausmeister. »Viel helfen, viel reden.«
Ryan umarmte seinen Hausmeister und rannte weg. Ich kam mir wie eine schlechte Mutter vor. Ich kam mir wie eine Rabenmutter vor.
Warum erzähle ich das alles? Weil ich sonst keine großen Unterschiede merke zwischen Ostfrauen und Westfrauen, aber bei der Reaktion auf diese Geschichte war der Unterschied spürbar.
»Ich hatte so ein schlechtes Gewissen!«, erzählte ich einer westdeutschen Freundin.
»Kann ich gut verstehen!«, antwortete sie sofort. »Du bist keine Karrierefrau, und der Kleine muss nicht zu Weihnachten das letzte Kind im Hort sein, oder? Du solltest versuchen, am letzten Tag vor den Ferien halbtags zu arbeiten.«
»Aber 16 Uhr ist echt nicht spät«, sagte ich, »oder?«
»Er wird bestimmt später seiner Therapeutin davon erzählen!«, lachte sie. Es war einer dieser Witze, die eigentlich nicht lustig sind.
Ich biss nachdenklich auf meiner Unterlippe herum. Wechselte das Thema und dann machte ich eine Umfrage bei meinen deutschen Freundinnen. Und ich entdeckte eine klare Trennung bei Ost- und Westdeutschen, die wie die Chinesische Mauer bestimmt vom Weltall aus gesehen werden könnte. Irgendwie dachten alle Westdeutschen, dass ich »irgendwie« »irgendwas« »besser« »organisieren« hätte sollen – ich weiß nicht genau, was –, während die Ostdeutschen gleichgültig mit den Schultern zuckten und sagten: »So ist das halt, wenn man arbeiten muss und ein Kind hat.«
»Findest du es echt nicht schlimm für ihn?«, fragte ich meine Freundin Steffi, die bei Lush arbeitete.
Sie lächelte: »Nein! Hat der Hausmeister ihn geschlagen oder so was? Ich verstehe die Geschichte nicht ganz. Klingt für mich nach Spaß, unten im Keller, mit den Werkzeugen und so.«
»Er liebt diesen Hausmeister«, gab ich zu.
»Siehste!«, sagte Steffi.
»Wollte ihn zu seinem Kindergeburtstag einladen.«
Steffi nickte.
»Ich denke manchmal«, fuhr ich fort, »dass meine Karriere es nicht rechtfertigt, ihn so viel im Hort zu haben. Ich sollte mehr Geld verdienen, dann wäre dieses Rabenmütterleben zu rechtfertigen.«
Steffi sagte: »Das kann ich nicht nachvollziehen. Du musst es gar nicht rechtfertigen, dass du arbeiten gehst und ein Kind hast. Egal, wie viel du verdienst! Das hat mit Rabenmüttern nichts zu tun! Das ist selbstverständlich.«
Und das ist es auch für die Frauen aus Ostdeutschland, die ich kenne: selbstverständlich. Eine Frau arbeitet, sie muss keine Karriere machen, aber sie arbeitet, auch wenn sie Kinder hat. In der DDR war es gang und gäbe, sein Kind zur Kita zu schicken, ab einem echt jungen Alter, und Hort war auch normal. Dieses Stigma, das wir aus dem englischsprachigen Raum mit Fremdbetreuung assoziieren, ist ihnen tatsächlich fremd. Die Ostfrauen hatten Gleichberechtigung, wenn es darum ging, nach der Geburt wieder arbeiten zu gehen. Allerdings mussten auch sie damals wie heute doppelt arbeiten: zu Hause und außerhalb des Hauses.
Im Vergleich dazu basiert die jetzige Bundesrepublik, so wie die alte Bundesrepublik, darauf, dass eine Frau entweder Hausfrau oder Karrierefrau ist. In den 50ern durfte eine westdeutsche Frau nicht arbeiten gehen ohne die Erlaubnis ihres Ehemannes. Heutzutage gibt es keine spezifischen Gesetze, die deutschen Frauen verbieten, arbeiten zu gehen – aber unsere Gesellschaft basiert subtil darauf, dass die Frau und die Kinder zu einem Mann gehören. Ehegattensplitting, Familienversicherung, all das macht es schwer für eine Frau, finanziell unabhängig zu sein. Wenn eine Frau mit einem Mann zusammenkommt, der mehr als sie verdient, ist es oft »praktisch«, es so zu »organisieren«, dass sie die meiste Kindererziehung übernimmt. Und dann verliert sie Jahre ihrer Karriere, und die Ungleichheit ist noch tiefer als zuvor.
86.000 Gedanken
Angeblich hat man 86.000 Gedanken am Tag, und wenn sie alle negativ sind, ist dein Gehirn wie ein Garten mit verdorbenem Unkraut, aber das Gute ist, wenn sie überwiegend positiv sind, dann ist dein Gehirn wie eine Wiese im Sommer mit kleinen blauen Blumen drin, und die Gedanken tanzen im hellgoldenen Sonnenschein in der leichten erfrischenden Brise, und das echt Gute ist, dass man seine 86.000 Gedanken steuern kann, indem man sich bewusst auf die positiven Gedanken konzentriert und die bösen, negativen ignoriert. Man denke an die guten und schlechten Bakterien im Darm und die Wirkung von Actimel, je mehr Actimel man trinkt, desto weniger böse Bakterien besiedeln den Darm, so einfach ist es, deine Gedanken zu steuern. Und deswegen schreibe ich jetzt ein Gratitude Journal: ein Dankbarkeitstagebuch.
Woher habe ich diese Info mit den 86.000 Gedanken, fragt ihr euch, und woher weiß ich, dass das stimmt? Das ist ganz simpel, ich habe das gelernt von einer Hippiefrau bei YouTube, und ich weiß, dass das stimmt, denn warum würde eine Hippiefrau bei YouTube mich anlügen?
Ich fange an, immer abends, nachdem das Baby eingeschlafen ist, ganz normal in mein Dankbarkeitstagebuch zu schreiben, werde aber immer besoffener, und manchmal, wenn ich richtig besoffen bin, gerät meine Dankbarkeit außer Kontrolle.
Ich fange ganz normal an:
Ich bin dankbar, dass die Welt schön ist und ich in Sicherheit bin.
Ich bin dankbar, dass ich Kinder habe.
Ich bin dankbar, dass die Kinder gesund sind (ich versuche, den Gedanken zu unterdrücken, dass das ein bisschen behindertenfeindlich ist).
Ich bin dankbar, dass die Kinder hübsch sind (ich versuche, den Gedanken zu unterdrücken, dass das lookist ist, schaffe es doch nicht, und lösche das aus meinem Dankbarkeitstagebuch).
Ich bin dankbar, dass ich meinen Freund kennengelernt habe, da er mir das Baby gemacht hat, und das Baby ist perfekt.
Ich bin dankbar, dass mein Exfreund mit mir Schluss gemacht hat, denn nur so konnte ich das Baby machen.
Ich bin dankbar, dass mein Freund jetzt drei Wochen weg ist, so dass ich mit dem Baby alleine eine Bindung aufbauen kann.
Ich bin dankbar, dass die perfekteste Kita aller Zeiten uns abgelehnt hat, weil wir jetzt viel, viel Zeit haben werden, um uns zu binden, wir werden so verbunden sein, wir werden eine Mutter-Kind-Bindung haben, auf die alle anderen Mütter auf dem Spielplatz voll neidisch sein werden.
JA, ICH BIN DANKBAR, DASS WIR KEINEN KITAPLATZ BEKOMMEN HABEN, SO HABE ICH MEHR ZEIT MIT MEINEN KINDERN. ICH BIN DANKBAR FÜR DEN BREXIT, SO LERNE ICH DIE EU RICHTIG KENNEN, RICHTIG ZU SCHÄTZEN, WIRKLICH ZU LIEBEN. ICH BIN DANKBAR, DASS ICH DICK BIN, DENN JETZT WEISS ICH, DASS MEIN FREUND MICH WIRKLICH WEGEN MEINER PERSÖNLICHKEIT LIEBT UND NICHT WEGEN MEINES KÖRPERS. ICH BIN DANKBAR, DASS ICH SO VIELE KOHLENHYDRATE ESSE, DASS MEIN BAUCH AUSSIEHT WIE DER EINES NARWALS, DENN DIE SIND MEINE LIEBLINGSWALE. ICH BIN DANKBAR, DASS ICH ALLEINE BIN IN DEUTSCHLAND, WEIL MENSCHEN MIT FAMILIEN IMMER AN NERVIGEN PICKNICKS UND GRILLPARTYS TEILNEHMEN MÜSSEN UND ICH TOTAL GLÜCKLICH ZU HAUSE BLEIBEN DARF. ICH BIN DANKBAR, DASS ICH UND DAS BABY DIE OSTERFEIERTAGE TOTAL ALLEINE VERBRINGEN DÜRFEN. ICH BIN DANKBAR, DASS …
Ich höre auf zu schreiben, dass ich dankbar bin, denn ich merke gerade, dass ich aus Versehen aus Langeweile viel getrunken habe innerhalb von zwanzig Minuten und eigentlich ziemlich betrunken bin. Keine Kita, keine Arbeit, keine richtigen Freunde, keine Ziele, Mann, bin ich deprimiert und total undankbar für mein verkacktes Leben. Ich twittere: When I am drunk sometimes the things I write in my gratitude journal can get a bit out of control. Zwei Minuten später schäme ich mich, dass ich das geschrieben habe, aber wenn ich es lösche, werden die Leute wissen, dass ich mich schäme, und solange die anderen Menschen nicht wissen, dass du dich schämst, ist es halb so schlimm, du schämst dich nur theoretisch. Das ist wie wenn ein Baum hinfällt im Wald, aber niemand guckt hin: zählt kaum. Ich threade eine Antwort zu meinem schamvollen Tweet: Schreibe gerade einen Text darüber für morgen bei meiner Lesebühne! Ha, denke ich mir. Jetzt schnell einen Text über Dankbarkeit schreiben, und das Leben kann weitergehen. BITTE SCHÖN!
Der Schmutz soll drinnen bleiben
Schmutz soll drinnen bleiben, drinnen, innerhalb der Wohnung, innerhalb der vier Wände. Es ist kein Zufall, dass man, wenn eine Frau erzählt, dass sie als Kind missbraucht oder als junge Frau belästigt worden ist, ihr sagt, sie solle ihre schmutzige Wäsche nicht in der Öffentlichkeit waschen. Ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass auf Deutsch – und auf Englisch – die Beleidigung für eine sexuell zu aktive Frau auch für eine schlechte Hausfrau passt. Auf Deutsch: Schlampe. Auf Englisch: Slut. Schlechte, schlampige Hausfrauen räumen den Schmutz nicht brav weg – sondern sie bringen den Schmutz ans Licht. Hier, guckt, hier. Hier ist Schmutz. Guckt her!
Eine Frau, die sich Hausfrau nennt, unterdrückt sich selbst. Sie ist schuld, wenn ihr Mann ihr nicht im Haushalt hilft, denn sie selbst will das so. Eine Frau, die sich nicht Hausfrau nennt, aber früh aufsteht, alles fertigmacht für die Kinder, arbeiten geht, nach Hause kommt, schnell putzt, während ihr Mann fernsieht? Sie ist frei. Sie lässt sich nicht unterdrücken. Sie befreit sich selbst aus der Hausarbeitsfalle.
Man findet Hausarbeit eklig, langweilig und eklig. Deswegen, vielleicht, findet man Hausfrauen lächerlich. Wer Schmutz wegputzt, muss vielleicht Kacke anfassen. Wer darüber spricht, gibt zu, dass er Kacke angefasst hat. Niemand möchte sich blamieren, deswegen tun alle so, als ob die Hausarbeit von alleine gemacht würde.
Hausarbeit und Putzen sind kein ernsthaftes Thema, mit dem man sich beschäftigen sollte. Es ist kein wichtiges Thema. Die Menschen, die sich damit beschäftigen, sind nicht so intelligent wie die, die sich nie darüber Gedanken machen.
Schmutz, wie auch die Frau, soll drinnen in der Wohnung bleiben. Es soll keine Kacke an die Hände kommen, oder Periodenblut auf die Wände. Frauen sollen keine Schlampen sein – sie sollen ordentlich sein und keinen Schmutz produzieren. Vielleicht denken Männer immer noch, unterbewusst, dass Frauen so eklig sind wegen der Periode, und deswegen alleine für das Putzen verantwortlich sind? Eine Frau, die mit der Hausarbeit nicht klarkommt und offen darüber spricht, sie zeigt ihren Schmutz der Welt. Das ist eklig. Man möchte nicht hingucken. Diese Frauen sollen schweigen. Und sie sollen sich nicht Hausfrauen nennen.
Dirty Bastards
Ich bin eine schlechte Hausfrau. Wahrscheinlich bin ich die schlechteste Hausfrau der Welt. Ich bin eine so schlechte Hausfrau, dass meine Exfreunde mich immer loben mussten, wenn ich ausnahmsweise was Sauberes gemacht habe statt Schweinerei.
Mein Exfreund, der Engländer, zum Beispiel. Er hat mich immer gelobt, wenn er dachte, ich mache Fortschritte.
»Du bist ein braves Mädchen heute«, sagte er zum Beispiel. »Ich bin total stolz auf dich.«
»Ja?«, fragte ich. »Warum? Was habe ich gemacht?«
»Du hast die Handtücher zurück ins Bad gebracht«, sagte er. »Sehr gut.« Oder manchmal: »Du hast die richtige Mülltüte in die Mülltonne getan. Danke schön. Das sieht so gut aus, wenn du das machst.«
Ich weiß nicht, warum ich so eine schlechte Hausfrau bin, aber ich weiß nur, dass ich, wenn ich was putzen muss, sehr spezifische Kopfschmerzen hinter den Augen bekomme. Deswegen kann ich nicht lange putzen. Mein Ex, der Engländer, glaubte, dass ich zu schnell denke, und beim Putzen muss man langsam denken, und deswegen halte ich es nicht aus. Deswegen sprach er, wenn er mir beim Putzen zuguckte, ganz langsam und hypnotisierend mit mir: »Hoch … und runter und … rund, und rund und rund und rund … und jetzt wieder hoch, jetzt den Lappen spülen – sehr gut – und jetzt noch eine Runde – hoch und runter und rund, rund, rund – einmal rund – den Lappen spülen – sehr gut. Sehr gut hast du das gemacht. Toll!«
Aber ich fürchte, dass das alles nur ein Trick gewesen ist, um mich mehr zum Putzen zu bringen.
Ich erinnere mich, wie meine ältere Schwester mit ihrer jüngsten Tochter nach Berlin zu Besuch kam, als mein Teenager Ryan so sieben Jahre alt war.
»Ich bin die schlechteste Hausfrau der Welt«, sagte ich zu ihr.
»Nee«, sagte sie. »Ich bin die schlechteste Hausfrau der Welt!«
»Nein«, korrigierte ich. »Ich bin das.«
Wir fingen an, uns darüber zu streiten, wer von uns die schlechteste Hausfrau der Welt ist. Ich muss sagen, der Schlampenwettbewerb ging echt knapp aus.
»Evie«, sagte sie über ihre zweite Tochter, »wusste nicht, dass man Eierkuchen aus Milch und Mehl und so machen kann, und nicht immer aus dem Fertigmix aus der Packung.«
Ja, dachte ich. Das ist ziemlich beschämend für eine Hausfrau. Aber ich kann das locker toppen.
»Einmal, als ich das Badezimmer geputzt habe und Ryan mir dabei zuschaute, fragte er mich, welche Großeltern uns morgen besuchen würden.«
Meine Schwester lachte.
»Ja, okay«, sagte sie. »Das ist ziemlich gut. Ich meine, schlecht.«
»Oh!«, sagte ich. »Und bei Ryans Sprachtest für die internationale Schule war das einzige Wort, was er nicht kannte, ›Bügeleisen‹. Sie haben mir nachher erzählt, wie er das Bild mit dem Bügeleisen anguckte und meinte: ›Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, was dieses Ding ist.‹ Aber sie haben ihm keine Punkte abgezogen, weil sie dachten, dass es kein sprachlicher Mangel wäre, sondern dass das Bügeleisen nicht zu seinem Alltag gehörte. Sie meinten zu mir: ›Wir haben uns gedacht, dass es vielleicht nicht Teil seiner Alltagskultur war.‹«
Meine Schwester lachte sehr.
»Ich kann das toppen«, sagte sie.
»Kannst du nicht«, sagte ich.
»Kann ich doch«, sagte sie.
»Dann topp mal«, sagte ich.
»Als Jamie das erste Mal unser Bügelbrett gesehen hat – ich bewahre es in der Putzkammer auf –, als Jamie das also das erste Mal gesehen hat, ist sie zu mir gerannt und hat gerufen: »Mama! Wir haben ein SURFBRETT im Schrank!«
Ich lachte. »Du gewinnst«, gab ich zu. »Aber ich bin die zweitschlechteste.«
Aber zwei Wochen später merkte ich, dass meine Schwester doch Unrecht hatte. Ich