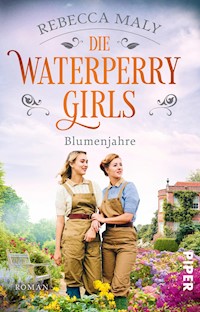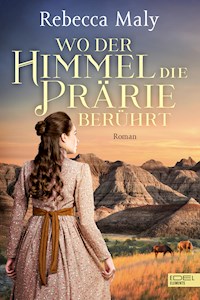9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Drama um zwei ungleiche Schwestern: dicht, atmosphärisch, bewegend Mitten im Winter verliert die junge Magd Jorun ihre Anstellung und muss zurück zum elterlichen Hof, dabei wollte sie ihre spröde Schwester nie wiedersehen. Doch bald entdeckt sie ein wohlgehütetes Geheimnis: In einer abgelegenen Hütte versorgt Salbjörg den schwer verletzten Erlendur, den sie bewusstlos und beinahe erfroren im Gestrüpp fand. Der Nachbarssohn wird des Mordes beschuldigt und überall gesucht – ihm selbst fehlt jedoch jede Erinnerung an das, was geschehen ist. Jorun beginnt, ihr Herz an Erlendur zu verlieren, an den Mann mit den eisblauen Augen. Auf keinen Fall darf Salbjörg davon erfahren, da diese ihn auf geradezu fanatische Art begehrt … Die karge Landschaft Islands im Winter und die bittere Armut der Bauern bilden einen beeindruckenden Hintergrund für diesen Roman.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 430
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Rebecca Maly
Die Schwestern vom Eisfluss
Roman
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Ein Drama um zwei ungleiche Schwestern: dicht, atmosphärisch, bewegend
Mitten im Winter verliert die junge Magd Jorun ihre Anstellung und muss zurück zum elterlichen Hof, dabei wollte sie ihre spröde Schwester nie wiedersehen. Doch bald entdeckt sie ein wohlgehütetes Geheimnis: In einer abgelegenen Hütte versorgt Salbjörg den schwer verletzten Erlendur, den sie bewusstlos und beinahe erfroren im Gestrüpp fand. Der Nachbarssohn wird des Mordes beschuldigt und überall gesucht – ihm selbst fehlt jedoch jede Erinnerung an das, was geschehen ist. Jorun beginnt, ihr Herz an Erlendur zu verlieren, an den Mann mit den eisblauen Augen. Auf keinen Fall darf Salbjörg davon erfahren, da diese ihn auf geradezu fanatische Art begehrt …
Über Rebecca Maly
Gewidmet meiner Skandinavistik-Professorin Frau Dr. Else Ebel-Vary
Kapitel 1
Das rat ich zum ersten,
daß du rechtschaffen dich
gegen deine Nächsten benimmst;
sei langsam zur Rache,
tun sie auch Leid dir an!
Das bringt Heil nach dem Hinscheiden.
Die Edda, Das dritte Sittengedicht, Strophe 1
Der Rhythmus war tief und regelmäßig. Er wummerte durch seinen Körper, pulsierte in seinem linken Oberschenkel, im Bauch und an einigen anderen Stellen.
Er wälzte sich herum und bereute die unbedachte Bewegung sofort. Der Schmerz steigerte sich zu purer Qual.
Erlendur stöhnte und riss die Augen auf.
Vor ihm schälte sich eine flache Küstenlandschaft aus dem Nebel. Die Sonne erhob sich soeben im Osten und umriss schroffe schwarze Felsen mit weißlichem Zwielicht. Es musste Morgen sein, das erstaunte ihn. Die Zeit war ihm entronnen, war wie sämige Milch durch ein Siebtuch geflossen und hatte nur Verunreinigungen zurückgelassen. In Erlendurs Mund lag noch der saure Geschmack der Rache. Das war das letzte Gefühl, an das er sich erinnerte.
Seitdem waren offenbar ein Abend und eine Nacht vergangen. Mit tränenden Augen starrte Erlendur in das fahle Licht der aufgehenden Sonne.
Nach und nach kehrte das Empfinden in seinen Leib zurück. Da war noch mehr als der Schmerz seiner Wunden. Unter seiner Wange taute froststarres Moos. Weich schmiegte es sich jetzt an seine Haut, weich und kalt. Er sank langsam ein, fand nicht die Kraft, sich aufzurichten. Der erdige Geruch schien Erlendur festzuhalten.
Dies könnte dein Grab sein, flüsterte das Moos, bleib hier in meinen weichen Armen. Gib dein kümmerliches Dasein auf.
Ich kann mich glücklich schätzen, die Nacht überlebt zu haben, dachte er.
Vielleicht trug er seinen Beinamen «der Glückliche» doch nicht zu Unrecht? Die Leute nannten ihn so, seitdem er am Strand einen Walkadaver gefunden und mit dem Verkauf der Barten viel Geld verdient hatte. Seitdem konnte er sich mehr leisten als viele andere junge Männer seines Alters, kein drittgeborener Sohn ganz Südislands zog mit ihm gleich.
Andererseits lag er wohl wegen seines Fundes auch hier, blutete ins Küstenmoos und würde vielleicht nie wieder aufstehen.
Hinter seinem Rücken schimpfte man ihn einen Betrüger. Einen unehrlichen Mann. Erlendur hatte versucht, dem Gerede ein Ende zu machen, doch die Menschen liebten Verleumdungen mehr als die Wahrheit. Die Wahrheit war fad, nicht das Rechte, um die endlosen Wintertage zu vertreiben.
Möwen zogen über den Himmel und riefen mit ihren schrillen Stimmen durcheinander. Auch sie lästerten über ihn, über den Sterbenden im Moos.
Nur langsam wich die Kälte und machte mehr Platz für den Schmerz in seinem Körper. Jetzt begannen seine Zehen zu kribbeln.
Zumindest waren sie nicht abgefroren, das erleichterte ihn. Die dicken Stiefel aus Robbenfell waren ihm von dem Händler nicht umsonst angepriesen worden. Ein ehrlicher Händler, dachte Erlendur. Am liebsten hätte er laut gelacht.
Mit einem Mal spürte er, wie die zähe Trägheit, die ihn seit seinem Erwachen fest im Griff gehalten hatte, endlich nachließ. Er sammelte alle Kraft, die er aufbringen konnte, und setzte sich ruckartig auf.
Schmerz schoss in seine Seite, doch Erlendur schaffte es, sich mit den Händen abzustützen. Auf allen vieren verharrte er und schöpfte Atem. Wer hätte gedacht, dass Atmen so anstrengend sein konnte?
Schwindel kam und legte sich wie ein Schleier über seine Augen, sodass er für eine Weile nur noch Schemen erkennen konnte. Als sich sein Blick wieder klärte, wünschte sich Erlendur, er wäre nie aufgewacht.
Drei Körper ragten wie schlafende Sagengestalten vor ihm auf. Keiner davon regte sich.
Deutlich erkannte er seine Axt, die aus dem Rücken des Mannes ragte, der ihm am nächsten lag. Das Blut auf dem milchweißen Wollumhang war braun geworden.
Erlendur biss sich auf die Unterlippe, damit sie aufhörte zu zittern. Plötzlich hatte er Angst.
Jón Atlisson war tot. Ermordet. Das halblange weißblonde Haar gehörte unverkennbar zu ihm, dem jüngeren der beiden Atlisson-Brüder. Erlendurs eigene Axt steckte in seinem Rücken.
Erlendur schmeckte bittere Galle und spie aus. Wütend schlug er mit der Faust auf den sumpfigen Grund und brüllte seinen Zorn heraus. Die Möwen ergriffen kreischend die Flucht, ihre Schreie klangen wie Gelächter. Bestimmt hatte man ihn reingelegt. Jemand, der listiger war als er, musste ihn zu Fall gebracht haben. Erlendur der Glückliche hatte sein Glück verloren!
Aber so leicht würde er sich nicht geschlagen geben. Schon seit er sich erinnern konnte, hatte seine Mutter Silja ihn für seine Sturheit getadelt und sein Vater ihn für die gleiche Eigenschaft gelobt.
«Wenn du glaubst, dass ich jetzt einfach liegen bleibe, hast du dich getäuscht!», rief er mit rauer Stimme.
Mit einem Mal fühlte Erlendur sich nicht mehr so schwach wie noch einen Moment zuvor und kämpfte sich auf die Beine. Der Schwindel kam und ging. Erlendurs Knie blieben weich.
Er sah sich um, nirgends war ein Mensch zu sehen. Ringsum nur Hügel, auf deren Schattenseiten sich Schneefelder abzeichneten. Im schwachen Licht des Morgens wirkten sie schmutzig grau. Tauwasser zerfurchte die vergilbten Wiesen wie Narben und rann ins Tal. Dort sammelte es sich zu einem weiten Flusslauf, um schäumend und strudelnd den kurzen Weg zur Küste zurückzulegen. Auf einer Sandbank hatten sich die Möwen niedergelassen, die zuvor über ihm gekreist waren. Eine saß noch immer in der Nähe auf einer struppigen Kriechweide und starrte ihn mit schiefgelegtem Kopf an.
«Verschwinde!», schrie Erlendur.
Kreischend spreizte der Vogel die Flügel und ließ sich vom Wind emportragen, der über der Kuppe heftiger blies.
Nun war Erlendur ganz allein. Schwerfällig ging er zu Jóns Leiche, zögerte kurz, dann zerrte er die Axt aus dessen Rücken. Kein Zweifel, es war seine eigene. Aber er konnte sich nicht daran erinnern, sie gezogen zu haben!
Eigentlich war er ausgeritten, um am Strand nach Treibholz zu suchen, das für den Hausbau taugte. Auf Island wuchs kaum ein Baum mehr als mannshoch. Nur Kriechweiden und Krüppelbirken hatten die Altvorderen übrig gelassen. Man erzählte sich, dass es hier einst große Wälder gegeben hatte, doch vielleicht war das alles nur Gerede. So oder so, es änderte nichts an der jetzigen Situation: Jeder, der dieser Tage ein Haus bauen wollte, musste Holz aus Europa kaufen, wenn er nicht in einem finsteren Loch aus Erde und Soden hausen wollte.
Auch die Wände seines elterlichen Hofs bestanden aus Soden, doch für die Tür und die Stützbalken kam nur Holz in Frage. Auf dem Land von Erlendurs Familie gab es gar keine Bäume, aber die Frühjahrsstürme brachten oft Treibgut mit, und Erlendur hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, in gefundene Balken sein Kennzeichen mit der Axt einzuschlagen.
Nun klebte Blut am frischpolierten Stahl. Erlendur biss die Zähne aufeinander und wischte die Schneide am weichen Moos sauber, dann ging er zu dem zweiten Toten und drehte ihn um. Es war Brynjar Atlisson, der zweite Sohn des Nachbarbauern Atli Ormsson und nicht weniger sein erklärter Feind. Brynjar und Jón hatten jede Gelegenheit genutzt, um Lügengeschichten über ihn zu erzählen. Auch jetzt, als er in das breite, sommersprossige Gesicht des Toten blickte, erfasste ihn kalte Wut.
Konnte es sein? Hatte er tatsächlich gegen die beiden Brüder die Hand erhoben? Erlendur wog die Axt in seiner Hand. Es bestand kein Zweifel, mit welcher Art von Waffe Brynjar erschlagen worden war.
Aber da war noch der dritte leblose Körper. Sleipnir, Erlendurs ganzer Stolz. Der Hengst lag mit ausgestreckten Beinen auf der Seite, sein goldbraunes Fell schimmerte in der Morgensonne. Jemand hatte dem Tier die Kehle durchgeschnitten wie einem Schlachtvieh.
Erlendurs Eingeweide krampften sich zusammen, sein Hals wurde eng. Er kniete nieder und strich Sleipnir über die breite Stirn. «Das hast du nicht verdient, Junge.»
Er kämpfte mit den Tränen, wischte sich zornig über das Gesicht. Nur langsam gewann er seine Fassung zurück. Er würde jetzt nicht heulen wie ein Weib.
Erlendur riss sich zusammen. Wenn er auch nur die geringste Chance haben wollte, ein freier Mann zu bleiben, durften die Leichen der Brüder nicht gefunden werden. Er musste sie verstecken, und zwar schnell. Wenn es ihm nicht gelang, würde man ihn früher oder später verhaften und zur Verurteilung ins ferne Dänemark bringen. Von dort war so gut wie kein Angeklagter je zurückgekehrt.
Hastig sah er sich um. Am Himmel zogen große graue Wolken auf und warfen ihre Schatten auf das karge Land. Landeinwärts brach ein Hang zum Schmelzwasserfluss hin ab. Ein Erdrutsch, der vor nicht allzu langer Zeit niedergegangen war, hatte die dünne Erdschicht abgeschält und das darunterliegende Geröllfeld freigelegt. Derer gab es auf Island viele, und man hörte immer wieder von Wanderern, die durch die dünne Vegetationsschicht gebrochen und für immer zwischen den darunterliegenden Felsen verschwunden waren. Früher hatte man ihren Tod den Trollen zugeschrieben.
Entschlossen packte Erlendur Jón Atlissons Leiche am Arm und begann zu ziehen. Sofort spürte er einen heftigen Stich in der Seite, und warmes Blut rann über seine Haut. Er presste eine Hand auf die Wunde und zerrte den leblosen Körper weiter. Um nicht vor Schmerzen zu schreien, biss er die Zähne zusammen. Dann kam ihm ein altes Lied in den Sinn, das ihm früher immer die Magd vorgesungen hatte. Es war kein Lied für Kinder, sondern kündete von Schrecken und Entbehrungen, die einem Reisenden widerfuhren, wenn er die Missetäterwüste Odáðahraun durchquerte.
Er fühlte, wie sich seine Schritte dem Rhythmus des Liedes anpassten. In seinem Kopf erklang die altvertraute Stimme, und bald sang er laut gegen den Schmerz in seinem Körper an: «Ríðum, ríðum rekum yfir sandinn, rennur sól á bak við Arnafell. Hér á reiki er margur óhreinn andinn úr því fer að skyggja á jökulsvell.» Wir reiten, jagen über den Sand, die Sonne sinkt hinter dem Arnarfell. Unreine Geister steigen aus den Schatten der Gletscher … «Drottinn leiði drösulinn minn, drjúgur verður síðasti áfanginn.» Herr, führe mein Ross, die letzte Wegstrecke wird schwer.
Die Anstrengung ließ seine Lungen brennen, der schwarze Fels verschwamm vor seinen Augen. Den Anfang der dritten Strophe keuchte er nur noch, während er das abschüssige Geröllfeld erreichte. Er ließ den Arm des Toten fallen, aber das Gefühl kalter Haut ließ sich nicht so leicht abschütteln. Erlendur wischte die Rechte an seiner Jacke aus grobem Vaðmál ab und rang nach Luft.
Er gönnte sich nur eine kurze Rast, dann erkundete er das Geröllfeld. Der Grund war uneben, das Tauwetter der letzten Tage hatte ihn in Bewegung versetzt. Erlendur trat auf einen wackeligen Stein, der plötzlich unter seinen Füßen wegglitt – der Sturz war nicht mehr aufzuhalten. Er fiel auf die Knie und rutschte mitsamt einigen losen Erdbrocken und Steinen abwärts. Es tat höllisch weh. Erlendur blieb der Atem weg. Er presste die Hand erst auf die blutende Seite, dann auf den Oberschenkel. Seine Knie brannten, aber was waren schon einige blaue Flecke gegen die anderen Verletzungen? Auf allen vieren kroch er ein kleines Stück bergauf. Die Hände tief im Morast versunken, fluchte er zornig.
Doch was war das? Der dunkle Fleck zwischen zwei großen Felsen sah vielversprechend aus. Mühsam kam Erlendur wieder auf die Beine.
Ja, das war genau das, was er zu finden gehofft hatte. Die Grube unter den Felsen war tief, beschattet und zur Hälfte mit Schmelzwasser gefüllt.
Nun gab es keine Zeit zu verlieren. Erlendur wusste, dass er mit jeder Minute schwächer werden würde. Vielleicht verblute ich, bevor die Atlisöhne von der Erde verschluckt sind, dachte er bitter.
Aber dann würden seine Eltern und Brüder ihn wenigstens nicht als Mörder in Erinnerung behalten.
Die Mittagsstunde war bereits vorüber, als Erlendur den Ort der Bluttat verließ. Dort, wo die Toten gelegen hatten, blieben nur ein paar Abdrücke im Moos, das sich bereits wieder aufrichtete.
Allein der Pferdekadaver lag noch immer dort, und es gab keine Möglichkeit, ihn zu verstecken. Erlendur nahm dem Tier den Sattel und das Zaumzeug ab. Zum Abschied strich er Sleipnir über die nachtkalte Stirn. Aus dieser Nähe konnte er noch immer den Blutgeruch wahrnehmen, der der klaffenden Wunde an der Kehle entströmte.
In einigen Tagen würde niemand mehr erkennen, wessen Tier dies einst gewesen war. Schon jetzt waren die Möwen zurück und warteten darauf, sich an dem Aas gütlich zu tun.
Auch ein paar große Raben hatten sich dazugesellt, ihr Blick kam ihm seltsam weise vor. Während die Möwen lärmten und einander jagten, saßen die Schwarzgefiederten ruhig nebeneinander und legten nur hin und wieder den Kopf schief, wenn Erlendur etwas tat, das sie verblüffte. Kein Wunder, dass die Altvorderen ihnen magische Kräfte zugeschrieben hatten.
Erlendur zog ein Messer und schnitt dem Pferd das Brandzeichen aus dem Fell. Das kleine Stück Haut warf er den Raben zu. Die stolzierten näher, sträubten das Gefieder, dann schlangen sie den Fetzen herunter.
Erlendur schauderte innerlich. Schließlich schulterte er sein Gepäck und ging davon, ohne sich noch einmal umzusehen.
Kapitel 2
Gut ist ein Hof,
ist er groß auch nicht:
daheim ist man Herr;
dem blutet das Herz,
der erbitten die Kost
zu jeder Mahlzeit sich muß.
Die Edda, Das alte Sittengedicht, Strophe 29
Die Tränen froren auf ihren Wangen fest, während Jorun gebeugt weiterstapfte. Pfeifend peitschte der Wind über die Ebene und drückte das Wollgras nieder; einen Horizont gab es seit einem halben Tag nicht mehr, nur noch zerfasertes Grau in Grau. Schnee und Graupel mischten sich mit Vulkanstaub zu einem undurchdringlichen Schleier. Es roch nach Eis und Eisen.
Klangen dort nicht Stimmen im Wind?
Jorun zog das Tuch enger um den Kopf, wollte nichts hören, nicht ihren Ängsten noch mehr Raum geben.
Vor ihr wurde Schnee über den Weg getrieben, verdreckt von Asche. Schon jetzt ragten die Wegmarken kaum noch aus den Verwehungen hervor, die sich im Windschatten der Steine bildeten.
Jorun hatte diese Reise erst ein Mal unternommen: im Sommer vor drei Jahren, bei schönstem Wetter. Jetzt zeigte sich das Land von seiner ungastlichen Seite. Der bewaldete Höhenzug Þórsmörk, der Wald des Thor, war nur hin und wieder durch das Schneetreiben zu erkennen. Er war von den ersten Siedlern nach dem Wettergott benannt worden, der auch dem kahlen Bergrücken seinen Namen gegeben hatte. Nun ragte er drohend wie ein gespenstischer Schemen vor Jorun auf. Von den Gletschern des Mýrdalsjökull war in dem weißen Treiben nichts zu sehen.
Jorun versuchte, sich an die Predigten des Pfarrvikars Olafur zu erinnern, doch kein tröstendes Wort wollte ihr in den Sinn kommen.
Mit einem Mal mischte sich ein anderes Geräusch unter das Heulen des Sturms. Wasserrauschen. Das musste der Gebirgsfluss Hamarsfljót sein, den Jorun auf jeden Fall überqueren musste, wollte sie die Nacht nicht ungeschützt auf der Ebene verbringen und damit riskieren zu erfrieren.
Das Rauschen des Wassers wurde mit jedem Schritt lauter. In den letzten Tagen hatte es immer wieder ein wenig getaut, überall schwollen die Bäche.
Sie schickte ein Stoßgebet gen Himmel. Bitte lass die Brücke noch da sein!
Der Fluss schnitt tief in das Land, und in engen Kehren wand Joruns Pfad sich nun hinab in die Klamm. Mit einem Schlag verschwand der Wind, und befreit von dem ständigen Gegendruck, stolperte sie vorwärts.
Durch die dünnen Sohlen ihrer abgetragenen Stiefel bohrte sich kantiges Lavageröll. Joruns Bewegungen waren ungelenk, die Muskeln steif vor Kälte. Sie rutschte und schlitterte, beinahe wäre sie in die Tiefe gestürzt, doch im letzten Moment bekam sie einen Felsbrocken zu fassen. Der Stein war scharf wie zerborstenes Glas.
Blut sickerte unter ihren Fingern hervor und lief über das schwarze Gestein. Jorun wagte nicht, ihre Hände anzuschauen, wollte nicht sehen, wie schlimm sie zerschnitten waren. Vielleicht würde es mehr weh tun, sobald sie die Verletzungen ansah? Der Schreck jagte Hitzewellen durch ihren Körper, und Jorun war klar, dass sie einen Teil der Schmerzen dämpften. Also biss sie die Zähne zusammen, ballte die Hände zu Fäusten und versuchte, das Blut zu ignorieren, so gut es ging.
Jorun fürchtete sich vor dem, was sie weiter unten in der Schlucht erwartete. Aber sie musste weiter, bald würde die Dunkelheit hereinbrechen.
Mühsam kam sie wieder auf die Beine, hob die hölzerne Rückentrage auf, mit der sie ihr weniges Hab und Gut transportierte, und nahm den Rest des Abstiegs in Angriff.
Am Ufer endete der Weg abrupt, milchige Wellen spülten über Sand und Kiesel. Der Gebirgsbach brüllte wie ein wütendes Tier. Fassungslos sah Jorun sich um. Ja, hier musste die Brücke gestanden haben. Auf der anderen Seite ging der Weg weiter und wand sich in Bögen wieder aus der Klamm hinaus – zum Teil von Schneeverwehungen verdeckt, doch sie irrte sich nicht. Genau dort musste sie hin. Deutlich markierten zwei hohe Steinhaufen den Pfad. Jetzt fiel Jorun auch ein abgerissenes Seil auf, das zerfasert in der Strömung trieb, und sie entdeckte zwei behauene Bretter, verkeilt zwischen Stöcken und vergilbten Grasbüscheln. Mit einem Schlag war ihre Hoffnung dahin.
Der Fluss gurgelte bedrohlich, als wartete er nur darauf, Wanderer zu ertränken, die sich in seine Fluten hineinwagten.
Zornig lief Jorun ein Stück flussabwärts. Was sie brauchte, war eine breite Stelle, wo das Wasser nicht so tief war und ruhiger floss. Auch dann war die Überquerung noch schwierig, wenn nicht sogar lebensgefährlich. Schon jetzt war die Kälte des Flusses deutlich spürbar, die mit dem Wasser vom Gletscher hergetragen wurde.
Dort! Hinter einigen Birkenschösslingen, wo die Klamm einen Knick machte, hatte sich etwas zwischen Findlingen verkeilt. Das Wasser zog und zerrte daran, doch es saß fest: ein Teil der Brücke, größtenteils erhalten. Nur einige Planken fehlten.
Von neuem Mut erfüllt, erklomm Jorun den nächsten Felsen, den sie vom Ufer aus erreichen konnte. Er war glatt geschliffen und mit Moos bewachsen, auf dem sie kaum Halt fand. Das Blut machte ihre aufgerissenen Hände glitschig, ihren Griff unsicher. Doch Jorun blieb keine andere Wahl, wenn sie die Nacht nicht schutzlos im Schneesturm schlafen wollte.
Auf dem Felsen stehend, sah sie sich um. Genau vor ihr gab es eine tiefe Stelle, in der das Wasser grünlich strudelte. Wenn ich dort hineinfalle, ist es aus, dachte sie. Aber ich werde nicht fallen! Ich darf nicht!
Die sperrige Holztrage auf ihrem Rücken erschwerte es Jorun, das Gleichgewicht zu halten. Sie überprüfte die Ladung und richtete wohl zum dritten Mal die Schulterriemen.
Hier, in der Mitte der Klamm, war auch der Wind zurück. Er trieb sein Spiel mit den Schneeflocken, formte Wirbel und dichte Vorhänge aus den weißen Kristallen.
Als Jorun sich einen Schritt weiter vorwagte, wurde sie von einer Bö erfasst, die ihr beinahe den Umhang vom Körper riss. Ihre Knie wurden weich. Jorun schwankte unter dem Ansturm des Windes, kippte vorwärts und erwischte gerade noch ein Stück der Brücke. Das Holz vibrierte von der Kraft des Wassers. Es war unheimlich.
Die Brücke lag auf der Seite. Jorun packte fest zu und rüttelte, doch zu ihrer Erleichterung bewegte sich nichts. Der Strom presste die Holzteile so stark gegen die Felsen, dass sie beinahe unverrückbar waren.
«Du kannst das, Jorun», sagte sie sich laut vor, aber ihre Stimme zitterte. Überzeugen konnte sie sich nicht. Trotzdem griff sie mit beiden Händen nach dem Holz, versuchte, die Schmerzen zu ignorieren, und setzte den ersten Fuß auf das schmale Brett. Die Strömung ließ es beben wie einen lebendigen Körper. Nur zögernd belastete Jorun das Bein und löste dann auch den zweiten Fuß vom sicheren Felsen.
Stückchen für Stückchen schob sie sich weiter vorwärts. Bald war die tiefste Stelle des Flusses erreicht, und sie konnte in den Malstrom hinabsehen. Das Rauschen und Gurgeln war ohrenbetäubend, ihr schwindelte. Der Anblick des Wassers zerrte an Jorun, als säße ein Teufel in dem Strudel und riefe ihren Namen.
Jetzt weiter, nur weiter!
Der nächste Schritt, dann noch ein kleiner. Plötzlich gab das hochkant stehende Brett unter ihrem Fuß nach. Jetzt nur nicht zurückweichen! Jorun überwand ihre Angst und tat zwei große Schritte. Das Ufer war schon fast in rettender Nähe, als plötzlich ein tiefes Poltern erklang, direkt aus dem grünen Herzen des Flusses.
Jorun zuckte zusammen und blickte auf. Ein Felsen rollte langsam, aber unaufhaltsam genau auf die Brücke zu. Hastig zog sie sich weiter, rutschte ab, fand wieder Halt, da krachte es.
Das Holz splitterte. Die beiden Hauptbalken gaben ein gequältes Ächzen von sich, bevor auch sie zerbarsten. Dann bewegte sich die Brücke, wurde von der Strömung weitergezogen, und Joruns Abstand zum Ufer vergrößerte sich. Sie hatte keine Wahl, sie musste springen, wenn sie nicht mit den Trümmern fortgerissen werden wollte.
Es blieb keine Zeit mehr für ein Bittgebet. Jorun biss die Zähne zusammen und stieß sich ab.
Wellen schlugen über ihrem Kopf zusammen. Das Wasser war so kalt, dass ihre Haut augenblicklich gefühllos wurde.
Jorun riss die Augen auf und sah nur milchiges Grau. Orientierungslos ruderte sie mit Armen und Beinen. Ihre Füße erreichten den Grund oder vielleicht auch nur irgendeinen rollenden Felsen, einen Unterschied machte es nicht. Sie stieß sich ab und tauchte auf. Luft! Verzweifelt strampelnd kämpfte sie sich gegen den Strom in Richtung Ufer und fühlte, wie sie von Augenblick zu Augenblick an Kraft verlor. Es war so schrecklich kalt.
Endlich bekam Jorun einen Felsen zu fassen und zog sich daran hinauf. Die Trage zerrte ihre Schultern hinunter. Doch Jorun wollte nicht in einem nassen Grab enden! Mit letzter Kraft ließ sie sich vornüberfallen und spürte Kiesel an ihrer Wange. Geschafft! Die schmerzenden Hände in das Ufer grabend, zog und zerrte sich Jorun ganz an Land.
Ihre Zähne schlugen laut klappernd aufeinander, durch ihre Beine zuckten Krämpfe. Was sollte sie nur tun? Die Kälte saß tief in ihr, der mitgebrachte Zunder war nass, sie konnte kein Feuer machen, und schon bald würde die Nacht hereinbrechen. Jorun war klar, was das bedeutete. Als sie diese Erkenntnis akzeptierte, wurde sie langsam ruhiger.
Sie hatte sich umsonst aus den Fluten des Hamarsfljót gekämpft. Sie würde sterben. Erfrieren. Jorun wälzte sich auf den Rücken und sah zum Himmel hinauf, wo der Wind die Schneeflocken zu atemberaubenden Wirbeln trieb.
In das Weißgrau mischte sich Nebel, Konturen verschwanden, und langsam versiegte auch der Schmerz. Alles fühlte sich leicht an. Jorun schloss die Augen. Der Tod würde sanft sein. Hoffentlich.
Ein Tag zuvor – Halldorshof
Eine seltsame Ahnung packte Jorun wie eine Hand im Genick und zerrte sie aus einem traumlosen Schlaf.
Es war früher Morgen, zu früh, um aufzustehen. Stille hing wie dichtes Gewebe zwischen den Erdwänden und drückte auf ihre Brust. Joruns Herzschlag stolperte, als wäre er durch irgendetwas aus dem Takt geraten.
Ihr schlichtes Lager knisterte, während Jorun sich herumwälzte und in das zähe Dämmerlicht starrte. In dem mit Moos und Stroh gefüllten Sack, der ihr als Unterlage diente, hauste Ungeziefer. Er war seit einem halben Jahr nicht mehr ausgetauscht worden, und schon der Gedanke, was sich im Laufe der Zeit darin angesammelt haben mochte, ließ ihre Haut kribbeln. Jorun kratzte sich in der Armbeuge und dachte nach.
Um ihre Schlafstatt sollte sie sich heute als Erstes kümmern. Der Frost würde einigen Flöhen und Wanzen sicher den Garaus machen. Damit die Bäuerin Ragnheiður nicht mit ihr schimpfte, sie würde sich mehr um ihre eigenen Angelegenheiten als um die aufgetragene Arbeit sorgen, wollte Jorun es jetzt gleich erledigen, bevor die anderen aufstanden. Vielleicht war es sogar gut, zu früh wach geworden zu sein.
Joruns Rücken schmerzte, kaum dass sie sich aufsetzte. Das tat er im Winter immer, selbst nach Tagen mit wenig schwerer Arbeit. Sie presste sich die Hände ins Kreuz und drückte die Wirbelsäule durch, dass es krachte. Gleich würde der Schmerz hoffentlich nachlassen.
Müde zog sie ihren Zopf nach vorn, löste ihn und fuhr sich mit einem dreizinkigen Holzkamm durchs Haar, dann band sie es wieder zu einem einfachen, festen Zopf zusammen. Im Zwielicht sahen Joruns Haare fast braun aus, dabei waren sie eigentlich richtig rot. Wie Feuer, hatte ihre Mutter früher immer gesagt, und genau passend für ein wildes Mädchen, wie sie es damals gewesen war.
Bei der Erinnerung musste Jorun schlucken. Obwohl Mutter jetzt schon sieben Jahre tot war, verging kein Tag, an dem Jorun nicht an sie dachte. Aber ihre Wehmut änderte nichts. Mutter war nicht da, würde es nie wieder sein. Seufzend schob Jorun den Zopf über die Schulter zurück und rieb sich die Augen.
Noch immer war da diese beunruhigende Ahnung. Sie durchwehte den Raum wie ein Geist, der darauf wartete, sich an jemandem zu rächen. Beinahe kam es Jorun so vor, als wäre sie nicht allein. Mit weichen Knien musterte sie ihre karge Kammer. Hatte sich dort nicht etwas im Schatten bewegt?
War vielleicht doch jemand vom heimlichen Volk anwesend? Eigentlich glaubte Jorun nicht an diese alten Sagen, aber einen Schwur, dass es die Alfen nicht gab, hätte sie trotzdem nicht geleistet.
Joruns Großmutter hatte immer behauptet, mal einen vom heimlichen Volk gesehen zu haben. Er hockte neben einem kleinen Lamm und würgte es. Er hat mich nicht gesehen. Und ich habe nicht gewagt, mich bemerkbar zu machen, aus Angst, er würde auch mich würgen.
Als Kind hatte Jorun diese Schauergeschichte wieder und wieder hören können und sich begierig jedes Detail ausschmücken lassen. Jetzt entstand bei der Erinnerung ein eisiges Kribbeln in ihrem Nacken.
Mit einem kurzen Gebet auf den Lippen zerrte Jorun ihre Decke aus grauem Vaðmál um die Schultern und stand auf. Für so einen Unsinn bin ich entweder zu alt oder noch zu jung, dachte sie. An das Volk, das in Hügeln und Steinen wohnt, glauben doch nur Kinder und rührselige Mütterchen.
Heute kam ihr die kleine Kammer noch winziger vor als sonst. Rauchgeruch stieg aus Joruns Kleidung und auch von der Haut auf. In ihrer Lunge kratzte der Qualm des Torffeuers von letzter Nacht und reizte sie zum Husten. Schnell löste Jorun die dünne Schafsblase von den Knebeln, die sie im Rahmen des winzigen Fensters hielten, und spuckte nach draußen. Die kalte Luft wehte herein, als hätte sie nur auf diese Gelegenheit gewartet, und verwandelte Joruns Atem in kleine, geisterhafte Wölkchen.
Fröstelnd zog sie die Decke dichter um die Schultern. Das Gewebe war dünn und verschlissen wie die abgetragenen Kleider, die sie von der Bäuerin bekam. Sie waren häufiger geflickt, als Jorun zählen konnte. Erst wenn Ragnheiður die Röcke selbst bei grober Arbeit nicht mehr tragen wollte, gab sie sie an Jorun weiter. Ihre Herrin war eine geizige Frau.
Meist spürte Jorun die Kälte nicht einmal mehr, so sehr hatte sie sich daran gewöhnt.
Draußen war es noch dunkel, doch Jorun benötigte kein Licht, um zu wissen, was dort war. Sie konnte den dichten, eisigen Nebel riechen, der vom Meer herantrieb und wie mit kalten Fingern Salzgeschmack auf ihre Lippen strich.
In dem niedrigen Bau mit Joruns schlichtem Lager war es immer zugig. Zwischen den Lehmsoden, aus denen die Wände geschichtet waren, befanden sich breite Lücken. Überschüssige Zeit, sie mit Moos zu stopfen, gab es nicht. Immerhin trennte Jorun nur eine dünne Flechtwand von den Kühen des Hofes, und die Tiere teilten bereitwillig ihre Wärme mit ihr.
Früher, so erzählte man sich, hatte man die Rinder im Winter in den Ställen eingemauert, damit sie nicht erfroren. Nur eine Luke blieb noch offen, durch die man ihnen Heu hineinwarf. An abgelegenen Orten hielt man es vielleicht noch heute so. Im Frühjahr mussten die Menschen die ausgezehrten Tiere dann auf die Weiden tragen. Oft war es dann aber zu spät, und die Kühe verendeten, obwohl sie mitten im sprießenden Grün lagen.
Der Halldorshof war nicht so arm wie viele andere, aber auch nicht reich. Der Bauer Arður Halldorsson hatte den Hof seines Vaters als einziger Sohn übernommen und bewirtschaftete ihn seither allein.
Jorun zerrte den Strohsack aus dem feuchten Winkel, der ihr als Bett diente, und warf ihn sich über die Schulter.
Hinter der Tür empfing sie warmer Stallgeruch. Die Rinder hoben ihre zottigen Köpfe, und die drei guten Reitpferde des Bauern schnaubten leise, während sie an ihnen vorbeiging. Es war so dunkel, dass Jorun nur Schemen erkennen konnte.
Draußen angekommen, suchte sie sich eine Stelle, wo der Boden schneefrei, aber hart gefroren war, breitete den Strohsack aus und beschwerte ihn mit einigen Steinen, damit der Wind ihn nicht davonwehte.
Eilig machte sie sich dann gleich auf den Weg in die Küche, wo bereits Arbeit auf sie wartete. Das Feuer im Ofen war über Nacht zu einem matten Glimmen geschrumpft. Sie legte einige dürre Äste und zwei Torfscheite hinein und blies, bis die Flammen am Holz emporzüngelten.
Es rauchte gewaltig; der Torf war von minderer Qualität und nicht ausreichend durchgetrocknet. Der gute war schon im Herbst an einen Händler nach Reykjavik verkauft worden, um für den langen Winter ausreichend Getreide und andere Dinge kaufen zu können, die nicht selbst angebaut oder hergestellt worden waren.
Der schwere Eisenkessel stand schon seit gestern Abend frisch geschrubbt auf dem Herd. Jorun goss Wasser hinein und setzte Brei an. In einer Tonschüssel stand Skyr bereit, den sie mit einer Handvoll getrockneter Beeren verrührte, um die säuerliche Quarkspeise etwas wohlschmeckender zu machen.
Für Jorun, die Bäuerin und die zwei Kinder reichte das karge Mahl, doch Arður Halldorson gab sich damit nicht zufrieden. Für den Hausherrn musste sie ein Stück Hangikjöt aus dem Rauchhaus holen. Es lag auf der windabgewandten Seite des Hauptgebäudes, der Weg dorthin war kurz. In dem Schuppen hingen die Vorräte hoch unter der Decke, es roch intensiv nach haltbar gemachtem Fleisch und Fisch.
Die Vorräte an geräuchertem Lammfleisch gingen zur Neige, und seit es an manchen Tagen wieder wärmer geworden war, hatte sich eine dünne grünliche Schicht auf dem Fleisch gebildet, die Jorun immer hauchdünn entfernte, um bloß nichts zu verschwenden.
Mit einem langen Stock, an dem ein Haken befestigt war, hob sie das Hangikjöt herunter und schnitt ein fingerbreites Stück davon ab.
«Jorun?»
Sie zuckte zusammen, beinahe hätte sie das Fleisch fallen lassen. Die tiefe, polternde Stimme des Bauern hatte sie aufgeschreckt.
Was tat er hier so früh? Wollte er sichergehen, dass sie nichts stahl? Das hatte sie noch nie getan, niemals. Er hatte keinen Grund, an ihr zu zweifeln.
Jorun drehte sich um. Arður Halldorsons Gesicht war gerötet wie eigentlich immer, das blonde Haar klebte ihm strähnig an den Schläfen. Mit seinen tiefliegenden Augen unter den buschigen Brauen sah er sie lauernd an.
Das bedrohliche Gefühl, das sie verfrüht aus dem Schlaf gerissen hatte, kehrte zurück, stärker noch als am Morgen.
Arður Halldorson hustete, auch ihm lag der Torfrauch auf der Lunge. Er musterte das Fleischstück in ihrer Hand.
«Schneide noch eins ab und nimm auch noch einen Fisch herunter. Einen kleinen.»
«Ja, Herr», antwortete sie irritiert und beeilte sich, seinem Wunsch nachzukommen. Wollte er verreisen und benötigte Proviant? Er hatte doch gar keine Reise erwähnt?
Warum ging er nicht wieder zurück, sondern wartete hier bei ihr und sah sie so seltsam an?
Arður hielt die Arme über seiner mächtigen Brust verschränkt, offenbar nicht bereit, etwas zu erklären.
«Komm mit», sagte er knapp.
Jorun folgte ihm zurück zum Haupthaus, das im dämmrigen Morgenlicht aussah wie eine niedergekauerte Kreatur. Die dicken Wände aus Erdsoden wölbten sich nach außen, auf dem buckeligen Dach ragten dünne Bäumchen durch den schwindenden Schnee. Zahnreihen aus Eiszapfen hingen von der Dachkante aus Birkenrinde. Als sie an den schimmernden Spitzen vorbeigingen, konnte Jorun sie tropfen hören – eine stete Melodie, die den Frühling ankündigte, an diesem Tag aber nicht ihre Stimmung hob.
«Bring das Essen in die Küche, dann komm in die Baðstofa, Jorun. Die Bäuerin und ich haben dir etwas zu sagen.»
«Ja, Herr Arður.» Joruns leerer Magen krampfte sich zusammen. «Aber ich muss noch den Brei fertig kochen», wand sie schwach ein.
«Das kann Tinna machen», beschied Arður.
Seine ältere Tochter half oft in der Küche, trotzdem hätte Jorun das Morgenmahl lieber selbst zubereitet und so noch ein wenig Zeit gewonnen. Plötzlich fürchtete sie sich davor, den Herrschaften in der guten Stube entgegenzutreten. Bestimmt wollten sie Jorun tadeln oder bestrafen. Was hatte sie nur falsch gemacht?
Fieberhaft durchkämmte sie ihre Erinnerung an die vergangenen Tage. Die meiste Zeit war sie damit beschäftigt gewesen, Wolle zu reinigen und für das Verspinnen vorzubereiten. Eine eintönige Arbeit, die nicht viel Fingerspitzengefühl verlangte.
Schließlich legte sie zögernd Fisch und Fleisch auf einen Holzteller, wischte die Hände am Kittel ab und betrat die Baðstofa.
Zwei Tranlichter erhellten die gute Stube des Halldorshofs mit weichem Licht. Die hagere Bäuerin Ragnheiður saß angekleidet auf der Kante ihrer Bettstatt, hinter ihr war der Vorhang zugezogen.
Sie blickte ihr mit steinerner Miene entgegen. Ohnehin war sie eine herbe Frau, die seit dem Tod ihrer jüngsten Tochter vor drei Jahren nicht ein einziges Mal gelacht hatte. Doch so wie heute hatte Jorun sie noch nie gesehen. Ihretwegen, das war Jorun sofort klar.
«Setz dich, Jorun. Wir müssen mit dir reden.»
Sie sah sich nach dem dreibeinigen Schemel um, doch ihre Beine versagten den Dienst, die Gelenke schienen plötzlich unbrauchbar. Joruns Hände begannen zu zittern, kalter Schweiß machte die Haut klebrig. Sie stolperte rückwärts und schaffte es irgendwie, sich auf den Schemel fallen zu lassen. «Wenn ich einen Fehler gemacht habe, ich …» Ihre Stimme brach.
Tinna betrat die Stube und stellte die Schale mit Skyr auf den Tisch, dann zog sie sich mit gesenktem Kopf zurück, als könnte sie der Situation nicht schnell genug entfliehen.
«Du hast nichts falsch gemacht, du bist eine gute Magd. Du bist fleißig, gottesfürchtig und ehrlich. Jeder kann sich eine Helferin wie dich nur wünschen.»
Jorun schluckte, schwieg, begann zu ahnen, worauf diese Unterhaltung hinauslaufen würde. Und sie ahnte auch, dass es unabwendbar war.
Die Bäuerin warf ihrem Mann einen bittenden Blick zu. Offenbar scheute sie sich davor, die Worte selbst auszusprechen.
Arður Halldorson räusperte sich. «Du kannst nicht länger hierbleiben, Jorun. Wir haben selbst nicht genug. Es tut mir leid.»
Da war es also. Die Ahnung hatte Gestalt angenommen. Ihre Kehle schnürte sich zu, bei dem säuerlichen Geruch des Skyr wurde Jorun übel. Sie können mich nicht entlassen, nicht nach drei Jahren, dachte sie. Nicht jetzt, nicht in dieser Jahreszeit!
Niemand würde eine Magd einstellen. Es war die härteste Zeit auf den Höfen. Vieh und Menschen starben am Anfang des Frühjahrs in einer solchen Zahl, als ginge der Tod rastlos von Haus zu Haus, von Hütte zu Hütte.
«Nein!», keuchte sie.
«Es tut uns leid.» Die Bäuerin sah Jorun nicht ins Gesicht, blickte lieber zu dem kleinen gekreuzigten Heiland im Winkel über dem Esstisch. Jorun hatte die Schnitzerei nie gemocht, sie war so voller Qual.
«Ich verzichte auf meinen Lohn, behaltet mich nur hier, schickt mich nicht fort», flehte Jorun und wusste doch, dass sie ihre Herrschaften nicht würde umstimmen können.
«Du wirst den Hof noch heute verlassen müssen», sagte Arður Halldorson. «Pack deine Sachen und nimm dir Wegzehrung mit. Den Trockenfisch und einen Laib Brot, mehr können wir dir nicht geben.»
Die Bäuerin griff hinter sich und reichte Jorun ihr gutes besticktes Wolltuch. «Nimm es, vielleicht kannst du es verkaufen. Deinen Lohn müssen wir dir schuldig bleiben.»
Kapitel 3
Gut ist ein Hof,
ist er groß auch nicht:
daheim ist man Herr;
hat man zwei Ziegen
und aus Zweigen ein Dach,
das ist besser als betteln gehn.
Die Edda, Das alte Sittengedicht, Strophe 28
Salbjörg drückte ihrer Stute die Fersen in die Flanken, die sogleich in einen ruhigen Passgang fiel. Das stete Klopfen der Hufe lullte Salbjörg ein.
Heute war ein guter Tag. Jeder Tag, den sie nicht an der Hofstatt verbrachte, war ein guter Tag, doch heute war auch noch Glück dazugekommen. Sie war nicht nur den Launen ihres Mannes Torger entgangen, sondern hatte einen schönen Fang gemacht. Versonnen strich sie über die beiden Füchse, die leblos am Sattel herunterbaumelten. Ein Weibchen und sein Gefährte, beide waren ihr fast gleichzeitig in die Falle gegangen. Sie hatte die Räuber nur noch erschlagen müssen. Dieses Jahr würden die Eiderenten in Sicherheit brüten, das machte sie froh.
Schon seit Generationen ernteten die Frauen vom Steinurshof die Daunen der freundlichen Vögel. Dafür beschützten sie die Brutplätze der Tiere, und kein Mensch tötete sie, um sie zu essen, oder raubte ihnen die Eier. Selbst in den schlechtesten Zeiten des Jahres hielt sich ein jeder daran, auch wenn Torger protestierte und Salbjörg einmal sogar geschlagen hatte, weil sie auf dieser Tradition bestand.
Heute Abend würde er keinen Grund haben, wütend auf sie zu sein. Schon ihre Großmutter hatte einen wunderbaren Eintopf aus Fuchsfleisch gekocht, und Torger liebte dieses Essen. Allerdings würde er noch einige Tage darauf warten müssen. Vielleicht reichte die Vorfreude auf seine Lieblingsspeise, um ihn gut zu stimmen.
Salbjörg würde das Fleisch in den Schmelzwasserbach neben dem Haus hängen, bis der beißende Beigeschmack ausgespült wäre. Der Pelz taugte nicht zum Verkaufen, die Füchse befanden sich mitten im Fellwechsel. Das weiße Winterhaar fiel ihnen aus, und das braune Kleid des Sommers zeigte sich erst an einigen Stellen. Das bedeutete, dass sie die Felle für sich benutzen konnte.
Salbjörg war tief in Gedanken versunken, als ihre Stute plötzlich schnaubte und ruckartig stehen blieb.
Die Bäuerin war mit einem Schlag hellwach.
«Vorwärts, du dummes Mädchen!» Sie gab dem Pferd die Fersen zu spüren, doch das Tier wurde immer aufgebrachter, lief nun rückwärts statt weiter geradeaus.
Irgendetwas schien ihm gewaltige Angst einzujagen. Salbjörg spürte deutlich, wie es jeden Muskel anspannte, bereit, im nächsten Moment davonzusprengen.
Sie zwang sich zur Ruhe und fasste die Zügel kürzer. Wenn das Pferd hier in Panik geriet und lospreschte, konnte es sich in den Felsen schnell die Beine brechen. Sie hoffte, dass es so vernünftig war, auf seine Reiterin zu hören.
Sosehr die Stute sich auch dagegen auflehnte, Salbjörg gab die Zügel nicht frei und tätschelte ihr den Hals. Angstschweiß tränkte das Fell.
«Ganz ruhig, da ist nichts.»
Bislang war sie einen Weg entlanggeritten, der nah an der Küste verlief. Im Moment war Ebbe, und dort, wo sonst Wellen gegen das Land brandeten, lagen muschelverkrustete schwarze Felsen trocken. In der Ferne vereinte sich der Horizont mit dem Meer. Wolken zogen schnell landeinwärts auf die Berge zu, wo sie ihre nasse, dunkle Fracht abladen würden.
Salbjörg lauschte. Es war seltsam still. Bis auf den Wind, der durch die Küstenvegetation pfiff, und das aufgeregte Schnauben ihres Pferdes schwieg die Natur.
Vor ihr wand sich der Pfad um eine grasbewachsene Kuppe. Dahinter, im Windschatten, wuchs dichtes Weidengestrüpp. Eigentlich der perfekte Ort für einen Verbrecher, um ihr aufzulauern.
Was für ein verrückter Gedanke! Es gab kaum noch Gesetzlose auf Island, und wenn, dann wagten sie sich nicht so weit in den Süden, wo sie schnell entdeckt wurden.
Langsam beruhigte sich das Pferd wieder ein wenig. Zögernd setzte es einen Huf vor den anderen, jeden einzelnen hörte Salbjörg knirschend aufkommen.
Mittlerweile wagte sie kaum noch zu atmen. Dort war etwas, ganz bestimmt. Zum ersten Mal seit vielen Jahren wünschte sie sich, Torger sei bei ihr. Er war ein Mann, mit dem keiner leichtfertig Streit suchte. In seinem Blick lag etwas, das den Menschen Angst einflößte.
Mit einem Mal riss die Wolkendecke auf, und sofort flutete gleißendes Licht über das Land. Geblendet hob Salbjörg die Hand, um ihre Augen abzuschirmen, da entdeckte sie etwas. Ein Stück Metall reflektierte die Sonnenstrahlen. Es lag zwischen einigen kahlen Birkenschösslingen und Krähenbeeren zur ihrer Linken. Das musste sie sich näher ansehen.
«Weiter, Mädchen, nur weiter», flüsterte sie ihrer Stute zu, die Stimme so sehr gesenkt, dass sie selbst nicht sicher war, ob sie überhaupt laut gesprochen oder die Worte nur gedacht hatte. Nun konnte sie deutlich erkennen, dass dort ein Zaumzeug auf der Erde lag. Es schien frisch poliert und blitzte nur so in der Sonne. Sicher hatte es jemand verloren.
Aber wer? Diesen Weg nutzte eigentlich nur, wer zum Steinurshof wollte. Wahrscheinlich würde sie demjenigen, der den Zaum verloren hatte, auf ihrem eigenen Hof begegnen. Ein Reisender konnte nicht ahnen, wie ungern der Hausherr Besuch empfing. Dennoch würde Torger jedem Fremden Essen und einen Schlafplatz zur Verfügung stellen. Er wollte nicht ins Gerede kommen. Den meisten Isländern war die Gastfreundschaft heilig, denn manchmal bedeutete eine Nacht im Freien den Tod.
Salbjörg hielt das Pferd an und ließ sich aus dem Sattel gleiten. Es tänzelte am Zügel, während sie sich nach ihrem Fund bückte.
Im selben Augenblick, in dem sich ihre Finger um das Leder schlossen, sah sie ihn. Salbjörgs Herz schien auszusetzen. «Gnade Gottes!», keuchte sie.
Der Mann, der dort lag, rührte sich nicht. Er schlief nicht, das war ihr sofort klar. Niemand, der sich schlafen legte, tat das auf verholztem Gestrüpp und mit derart verrenkten Gliedern.
War er tot?
«He da! Hörst du mich?»
Salbjörgs Knie fühlten sich weich an, die Füße wie mit dem Boden verwachsen.
Der Mann lag reglos da. Sie konnte nur seinen Rücken sehen, der Kopf wurde von dem Sattel verdeckt, den er offenbar ebenfalls bei sich getragen hatte.
Ihm muss ein Unglück zugestoßen sein, fuhr es ihr durch den Kopf. Sein Pferd ist verunglückt, und er hat es zurücklassen müssen.
Das Zaumzeug in ihrer Hand war von guter Qualität, auch der Sattel sah gepflegt aus, und die Kleidung des Fremden gehörte zu keinem ärmlichen Besitzer. So jemand täuschte doch nicht vor, verletzt zu sein, um einer einsamen Frau aufzulauern!
«Du, verhalte dich still», mahnte Salbjörg ihre Stute, während sie die Zügel um einen jungen Baum wickelte. Kurz blieb sie unschlüssig stehen. Vielleicht sollte sie doch besser erst zum Hof reiten und Torger holen? Aber dann war es womöglich zu spät, und der Fremde starb … Wenn er nicht bereits tot war.
Von einem Toten ging allerdings auch keine Gefahr mehr aus. Salbjörg biss die Zähne aufeinander und ging näher.
Da! Er atmete. Oder bildete sie sich das nur ein? Sie wartete ab, lauschte auf ihren eigenen schnellen Herzschlag und starrte auf den Rücken des Mannes. Eine kleine Ewigkeit verstrich, bevor sich die Rippen unter dem nächsten Atemzug hoben und senkten.
So atmete kein Mensch, der bei Bewusstsein war.
Sofort fühlte Salbjörg sich sicherer.
Schnell lief sie zu dem Ohnmächtigen, zog den Sattel zur Seite, der stark nach Pferdeschweiß roch, und kniete neben dem Fremden nieder.
Es war ein junger Mann, die Gesichtszüge ungewöhnlich kantig für einen Isländer. Oder war es der Schmerz, der ihn zeichnete? Denn Schmerzen hatte er zweifellos gehabt, bevor er bewusstlos geworden war. Ganz deutlich konnte sie getrocknetes wie frisches Blut an seiner rechten Hand ausmachen.
«Mein Herr, kannst du mich hören?», versuchte sie es erneut und berührte ihn an der Schulter.
Als nichts geschah, nahm sie ihren Mut zusammen und drehte ihn auf die Seite.
Es war schwieriger als gedacht, der Verletzte war schwer, und ständig kamen ihr die sperrigen Sträucher in den Weg.
Als er endlich anders lag, entwich ihm ein Stöhnen.
Salbjörg zuckte zurück, fasste sich aber rasch wieder.
«Wo bist du verletzt? Wie ist das passiert?»
Die Augenlider des Fremden zitterten, während er darum kämpfte, wach zu werden. Sobald er sie schließlich öffnete, schienen seine hellblauen Iriden Salbjörg anzuziehen wie brüchiges Eis den glücklosen Wanderer. Um das ungewöhnliche Gletscherblau zog sich jeweils ein schwarzer Kranz. Hell und dunkel. Der Mund war schmal, die Haut aufgesprungen. Braunes Haar bedeckte die hohe, blutbesudelte Stirn.
Sie kannte diesen Mann, wurde ihr plötzlich klar – doch als sie ihn das letzte Mal gesehen hatte, war er fast noch ein Junge gewesen. Er war der jüngste Sohn vom Ketilshof und besaß die typischen eckigen Brauen, die alle Kinder des alten Ketil Bjarnarson zeichneten und ihnen etwas Energisches, ja beinahe Verschlagenes gaben.
Sie hatte den Namen des Jüngsten vergessen, aber damals, bei ihrer letzten Begegnung vor sieben oder acht Jahren, war er bei einem Pferderennen geritten und hatte sich gegen seine erwachsenen Gegner durchgesetzt, obwohl ein heftiges Gewitter tobte. Bei dem Rennen waren zwei Reiter mit ihren Pferden verunglückt, einer davon war gestorben.
Viele Tage nach dem Rennen, das jedes Jahr zum Schaftrieb stattfand, hatte sie noch an den mutigen Jungen denken müssen, der es bei diesem Höllenritt mit erfahrenen Männern aufgenommen hatte.
Was für ein Mensch war aus ihm geworden? Ein Draufgänger? Man erzählte sich, dass auf dem Ketilshof Glück und Unglück besonders nahe beieinanderlagen.
Ein Beben durchlief den Körper des Mannes, und er presste die blutige Hand auf seine rechte Seite. Dort musste die Verletzung sein, die ihn so plagte. Er verzog das Gesicht vor Schmerzen.
«Lass mich mal sehen.» Vorsichtig versuchte sie, seine Hand zur Seite zu ziehen, doch er stieß sie mit letzter Kraft fort.
«Geh weg, lass mich allein.»
«Dann wirst du sterben!»
«Dann ist es so.»
«Es ist meine Christenpflicht …»
Sein eisiger Blick schnitt ihr das Wort ab. «Nein», knurrte er nur und schloss gepeinigt die Augen.
Seine heftige Ablehnung weckte wieder die tiefsitzende Angst in ihr, die ihr Mann Torger unverrückbar in ihr Herz gepflanzt hatte.
Doch dieser Fremde war dem Tod näher als dem Leben.
Er kann mir nicht gefährlich werden, beschwor sie sich.
«Entweder du lässt mich dir helfen, oder ich hole meinen Ehemann und schicke nach einem Arzt.»
Der Verwundete ließ die Hand sinken.
Erleichtert zog Salbjörg den verkrusteten Stoff auseinander, doch dann stockte ihr vor Schreck der Atem. Da war eine Stichverletzung wie von einem Messer. Die Haut darum war angeschwollen und glühend heiß. Die Wunde hatte sich nicht geschlossen, und es traten Blut und eine trübe Flüssigkeit aus. Das war nicht gut. Salbjörg beugte sich vor und roch an der Wunde. «Wann ist das passiert?»
«Gestern, vielleicht auch vorgestern. Ich habe mein Gefühl für die Zeit verloren.»
«Hast du noch mehr Verletzungen?»
«Am Bein. Ich kann nicht mehr weiterlaufen.»
«Wo wolltest du denn hin?»
«Weg», stöhnte er, «nur weg.»
Er ist gesetzlos, schoss es Salbjörg durch den Kopf, dieser Mann ist gefährlich. Erzählte man sich nicht, dass der Teufel oft mit einem hübschen Gesicht daherkam? Vielleicht sollte sie ihn doch einfach hier liegen lassen, vielleicht war es besser so. Aber ihr Gefühl sagte etwas anderes. Sie musste ihm helfen.
«Ich habe ein Pferd. Du wirst bis zum Hof reiten müssen.»
«Nein, bitte.» Er sah sie aus seinen betörend blauen Augen an. «Niemand darf wissen, wo ich bin.»
Also stimmte ihre Ahnung. Sie nahm all ihren Mut zusammen. «Hast du ein Verbrechen begangen?»
Er zögerte, suchte nach den richtigen Worten. «Ich weiß es nicht», brachte er endlich hervor.
Salbjörg musterte ihn unschlüssig. Er schien die Wahrheit zu sagen, zumindest speiste er sie nicht mit einer simplen Lüge ab. Fieberhaft überlegte sie, was sie tun sollte. Hier bleiben konnte er nicht, auf den Hof bringen konnte sie ihn auch nicht.
«Es gibt eine kleine Hütte auf Austurengi, nicht weit von hier. Wir treiben die Schafe erst in einigen Wochen auf diese Weide», schlug sie ihm endlich vor.
Er richtete sich unter großer Anstrengung auf. «Danke, ich werde es dir vergelten, wenn ich kann. Aber ich kenne deinen Namen noch nicht.»
«Salbjörg Jakobsdóttir», erwiderte sie unsicher. War es richtig, ihm ihren Namen zu nennen? «Du bist ein Sohn Ketil Bjarnarsons, nicht wahr?»
Er schien erschrocken darüber, dass sie ihn erkannt hatte. «Erlendur, der Jüngste», gab er schließlich zu.
«Komm, es wird bald dunkel. Mein Mann soll keinen Verdacht schöpfen.»
Sie zog ihn hoch, so gut sie konnte, bis er schwankend auf die Beine kam. Erlendurs Gesicht war kreidebleich, er blinzelte, als würde ihm schwarz vor Augen.
«Geht es?»
Er nickte nur und hielt sich an einem dürren Baum fest, der sich unter der Belastung gefährlich bog.
Salbjörg führte ihre Stute ganz nah an ihn heran und half ihm in den Sattel, den er unter größter Anstrengung erklomm. Er musste sich an der Mähne des Pferdes festhalten, um nicht herunterzufallen, während Salbjörg zu Fuß den Weg zur Schäferhütte von Austurengi einschlug.
Der Himmel war feuerrot, als sich Salbjörg in den Sattel schwang, zuerst zum Küstenweg zurückritt und sich dann im raschen Tölt heimwärts wandte.
Sie hatte Erlendurs Wunden, so gut sie konnte, verbunden und ihn bei Einbruch der Dämmerung zurückgelassen, obwohl es ihr schwergefallen war.
Salbjörg hatte ihm untersagt, Feuer zu machen, das wäre zu auffällig gewesen. Zum Glück lagerte in der Hütte noch immer etwas Heu, Erlendur hatte sich mitten hineingelegt und sich in seinen warmen Umhang gewickelt. Zusätzlich hatte Salbjörg eine dicke, duftende Heuschicht über ihn gedeckt.
Ein wenig Wasser und ein Stückchen alter Schafskäse waren alles, was sie noch an Proviant bei sich gehabt hatte. Erlendur bekam beides. Als Salbjörg aufbrach, war er bereits in einen tiefen Schlaf gesunken.
Je näher sie dem Hof kam, desto angespannter wurde sie. Die Gebäude von Steinurshof lagen in einem langgestreckten Tal, das sich von den Gletschern bis zum Meer zog. Es war fruchtbares Land, viele Nachbarn beneideten sie um die Wiesen, die schon früh im Jahr schneefrei waren und gutes Gras trugen. Sogar Kartoffeln, Rüben und Kohl konnte sie in ihrem kleinen Garten anbauen. Für Getreide reichte es dennoch nicht, Hafer und Gerste reiften in den kurzen Sommern nicht aus und taugten allenfalls als Viehfutter.
Es gab ein Wohnhaus und zwei Stallgebäude, alle bestanden aus übereinandergeschichteten Grassoden, Torf und Steinen.
Stolz war Salbjörg auf die zwei Fenster im Wohnhaus, die nicht aus Schafsblase, sondern aus echtem Glas bestanden und den ganzen Weg aus Reykjavík auf dem Pferderücken transportiert worden waren.
Besonders im Frühjahr, wenn die Tage lang wurden und es nur wenig zu tun gab, genoss sie es, davorzusitzen und zu stricken oder in ihrer Bibel zu lesen.
Nun konnte sie ein Licht hinter dem Fenster zur guten Stube ausmachen, und gleich schlug ihr Herz noch ein wenig zaghafter.
Torger wartete also bereits auf sie. Sicher war er nicht besonders gut gelaunt; das Essen hätte längst auf dem Tisch stehen müssen. Ihr Ehemann war keiner, der sich selbst etwas zubereitete. Er erwartete, dass sie ihren Pflichten nachkam, und eigentlich war es ja auch richtig so.
Salbjörg hatte ihr Ehegelübde aus voller Überzeugung geleistet und versucht, es in den darauffolgenden Jahren so gut wie möglich zu erfüllen. Aber das änderte nichts daran, dass ihr Ehemann ein Tyrann war, dem sie nichts recht machen konnte. Er genoss es einfach zu sehr, über sie zu herrschen.
Ihre Stute wieherte laut; die Pferde im Gatter gaben Antwort. Jetzt wusste auch Torger, dass sie heimkam.
Schon konnte sie im letzten Abendlicht sehen, wie er aus dem Haus trat, ein dunkler, klobiger Schemen vor der rot gestrichenen Tür, bedrohlich wie eine Kreatur aus alten Sagen. Sie spürte seinen Blick schon von weitem. Er drückte ihr auf die Brust, als läge ein Stein darauf.
«Ich dachte schon, die Erde hätte sich aufgetan und mein Weib verschlungen», spie Torger ihr entgegen, sobald Salbjörg in Hörweite war.
Ihre Stute scheute. Sie mochte Torger nicht, und im Gegensatz zu ihrer Reiterin durfte das Tier seine Gefühle zeigen. Manchmal kam Salbjörg sich vor wie ein Stein, während alles Leben um sie herum die Empfindungen zeigte, die sie selbst zu verbergen suchte. Fieberhaft suchte sie nach einer Antwort. Ihr wollte einfach nicht einfallen, was sie sagen sollte, um Torgers Zorn zu entgehen.
Er musterte sie wie eine Fremde. Kurz blieben seine Augen an den Füchsen hängen, da kam ihr eine Idee. «Ich habe die Zeit vergessen, es tut mir leid. Es hat gedauert, bis der zweite in die Falle gegangen ist.» Schnell sprang sie aus dem Sattel, zog die Füchse herunter und hielt sie ihrem Mann hin. «Schau, wie groß sie sind! Ich weiß doch, wie gerne du Fuchsfleisch isst.»