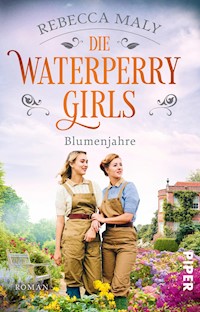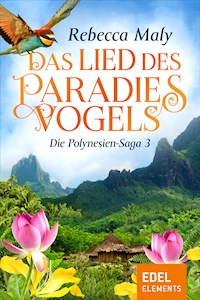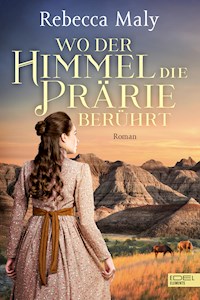
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Montana, 1871: Solange sie denken kann, zieht die rebellische Mary mit ihrem Vater, dem gestrengen Wunderheiler Joshua Jerobe, in einem Planwagen durch die Prärie. Nichts wünscht sie sich sehnlicher als einen Ort, an dem sie sesshaft werden kann. Als ihr Vater nach einer schweren Verletzung beschließt, sich als Lehrer an einer Schule für indianische Waisenkinder in dem beschaulichen Dörfchen Ulyssus' Rest niederzulassen, verliebt sich die junge Frau gegen alle Widerstände in den Halbblut-Cree Timothy. Doch der ist mit einem gefährlichen Auftrag nach Ulyssus' Rest gekommen, und schon bald muss Mary für die Liebe alles aufs Spiel setzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 489
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Kurzbeschreibung
Montana, 1871: Solange sie denken kann, zieht die rebellische Mary mit ihrem Vater, dem gestrengen Wunderheiler Joshua Jerobe, in einem Planwagen durch die Prärie. Nichts wünscht sie sich sehnlicher als einen Ort, an dem sie sesshaft werden kann.
Als ihr Vater nach einer schweren Verletzung beschließt, sich als Lehrer an einer Schule für indianische Waisenkinder in dem beschaulichen Dörfchen Ulyssus‘ Rest niederzulassen, verliebt sich die junge Frau gegen alle Widerstände in den Halbblut-Cree Timothy.
Doch der ist mit einem gefährlichen Auftrag nach Ulyssus‘ Rest gekommen, und schon bald muss Mary für die Liebe alles aufs Spiel setzen.
Rebecca Maly
Wo der Himmel die Prärie berührt
Roman
Edel Elements
Edel Elements
Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2021 Edel Germany GmbH Neumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2021 by Rebecca Maly
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Agentur Arrowsmith.
Covergestaltung: Anke Koopmann, Designomicon
Lektorat: Sarah Heidelberger
Korrektorat: Susann Harring
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-96215-379-3
www.instagram.com
www.facebook.com
www.edelelements.de
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Epilog
KAPITEL 1
Montana, 1867
In der Morgendämmerung strich ein Kojote durch das hüfthohe Gras, sein gelbgrauer Pelz war perfekt an die Farbe der trockenen Prärie angepasst. Er verschmolz mit den Halmen, wurde zu einem flüchtigen Schatten im Gräsermeer.
Mary hockte mit gerafftem Rock hinter einem Manzanita-Strauch und beobachtete den vierbeinigen Räuber genau. Der Kojote hatte sie noch nicht bemerkt. Neugierig schnüffelte er mit hocherhobener Nase nach dem Planwagen.
Als sich Mary nun erhob, stieß er ein erschrockenes Bellen aus und stob mit gesträubtem Fell und herabgebogener Rute davon. Sie beachtete das Tier nicht weiter. Von einem einzelnen Kojoten hatte ein junges Mädchen nichts zu befürchten.
Gähnend lief sie zu einem kleinen Wasserlauf und wusch sich hastig. Ihr Magen knurrte schon, seitdem sie mitten in der Nacht davon aufgewacht war, doch nun wurde er richtig laut. Warum nur konnte sie sich nicht einfach an den Hunger gewöhnen wie an andere Fährnisse ihres Lebens auch?
Bis zum Frühstück dauerte es noch eine Weile. So war es stets. Und wie an anderen Tagen würde sie das flaue Gefühl bei den anstehenden Aufgaben begleiten.
In dieser Sache war der Vater streng. Unzureichende Tüchtigkeit wurde mit dem Riemen und fehlenden Mahlzeiten belohnt. Daher säumte Mary nicht und blieb nur so lange am Wasser, wie unbedingt nötig war. Das eisige Nass ließ ihre Wangen und Hände rosig werden. Hastig kämmte Mary ihr kastanienbraunes Haar aus und flocht es neu. Es war dicht und wellig, der Zopf reichte ihr bis hinab zur schmalen Hüfte. Ihr Haar, so fand sie, war das Hübscheste an ihr, der Rest war gefällig, aber mehr auch nicht. Das war vielleicht auch gut so, denn die hübschen Mädchen bekamen immer Probleme. Flach wie ein Waschbrett war sie angeblich, und genauso knochig.
Sie steckte den Hornkamm in die Tasche ihrer Kittelschürze, in der sie auch ein Stückchen trockenes Brot aufbewahrte. Vom Planwagen zog Kaffeegeruch herüber. Hoffentlich ließ Vater ihn nicht wieder anbrennen. Ihm war es gleich, wie bitter das Gebräu wurde, solange es nur wach machte.
Mary lief auf leisen Sohlen durch das hohe Gras. Schopfwachteln piepsten unsichtbar im Gebüsch. Hinter einer Gruppe hartblättriger Eichen entdeckte sie zwei dunkle Schemen. Wie große, von Wind und Regen rund geschliffene Felsen standen die Büffel da. Der vordere hob den zottigen Kopf und entdeckte Mary sofort. Sie hielt einen Moment lang inne, nahm das Stückchen Brot aus der Tasche, legte es lockend in die vorgestreckte Hand.
Langsam ging sie näher, streifte mit den Fingerspitzen durch das Gras, die Warnungen vor gefährlichen Spinnen missachtend. Der Bison hielt beim Fressen inne. Seine kleinen, dunklen Augen musterten sie. Aus dem Maul tropfte dünnflüssiger Speichel.
„Komm, George, komm“, flüsterte Mary und streckte die Hand mit dem Brot weiter aus. Ein warmer Atemstoß, ein feuchtes Maul. Der Bison nahm den Bissen mit der Zunge.
Mary rieb über die breite, wollige Stirn. Warmer, vertrauter Moschusgeruch entstieg dem Fell, an dessen Spitzen sich Morgentau gesammelt hatte. Georges Buckel war höher als sie. Es erschien ihr jeden Tag aufs Neue wie ein Wunder und Geschenk Gottes, dass sie diesem gewaltigen Tier so nahe kommen durfte.
Sie kraulte den Bison hinter dem Ohr, dann haschte sie nach dem dünnen Seil, das am Nasenring befestigt und, damit es nicht beim Grasen störte, um die Hörner gewickelt war.
George schnaufte missmutig und ergab sich seinem Schicksal. Mary löste die Hobbel, eine Fessel aus zwei Lederriemen an den Beinen, mit der die Tiere in der Nacht keine großen Schritte machen konnten. „Komm, gehen wir, George.“
Der Büffel trottete hinter ihr her zum Planwagen, Brother kam in ungelenken, hüpfenden Schritten nach. Wo George hinging, da folgte er.
„Na, das hat gedauert, Mädchen“, murrte der Vater. Er war ein schlanker Mann, sehnig wie ein Windhund, mit einem spitzen Gesicht und großen, wässrigen Augen. Sein dichter, dunkelblonder Backenbart, auf dessen Pflege er großen Wert legte, lenkte von der wachsenden Glatze ab. Auch an diesem Morgen hatte er direkt einen Hut aufgesetzt. Mary wusste, dass ihr Vater eitel war. Es gehörte wohl zu seinem Beruf als fahrender Barbier und Verkäufer von Salben, Tinkturen und allerlei Wunderdingen, selbst das beste Aushängeschild für seine Produkte zu sein. Doch sie hätte nie gewagt, das zu erwähnen.
Mary machte George am Planwagen fest und begann, Klettensamen und Grannen aus dem dichten Fell zu zupfen. Der Bison schlug mit dem Kopf. Er mochte den Vater nicht. Joshua Jerobe hatte das Gespann in einem Würfelspiel gewonnen. Nach drei Jahren des Herumziehens war es zu seinem Markenzeichen geworden. Nun kannte jeder auf ihrer langen Reisestrecke den Barbier und Heiler mit dem Bisongespann.
Die Tiere mussten stets ihren Dienst tun, auch wenn es bedeutete, dass sie von morgens bis abends schufteten. Joshua Jerobe duldete keine Schwäche, und er sparte nicht mit der Peitsche.
Vom ersten Tag an hatten die Bisons Mary fasziniert. Sie waren über die Jahre Freunde geworden, und sie konnte es nicht ertragen, wenn der Vater bös zu ihnen war. Deshalb murrte sie auch nicht, weil Joshua es mehr und mehr ihr übertrug, sich um George und Brother zu kümmern.
„Setz dich, Mary“, erklang die knurrige Stimme des Vaters. Es war ungewöhnlich, dass sie aßen, bevor sie mit ihren Arbeiten fertig war. Sie sah sich fragend zu ihm um.
Er zog die Nase hoch und spuckte ins Feuer. „Worauf wartest du? Setz dich, oder willst du dort festwachsen? Ich muss gleich noch Waren vorbereiten, dann kannst du anschirren.“
„Natürlich, Vater.“
Sie kniete sich neben das Feuer, goss Kaffee ein und roch sofort, dass er verbrannt war. Der Vater schob ihr eine Schüssel mit Getreidebrei herüber, in den er den Rest der Bohnen vom Vortag sowie einige papierdünne Streifen Speck eingerührt hatte.
Mary aß hastig. Sie war so hungrig, dass sie den faden Geschmack kaum bemerkte.
Joshua und Mary Jerobe hatten sich ihr karges Leben zu zweit gut eingerichtet, ein jeder kannte seine Aufgaben. Das war nicht immer so gewesen. Nach Mutters Tod war der Vater zu einem Fremden geworden. Er litt unter bösen Launen, beschimpfte und schlug seine Tochter, als mache er es ihr zum Vorwurf, dass sie die Grippe überlebt hatte, die ihm die Ehefrau nahm.
Nun, drei Jahre später, verstand Mary, dass ihm die Trauer beinahe den Verstand genommen hatte und er die Wut über das erlittene Schicksal an ihr ausließ. Dass auch sie einen wichtigen Menschen verloren hatte, schien er in seinem Wahn nicht zu bemerken. Sollten sie nicht lieber zusammenrücken und an dem festhalten, was geblieben war? Sie hatten schließlich noch einander, oder nicht?
Mary mochte nicht darüber nachdenken, wie sie selbst empfunden hatte. Von einem Tag auf den anderen war ihre kleine Welt zusammengebrochen. Und doch hatte sie den Kopf nicht hängen lassen. Die Verzweiflung des Vaters war ihr zur Mahnung geworden. Sie durften sich nicht beide verlieren, wenn sie in dieser harschen Welt bestehen wollten.
Noch immer schmerzte jeder Gedanke an Mutter Amalia, deren Aufgaben sie klaglos übernommen hatte und mittlerweile sogar gut beherrschte.
„Sind die Banner bereit?“, fragte der Vater und riss sie damit aus den Gedanken.
„Gewaschen und gestärkt.“
„Gutes Mädchen.“ Er hatte einen kleinen Klappspiegel vor sich aufgebaut und schmierte sich nun die Zähne mit einer von ihm entwickelten Mischung aus Salbei, Bleichmittel und Salz ein. Kräftig rieb er mit einem faserigen Stöckchen darüber.
Marys Laune sank. Er würde erwarten, dass sie sich ebenfalls mit diesem widerlichen Gebräu behandelte, von dem ihr noch stundenlang die Lippen brennen würden. Unser Lächeln ist unser Kapital, würde er dann wieder sagen.
Und recht hatte er. Jedes Mal, wenn sie an einen neuen Ort kamen, war die Mixtur eine ihrer besten Einnahmequellen. Vater war Barbier und, wie böse Zungen es nannten, ein Quacksalber.
Er zog Zähne, rasierte Gesichter, öffnete Furunkel und renkte Glieder ein. Gelegentlich kurierte er nicht nur den Durchfall der Kinder eines Farmers, sondern Pferd und Hund gleich mit. Dazu verkauften sie eine große Auswahl von Salben, Tinkturen, Kräutern und Heilwässerchen. Als Besonderheit predigte Vater auch noch aus der Bibel und bot im Anschluss Wundermittel gegen jegliches Leiden an. Läppchen, Holzstückchen und Bruchstücke von Hostien, deren Wirkmächtigkeit vom Kontakt mit einer Heiligenfigur stammten. Was selbstverständlich ausnahmslos erstunken und erlogen war. Es gab keine Heiligen, niemand segnete die Stoffstückchen, und die Hostien buk Mary selbst.
Auf der Seite des Wagens war ein großer Zahn aufgemalt, weiß und eben, wie er sein sollte. Wie das Lächeln der Jerobes.
„Warst du schon einmal in John’s Grove, Vater?“
„Nein, und nun trödeln wir nicht länger, es gilt, Geld zu machen.“
„Ja, Vater.“
Mary wusch eilends das wenige Geschirr und verstaute es, dann putzte sie die beiden Bisons heraus und schirrte sie an. Sie trugen umgearbeitete Pferdetrensen, der Rest bestand aus Vorderzeug, das auch Ochsen gepasst hätte. Das Leder war geölt und poliert. Bunte Bänder und Kupferglöckchen lenkten zusätzliche Aufmerksamkeit auf das ungewöhnliche Gespann.
Brother schüttelte unwillig das zottige Haupt. Er hasste das enervierende Bimmeln.
Mary war sich sicher, dass die Tiere den Feiertagsschmuck auch mit dem Aufenthalt in einer Siedlung verbanden, was für sie meist ein unangenehmes Erlebnis war. Jeder wollte die Tiere anfassen, wofür Joshua Jerobe ebenfalls Geld verlangte.
Im Planwagen klimperte und klirrte es, als Vater die letzten Tinkturen in kleine Fläschchen umfüllte. Wenn Mary dem Vater bei der Herstellung half, enthielt sie sich jedes Kommentars. Vieles von dem, was aus Kräuterextrakten und Mineralen hergestellt wurde, war sicherlich wirksam und nützlich, aber bei den Wundermitteln kam mehr zum Einsatz. Zu den Geheimrezepturen gehörten Pilze, verbranntes Horn und Knochen, Bisonwolle, kleine Frösche, glänzende Käferflügel – nach den Biestern musste sie oft von morgens bis abends suchen - sowie manchmal etwas von ihrem Haar, viel öfter aber Urin. Angeblich steigerte Jungfrauenurin bei Männern die Potenz und bei Frauen die Fruchtbarkeit. Schon beim Gedanken daran, wie die Gutgläubigen die Tinktur tranken, verzog Mary den Mund.
Es war Mittag, als sie mit großem Lärm und Getöse in John’s Grove einzogen. Es war ein Straßendorf, wie es seiner unzählige gab. Eingebettet in Buschland, weiche Hügelketten und Weideland reihten sich Blockhäuser und das eine oder andere aus gefügten Feldsteinen aneinander. Es gab eine kleine Kirche mit weißgetünchter Fassade und einem etwas abseits errichteten Glockentürmchen, das auf Mary ein wenig verloren wirkte. Wie ein Hund, der vor die Tür gejagt worden war.
Sie lenkte das Bisongespann im Stehen vom Kutschbock aus. Brother drängte sich wie immer ein wenig zur Deichsel hin, näher an seinen Kameraden George, der den Einzug in den Ort gelassener vollzog. Mary zupfte an den Leinen und war sich des Aufsehens, das sie erregte, voll bewusst. Ein zartes, dünnes Mädchen in einem unscheinbaren Kleid, den Kopf mit einem weißen Tuch bedeckt wie eine brave Quäkerin, lenkte ein Gespann halbwilder Tiere. Und das offensichtlich mühelos.
Der Vater ging in seinem dunkelbraunen Anzug voraus, ein großes, schlichtes Kreuz um den Hals, auf dem Kopf einen Zylinder, der ihn aussehen ließ wie einen gelehrten Herrn.
Er schlug mit großer Geste auf eine umgehängte Trommel. Seine Stimme war geschult wie die eines Predigers, und genauso klang er auch, als er ankündigte: „Joshua Jerobe und sein Büffelgespann sind in eurer Stadt, liebe Leute, verehrte Damen, geschätzte Herren! Schmerzt der Zahn? Ist der Rücken verrenkt? Jerobe wird es richten! Magenschmerzen, Pein im Kopf, Flatulenzen? Im Nu ist das vorüber, habt ihr erst einmal die richtige Pille, das richtige Wässerchen. Kommt her, liebe Leute, kommt her!“
Auf einen Wink ihres Vaters fuhr Mary einen Bogen auf dem Dorfplatz und hielt an, während ihr Vater weitere Produkte anpries und die Menschen auf die Straße geströmt kamen. Dieser Ort war wie so viele andere zuvor. So wie auch jeder Tag war wie der andere.
Die Leute arbeiteten viel und hart, und vom täglichen Einerlei gab es bis auf Markttag und Kirchgang keine Abwechslung. John’s Grove hatte vermutlich noch nie Besuch von Gauklern oder einer fahrenden Menagerie erhalten. Die Jerobes waren also eine echte Attraktion.
Schnell waren der Stand aufgebaut und die Ware ausgestellt. Der Vater richtete unterdessen seinen Arbeitsplatz unter freiem Himmel ein. Mary nannte es den Folterstuhl. Ein schweres Möbel mit allerlei Riemen und Spangen, mit denen der leidgebeutelte Patient ruhiggestellt wurde. Wie immer kamen jene zuerst, die am meisten litten und sich keinen anderen Rat mehr wussten, als sich einem fahrenden Barbier und Wunderheiler anzuvertrauen. Und es kamen jene, die sich am Leid anderer ergötzen wollten.
Vater legte seine Werkzeuge aus, die zum Zähneziehen, für den Aderlass und das Schienen von Knochen nötig waren, daneben fanden Klistiere, Messer, Salbentöpfchen und Verbände Platz. Seine einstudierte Nummer ließ ihn ein wenig so wirken wie einen Folterknecht, der seinen Opfern vor dem peinlichen Verhör die Daumenschrauben zeigte.
Ein Väterchen, gebeugt und die Hand auf die geschwollene Wange gedrückt, hielt sich bislang im Hintergrund, doch Mary ahnte, dass sie den ersten Patienten vor sich sah. Die meisten Leute hatten ganz zurecht Angst vor der Behandlung.
„Tretet näher, gute Leute, treten näher. Scheut euch nicht, hier wird euch mit Gottes Hilfe wohlgetan!“, rief Mary und breitete einladend die Arme aus. „Die erste Behandlung des Tages ist umsonst!“
Plötzlich kam Bewegung in die Menge. Der Alte mit dem schmerzenden Zahn drängte sich überraschend energisch nach vorn. „Ich, fangen Sie mit mir an, Mister!“
Der Vater legte ihm eine Hand auf die Schulter und führte ihn mit gewinnendem Lächeln zu dem Behandlungsstuhl.
Drei Jungen, die im wachsenden Publikum standen, stießen sich gegenseitig an und machten schlechte Scherze. „Gleich schreit der alte Dempsey wie ein abgestochenes Schwein, wollen wir wetten?“
Mary hasste Jungen wie diese. Ihr Spott machte es den Menschen, die ohnehin schon litten, noch schwerer. Doch sie wusste ein Mittel gegen solche Burschen. Vater durfte sie nur nicht dabei erwischen.
Die Gelegenheit war günstig. Aller Augen waren auf den Alten gerichtet, der sich nach kurzer Inspektion des entzündeten Zahns auf dem Stuhl festschnallen ließ und dabei vor Angst zitterte.
Mary nahm eine Schleuder und einen Stein aus der Kittelschürze und schätzte die Entfernung ab.
„Quiek, quiek, schrei doch!“, keifte der Anführer der drei, dann schrie er plötzlich selbst schrill auf und presste mit hochrotem Kopf die Hände zwischen die Beine. Als er sich mit Tränen in den Augen nach dem Übeltäter umsah, hatte Mary die Schleuder längst wieder in der Tasche verschwinden lassen und stapelte an ihrem Verkaufsstand Tiegelchen mit Warzensalbe. Ein Grinsen konnte sie sich dennoch nicht verkneifen. Noch ein dummer Spruch, und dem Nächsten tun die Nüsse weh, dachte sie grimmig. Sie hatte noch niemals danebengezielt.
Mary war geübt mit der Schleuder. Der Vater hatte es ihr schon in jungen Jahren beigebracht, um Präriehunde, Wachteln und mit etwas Glück den einen oder anderen Wüstenhasen zu erlegen.
Manchmal zogen sie lange durch unbewohnte Gegenden, und da war jeder kleine Jagderfolg ein Segen. Das war auch schon so gewesen, als die Mutter noch gelebt hatte. Damals reisten sie noch mit einem Pferdegespann von Ort zu Ort. Mutter hatte es nicht gern gesehen, wenn Mary auf die Pirsch ging, doch da die Ehe der Jerobes keinen Sohn, sondern nur ein Mädchen hervorgebracht hatte, akzeptierte sie es. So bekam Mary Übung mit der Schleuder.
Ein Junge, nur wenige Schritt von ihr entfernt, der sich im Gegensatz zu einer hektischen Wachtel kaum vom Fleck rührte, war für sie ein sicheres Ziel.
Vater setzte die Zange an, und der alte Mann begann zu schreien. Mary fühlte, wie sie sich anspannte, auch wenn sie sich eigentlich längst daran gewöhnt hatte. Sie wusste, was nun von ihr erwartet wurde. Schnell füllte sie ein Glas mit selbstgemachtem Kräuterschnaps.
In diesem Moment riss Vater dem Alten mit einer dramatischen Geste den Zahn heraus. Es folgten ein langgezogener Schrei, saftige Flüche und eine Welle von Gestank.
Die Zuschauer applaudierten, während Joshua Jerobe den schwärzlichen Zahn herumzeigte und jeden darauf hinwies, dass er ihn perfekt, mitsamt der Wurzel, entfernt hatte.
Dem alten Mann liefen Blut, Speichel und Eiter aus dem Mund. Er war kreidebleich, die Augen glasig, aber das Schlimmste hatte er überstanden.
„Mister, Mister, spülen Sie den Mund aus und spucken Sie die verderbten Säfte aus. Hier haben Sie Wasser.“ Mary drückte ihm ein Wasserglas in die Hand und machte zugleich die Lederriemen los, mit denen der Patient fixiert war. Das alte Väterchen trank, gurgelte und spuckte, dann ließ es sich mit einem Seufzen in den Stuhl zurücksinken.
„Besser?“
Er nickte nur.
„Dann haben Sie hier noch etwas Kräftiges. Einen guten Kräuterschnaps, den kann ich zur Nachbehandlung sehr empfehlen. Den ersten Schluck gurgeln und ausspucken, den zweiten können Sie gern trinken.“
Er nahm das Glas mit beiden Händen und setzte es gierig an. Es musste fürchterlich in der Wunde brennen, doch der Alte bekam eine rosige Gesichtsfarbe, gurgelte lange und spuckte aus. „Teufel noch eins“, knurrte er, dann setzte er das Glas wieder an und trank es leer.
***
Hudsonstraße, vor der Ungava-Halbinsel, Juli 1867
„Pull, pull, pull“, schrie der Harpunier gegen die kalte Atlantikgischt an, die sie alle wie ein eisiger Regen durchtränkte. Timothy ruderte, als hinge sein Leben davon ab, und das tat es gewissermaßen auch. In ihrem kleinen Holzboot waren sie den gewaltigen Wogen und dem verwundeten Wal, der jeden Moment wieder aus den dunklen Tiefen auftauchen konnte, schutzlos ausgeliefert.
Timothy war gerade erst siebzehn Jahre alt und mit Abstand der Jüngste in diesem Boot. Sie behandelten ihn wie eine Last, dabei wusste er genau, dass er sich zumindest im Rudern mit den anderen Männern messen konnte. Sein Vater aber war der eigentliche Grund, aus dem man ihm zähneknirschend ein Grundmaß an Respekt entgegenbrachte. Noah Anteo war Harpunier, einer der besten, die es auf dem Walfänger Windspirit gab, und Timothy glaubte fest daran, dass er auch diesen Tag retten würde.
Der Vater war sein Held, sein Vorbild. Deshalb legte er sich mit letzter Kraft in die Riemen, spürte kaum, wie seine schwieligen Hände trotz der Abhärtung aufrissen und sich das Salzwasser hineinfraß. Gleichmäßig wie ein Uhrwerk stieß er sein Paddel in die graugrünen Wogen, zerrte, krümmte den Rücken, in dem jeder Muskel glühte und brannte. Am Horizont im Westen war ein dünner Streifen Festland auszumachen und versank immer wieder hinter Wellenkämmen.
„Pull, pull … Blas, vier Uhr!“
Sie wendeten das Boot, die acht Männer kamen einander auch jetzt nicht mit den Paddeln ins Gehege. Eine Welle brach, stürzte über sie und traf einen jeden von ihnen wie ein eisiger Faustschlag in Gesicht und Nacken.
Timothy prustete, schüttelte sich das Wasser aus dem rabenschwarzen Haar, ruderte und wagte einen kurzen Blick über die Schulter. Sein Vater balancierte mühelos im Bug und hielt die Harpune hocherhoben, während sie sich rasch der Stelle näherten, wo er den Blas, den Atem des Wals, gesehen hatte.
Ihre Beute atmete vier-, fünfmal aus, bevor sie erneut für lange Zeit in der Tiefe verschwand. Ein verwundeter Wal kam häufiger hoch. Mit einem Pfeifen stieß das Tier Atemluft aus. Timothy wusste, dass sein Vater nun warf. Ein dumpfer Knall. Getroffen. Die Männer jubelten. Der nächste Blas war unverkennbar rot, der Wal wälzte sich im Todeskampf. Noah Anteo hatte es wieder einmal geschafft.
Mit einem stolzen Grinsen wandte sich Timothy zu seinem großen Vorbild um, als plötzlich etwas Dunkles heranraste. Die Fluke des Wals, groß wie ein Scheunentor, schmetterte gegen das kleine Boot. Wo eben noch der Harpunier gestanden hatte, war nun nichts mehr, kein Mensch und auch kein Boot. Die Zeit schien stillzustehen. Timothy sah den Wal, wie er sich auf die Seite rollte, das fremd wirkende Auge anklagend auf ihn gerichtet – dann fand er sich plötzlich in eisigem Wasser wieder und schwamm um sein Leben.
Überall waren Holztrümmer, Kameraden, die um ihr Leben schwammen, und Wasser, so viel Wasser. Die Wogen, die über ihn hinwegspülten, waren schaumig. Blut trieb in roten Schlieren umher.
Etwas bohrte sich in Timothys Arm, ein scharfer Schmerz jagte durch sein Fleisch, gefolgt vom Brennen des Salzwassers. Für einen Moment geriet er aus dem Schwimmrhythmus und sank abwärts, aber so leicht gab ein Anteo nicht auf. Prustend kam er wieder hoch. „Vater, Vater, wo bist du?“, schrie er, bevor er sich am Wasser verschluckte und ihn eine Hustenattacke schüttelte. Er griff nach Holztrümmern, drückte sich daran hoch, um weiter sehen zu können.
Die Windspirit war nicht fern. Männer an Bord riefen und winkten, während sie ein Beiboot herabließen. Timothys Ruderkameraden hatten schon die Hälfte der Strecke schwimmend zurückgelegt. Nur er war ihnen nicht gefolgt.
Und Vater.
Der Wal rollte und rollte sich im Todeskampf. Möwen kreisten über ihm, versuchten, auf den Bootstrümmern zu landen. Ihre gellenden Schreie klangen schadenfroh. In diesem Moment hasste Timothy die Biester. Er schwamm mit kräftigen Bewegungen. Trieb dort ein Körper im Wasser?
„Vater!“, keuchte er, fasste den leblosen Mann an den Schultern und riss ihn herum. Ein Stöhnen nahm ihm die schlimmste Befürchtung. Mit der einen Hand hielt er seinen Vater fest, mit der anderen klammerte er sich an ein Stück Treibholz.
Mit den Füßen tretend versuchte Timothy sich weiter von dem Wal wegzubewegen. Grau und alt wie die Zeit sah der Kopf des Ungetüms aus. Hin und wieder holte der Koloss pfeifend Atem, doch jedes Mal schien es angestrengter.
In diesem Moment, während er um sein eigenes Leben und das seines Vaters kämpfte, kam es Timothy vermessen vor, dass der Mensch diesen Leviathanen nachstellte. Hatte nicht schon in der Bibel der Wal den Menschen verschlungen und nicht andersherum? Wie anmaßend war es, dass sie wie Ameisen über diese Riesen herfielen. Da war es nicht verwunderlich, dass die Menschen von ihnen zermalmt wurden.
„Hier, hierher!“, schrie Timothy und ließ für einen Moment das Holzstück los, um den Kameraden im Beiboot zu winken. Sofort schlug eine Welle über ihm zusammen. Nur mit großer Anstrengung durchstieß er erneut die Wasseroberfläche.
Jemand hielt ihm ein Ruder hin. „Hier, Junge, fass zu!“
Sein Vater wurde ihm aus dem Arm gezerrt und stöhnte jämmerlich, als er an Bord gehievt wurde.
Timothy schaffte es aus eigener Kraft, stürzte dann aber zwischen die Ruderbänke und blieb japsend liegen.
„Wir haben alle“, sagte ein Bärtiger, den Timothy nur verschwommen erkennen konnte. „Zumindest alle, die noch leben.“
Timothy hockte neben Vaters Koje. Die winzige Kabine, die sie teilten, nannte er sein Zuhause, fast so lange er denken konnte. Vielleicht wollte er sich an die Zeit davor auch einfach nicht erinnern.
Seine Mutter hieß Margret Maygull und war eine Hure in einem kleinen Fischerort, eine blonde Frau, deren seidiges Haar er in seinen Träumen noch heute manchmal über sein Gesicht streichen spürte. Ihr weicher Körper verströmte einen süßen Duft, der Mund fast immer säuerlichen Alkoholgeruch.
Die Stimme, mit der sie Timothy bedachte, war schneidend. Ganz im Gegensatz dazu, wie sie mit ihren Kunden sprach. Dann waren ihre Worte weich und säuselnd und voller Versprechen auf Zärtlichkeit.
Timothy war ihr Schandfleck gewesen, wenn es so etwas für eine Hure überhaupt geben konnte. Er war schwarzhaarig, seine Haut auch im Winter immer ein wenig zu dunkel. Er war ein Halbblut, mit hohen Wangenknochen und leicht schräg stehenden schwarzbraunen Augen, und der lebende Beweis dafür, dass seine Mutter sich eine Zeit lang nicht zu schade gewesen war, es für Geld auch mit einem Wilden zu treiben.
Sogar für eine Hure war der Ruf von Bedeutung, und Margret Maygull litt unter ihrem.
Stets wurde Timothy davongescheucht. Zu Hause konnten Mutters Freier jederzeit an die Tür klopfen. Also musste er fort. Er trieb sich in den schlammigen Gassen des kleinen Ortes herum, balgte sich mit den halbwilden Hunden um magere Essensreste. Im Winter wurde er bei einer alten Vettel untergebracht, die dafür sorgte, dass er seine Mutter nicht störte und den Freiern nicht unter die Augen kam.
Soweit Timothy sich an diese Zeit erinnern konnte, hatte er als Kind nur das vage Gefühl gehabt, dass etwas fehlte. Die anderen Hurenkinder lebten ähnlich wie er. Sie hielten gegen die anderen Kinder zusammen und spendeten einander die Nähe und den Trost, die sie von ihren Müttern nicht bekamen.
Timothy war sieben gewesen, als er seinen Vater zum ersten Mal sah. Noah Anteo kam zu seiner Mutter, als sie gerade etwas Porridge aufgewärmt hatte. Es war einer ihrer guten Tage. Er erinnerte sich genau an den kleinen, abgewetzten Holztisch, an die dunklen Vorhänge, die heute ausnahmsweise nicht vor das Fensterchen gezogen waren. In der winzigen Wohnung roch es nach abgestandener Luft, Kohl und ranzigem Männerschweiß.
Timothy leckte gerade seinen Teller aus, als es klopfte.
„Nicht jetzt“, hatte seine Mutter gerufen, doch der Freier klopfte wieder und wieder. Also zog sie ihre Schürze aus und richtete ihr blondes Haar, auf das sie so stolz war. Schließlich sprühte sie sich mit einem billigen Parfüm ein, das er wohl bis an sein Lebensende wiedererkennen und genau so lange hassen würde, stand es doch für die fehlende Liebe seiner Mutter und für die Fremden, die sie länger und häufiger umarmte als ihn.
„Da hat es aber jemand nötig“, sagte sie und wies Timothy mit einer herrischen Geste an, zu verschwinden. Aber er ging nicht in die kleine Speisekammer, in der er sonst stets ohne Murren verschwand. Bis heute wusste er nicht, warum.
Die Mutter öffnete einem kräftigen, dunklen Mann. Sein Gesicht war braun und wettergegerbt, die Augen wie kohlschwarze Knöpfe. Das schwarze Haar hing ihm in Strähnen vom Kopf. Er trug die Leinenkleidung eines Fischers, dazu eine Jacke aus speckigem Robbenfell und schwere Stiefel. „Du bist noch immer so schön wie in meiner Erinnerung“, sagte er weich und betrachtete die Mutter mit schiefgelegtem Kopf. So hatte, seit Timothy sich erinnern konnte, noch nie jemand mit ihr gesprochen. Doch seine Mutter bedankte sich nicht für das Kompliment.
„Noah? Du? Was machst du hier?“, stotterte sie und trat scheinbar unbewusst einen Schritt zurück.
Der Fremde nahm es als Einladung. „Ich habe dich in all den Jahren nicht vergessen können, Margret.“
„Ich dich auch nicht, aber nicht, weil du mir so gefehlt hättest.“ Ihr Blick glitt zu Timothy, der nun von seinem Stuhl aufstand. Sofort war ihm bewusst geworden, dass der dunkle Fremde keiner der üblichen Freier war. Es war, als habe er Mutter eine Maske heruntergerissen.
Dem Mann namens Noah rutschte das Bündel von der Schulter. Er starrte Timothy an, dass es dem Jungen angst und bange wurde. Der Fremde schien etwas in ihm zu erkennen. Es war unheimlich.
Timothy stand langsam auf, sah fragend zu seiner Mutter, dann nahm er Reißaus, um sich nun doch in der Speisekammer zu verbergen. Klein zusammengekauert, die Arme um die angezogenen Knie geschlungen, hörte er den Mann mit tiefer Stimme fragen: „Mein Sohn?“
„Was denkst du denn? Du bist der erste und letzte Wilde, mit dem ich mich eingelassen habe.“
Timothy hörte, wie ein Stuhl zur Seite gezogen wurde und jemand sich schwer daraufsetzte. Die Erwachsenen redeten leise miteinander. Er konnte kaum ein Wort ausmachen. Seine Gedanken strudelten wild durcheinander. Er fühlte sich verloren, wie die kleinen Blattschiffchen, die er und seine Freunde manchmal im Meer schwimmen ließen. Nie kehrte eines der primitiven Spielzeuge zurück.
Der Fremde war sein Vater? Timothy hatte nie einen Vater gehabt, und er wollte auch keinen. Christobal und sein Bruder Graham wurden von ihrem Dad regelmäßig mit dem Gürtel verhauen, bis sie nicht mehr sitzen konnten. Von den anderen Kindern, die einen Vater hatten, hörte er nichts Besseres.
Nein, auf einen Vater konnte er verzichten, besonders auf einen mit derart unheimlichen Kohleaugen. Er würde einfach in seinem Versteck ausharren und abwarten, bis der Fremde wieder verschwand. Sicher würden Mama und er bald komische Geräusche machen und der Mann kurz darauf aufbrechen.
Doch Timothy wartete vergebens. Schließlich lugte er vorsichtig aus der Speisekammer. Die Mutter ertappte ihn. „Timothy, komm her und gib deinem Vater die Hand.“
Als er zögerte, rief sie seinen Namen so scharf, dass er zusammenzuckte. Mit gesenktem Kopf und schlurfendem Schritt trat er an den Tisch. Aus dem Augenwinkel sah er, wie der Fremde breit lächelte, als freue er sich tatsächlich, Timothy zu sehen.
„Ich bin Noah Anteo, gibst du mir die Hand, kleiner Mann?“
Er traute sich nicht, die hingehaltene Rechte war groß und breit wie eine Bärentatze, mit Schwielen und Teerflecken darauf. Doch so leicht ließ der Fremde sich nicht entmutigen. Er griff zu, und schon verschwanden Timothys kleine Finger in der Pranke. Ganz still hielt er, während der Mann sein Kinn hob, um ihn zu mustern, und ihm dann durchs Haar wuschelte. Timothy wünschte unterdessen, sich klein und unsichtbar machen zu können wie die Mäuse, die nachts durch die Küche huschten.
„Du hast mich überzeugt, Margret. Der Junge sieht meinem jüngeren Bruder zum Verwechseln ähnlich. Es ist nicht anders zu erklären, er muss mein Sohn sein. Ich werde ihn anerkennen, aber ich verstehe noch immer nicht, warum ich ihn mitnehmen soll.“
Hatte er richtig gehört? Timothy sah erschrocken zu seiner Mutter, in deren Augen Tränen schimmerten. Ihre Wangen waren blass wie Porzellan, das Gesicht ausdruckslos. Sie trug ihre Maske wieder, und diesmal versteckte sie ihre Gefühle vor ihm, ihrem eigenen Sohn. Das hatte sie noch nie getan. Timothy bekam es mit der Angst.
„Ich gehe nicht mit ihm“, protestierte er. Das alles kam ihm vor wie ein böses Spiel. Er versuchte, sich an die Mutter zu klammern, doch sie stieß ihn grob von sich, sodass er nur noch eine Falte ihres Kleides in den Händen hielt.
Sie wandte sich wieder dem Besucher zu. „Weißt du, was eine Hure auf keinen Fall gebrauchen kann?“, fragte sie schneidend und gab sich gleich darauf selbst die Antwort. „Ein Kind. Schlimmer noch, einen halben Wilden! Die Männer kommen nicht mehr zu mir, wenn sie den Bengel sehen, sie denken, sie könnten sich Krankheiten bei mir holen. Timothy muss weg. Es ist das Beste für mich und für ihn. Ich habe ihn sieben Jahre lang durchgefüttert, das ist mehr, als andere getan hätten. Jetzt bist du dran.“
Und mit diesen Worten fasste sie ihn an der Schulter und stieß ihn dem Fremden in die Arme. „Ich … ich kann nicht!“, stotterte der. „Ich arbeite auf einem Walfänger!“
„Dann habt ihr jetzt einen Schiffsjungen mehr. Timothy wird sich nützlich machen.“ Sie gab ihrem Sohn eine Kopfnuss. „Das wirst du doch?“
Er hatte ob der groben Behandlung geweint. Er hatte doch nichts falsch gemacht! Es folgte ein Klaps auf den Hinterkopf. „Heul nicht, du weißt, ich mag das nicht. Du bist jetzt ein Mann, also benimm dich wie einer.“
Der Fremde hatte ihn zu sich gezogen, fort von der Mutter, gerade rechtzeitig, um dem nächsten Klaps zu entgehen. „Schlag ihn nicht. Es ist ja gut, ich nehme ihn mit. Vielleicht wollen es die Geister so, nehmen mir innerhalb weniger Tage meinen einzigen Bruder und schenken mir dafür einen Sohn. Ich dachte, bei dir könnte ich etwas Ablenkung finden, Trost vielleicht … Aber nicht das, niemals das.“ Noah hatte ihn angesehen, als sähe er einen anderen Menschen in ihm. Den verlorenen Bruder vielleicht?
Timothy wusste noch genau, wie er sich gefühlt hatte. Ganz taub und so hilflos. Hatte einfach dagestanden und zugeschaut, wie die Mutter ein kleines Bündel packte, in das sie alles hineinstopfte, was ihm gehörte. Auch die Murmeln und seine Sammlung kleiner, gelochter Steine. Eine warme Wolldecke rollte sie ein, dann gab sie ihm einen Kuss auf die Wange. „Ab mit dir. Und mach mir keine Schande.“
Timothy erinnerte sich noch genau an das Gefühl, nicht geliebt zu werden. Er war mit dem Mann gegangen, der angeblich sein Vater war und ihn fest an der Hand hielt. Wie von allein hatten sich seine Beine bewegt und ihn von allem Vertrauten fortgetragen. Hin zum Hafen, hin zu einem gewaltigen Schiff, von dem Tranfässer abgeladen wurden, die eine glitschige Fettschicht auf der Pier hinterließen. Timothy erkannte viele der Schauerleute wieder. Die einfachen Packer und Träger lungerten Tag für Tag an den Lagerhäusern der Hudson Bay Company nahe dem Hafen herum und warteten darauf, angeheuert zu werden. Sie gehörten ebenso zum Ort wie die streunenden Hunde und verwahrlosten Kinder.
Nun rollten sie gewaltige Fässer vor sich her, die sie gemeinsam mit der Mannschaft des Walfängers über Bohlen von Bord brachten.
„Das ist die Windspirit“, hatte Noah Anteo feierlich gesagt, als stelle er ihm eine gewichtige Person wie den Sheriff oder Bürgermeister vor. Timothy kannte Schiffe wie dieses. Sie legten hin und wieder an und spien die seltsamsten Leute an Land. Auch sonst kamen mit den Fallenstellern und Jägern regelmäßig Indianer in den Ort, doch die Wilden von den Walfangschiffen waren anders. Sie duckten sich nicht vor den Weißen. Keiner wagte, auf sie hinabzublicken.
Erst später sollte Timothy erfahren, dass die Besatzungen auf den Schiffen aus aller Herren Länder kamen. Auf der Windspirit gab es den Seemann Ito aus dem fernen Japan, einen wendigen kleinen Kerl, der sich im Takelwerk bewegte, als sei er dafür geboren. Ein Maat kam wiederum aus Neuseeland, sein lackschwarzes Haar trug er zum Knoten gebunden, das Gesicht war mit Spiralen und Linien übersät.
Timothy starrte die Fremden an. „Es gibt Inuit auf dem Schiff und einige Cree wie dich und mich.“
Noch am Abend hatten sie abgelegt.
Anteo brachte ihn in einen winzigen Raum mit einem Bullauge, der nur mit einer Pritsche und einer Kiste als Tischchen eingerichtet war. Überall hingen gefährlich aussehende Gerätschaften, aber auch flache Knochen mit Schnitzereien von Tieren und Menschen.
Die erste Nacht kam. Timothy weinte nicht, aus Angst, der fremde Mann, neben dem er schlief, würde ihn schlagen, wie Mutter es getan hatte. Dann war er seekrank geworden, und für eine lange Woche gab es keinen anderen Gedanken mehr als die Übelkeit.
Noah Anteo umsorgte ihn, wie die Mutter es nie getan hatte. Jeden Abend erzählte er ihm Geschichten von gefährlichen Seeschlangen und fernen Ländern. Auf den Pfaden geheimnisvoller Abenteuer erschlich er sich ganz langsam das Herz seines Sohns. Timothy lernte, ihn liebzuhaben. Schnell merkte er, dass der Vater nicht unheimlich und fremd aussah, sondern wie er selbst. Er war kein Mensch von Porzellanhaut und Weizenhaar, sondern dunkel wie der Vater und wie viele andere aus der Mannschaft, und auf der Windspirit sah wegen seines Äußeren niemand auf ihn herab. Ganz im Gegenteil galten die Indianer als besonders fähige Waljäger, und die Kälte des Nordens machte ihnen weniger zu schaffen.
Seitdem waren zehn Jahre vergangen. Seine wenigen Besuche an Land konnte Timothy an zwei Händen abzählen. Er hatte aufgehört, das Meer zu fürchten, bis zu diesem Tag. Heute würde das Meer ihm den Vater nehmen. Der sterbende Wal hatte ihm die Brust zertrümmert. Dafür gab es keine Heilung.
Schon seit Stunden kauerte Timothy neben der Pritsche und hielt die Hand des einzigen Menschen, der ihm auf dieser Welt etwas bedeutete. In Gedanken hatte er seine Ahnen angerufen und sie um Hilfe angefleht, wie die Menschen es in Vaters Geschichten taten. In Wahrheit fühlte er sich hilflos und unvorbereitet. Er wusste zu wenig über das Leben der Cree, und der Glaube seiner Mutter konnte ihm keinen Trost schenken.
Noah Anteo war in einen tiefen Erschöpfungsschlaf gesunken und nicht mehr daraus aufzuwecken. Sein Atem ging langsam, angestrengt und rasselnd. Er musste viel Salzwasser geschluckt haben, doch das war nicht das einzige Problem. Bei der Havarie war sein Brustkorb schwer gequetscht worden. Timothy hatte zusehen können, wie sich die Haut an den Rippen blau verfärbte. Es gab nur eine kleine Wunde, doch da hatte eine gebrochene Rippe die Haut durchstoßen. Er wollte sich nicht vorstellen, wie es darunter aussah. Wohin sich die scharfen Knochensplitter noch ihren Weg gesucht hatten.
Verzweifelt drückte Timothy die schwielige Hand des Vaters und dachte daran zurück, wie er sie zum ersten Mal gehalten hatte. Wie Noah ihn daran in ein neues Leben geführt hatte. Nun war seine eigene Hand genauso groß und rau. Von der harten Arbeit an Deck, von nassem, eisverkrustetem Takelwerk und der Ruderbank.
Noch war Timothy ein einfacher Seemann auf dem Walfänger, aber irgendwann würde er ein guter Harpunier werden, wie der Vater. Beinahe täglich übten sie zusammen, wie die schwere Waffe zu handhaben war.
All das hatte binnen weniger Augenblicke ein Ende gefunden. Noah Anteo würde keinen Wal mehr töten, wurde Timothy mit voller Schwere bewusst. Die plötzliche Gewissheit fühlte sich an, als würde er von einem Bleigewicht in die nachtschwarze See gezogen und immer tiefer sinken. Es gab keine Hoffnung mehr für ihn.
Noah Anteos Geist würde die andere Welt betreten.
Draußen waren die übrigen Männer damit beschäftigt, den letzten Fang seines Lebens abzuflensen. Sie hatten den Kadaver an die Schiffsseite gezogen und gut vertäut. Geschickte Schlächter schälten nun mit ihren langen Messern die dicke Speckschicht herunter. Seilwinden brachten sie in langen Bahnen an Bord, wo sie gelagert wurden, bis man beim nächsten Landgang den Tran in gewaltigen Kesseln auskochen und in Fässer abfüllen würde.
Bis auf einige Fleischstücke für den Verzehr würde der Rest des Kadavers bald losgemacht und dem Meer überlassen werden. Stets folgten dem Schiff Möwen und Fregattvögel, hin und wieder machten sich auch schwarzweiße Orcas über ihre gefallenen großen Brüder her.
Timothy mochte nicht daran denken, dass sie womöglich bald auch Vaters Leib zerreißen würden. Alles in ihm krampfte sich zusammen.
„Das werde ich nicht zulassen“, flüsterte er, kämpfte gegen die Tränen und verlor.
Es war so ungerecht! Warum hatte es ausgerechnet seinen Vater getroffen? Sie waren nicht unvorsichtig gewesen, zumindest nicht mehr als andere. Timothy war sich sicher, hätte nicht der angeberische Bowmore die erste Harpune geworfen, sondern sein Vater, dann hätte der Wal nicht so gekämpft. Seufzend rieb er sich mit den Händen über das Gesicht. Es nutzte nichts, sich in derlei Gedanken zu verrennen. Von Schuldzuweisungen wurde sein Vater auch nicht wieder gesund.
Der Harpunier stöhnte. Timothy sprang auf und beugte sich über das Bett. „Vater, ich bin hier.“
„Mein Junge“, krächzte er.
„Wie geht es dir?“
„Kalt“, brachte der Vater hervor und blinzelte.
Timothy zog eine Decke aus dichtem, braunem Schaffell von seiner eigenen Schlafstatt und legte sie noch über die Decke des Vaters. Eigentlich war es um diese Jahreszeit schon für eine einzelne Decke zu warm. Unter der doppelten müsste es seinem Vater glühend heiß sein, doch als er nun über dessen Stirn strich, war die Haut kalt und klamm. Die Kälte des Atlantiks hatte sich tief in seinen Körper gegraben. „Hast du Schmerzen? Soll ich dir eine warme Suppe besorgen?“
„Nein, bleib … bleib nur bei mir, Timothy.“
„Versprochen.“
Noah blickte ihn lange und prüfend an, als würde er versuchen, sich das Aussehen seines Sohnes für die jenseitige Welt einzuprägen. „Weißt du noch, wie du zu mir gekommen bist?“, fragte er mit rasselndem Atem.
„Ja, natürlich, wie sollte ich das je vergessen? Ich hatte Angst vor dir. Hätte ich nur geahnt, wie viel besser mein Leben an deiner Seite sein würde.“ Ein warmes Gefühl breitete sich in Timothy aus.
„Ich bin froh, dass du so denkst. Weißt du, ich hatte auch Angst.“ Der Vater lächelte, und in seinen Augen schimmerte es.
„Du? Du hast vor nichts Angst.“
„So denken kleine Jungen von ihren Vätern, aber das stimmt nicht, und du bist kein kleiner Junge mehr. Ja, ich hatte Angst. Ich wusste nicht, ob ich nicht einen großen Fehler beging. Die Windspirit ist kein Ort für ein Kind. Aber damals war ich so voller Schmerz. Dein Onkel Jacob war erst zehn Tage zuvor gestorben, und ich fühlte mich so allein wie noch nie. Und dann gab es plötzlich dich. Du sahst ihm so ähnlich. Im ersten Moment dachte ich, seine Seele lebe in dir weiter, aber das stimmt nicht. Du bist ein ganz anderer, auf deine Weise besonderer Mensch.“ Er reckte die Hand nach Timothy, und der beugte sich vor, bis der Vater ihm die Linke an die Wange legen konnte. „Du hast mich damals gerettet.“
Timothy schüttelte den Kopf. „Nein, was sagst du denn da? Du hast mich gerettet, Vater.“
„Dann haben wir einander gerettet. Ohne dich hätte ich mich weiter in dem Wahn verrannt, Jacobs Mörder finden zu müssen, obwohl ich bis heute nicht recht sicher sein kann, ob es ihn überhaupt je gab.“
„Aber ist mein Onkel denn nicht aus dem Krähennest gefallen?“
„Darauf wurde sich an Bord geeinigt, nachdem niemand gesehen haben wollte, was geschehen war. Es war eine dunkle Nacht. Oyans und Bay, die am Bug Wache schoben, haben angeblich nur den Aufprall gehört.“ Seiner Brust entrang sich ein tiefes Seufzen. „Jacob trank nicht, niemals, Timothy. Jacob und ich haben als Kinder beide gesehen, was Branntwein mit einem Menschen machen kann. Also haben wir nie welchen getrunken, haben nie bei Landgängen mit den anderen Männern gezecht. Auch wenn unsere Zurückhaltung nicht gern gesehen wurde.“
Timothy kannte die herablassenden Kommentare der anderen Seeleute zur Genüge, wenn die Anteos wieder einmal an Bord blieben, während sie ihre Heuer versoffen. Sein Vater und er wurden wie Außenseiter behandelt, und das waren sie ja auch in gewisser Weise.
„Sie haben mir nie verziehen, dass ich Männer aus der eigenen Mannschaft verdächtigte, mit Jacobs Tod etwas zu schaffen zu haben. Manch einer hasst uns, Timothy, auch wenn sie nicht wagen, es uns ins Gesicht zu sagen.“ Er atmete mehrfach tief ein und aus, wobei er den Mund vor Schmerz verzog.
„Sprich nicht weiter, Vater, ruh dich aus, bitte.“
„Ich habe keine … Zeit … mich auszuruhen, Junge“, protestierte er, schloss dann aber doch erschöpft die Augen. Timothy saß bei ihm und hielt seine Hand, den Blick auf die schwarzen Linien und Flächen gerichtet, mit denen der Unterarm des Vaters bedeckt war. Die Tätowierungen hatten ihm als kleinem Jungen ein wenig Angst eingejagt, später erlag er ihrer Faszination. Einer der anderen Cree-Seemänner fertigte sie an, und so hatte sich auch Timothy für jeden Schritt seines Erwachsenwerdens heilige Ornamente in Oberkörper und Arme stechen lassen. Doch während sich die weißen Seeleute gegenseitig mit barbusigen Meerjungfrauen, Schiffen, Kruzifixen und Namen versahen und dabei kräftig tranken und fluchten, verlief das Ritual bei den Cree ganz anders. Sie beteten gemeinsam in einer einfachen Schwitzhütte, bis die Geister ihnen die richtigen Zeichen eingaben, die den Träger schützten oder von überstandenen Gefahren berichteten. Auf Vaters Arm gab es einen Kranz breiter, schwarzer Zacken. Timothy strich vorsichtig mit seinen Fingern darüber. Die Haut war so kühl. Besorgt zog er ihm die Decke bis zum Kinn hinauf. Das Gesicht seines Vaters war ihm noch nie schmal vorgekommen. Heute stachen seine Wangenknochen spitz hervor.
Plötzlich zeichneten sich die Kiefermuskeln ab. Der Vater riss die Augen auf und hustete rasselnd. Als er schließlich zurück in die Kissen sank, sammelte sich in einem Mundwinkel etwas Blut. Timothy ahnte, was das bedeutete. Seine Lunge war verletzt, wie er befürchtet hatte, und ihm blieben womöglich nur noch wenige Augenblicke, bevor er sich verabschieden musste. In seiner Kehle formte sich ein Schrei, doch heraus kam nur ohnmächtiges Schweigen.
„Sohn, hör mir zu und versprich mir etwas.“
Er rückte näher, lehnte sich vor, um jedes Wort zu verstehen. Jedes einzelne war kostbar. „Was ist es?“
„Ich sterbe. Wenn ich tot bin … Wenn ich tot bin, kann ich dich nicht mehr beschützen. Du musst das Schiff im nächsten Hafen verlassen.“
„Vater, was sagst du denn da? Dies hier ist mein Heim.“
„Timothy!“ Er rang pfeifend nach Atem. Der dünne Blutfaden schwoll zu einem Rinnsal, er hustete gequält. „Versprich mir, dass du von Bord gehst und nicht zurückblickst.“
„Aber warum?“ Warum wollte er ihm auch das Letzte nehmen, was ihm noch blieb? Der Vater hatte ihn stets gemahnt, sich an die kleine Gemeinschaft der Harpuniere zu halten, sie waren fast wie eine Familie. Vor den anderen würde er sich schon in Acht nehmen.
Seinem Vater fielen die Augen zu. Er schien sie nicht mehr offenhalten zu können. Erschrocken fasste Timothy ihn an der Schulter. „Vater.“
Er riss die Augen auf. „Es gibt Männer, die dir Böses wollen, Timothy. Die Windspirit hat mir den Bruder genommen und wird dir den Vater nehmen. Du musst fortgehen … versprich …“
„Ich schwöre es.“
„Gut.“ Langsam verzog der Vater die Lippen zu einem blutigen Lächeln.
Dann starb er. Wie ein sachtes Lüftchen wich der letzte Atem einer ewigen Flaute. Timothy hatte zuvor nie darüber nachgedacht, dass sein Vater den Tod finden könnte. Ein starker, mutiger Mann wie er sollte sich nicht so aus dem Leben schleichen. Nicht so früh. Es war nicht richtig.
Der Schmerz war wie ein Strudel, der ihn mit sich riss. Timothy wollte stark sein, ein Mann sein. Doch er legte nur den Kopf auf die Brust seines Vaters und ließ den Tränen freien Lauf. Nie wieder würde er den Vater lachen hören. Nie wieder mit ihm den Speerwurf üben oder singen und Geschichten erzählen, wenn sie einen großen Fang gemacht hatten.
Von diesem Augenblick an war er ganz und gar allein.
KAPITEL 2
Der Vater predigte mit lauter, melodischer Stimme, die mehr für eine Kathedrale gemacht schien als die Scheune, in der sie an diesem Morgen nach einer kurzen Fahrt untergekommen waren. Drei Dutzend Menschen hatten sich versammelt, um Joshua Jerobe zu lauschen.
In dem winzigen Ort gab es noch keine Kirche, er war einfach gewachsen und gewachsen, ohne dass sich ein Geistlicher hierher verirrt und beschlossen hätte zu bleiben. Für Hochzeiten und Taufen mussten die Menschen in den Nachbarort reisen. Hier wurde ihr Vater mit offenen Armen empfangen, und er genoss seinen Auftritt sichtlich.
Mary beobachtete ihn vom Rand der versammelten Menge aus. Die Leute hingen an seinen Lippen, während er von den Sünden und Verfehlungen der Menschen predigte. Ehrfürchtig sahen sie zu ihm hinauf. Ein hagerer Alter lauschte mit offenem Mund, während sich eine Frau in schwarzer, langer Tracht nach jedem zweiten Satz bekreuzigte und ihren Rosenkranz küsste. Für sie war die Predigt wie das rettende Wasser nach einem schier endlosen Marsch durch die Wüste.
Ein wenig versöhnte das Mary mit ihrem Vater. Auch wenn er ein Scharlatan war, so brachte er den Menschen doch Hoffnung und stillte ihre Sehnsucht. Er gab sich nicht als Priester aus, aber er korrigierte auch niemanden, der ihn so nannte. Seine Kleidung war sorgfältig ausgewählt. Schlicht, dunkel, ein weißer Hemdkragen und darüber ein einfaches Holzkreuz, ganz ohne Zier. So stellte man sich einen demütigen Diener Gottes vor.
Der Vater breitete die Arme aus, als wolle er seine Zuhörer segnen, und rief Gottes Güte auf sie hinab. Die Leute rückten zusammen, näher nach vorn, um in den Kreis der schirmenden Hände zu gelangen. Viele hielten die Hände gefaltet, manche beteten mit gesenktem Kopf, die meisten aber starrten auf Vaters Lippen. Er lächelte mit blitzend weißen Zähnen.
„Amen“, klang es vielstimmig. Dann Schweigen.
Vater wartete einige Herzschläge lang. Es war wie ein Ritual. Gerade als das erste leise Murmeln erklang, die ersten Schritte über den hart verkrusteten Schlamm scharrten, breitete er in einer einladenden Geste die Arme aus. „Liebe Leute, hört mich an.“ Konzentriert blickte er einem nach dem anderen in die Augen. „Nur Gott allein kann sich eurer Seelen annehmen, aber für die irdischen Leiden, die Gebrechen und Krankheiten des Leibes gibt es Medizin und stärkende Elixiere. Kräuter aus den Gärten heiliger Mönche, Pillen aus dem Staub von Hostien und Weihrauch. Kommt und seht.“ Er wies zu seiner Linken.
Mary wurde erschrocken klar, dass sie ihren Einsatz verpasst hatte. Hektisch eilte sie zu dem Klapptischchen, auf dem die Waren ausgestellt wurden. Sie setzte ihr schönstes Lächeln auf, doch der Gesichtsausdruck ihres Vaters zeigte, dass es nicht reichte. Tiefe Kerben der Missbilligung hatten sich in seine Mundwinkel gegraben.
Mary zwang sich, nicht an den Abend zu denken, wenn er ihr mit Gürtel oder Rohrstock einbläuen würde, dass sie ihre Aufgabe minutiös auszuführen hatte. Sie würde den Schmerz aushalten, wie sie ihn stets aushielt, und sich fest vornehmen, diesen Fehler nicht noch einmal zu begehen.
Ob je der Tag käme, an dem der Vater nichts an ihr auszusetzen hatte? Sie wünschte sich so sehr, dass er mit Stolz auf sie blickte.
Dafür musste sie den rebellischen Kern in sich zum Schweigen bringen, der immer und immer wieder sein hässliches Haupt hob. Ihr Trotz gehörte sich nicht für eine Frau. Auch in der Bibel stand, dass eine Tochter dem Willen ihrer Eltern zu entsprechen hatte, ganz gleich, wie sie darüber dachte. Gehorsam, das sollte sie sein.
Sie durfte die Verfehlungen des Vaters nicht mehr sehen, geschweige denn danach suchen. Also riss sie sich zusammen und lächelte verkrampft.
Eine Frau betrachtete die Auslagen. Ihre zartgliedrigen, gepflegten Hände verrieten sofort, dass Mary es mit einer bessergestellten Dame zu tun hatte.
„Wie kann ich Ihnen helfen? Suchen Sie etwas Bestimmtes?“
„Mein Kind ist oft wund unter den Windeln, und in letzter Zeit wird die Kleine von Bauchweh geplagt. Hat der Reverend denn etwas dagegen?“
Mary biss sich auf die Zunge und korrigierte die Frau nicht. Stattdessen überlegte sie, was sie der Kundin neben den gewünschten Mittelchen noch verkaufen konnte. An Geld mangelte es ihr ja offensichtlich nicht.
„Hier habe ich eine wundervolle Salbe. Auch Nonnen benutzen seit Jahrhunderten diese Kräuter. Das wird Ihrer Tochter helfen, und auch Ihnen oder Ihrem Gatten. Bei kleinen Verletzungen nach dem Reinigen zweimal am Tag die Salbe auftragen.“ Sie schob ihr das kleine Tiegelchen zu.
Die Frau roch daran und zog dabei ihre Stupsnase kraus. „Angenehm, die nehme ich.“ Mary stellte ein Fläschchen hinzu. Es widerstrebte ihr, zu lügen. Das Mittel gegen Magenreizung war ihnen ausgegangen, seitdem verkauften sie dieses mit Waid eingefärbte Wasser, in dem außer dem Farbstoff nur etwas Kamillenextrakt enthalten war. Zumindest würde es nicht schaden. Sie lächelte noch breiter. „Wenn Ihr Kindchen oft weint, dann nehmen Sie das hier. Einige Tropfen nur helfen gegen Bauchweh. Reiben Sie dazu auch sanft über den Leib, dann wird es schnell besser.“
Die Kundin steckte beides ein. „Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf, Fräulein?“
„Fünfzehn, Miss.“
„Das ist wirklich erstaunlich. Können Sie lesen?“
„Mein Vater hat es mir beigebracht. Er legt viel Wert darauf, dass ich Gottes Wort jederzeit selbst lesen kann, wenn ich des Trostes bedarf.“
„Außerordentlich. Ein Hausmädchen wie Sie könnte ich gebrauchen.“
„Vielen Dank, das ist ein großes Kompliment“, sagte Mary und errötete. Sie wusste nichts mehr zu sagen. Könnte das ihr Leben sein? In einem großen Haus bei einer Rancherfamilie leben und sich um deren Kinder kümmern? Sie mochte Kinder, auch wenn sie auf ihren ständigen Reisen nur selten mit ihnen in Kontakt kam.
„Hat meine Tochter nicht das Richtige für Sie gefunden?“, erklang der brummige Bass Joshua Jerobes. Mary fuhr zusammen und zog die Schultern hoch.
„Nein, Reverend, ich habe bereits alles.“
„Eine schöne Dame wie Sie nutzt doch sicherlich auch Mittel zur täglichen Hygiene. Mary, zeig ihr unsere Seifen und Zahnpolitur.“
„Selbstverständlich, kommen Sie bitte.“
Sie hatten gute Geschäfte gemacht, sehr gute sogar. Der Vater hatte noch zwei Patienten den Zahn gezogen und zum Abschluss einen Mann wieder gehen gelehrt, nachdem er ihm unter lautem Krachen und Knacken den Rücken eingerenkt hatte. Die Leute hatten gejubelt und nach dem kleinen Wunder tüchtig von den Salben und Wässerchen gekauft.
Vaters Laune war gut. Vielleicht waren die Schläge auch deshalb nur milde ausgefallen und Mary fiel das Sitzen nicht allzu schwer. Dennoch hätte sie sich gern eine Decke untergelegt.
Vater schlug sie nie auf die Hände. Die Striemen auf den Fingern vergraulten die Kunden, meinte er.
Sie lagerten auf einer kleinen, eingezäunten Wiese am Westrand der Siedlung. Mary hatte gleich dort drei fette Präriehunde mit der Schleuder erlegt. Die kleinen Tiere waren schnell geputzt, und nun köchelte auf dem Feuer ein würziger Eintopf. Geld war an diesem Tag genug in ihre Taschen geflossen, dennoch waren die Jerobes sich nicht zu schade dafür, das zu essen, was Gottes Schöpfung ihnen schenkte.
Sie hatten Erbsen gekauft, Bohnen und Linsen in vernähten Leinensäcken, dazu Verderblicheres wie Zwiebeln, Rüben, Äpfel und Kartoffeln, die nun ebenfalls im Topf köchelten.
Vater rührte Salbenfett, das er vorsichtig am Feuer erwärmte. Es durfte beim Abkühlen nicht klumpen.
Beim Essen wechselten sie sich mit dem Rühren ab. Schließlich schob der Vater ihr das Töpfchen zu. „Du weißt, was du zu tun hast, Tochter. Enttäusche mich nicht wieder.“
„Gehst du noch einmal fort?“ Sie hatte es schon vor einer Weile geahnt. Immer wenn der Wind den Klang von Fiedeln herübertrug und das Gelächter ausgelassener Menschen, hielt der Vater inne und lauschte. In dem Marktflecken gab es einen Saloon, und der lockte mit Karten und Würfelspiel.
„Warte nicht auf mich.“ Mehr Erklärung würde sie nicht von ihm bekommen. Sie wusste, dass er das gesamte mühsam verdiente Geld mitnehmen würde und war nur erleichtert, dass sie die Vorräte bereits aufgestockt hatten. Manchmal gewann er, meist aber verlor er das Geld.
Joshua Jerobe strich seine Kleidung glatt, klopfte sich den Staub vom Hut und ging mit langen Schritten davon. Mary sah ihm nach. Er lief geschmeidig wie ein junger Mann, dabei war er fast fünfzig Jahre alt. Sie würde vermutlich noch viele, viele Jahre mit ihm herumziehen.
Mary rührte die Salbe fertig und füllte sie ab, dann kehrte sie zurück und stocherte im Feuer, als gelte es, einen Gegner zu besiegen. Die Kohlen spritzten auseinander und sandten einen Funkenregen in den schwarzen Nachthimmel. Wenn ich doch nur wie die Funken diesem Ort entfliehen könnte, dachte sie wehmütig.
Sie hatte sich nie Gedanken über ihre eigene Zukunft machen wollen, dafür tat es zu weh. Der Vater brauchte sie, er würde sie nicht gehen lassen. Würde nicht erlauben, dass sie eine Anstellung fand, wie bei der netten Dame, mit der sie heute gesprochen hatte. Sie blieben auch nie lange genug an einem Ort, um andere Menschen kennenzulernen. Geschweige denn lange genug, damit eine junge Frau Ausschau nach einem Ehemann halten konnte.
Und wer würde sie schon haben wollen? Mary machte sich keine falschen Hoffnungen. Sie war die Tochter eines Predigers, Wunderheilers und Barbiers, der nicht mehr besaß als den Bison-Wagen und das, was darin verstaut war. Sie brachte nicht weiter mit in die Ehe als den schlechten Ruf eines Rosstäuschers.
Alle Männer, die sich davon nicht abschrecken ließen, taugten selbst noch viel weniger und waren völlig mittellos. Da hätte sie sich genauso gut als Gewinn in einem Kartenspiel oder Pferderennen ausloben können.
Nein, unter diesen Bedingungen blieb sie doch lieber einsam. Schlagen tat sie auch der Vater, und der war zumindest kein Trunkenbold.
Mary zog die Nase hoch und stieß den Stock tief in die Glut, bis er Feuer fing. Mit der Spitze malte sie Muster in den Nachthimmel. George, der nur wenige Schritt neben ihr graste, hob irritiert den Kopf, schüttelte seine mächtige Mähne und schnaubte. Feuerschein spiegelte sich einen Moment lang in seinen kleinen, intelligenten Augen.
Das war es also, ihr Leben. Und eine Änderung war nicht in Sicht.
Vor dem Schlafengehen hängte sie Kräuter zum Trocknen auf, brachte das Lager in Ordnung und sah nach den Tieren. Gähnend betrat sie schließlich den Planwagen, breitete auf dem Boden zwischen Kisten, Säcken und einem Tischchen mit Destillationsapparaturen ihre Decken aus. Der Vater schlief an warmen Tagen unter dem Wagen, und sie konnte nur hoffen, dass er sich auch heute dazu entschied.
Die Nächte in der Wildnis waren Mary vertraut. Sie fürchtete weder Puma, Bär noch Wolf. Keines der Tiere wagte sich an den beiden ausgewachsenen Büffeln vorbei. In der Nähe von Ortschaften oder Goldgräberlagern lauerten andere Gefahren. Dieser Marktflecken war ihr wie ein angenehmer Ort erschienen. Einer, der nicht einmal einen Gesetzeshüter brauchte. Hier schien es nur Farmer, Krämer, einen Fassmacher und einen Hufschmied zu geben.
Mit leiser Wehmut, weil sie wohl niemals ein solches Dörfchen ihr Zuhause nennen würde, schlief sie ein.
George stampfte mit den Hufen und schnaubte. Erst wusste Mary nicht, warum sie das geweckt hatte, dann schnaubte der Büffel wieder, und sie erkannte am Klang, dass Gefahr drohte.
In einem Baum stieß ein Nachtvogel einen schrillen Ruf aus. Die Luft war voller Zikadengesang, doch da war noch mehr. Rascheln. Etwas näherte sich.
Mary setzte sich langsam auf und drückte sich die Hand auf die Brust, doch ihr panisch rasendes Herz ließ sich von solch einer hilflosen Geste nicht beruhigen.
Jetzt hörte sie die Schritte ganz deutlich. Dort kam jemand, und es war nicht der Vater. Ihn hätte sie unter hundert anderen erkannt.
Der Fremde näherte sich dem Wagen. Er durfte sie nicht hier finden. Männer waren Raubtiere, das hatte der Vater ihr immer eingebläut. Das Sicherste war, ihnen nicht allein zu begegnen. Hier würde niemand ihre Schreie hören, niemand zu ihrer Rettung eilen, und der Vater würde bestimmt erst in einigen Stunden zurückkehren.
Auf bloßen Füßen huschte Mary zum Wagenende, an dem eine kleine Treppe lehnte. Würde sie es noch unbemerkt hinausschaffen? Sie hielt inne. Ihr panisches Herz dröhnte mittlerweile so laut, dass es ihr schwerfiel, etwas anderes zu hören als sein stetes, rasendes Hämmern. Zwischen den Leinenbahnen erahnte sie die Wiese, die in bläulich leuchtendes Mondlicht getaucht war. Ein Schemen bewegte sich gleich in der Nähe.
Nein, hier kam sie nicht mehr heraus. Sie drehte um. Achtete sorgsam darauf, nicht auf die knarrenden Stellen zu treten, wo die alten Holzbohlen ein Eigenleben entwickelt hatten.
Rasch an dem Tischchen mit der Glasapparatur vorbei, über die Truhe mit der Kleidung und jener mit Vorräten und Kochutensil. Dann endlich umfassten ihre Hände den Kutschbock. Ganz vorsichtig stieg sie über die Rückenlehne und hinauf auf das Sitzbrett.
Im gleichen Moment wurde hinten die Plane zur Seite gerissen und glattes Metall blitzte auf. Kurz erahnte sie ein bärtiges, aber recht junges Gesicht, hager und mit wildem Blick, dann duckte sie sich hinter die Rückenlehne und hielt den Atem an. Vielleicht würde der Gauner sie nicht bemerken. Sie für ein Ding halten, wenn sie nur ganz und gar stillhielt. Ihr Unterkleid war milchweiß und leuchtete im Mondlicht grell, aber wenn sie nur stillhielt …
Der Wagen bewegte sich. Der Fremde musste nun im Inneren sein. Die Bohlen knarrten unter seinem Gewicht, dann erklang ein leises Klirren, Glas zerbrach, Stoff raschelte.
„Jerobe, du verdammter Mörder, wo versteckst du dich?“, grollte der Fremde. Es klang, als trete er ihre Decken zur Seite.
Ihr Vater ein Mörder? Der Fremde musste sich irren.
Truhen wurden geöffnet, er wühlte darin, kam dem Kutschbock immer näher. Er war gründlich. Mary zweifelte nicht daran, dass der Fremde auf seiner Suche bis zu ihr nach vorne vordringen würde.
Sie musste fort, so schnell wie möglich.