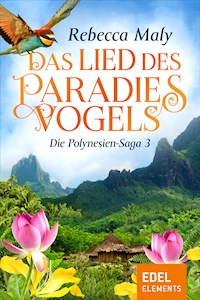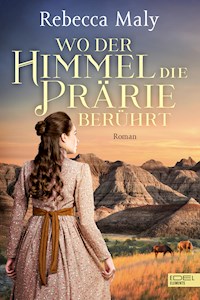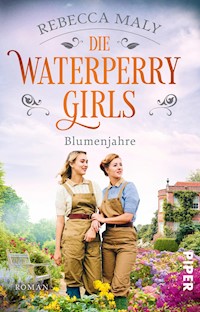
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Aufbruch in ferne Welten und neue Zeiten England 1939: Sybilla schließt sich der Bewegung »Dig for Victory« an, wo jede freie Fläche für Gemüseanbau genutzt wird, um den Hungernden in den Kriegsjahren zu helfen. Sie vermisst ihre Freundin Tilda, doch die ist in Borneo und bangt um das Leben ihres Geliebten: Muss er an die Front? Als die Pflanzensucher es endlich zurück nach England schaffen, erkennt Tilda ihre Heimat kaum wieder, und ihre sonst so starke Freundin hat Liebeskummer: Die Zeit der blühenden Gärten scheint vorbei. Doch dann hat Tilda eine geniale Idee, wie die beiden Freundinnen in eine glückliche Zukunft starten können. Ein hinreißender historischer Roman für alle, die England und seine Gärten lieben
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Die Waterperry Girls – Blumenjahre« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2022
Redaktion: Sarah Heidelberger
Covergestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign
Covermotiv: unter Verwendung von shutterstock.com
und Rekha Arcangel/arcangel.comCovergestaltung:
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence, München mit abavo vlow, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem E-Book hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen und übernimmt dafür keine Haftung.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
1
Borneo, Mai 1939
2
London, Mai 1939 – Chelsea Flower Show
3
Borneo, drei Wochen später
4
Oxford, Ende Juni 1939
5
1. September 1939
6
5. September 1939
7
Jesselton, Borneo – Oktober 1939
8
Healey House, Dezember 1939
9
Borneo, Mai 1940
10
Englischer Kanal, Mai 1940
Dünkirchen, Frankreich – zur selben Zeit
11
Oxford, zwei Wochen später
12
Borneo, September 1940
Ärmelkanal, November 1940
13
Oxford, November 1940
Borneo, Dezember 1940
14
Oxford, Januar 1941
Waterperry School of Horticulture
15
Borneo, Februar 1941
16
Oxford, Februar 1941
17
Oxford, März 1941
Eine Woche später – Sonntag
18
Vor der Küste von Kapstadt, März 1941
Healey House, März 1941
19
Oxford – Musterungszelt, April 1941
Kapstadt, zur gleichen Zeit
20
Feldlazarett – Asmara, Eritrea – April 1941
London, zur gleichen Zeit
Feldlazarett – Asmara, Eritrea – drei Tage später
21
Atlantischer Ozean
Nahe Oxford, Büro von Ephraim Temple
22
Ende April 1941
23
24
Vor der Küste von Gibraltar, 1. Mai 1941
Healey House
25
26
Oxford – Wolvercote Cemetery, 22. Mai 1941
27
28
Kapstadt, Juni 1941
29
30
Indonesien, Dezember 1941
31
7. Dezember 1941
32
Ende März 1942
33
Dschungel von Borneo, Frühjahr 1942
34
35
Zwei Jahre später – Anfang Juni 1944
36
Vier Stunden später
37
Drei Tage später
Epilog
12. Juni 1947
Nachwort und Dank
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
1
Borneo, Mai 1939
Da war Blut auf Bennets Hemd.
Blut, das sich rasend schnell ausbreitete.
Bennets Augen waren plötzlich glasig. Er wankte. »Tilda … Ich … Ich bin getroffen«, stammelte er.
»Wir werden angegriffen! Mein Mann ist verletzt!«, brüllte sie. Ihre Stimme überschlug sich, klang schrill in ihren eigenen Ohren.
Eben erst hatte es aufgehört zu regnen, und sofort war Nebel aus dem dichten, dunkelgrünen Blätterdach des bornesischen Dschungels aufgestiegen. Ihr hölzernes Flussschiff, ein fast zwanzig Schritt langes Gefährt mit flachem Boden, hatte sich geräuschlos durch die trägen, trübbraunen Fluten des Urwaldstroms bewegt. Hier und da waren an Sandbänken Krokodile zu erahnen gewesen, saßen Reiher auf niedrigen Zweigen und lauerten auf Beute.
Tilda hatte den Tag damit verbracht, die herrliche Landschaft zu beobachten, die an ihnen vorbeizog. Hin und wieder ließ sich sogar ein Blick auf die gewaltigen Berge erhaschen, die sich die meiste Zeit als bläuliche Schemen hinter einem Schleier aus Nebel verbargen. Auf ihrer Expedition waren die Bäume meist so hoch und dicht gewesen, dass von der herrlichen Landschaft in der Ferne nichts zu sehen gewesen war. Nun kehrten sie in dichter besiedelte Küstengebiete zurück.
Das Schiff glitt mit dem Strom und wurde nur durch den Steuermann mit einem langen Stecken auf Kurs gehalten. Die übrige Arbeit tat der Fluss, dessen trübes Wasser dem Meer entgegenstrebte.
Sie reisten beinahe geräuschlos. Etwas anderes blieb ihnen ohnehin nicht übrig, denn der Treibstoff war ihnen schon vor zwei Tagen ausgegangen. Auf dem Schiff breitete sich nun der Duft von würzigem Essen aus, das in diesem Moment aufgetischt wurde. Tilda war zu Bennet gekommen, um ihm Bescheid zu geben. Statt sich auf der Bastmatte niederzulassen und zu essen, waren sie beide wieder einmal so sehr vom Anblick der üppigen Natur gefangen gewesen, dass sie alles andere um sich herum vergaßen.
Der Schuss war wie aus dem Nichts gekommen.
Vögel flogen in Schwärmen auf, und aus dem Wald drangen die Warnrufe von Affen. Erst jetzt bemerkte Tilda ein schmales Holzboot, das sich aus einem überwucherten Nebenarm schob.
Um sie herum brach Panik aus. Der Schiffseigner rief seinen beiden Helfern etwas zu, seine Frau duckte sich in eine Nische.
Auf dem Wasser erschienen nun nicht nur ein, sondern zwei kleine Ruderboote und kamen erschreckend schnell näher. Sie würden das größere Flussschiff bald eingeholt haben.
»Wir müssen hier weg, Bennet«, flüsterte Tilda gepresst. Nachdem die Angst wie ein Sturm über sie hinweggefegt war und sie beinahe von den Beinen gerissen hatte, klärte sich ihr Verstand nun. Sie umfasste Bennet mit beiden Händen und zog ihn von der Reling fort, während sich weitere Kugeln krachend in die Bordwand gruben.
Die angreifenden Boote zingelten sie von zwei Seiten ein.
Tilda hatte nur noch einen einzigen Gedanken: Fort! Ihren Liebsten in Sicherheit bringen!
Brüllaffen schrien in den Bäumen am Ufer, der Himmel war noch immer voller aufgeschreckter Vögel. Ihre kleine Schiffsmannschaft mühte sich mit Rudern und Staken, den Angreifern zu entfliehen, doch es schien aussichtslos. Zu schwerfällig war ihr voll beladenes Flussboot. Sie schrien die Angreifer in ihrer Sprache an. Die Köchin hingegen kauerte zitternd in ihrem Versteck.
Tilda zog Bennet mit sich. Er stolperte und hielt sich die Brust. Endlich erreichten sie einen sicheren Bereich zwischen hochgestapelten Kisten voller Fundstücke. Sie zwängten sich in einen schmalen Gang. »Setz dich«, drängte Tilda heftig atmend.
Bennet versuchte, sich abzustützen, doch ihm rutschten die Beine weg, und er sackte auf dem Boden zusammen. Auf einer der Kisten blieb eine Blutspur zurück.
»Bring dich in Sicherheit, Tilda. Du musst dich retten«, keuchte er, und seine grünen Augen wurden dunkel wie ein Urwald, in dem man sich leicht verirrte.
»Unsinn, ich lasse dich nicht allein. Und wo sollte ich denn auch hin?«, erwiderte sie flüsternd.
»Tilda!«
»Leise jetzt.«
Er blinzelte langsam und lehnte den Kopf mit halb geschlossenen Augen gegen eine der Kisten. Die Schüsse hatten aufgehört, doch Tilda nahm ohnehin nichts mehr wahr außer Bennet und dem Blut auf seinem dünnen Tropenhemd. Energisch riss sie es auf und streifte es über seine Schultern. Mit dem zusammengeballten Stoff wischte sie das Blut fort, bis sie die Wunde besser erkennen konnte. Die Kugel war knapp unter dem rechten Schlüsselbein eingedrungen und auf gleicher Höhe wieder ausgetreten, das sah sie nun.
Aus der Wunde auf dem Rücken ragte ein Knochenstückchen.
Übelkeit schwappte über Tilda hinweg, doch sie schluckte hart und fing sich rasch wieder. Für derlei Befindlichkeiten war jetzt keine Zeit!
Energisch riss sie das Hemd entzwei und drückte die eine Hälfte auf die Eintrittsstelle, um den Blutfluss zu stoppen. Bennet stöhnte, sein Kopf sackte nach vorn.
»Bennet? Bennet, Liebster, bleib bei mir. Nicht einschlafen. Ich liebe dich, hörst du? Bleib bei mir, verdammt!« Ihre Stimme zitterte. Sie drückte ihm einen Kuss auf den Mund, und tatsächlich hob er den Kopf wieder und lächelte gequält. »Zu … Befehl.«
Ein Ruck ging durch das Flussboot. Männer sprangen an Deck. Der Bootseigner Samat schrie etwas, die Angreifer brüllten zurück, dann fiel ein weiterer Schuss, und es wurde schlagartig still.
»Miss?«, hörte Tilda Samat mit zittriger Stimme rufen. Er musste es noch einmal wiederholen, bis sie reagierte.
Sie nahm Bennets Hand und legte sie auf das zusammengeknüllte Hemdstück. »Drück das auf die Wunde«, beschwor sie ihn. Er tat es, hielt Tilda aber mit seiner anderen Hand am Arm fest. »Nicht.« Er blickte ihr tief in die Augen.
»Ich muss.« Langsam richtete sie sich auf und sah erst jetzt, was inzwischen geschehen war. Vier Räuber, zwei von ihnen mit Gewehren bewaffnet, waren an Bord gekommen. Die Mannschaft stand mit erhobenen Händen da. Nur sehr langsam folgte Tilda ihrem Beispiel, als ein Gewehrlauf zu ihr herüberschwenkte.
Sie waren überfallen worden, aber warum? Weshalb ausgerechnet sie? Sie hatten doch nichts! Was wollten diese Leute von ihnen? Tilda würde ihnen alles geben, nur damit sie wieder verschwanden und sie Bennet so schnell wie möglich zu einem Arzt bringen konnte. Die Sorge um ihren Mann war es auch, die Tilda in dieser Situation nicht den Kopf verlieren ließ.
»Was wollen diese Leute von uns?«, wandte sie sich an Samat.
»Geld, Miss. Alles von Wert.«
»Wir haben nichts.«
»Das habe ich ihnen auch gesagt, aber sie glauben mir nicht. Sie denken, alle Engländer sind reich.«
Der Anführer der Gauner, ein hagerer Kerl mit knotigen Gelenken und schütterem Bart, schrie etwas. Dann schlug er der Köchin Eseha den Gewehrkolben an die Schläfe. Die zarte Frau brach sofort zusammen. Ihr Mann sank mit einem Klagelaut in die Knie.
Tilda musste die Sprache nicht verstehen, um zu wissen, dass er gerade um das Leben seiner Liebsten flehte. Sie selbst stand einfach da wie zur Salzsäule erstarrt, während die Räuber begannen, die Kisten zu öffnen und die gesammelten Pflanzen herauszuwerfen. Achtlos trampelten sie über einmalige Bromelien, Lilien und Orchideen, wühlten sich bis zum Grund der Behältnisse vor und schleuderten die leeren Kisten über Bord.
»Tilda«, hörte sie Bennet flüstern und drehte sich zu ihm. Mit dem ausgestreckten Arm hielt er ihr ein kleines Goldkreuz an einer Kette hin, das er als Andenken an seine verstorbene Schwester Beatrice trug. In der blutverschmierten Handfläche lag auch sein Ehering. »Gib ihnen den Schmuck.«
Ihr Herz fühlte sich an, als würde es zwischen Gewichten zerquetscht, während sie ihren eigenen Ring vom Finger zwang. In der schwülen Dschungelwärme saß er sehr fest. Die Kette mit dem Silbermedaillon war schnell abgenommen.
»Hier, mehr haben wir nicht.«
Sie hielt den Schmuck dem Räuber hin, der ihr am nächsten war, einem brutal aussehenden Kerl, dem zwei Schneidezähne fehlten. Er grapschte die magere Beute gierig aus Tildas Hand, an der Bennets Blut klebte.
Der Spuk endete genauso plötzlich, wie er begonnen hatte. Als sich weitere Flussschiffe näherten, sprangen die Bewaffneten auf ihre schmalen Holzboote und machten sich mit schnellen Ruderschlägen davon, um in einem der zugewachsenen Nebenarme unterzutauchen.
Tilda war sofort wieder bei Bennet, der überraschenderweise schon etwas besser aussah. Die Blutung war fast zum Stillstand gekommen. Sein Gesicht war blass, doch er sah mit wachem Blick zu ihr auf.
Eseha kam zu Bewusstsein und hielt sich den schmerzenden Kopf. Im Dschungel, in dem es kurz ungewöhnlich still gewesen war, breitete sich wieder der übliche Lärm aus. Vögel sangen durcheinander, überall sirrten, zirpten und brummten die Insekten und wurden nur hin und wieder vom Ruf eines Affen unterbrochen. Die mächtigen Bäume schüttelten im auffrischenden Wind Wassertropfen aus ihren glänzenden Blätterkronen, als würden sie sich für den nächsten Schauer bereit machen.
An Bord kehrte nach kurzer, hektischer Betriebsamkeit jeder an seinen Posten zurück, und bald bewegten sie sich wieder den Fluss hinab. Mit Staken stießen die Männer das Schiff in den sedimentgefärbten Fluten vorwärts. Jeder hatte es nun eilig, doch Tilda ging es dennoch nicht schnell genug. Am liebsten hätte sie sich selbst ein Ruder geschnappt. Nun rächte sich, dass sie mit der Kohle für die kleine Dampfmaschine nicht besser gehaushaltet hatten und sie schon vor Tagen ausgegangen war. Also ging sie zu Samat, redete auf ihn ein, dass Bennet schnell zu einem Arzt musste, obwohl der nächste noch eine mehrtägige Reise weit entfernt war. Ihr Bootsführer wusste das alles und hatte auch ohne ihr Zutun bereits geplant, einen anderen Kurs einzuschlagen. Er wusste von einer Missionsstation, die über einen Arzt verfügte, nur zwei Tagesreisen entfernt. Bis dahin würden sie allein zurechtkommen müssen. Bennet hatte auf Expeditionen immer eine umfangreiche kleine Apotheke dabei. Auf sein Verlangen hin brachte Tilda ihm Penizillin und Schmerzmittel. Er spülte beides mit viel Wasser hinunter und schloss die Augen. Dann saß sie neben ihm und bewachte seinen Schlaf.
Sie strich ihm vorsichtig über die Stirn, die sich ungewohnt kalt anfühlte. In ihrem Herzen blieb ein klammes Gefühl. Sie hatte solche Angst, ihn zu verlieren. Hin und wieder sah sie auf die Stelle an ihrem Ringfinger, wo der nun fehlende Ehering ein weißes Band hinterlassen hatte, und merkte anfangs gar nicht, wie ihr die Tränen kamen.
Bennet änderte seine Position auf dem provisorischen Lager, das sie unter der aufgespannten Plane an Deck eingerichtet hatte, drückte ihre Hand und sah mit seinen grünen Jadeaugen zu ihr auf. »Hab keine Angst, Tilda. Ich bin aus härterem Holz geschnitzt, als du glaubst.«
2
London, Mai 1939 – Chelsea Flower Show
Francis hatte Sibylla sofort erkannt. Sie gar nicht bewusst gesehen, sondern vielmehr gespürt. Als wären ihre Wurzeln miteinander verflochten. Ihr braunes, kinnlang frisiertes Haar schimmerte golden. Sie betrachtete seinen Garten mit echtem Interesse.
Francis war unsicher, was er tun sollte. Ihre Trennung vor fast zwei Jahren war abrupt gewesen, und keiner von beiden hatte sie gewollt. Sie hatten dem Willen der Healeys folgen müssen, die nicht ertrugen, dass sich die Tochter mit einem gewöhnlichen, nahezu mittellosen Mann einließ. Unter der Drohung, dafür zu sorgen, dass Francis andernfalls nie wieder eine Anstellung finden würde, hatten sie geschworen, fortan getrennte Wege zu gehen. Es hatte ihm beinahe das Herz gebrochen.
Und nun, nachdem er sie so lange nicht mehr gesehen hatte, war sie plötzlich hier.
Anfangs hatte er die Schuld an ihrem gemeinsamen Unglück bei sich gesucht, später bei ihr, denn es war leichter, wütend auf Sibylla zu sein, als sie zu vermissen.
Schließlich hatte er eingesehen, dass keiner von ihnen beiden zu belangen war. Allenfalls ihre Eltern und die allgemeinen Konventionen, die Frauen gegenüber besonders ungerecht waren.
Wäre ihre Lage umgekehrt gewesen, er der Fabrikantensohn und sie ein Mädchen aus einfachen Verhältnissen, hätte er sie heiraten können. Sicher hätte es auch dann ein wenig Gerede gegeben, aber das wäre schnell vergessen gewesen, und seine Eltern hätten es ihm nach Einsatz einiger Überredungskunst sicherlich auch erlaubt. Wenn nicht, hätte er sich über ihren Willen hinwegsetzen können. Nicht aber Sibylla. Denn ihr Vater blieb bis zur Ehe ihr Vormund.
Francis beschloss, sie nicht sofort anzusprechen. Stattdessen betrachtete er ihre Silhouette. Ihre Taille hatte er schmaler in Erinnerung, wusste noch genau, wie es sich anfühlte, wenn er sie beim Tanzen emporhob, sie herumwirbelte. Mein Gott, wie sie getanzt hatten! Lindy Hop und Swing, bis man die Tanzfläche für sie räumte, die Leute zusahen, klatschten und sie anfeuerten. Mit keiner Frau hatte er sich so zur Musik bewegen können wie mit ihr.
Ohne sie war er kaum noch ausgegangen. Es bereitete ihm keine Freude mehr, weil überall Erinnerungen lauerten. Vielleicht würde es erst mit der Zeit besser werden. Oder mit einer neuen Frau in seinem Leben.
Zum Glück hatte er derzeit den Kopf voll mit anderen Dingen. Die Arbeitsstelle bei dem Landschaftsarchitekten Ephraim Temple nahm ihn ganz und gar in Beschlag, denn er besuchte nebenher an drei Tagen die Universität und musste die versäumte Arbeitszeit so gut wie möglich nachholen.
Sein Arbeitgeber und gleichzeitiger Förderer war ausgesprochen zufrieden mit ihm. Es machte Francis stolz, bedeutete aber auch, dass er sich mit ständig neuen und größeren Prüfungen konfrontiert sah, denen er sich nicht immer gewachsen fühlte. Bislang war es stets gut ausgegangen, doch die Selbstzweifel fraßen an seiner Kraft und nahmen ihm nachts die Ruhe.
Einen eigenen Garten zu entwerfen und ihn hier auf der Flower Show zu präsentieren, war eine weitere große Hürde auf seinem Werdegang, die sich bei Gelingen zu einem wichtigen Trittstein mausern konnte.
Offenbar fand seine mutige Mischung der Stile Anklang beim fachkundigen Publikum. Dass nun ausgerechnet Sibylla hier stehen geblieben war und seine Schöpfung musterte, ließ sein Herz jagen wie nach einem Dauerlauf. Seine Komposition gefiel ihr, das konnte er an ihrem Gesicht ablesen. Nun sah sie sich nach der Plakette um, auf der sein Name vermerkt war.
Sie zuckte zusammen, dann strich sie mit den Fingern über die Buchstaben, scheinbar ohne es selbst zu bemerken. Wie aus einem Traum gerissen, sah sie sich hektisch um, bemerkte Francis aber aus dem Blickwinkel nicht. Als sie die Flucht antrat, rief er ihren Namen.
Sie musste ihn gehört haben, ihr Schritt geriet aus dem Takt, doch sie drehte sich nicht um. Francis wusste nicht, was in ihn gefahren war. »Sibylla?« Er holte sie mit schnellen Schritten ein und berührte sie am Arm. »Miss Healey!«
»Mein Name lautet Sable«, erwiderte sie kühl. Als sie sich nun umwandte, war ihr praller Kindsbauch nicht zu übersehen. In ihm krampfte sich alles zusammen. Sie war verheiratet! Schwanger gar!
So schnell? Es war doch kaum Zeit vergangen seit ihrer Trennung! Unbewusst war er immer davon ausgegangen, dass sie ebenso trauerte wie er. Francis war nicht bereit für eine neue Frau, doch Sibylla …
»Schwanger?«, flüsterte er so erstickt, dass er selbst nicht wusste, ob er es laut gesagt hatte.
Sie blickte ihn starr an. Ihr hübsches Gesicht wirkte plötzlich kantig wie eine Maske. Sibylla biss die Zähne fest aufeinander, und in den schönen blauen Augen schimmerte es verräterisch.
Hatten ihre Eltern sie gezwungen zu heiraten? Sosehr es ihm auch wehtun würde, er musste wissen, wie es ihr ergangen war. »Geht es dir gut?«, fragte er. »Liebst du ihn?«
Sie nickte, gab ein Geräusch von sich, bei dem es sich um ein Ja handeln mochte. »Du hast den schönsten Garten«, brach sie ihr Schweigen.
»Wir könnten … könnten einen Tee …«, stammelte er, doch sie schüttelte nur heftig den Kopf. »Nein, Francis, ich muss jetzt gehen, leb wohl.«
Sie wandte sich ab. Francis wusste nicht, was er tun sollte. Ihr plötzliches Auftauchen hatte alles verändert. Sie durfte jetzt nicht so einfach wieder verschwinden. Er folgte ihr. »Sibylla!«
»Ich kann dich nie wiedersehen«, rief sie, und schon war sie von der wachsenden Besuchermenge verschluckt worden.
Francis blieb zurück und fühlte sich um eine Chance betrogen, die sich nur Augenblicke lang präsentiert hatte, wie um ihn zu verspotten. Nur um ihm an einem Tag, der zu einem Triumph hatte werden sollen, vorzuführen, was er alles verloren hatte.
Der Anblick seines Gartens, den er wochenlang akribisch geplant hatte, ekelte ihn plötzlich an. Er wandte sich ab und eilte in die andere Richtung davon. Zu viele Erinnerungen hingen an diesem Ort. Er hätte niemals herkommen dürfen.
*
Sibylla blickte zurück. Folgte er ihr? Nein. Sie atmete auf, doch zugleich war da ein Hauch von Enttäuschung. Andere Männer hätten wohl nicht so schnell aufgegeben und sie weiter bedrängt. Nicht jedoch Francis.
Er hatte ihren Willen seit jeher akzeptiert, und das war einer der Gründe, warum sie sich so zu ihm hingezogen gefühlt hatte. Sie begegneten sich auf Augenhöhe.
Sibylla rieb mit einer Hand über ihren Bauch. Die Schmerzen hatten nachgelassen. Ihr Kleines trat sie nicht mehr, und die Übelkeit verschwand. Es kam ihr vor, als würde das Ungeborene Francis ablehnen. Sibylla war nun Oliver Sables Frau, erwartete sein Kind, und sie liebte ihn. Wenn auch auf eine völlig andere Weise als Francis. Der frühere Gärtner ihrer Eltern war ihre erste große Liebe gewesen, und die vergaß man nicht. Warum nur tat es auch nach zwei Jahren noch so weh, an ihn zu denken?
Warum konnte ihr dummes Herz nicht einsehen, dass sie einen anderen Weg eingeschlagen hatte? Den Pfad an Olivers Seite, den sie nicht mehr verlassen konnte. Und auch nicht wollte. Sie hatten sich gemeinsam ein Leben aufgebaut und würden in wenigen Wochen zu einer richtigen kleinen Familie werden.
Es tat gut, einfach weiterzugehen und die vielen Eindrücke auf sich einstürmen zu lassen. Menschenlärm und Trubel lenkten sie ab, dazu die vielen Zelte, in denen weitere Ausstellungen und Wettbewerbe stattfanden. Es duftete nach Pflanzen und Zuckerwatte.
Im vergangenen Jahr war sie noch mit ihrer besten Freundin Tilda über das Ausstellungsgelände flaniert. Sie hatten jede freie Minute miteinander verbracht, auch weil damals schon feststand, dass Tilda bald auf Expedition gehen würde. Seitdem war so viel geschehen. Sibylla versuchte, sich jede Einzelheit in Erinnerung zu rufen, um den Gedanken an Francis aus ihrem Kopf zu verbannen.
Hier hatte Tilda ihre selbst gezüchtete Rose ausgestellt und damit ihr Stipendium gewonnen. Dort waren sie mit einer ganzen Schar von Mädchen in die Seerosen-Ausstellung eingefallen und hatten einige besonders hübsche Exemplare für ihre Schule erworben.
Sibylla ging unbewusst schneller. Dort! Dort war der Stand der Schule! Neue Mädchen hatten ihren Platz eingenommen und warteten mit vor Aufregung geröteten Wangen auf Besucher. Die Schule stellte robuste Obst- und Gemüsepflanzen aus, aber auch wunderschöne Ziersträucher und Blumen. Besonderes Augenmerk lag in diesem Jahr wie so oft auf den Erdbeeren, die mittlerweile wohl in ganz England bekannt sein mussten. Selbst König George und seine Frau Elisabeth schätzten die Früchte der Waterperry-Züchtung Royal Sovereign.
»Mrs Sable, welch eine Freude!«, wurde Sibylla von der Rektorin begrüßt, einer resoluten und strengen, aber doch warmherzigen Frau, deren ganze Leidenschaft der grünen Natur und der Frage galt, wie der Mensch sie verbessern konnte. Sie kannte Mrs Havergal hauptsächlich in Hosen, derben Schuhen und einem grünen, formlosen Kittel; heute trug sie dem Anlass entsprechend ein Kostüm, in dem sie ein wenig wie verkleidet aussah.
»Mrs Havergal, welch eine Freude!« Sie gab ihr die Hand und bekam einen kräftigen, etwas rauen Händedruck und ein herzerwärmend ehrliches Lächeln zurück.
»Wie geht es Ihnen? Ist die Erdbeerernte gut angelaufen?«
»Alles bestens«, erwiderte Mrs Havergal. »Die kleine Staudenrabatte, die Sie neben dem Tennisplatz angelegt haben, zeigt sich dieses Jahr in ihrer ganzen Schönheit. Duftende Blüten und Schmetterlinge, so weit das Auge sieht. Auch unsere Bienen lieben die üppigen Trachtpflanzen. Sie sollten einmal zu Besuch kommen, wenn es Ihr Zustand erlaubt.«
»Das würde ich nur zu gern, aber zuerst muss mein Kleines auf die Welt kommen. Ich wage mich kaum noch von daheim fort, aber die Chelsea Flower Show konnte ich mir einfach nicht entgehen lassen. Führen Sie mich ein wenig herum?«
»Selbstverständlich.«
Sibylla betrat den kleinen Pavillon der Schule und fühlte sich sogleich um ein, zwei Jahre zurückgeworfen, als sie selbst noch hier gestanden und Besucher empfangen hatte. Wie immer waren die Pflanzen der Schule exquisit. Sibylla spürte, dass sie es überraschenderweise vermisst hatte, sich mit Stecklingen und Veredelungen zu beschäftigen.
Und hier, genau hier an dieser Stelle, war sie dem König und der Königin höchstpersönlich begegnet. Nur wegen ein paar Erdbeeren, die allerdings zweifellos besonders gut schmeckten.
Mrs Havergal erkundigte sich, ob Sibylla inzwischen neue Artikel verfasst hätte, und war erstaunt, dass es mittlerweile so viele waren.
»Ich erinnere mich noch sehr genau an Ihre ersten Schritte, Mrs Sable. Wie aufgeregt Sie waren. Ich schätze mich stolz, dass eine so begabte Schriftstellerin wie Sie ihren ersten Artikel in unserer Schülerzeitung veröffentlichte. Sie werden noch Karriere machen, meine Liebe.«
Sibylla fühlte, wie ihre Wangen zu glühen begannen.
»Nun schauen Sie nicht so irritiert. Wer gute Arbeit leistet, darf auch stolz darauf sein. Ich hoffe doch, Sie bleiben Ihrem Thema treu?«
»Ja, natürlich. Es gibt noch so viele spannende Persönlichkeiten mit einem Hang zum Gärtnern, das reicht für ein ganzes Leben.«
»Und wir sorgen ständig für Nachwuchs«, erwiderte Mrs Havergal lachend.
Sie plauderten noch ein wenig über gemeinsame Bekanntschaften, dann verabschiedete sie sich.
Sibylla atmete tief durch, was mit dem großen Bauch gar nicht so einfach war, und schlenderte los. Sie hatte noch einige Termine, doch nun, da sie nicht mehr abgelenkt war, sah sie wieder Francis vor sich. Die Enttäuschung in seinem Blick, als hätte er gehofft, dass sie doch auf ihn wartete. Aber wie? Außerdem hatten sie einander geschworen, sich niemals wiederzusehen. Leise krochen Schuldgefühle näher, die Sibylla jedoch nicht an sich heranlassen wollte. Sie hatte darauf verzichtet, ihm zu schreiben, um ihren Vater nicht gegen ihn aufzuwiegeln. Für Francis hatte sie sich zusammengerissen, aus Liebe zu ihm verzichtet.
Es war die Wahrheit. Aber warum fühlte es sich dann trotzdem falsch an, fast wie eine Lüge?
Sibylla streifte über die Ausstellung, ohne wirklich etwas anzusehen. Das herrliche Frühlingswetter besserte ihre Stimmung nicht. Als sie schließlich auf ihre Eltern traf, wollte sie eigentlich nur noch nach Hause zurückkehren.
3
Borneo, drei Wochen später
Bennet saß auf der Terrasse ihres kleinen Häuschens und blickte hinab auf den Fluss. Friedlich lag er da, wie ein breites, golden schimmerndes Band. Ein Mann ruderte seine kleine Familie auf einem schlanken Einbaum zur anderen Seite. Sonnenlicht brach sich silbrig auf dem Inhalt eines Flechtkorbes.
Bennet benötigte kein Fernglas, um zu wissen, womit er gefüllt war. Neben Knollen würden die Leute Hunderte winziger Fische zum Verkauf anbieten. Die kleine Ansiedlung hatte einen Marktflecken, wo die Bauern die Früchte ihrer Arbeit anboten, Fischer ihren Fang verkauften.
Er sehnte sich danach, endlich wieder mehr zu sehen als die Hütte und das wenige, das er von der Terrasse aus erkennen konnte.
Wer hätte gedacht, dass auf dieser Reise nicht seine geliebte Tilda, sondern er in Lebensgefahr geraten würde? Er hatte sich so in ihr geirrt. Sie war stark und tapfer und so mutig, dass sie es mit jedem Mann aufnehmen konnte.
Auch jetzt schwang sie Grabhacke und Schaufel, während er zur Untätigkeit verurteilt war und wie ein alter, gebrechlicher Mann auf der Veranda saß.
Er lehnte sich in seinem Stuhl zurück und rieb über die Eintrittsstelle der Kugel. Einen Verband trug er nicht mehr, doch die frische Narbe schmerzte und juckte im Wechsel.
Mit geschlossenen Augen rief er sich den verhängnisvollen Tag erneut in Erinnerung. Räuber hatten ihr Flussschiff überfallen, auf dem sie eine mehrtägige Expedition tief in den Dschungel unternommen hatten. Und was für ein Erfolg die Exkursion gewesen war! Ihre Stiegen und Kisten waren bis unter den Rand gefüllt mit seltenen und unbeschriebenen Pflanzen. Genug für ein Lebenswerk, selbst wenn er nie wieder auf Forschungsreise gehen sollte. Und nun war all das verloren.
Irgendwann war ihr Treibstoff zu Ende gegangen, und so hatten sie sich auf eine ruhige Fahrt flussab eingestellt. Mit Staken und Ruder ging es auch so gut voran.
Als die Räuber auftauchten, hatte er sie nicht einmal bemerkt. Der Schuss fühlte sich an wie ein Faustschlag. Der Schmerz kam später. Ihm war die Luft weggeblieben, dann hatte er gespürt, wie ihm das Blut den Rücken hinunterlief. Ihm fehlten die Erinnerungen an die Minuten danach. Tilda hatte ihn in Sicherheit gebracht, dabei Ruhe bewahrt.
Auf der Rückfahrt war er immer wieder eingeschlafen. Als sie schließlich einen Missionsarzt fanden, waren fast zwei Tage vergangen, und die Wunde hatte sich entzündet. Zum Glück hatten sie genug Penizillin bei sich gehabt.
Das Fieber war gekommen und wieder gegangen. Beim nächsten Mal war er hier aufgewacht, in seinem eigenen Bett, und Tilda weinte, als er zum ersten Mal ihre Hand nahm und sie drückte. An einige Tage aber konnte er sich nicht mehr erinnern.
Nun ging es ihm endlich besser, doch es war ein schleichender Prozess. Er konnte aufstehen und ein wenig herumgehen, doch es ermüdete ihn schnell. Seine innere Unruhe wuchs mit jeder Stunde. Er wollte endlich wieder Teil dieses Abenteuers sein statt nur Zuschauer!
Wenigstens konnte er sich nun so wie früher der Bestimmung und Katalogisierung ihrer Sammelstücke widmen. Er legte Herbarien an, für die er Blätter, Wurzeln und Blüten presste. Zeichnete und beschrieb, was Tilda ihm brachte.
Nachdem er die Schrauben an einer Pflanzenpresse festgezogen hatte, lehnte er sich mit einem Seufzer zurück. Sogar das war anstrengend gewesen.
Er schob die Reste der Lilie von der alten Zeitung, die ihm als Unterlage diente, und überflog die Zeilen, die er bis dahin nicht bewusst wahrgenommen hatte. Sie waren so weit weg von Europa, dass die Politik daheim aus dem Blick geriet. Bennet hatte sich nie besonders dafür interessiert, er verstand sich als Weltbürger, weniger als Engländer. Wer in so vielen Ländern gelebt hatte wie er, verlor seine Wurzeln. Womöglich war es eine Art Selbstschutz. Dann tat es weniger weh, wenn das Schicksal ihn von einem Ort fortriss und an einen anderen trieb. Eine Lektion, die er schon als Kind verinnerlicht hatte. Die ständigen Reisen seiner Eltern hatten dafür gesorgt, dass seine Schwester Beatrice und er keine Freundschaft länger als einige Monate gepflegt hatten und sich deshalb umso mehr aneinanderklammerten.
Sein Blick fiel wieder auf die alte, vergilbte Zeitung, auf der Erde und Pflanzensäfte Flecken hinterlassen hatten. Sie war bereits mehrere Monate alt, er wusste gar nicht mehr, woher sie stammte. Vom Japanisch-Chinesischen Krieg stand dort geschrieben. Es war der zweite dieser Art. Die japanische Armee drang immer weiter auf chinesische Gebiete vor. Die Truppen Chinas waren rückständig und kaum gerüstet, und um nicht noch mehr Territorium zu verlieren, sah sich die Führung scheinbar zu immer drastischeren Maßnahmen gezwungen.
Über dem nächsten Absatz hatte ein dunkler Erdfleck das Papier aufgeweicht. Bennet schob seine Brille höher auf die Nase. Entzifferte Buchstabe um Buchstabe.
Um den Vormarsch der Japaner zu stoppen, hatte China die Dämme des Gelben Flusses zerstört. Bennet war noch nie dort gewesen, doch das war auch nicht nötig, um zu wissen, dass es ein gewaltiger Strom war. Die verursachte Überflutung hatte die einrückenden Soldaten zwar aufgehalten – aber zu was für einem Preis? Beinahe eine Million Zivilisten waren ertrunken, Tausende Dörfer dem Erdboden gleichgemacht. Niemand hatte diese Menschen gewarnt. Bennet berührte das unglaubliche Ausmaß der Katastrophe. So viele einzelne Schicksale … einfach ausgelöscht. Er starrte weiter auf die Zahl – 890 000 – und kam sich selbst plötzlich völlig unbedeutend vor. Was war er schon? Eine winzige Ameise in einem gewaltigen System kleiner Leben. So schnell zertreten, ausgelöscht …
Seine Verwundung, das lächerliche Gefühl, nicht produktiv genug zu sein – was hätten all die Menschen, die dort ertrunken waren, dafür gegeben, mit ihm tauschen zu dürfen? Er knüllte die Zeitung zusammen, stützte sich am Tisch ab und stand auf. Langsam trat er an das Geländer der Veranda, blickte erst auf den Fluss hinab, der harmlos und friedlich in seinem Bett dahinzog, dann auf die Berge in ihren Nebelkleidern, die wie Schemen hinter dem Wald aufragten.
Frauen sangen, während sie Wäsche wuschen und auf den Büschen zum Trocknen ausbreiteten. Kinder tollten mit kleinen Hunden am Ufer umher. Alles machte einen friedlichen Eindruck und konnte doch die Unruhe in seinem Inneren nicht besänftigen. Seitdem er dem Tod nur knapp entkommen war, war etwas mit ihm geschehen, das sich so leicht nicht abschütteln ließ.
Bennet stützte sich auf die Brüstung, lehnte sich weit nach vorn und konnte schräg hinter dem Häuschen auf einer kleinen Parzelle die Frau sehen, deren bloßer Anblick das klamme Gefühl in seiner Brust schon ein wenig zu lindern vermochte.
Mit der Präzision eines Uhrwerks schwang Tilda eine Hacke. Müdigkeit schien sie nicht zu kennen. Sämtliche Vorurteile, die er über Frauen in der Feldforschung hegte, hatte sie in einem Sturm hinweggefegt. Ihr Tatendrang, die Begeisterung und Energie, mit der sie ihre Ziele verfolgte, waren inspirierend.
Und er? Er schaffte es nicht einmal aus ihrem Häuschen heraus. Wut über seine eigene Unzulänglichkeit machte sich in ihm breit. Keinen weiteren Tag sollte es so weitergehen. Er setzte seinen Hut auf, drückte eine Hand auf die schmerzende Schulter und ging zu dem angelehnten Baumstamm, der von der Terrasse zum Boden führte. Zwei Meter nur. Zwei Meter und doch ein schier unüberwindbares Hindernis.
In den Stamm waren Kerben geschlagen, die als Trittstufen dienten. Ein Geländer gab es nicht. Er hatte anfangs über dieses Konstrukt gescherzt und überlegt, sich eine vernünftige Treppe bauen zu lassen, doch Tilda hatte nichts davon hören wollen. Dann sieht unser Häuschen ganz verkehrt aus, hatte sie gesagt. Lernen wir lieber, ein bisschen geschickter zu sein.
Bennet biss die Zähne zusammen und betrat die erste Stufe. Er wankte. Oder war es der Stamm, der sich bewegte? Noch ein Schritt. Gut gegangen. Doch beim nächsten wurde ihm einen Moment lang schwarz vor Augen. Es war doch eine dumme Idee gewesen. Unsicher griff er mit der Hand ins Leere, verlor das Gleichgewicht …
*
Tilda richtete sich auf und drückte den Rücken durch. Etwas hatte sie innehalten lassen. Ein Geräusch? Sie nahm den breiten Strohhut ab und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Heute hatte es erst ein einziges Mal geregnet, was in diesem Winkel der Welt bereits als trockener Tag galt. Es sah nicht so aus, als würden die Wolken bald Erleichterung bringen. Wenn es regnete, arbeitete sie einfach mit nasser Kleidung weiter, wie es auch die Einheimischen taten. Kalt wurde ihr hier niemals, der Regen verschaffte die nötige Kühlung.
Tilda blickte auf die geraden Furchen, die sie mit der Hacke in den weichen Urwaldboden gezogen hatte. Er war arm an Nährstoffen, deshalb hatte sie schon vor einigen Wochen damit begonnen, die Fischabfälle der Dörfler zu sammeln und neben neu gesetzten Pflanzen in den Boden einzubringen. Solange Gräten und Köpfe noch frisch waren, war die Arbeit nicht unangenehm.
Zwei Furchen würde sie noch ziehen, dann konnte sie mit dem Pflanzen beginnen. Sie hatte sich fest vorgenommen, die von Bennet gesammelten Lilien bis zu ihrer Rückreise nicht nur am Leben zu halten, sondern sie zu fördern, gesund und robust zu machen, vielleicht sogar schon zu vermehren. Schließlich ging es nicht nur um die wissenschaftliche Präsentation seltener und unbekannter Arten – sie wollten auch Geld damit verdienen. Das war bitter nötig. Bennets Verwundung hatte sie in ihrem Zeitplan weit zurückgeworfen, und durch den Überfall der Räuber hatten sie einen Großteil ihrer Funde unwiederbringlich verloren. Doch Tilda war nicht bereit, sich einfach damit abzufinden. Sie würde es schon mit den Fährnissen dieser Expedition aufnehmen!
Die Ausbildung in Waterperry kam ihr dabei sehr zugute, und sie dachte oft an ihre strenge, aber freundliche Lehrerin Mrs Havergal zurück.
Rascheln im Laub, schlurfende Schritte. Wer da wohl kam? Sie wandte sich um. »Bennet!« Erschrocken eilte sie ihm die letzten Schritte entgegen. »Du meine Güte, wie siehst du denn aus?«
»Nun, wie sehe ich denn aus, Darling?«, erwiderte er etwas abgekämpft und lächelte schief. Sein Gesicht war unter der Sonnenbräune blass, Schweißperlen sammelten sich auf seinen Wangen und der Nase. Seine grünen Augen wirkten unter den dunklen Wimpernbögen ungewöhnlich hell. Den zerknitterten Hut trug er in der Hand. Seine Hose war am linken Knie verschmutzt und aufgerissen, auf dem Bein war Blut.
»Ich … Ich weiß nicht. Was machst du denn hier?«
»Ist es so verwerflich, seine Ehefrau zu besuchen?«
»Nein, natürlich nicht.« Tilda legte ihm die Hände an die Wangen, ging auf die Zehenspitzen und küsste ihn. »Das ist die schönste Überraschung heute.«
»Ich kann doch nicht für immer dort eingesperrt bleiben wie ein Vogel im Käfig.«
Sie zupfte das zerrissene Hosenbein auseinander, um sich sein Knie anzusehen. Nur ein paar blutige Schrammen und ein blauer Fleck. Nichts Ernstes. »Ich frage wohl besser nicht genauer nach, wie das passiert ist.«
Bennet grinste. »Führ mich lieber herum. Von der Terrasse aus ist kaum zu ermessen, was du in den vergangenen Wochen alles erreicht hast.«
»Nun gut.« Sie ließ die Hacke liegen und hakte sich bei ihm unter. »Willkommen in der Gärtnerei Morris, Sir.« Sie kicherte gut gelaunt. Wie lange hatte sie darauf gewartet, ihm alles zu zeigen! Sie war stolz auf das, was sie mit einfachsten Mitteln erreicht hatte.
Sie mussten ein Stückchen gehen, dann war sie im Herzen der Pflanzung angelangt. »Hier sind all die Lilien, die ich nach ihrer Begegnung mit den Räubern noch retten konnte. Wie du siehst, machen sie sich recht gut und treiben kräftig aus. Ich habe für den Anbau den alten Obstgarten benutzt. Schau, die Mangobäume, Papayas und Bananenstauden sorgen für Schatten, damit sie nicht verbrennen. Ich habe mir auch noch andere Bäumchen bringen lassen. Die Einheimischen waren so hilfreich, schau nur, hier.« Sie führte ihn zu einem jungen Bäumchen, das sie wie in einer englischen Baumschule mit zwei Stützen versehen hatte. »Das ist eine Guave. Und das dort ist ein Rambutan, die Bäume werden riesig, doch das erleben wir wohl nicht mehr. Er trägt aber jetzt schon erste Früchte.«
Seitdem sie ein wenig sesshaft geworden waren, hatte Tilda es zu einer kleinen Wissenschaft gemacht, alles zu probieren, was die Einheimischen an seltsamen Früchten anbauten und aßen. Selbst mit der stinkenden Durian hatte sie sich mittlerweile angefreundet.
Bennet bückte sich, um einige Pflanzen zu begutachten, und drehte die Blüten verschiedener Exemplare zwischen den Fingern. »Wenn ich dich nicht hätte«, seufzte er.
Ein Schatten huschte durch Tildas Gedanken. Wenn er sie nicht hätte, dann wäre ein Großteil der Pflanzen verloren gewesen. Und vielleicht auch Bennet, denn ohne ihr schnelles Handeln … Nein, sie mochte gar nicht daran denken.
»Ich möchte das daheim auch probieren, Bennet.«
»Hmm?«
»Baumreihen und niedrige Pflanzen abwechselnd setzen, damit sie einander gegenseitig nutzen. Wie wir jetzt schon Brunnenkresse einsetzen, damit sie die Schädlinge vom Gemüse fernhält. Die Wurzeln der Bäume reichen tiefer und ziehen das Wasser hinauf, Gemüse und Obst schützen den Boden mit ihrer Blätterschicht zugleich davor, auszutrocknen. Ich muss nur noch mit Düngearten und Bodenaufbau experimentieren.«
Er küsste sie auf die Wange. »Davon müsstest du deine Eltern überzeugen, sie haben die Gärtnerei, nicht ich.«
»Ich werde auch Mrs Havergal davon erzählen.« Tilda war ganz berauscht von der Idee, in Waterperry ein eigenes Experimentierfeld anzulegen. Schließlich hatte die Rektorin ihr ja angeboten, die Schulzeit dort zu beenden. »Ich werde mir noch weitere Waldgärten ansehen und alles genau aufschreiben.«
»Ich wusste doch, was für eine Forschernatur in dir steckt. Ziehst du deshalb immer frühmorgens mit den Frauen los?«
»Du hast mich beobachtet.« Tilda war erstaunt. Also vergrub er sich nicht so tief in seine Forschung, wie sie geglaubt hatte.
»Ich vermisse dich jeden Moment, den du nicht bei mir bist. Natürlich sehe ich dir nach! Du hast nur nie zurückgeblickt«, konterte er, und sie meinte, einen Hauch von Anklage aus seinem Tonfall herauszuhören.
»Wie hätte ich denn ahnen können …?«
Er lächelte geheimnisvoll. »Jetzt weißt du es, und nun bin ich ja hier. Dort oben fällt mir die Decke auf den Kopf. Ich kann mich doch nicht jetzt schon an die Nachbearbeitung setzen, während hier draußen das Leben pulsiert. Von heute an werde ich wieder jeden Tag mithelfen.«
»Das ist schön.« Tilda schmiegte sich an ihn. Es kam ihr noch immer unwirklich vor, dass Bennet ihr nicht vom Schicksal genommen worden war. Jeder Tag mit ihm war wie ein Geschenk, auch wenn sie meist nur die Morgen und Abende miteinander verbrachten. Ab heute würde das wieder anders werden. »Ich freue mich darauf. Sicherlich finden sich Möglichkeiten, wie du in den Gärten arbeiten kannst.«
Sein Blick verdunkelte sich. »Im Moment bin ich ganz und gar damit beschäftigt, mich auf den Beinen zu halten.«
»Dann machen wir es anders. Wir lassen hier draußen einen Tisch für dich zimmern, und du kümmerst dich um die Teilung der Pflanzen. Ich denke, wenn wir noch einige Monate hier sind und uns gut kümmern, können wir mit der doppelten oder dreifachen Menge heimfahren! Nirgendwo anders werden sie so gut gedeihen wie in ihrer natürlichen Heimat. Was hältst du davon?«
»Dass meine Frau ein Genie ist. Du wirst uns noch reich machen.«
»Reich muss ich nicht sein, Hauptsache, ich habe dich, und wir sind glücklich.«
Er schloss sie von hinten in die Arme. Gemeinsam sahen sie auf die wolkenbekränzten Berge, die wie blaue Zacken aus dem Urwald ragten. Es duftete süß nach überreifen Mangos und Erde, und Tilda glaubte, noch nie so glücklich gewesen zu sein wie in diesem kostbaren Augenblick.
4
Oxford, Ende Juni 1939
»Ich bin so froh, dass du hier bist, Mum. Lass mich nicht allein, lass mich jetzt nicht allein!«, stöhnte Sibylla. Es fühlte sich an, als würde ihr Innerstes entzweigerissen, dabei hatten ihre Wehen gerade erst begonnen.
Ihre Mutter wohnte bereits seit fünf Tagen bei ihr. Oliver war in der Kaserne, und sie wollte in den letzten Tagen der Schwangerschaft nicht ganz auf sich allein gestellt sein.
Nun lief sie an den Arm ihrer Mutter geklammert in der Wohnung auf und ab, während die Haushälterin das Bett für die Niederkunft vorbereitete.
»Soll ich mich nicht hinlegen?«
»Nein, du läufst, so ist es besser, komm.«
»Aber meine Beine fühlen sich an wie Pudding.«
»Sibylla, Mädchen, du bist stark.« Die Stimme ihrer Mutter wurde weich, und sie rieb Sibylla den Rücken. Das hatte sie schon als Kind geliebt, und nun linderte die liebevolle Geste für einige Atemzüge den Schmerz, bevor es wieder von vorn losging.
»Komm, stütz dich hier ab.«
Sibylla lehnte sich mit beiden Händen auf den Wohnzimmertisch. Ihre Mutter huschte unterdessen von einem Fenster zum anderen und zog die schweren Vorhänge zu. Gut so. Ihre Nachbarn mussten nicht sehen, wie sie am helllichten Tag in ihrem weiten, hellblauen Nachthemd herumgeisterte.
Als die nächste Wehe kam, vergaß sie, zu atmen. Das Kind! Sie spürte genau, wie es sich bewegte! Ihr Wasser war erst vor einer Stunde gebrochen. Es kam ihr jetzt schon wie eine kleine Ewigkeit vor. Wie sollte das nur weitergehen?
»Ich schaffe das nicht.«
»Natürlich schaffst du das, Darling.« So energisch hatte Sibylla ihre Mutter noch nie erlebt. »Du willst dein Kindchen doch endlich in den Armen halten können, oder nicht? Es will hinaus, und du willst es heraus haben. Das schafft ihr nur gemeinsam. Und nun los, auf die Beine.«
Sibylla drückte sich hoch und sah sich zweifelnd in ihrem Wohnzimmer um. Die zugezogenen Vorhänge sorgten für schummriges Licht. Es kam ihr merkwürdig vor, hier zu sein, falsch. Zugleich missfiel ihr die Vorstellung, sich in ein Auto zu quetschen, um unter der Aufsicht von Fremden ihr erstes Kind zu bekommen. Dies hier war ihr Heim, der Ort, den sie selbst liebevoll eingerichtet hatte wie ein Nest. Hier fühlte sie sich wohl. Sie wollte nicht fort. Aber was, wenn etwas schiefging? »Sollten wir keinen Arzt holen?«
»Papperlapapp. Ich habe dich und deinen Bruder allein auf die Welt gebracht, und deine Haushälterin, die gute Rose …«
»… hat acht gesunde Kinder bekommen, ich weiß, ja.« Sibylla stöhnte. Es klang selbst in ihren eigenen Ohren jämmerlich. Die Wehen kamen jetzt schneller. Alles zog, zerrte und quetschte. Sie fühlte Nässe an ihrem Oberschenkel. »Der Teppich«, keuchte sie und wankte am Arm ihrer Mutter zurück in den Flur.
»Alles bereit, Madam.« Rose kam aus dem Schlafzimmer an ihre andere Seite geeilt und blickte besorgt auf die Standuhr. »Jetzt ist es bald so weit«, sagte sie weich, nachdem sie wohl den Abstand der Wehen geprüft hatte.
Sibylla wusste nur, dass es schlimmer wurde. Zwischen den Krämpfen bekam sie kaum noch genug Luft. Die Zeit verging schleichend, floss wie träger Sirup. Sie war wie benommen, entrückt beinahe. Nach einer Weile schwand die Angst, obwohl der Schmerz stetig zunahm. Sie überließ sich ganz den beiden erfahrenen Frauen.
Presste, wenn sie pressen sollte, atmete, wenn sie dazu angefeuert wurde, wie bei einem Tausendmeterlauf.
Sie gebar den kleinen Philipp kniend, die Arme um den Bettpfosten gekrampft, weil sich jede andere Position falsch anfühlte.
Als sie schließlich im Bett lag, das kleine, noch ein wenig nasse Kind in den Armen, war sie so glücklich wie wohl noch nie in ihrem Leben. »Ich hab ihn so lieb«, sagte sie mit Tränen in den Augen. Ihre Mutter und die Haushälterin Rose saßen an ihrem Bett und lächelten. Ja, sie wussten ganz genau, wie Sibylla sich nun fühlte.
»Und? Hat sich die Mühe gelohnt?«
»Oh, Mum, wie kannst du das nur fragen? Natürlich, schau ihn dir doch nur an, wie hübsch er ist! Und so klein.«
Sie strich ihrem Sohn über die Wange. Philipp gab schmatzende Geräusche von sich und zog die Unterlippe ein. Seine blauen Augen waren nur ein wenig geöffnet und blickten scheinbar ziellos umher.
»Mr Sable kommt«, sagte Rose und sprang auf. Da hörte auch Sibylla den Schlüssel im Schloss und gleich darauf, wie die Haustür geöffnet wurde. »Ja, ist es denn schon so spät?«, fragte sie irritiert.
»Bald wird es sieben. Ihr beiden habt euch Zeit gelassen«, sagte ihre Mutter und huschte aus dem Zimmer.
Und dann war Oliver da.
Er blieb im Türrahmen stehen. Im Gegenlicht sah Sibylla nur seine Silhouette, kantig in der Uniform, beinahe wie der Umriss einer Statue.
»Komm her und begrüße deinen Sohn.«
»Ein … Ein Sohn«, flüsterte er mit belegter Stimme und näherte sich zögernd. Ihm hing der Duft von Sonnenwärme an, und ein Hauch Tabak. Seine lackierten Stiefel glänzten ebenso wie die Gürtelkoppel. Er streifte seine Jacke ab und kniete sich neben das Bett. »O mein Gott, Sibylla, du machst mich zum glücklichsten Mann der Welt.«
»Umso besser, dass du die glücklichste Frau der Welt hast. Willst du ihn nicht in den Arm nehmen?«
»Kann ich das denn?« Er küsste sie auf die Stirn, dann auf den Mund. Ihre Lippen waren ganz spröde, weil sie so viel geschrien hatte, aber Oliver schien es nicht zu bemerken.
Sibylla setzte sich vorsichtig im Bett auf. Sie wusste noch nicht, wie viel sie sich zutrauen konnte. Aber so geschwächt wie vor einer halben Stunde war sie auch nicht mehr. Es war doch erstaunlich, was die Natur einem Frauenkörper abverlangte. Besonders, wenn man bedachte, wie die Männer das angeblich schwache Geschlecht behandelten. Oliver strich ihr mit den Fingerspitzen über den Arm, als fürchte er, sie könne jeden Moment zerbrechen.
»Ich wünschte, du hättest hier sein können«, sagte sie leise.
»Ich wäre wohl kaum von Nutzen gewesen. Geht es dir gut?«
»Es tut weh, aber der Kleine ist ein herrlicher Trost. Hier, nun nimm ihn endlich.« Sie legte ihm seinen Sohn vorsichtig in die Arme. Unter Olivers breiten Schultern sah das Baby noch winziger aus. Das kleine, gerötete Gesichtchen verschwand beinahe in der flauschigen Decke.
»Er kommt ganz nach dir, schau.« Sibylla strich vorsichtig die Mütze zurück. Ein dichter Schopf aus flaumigem blondem Haar war darunter zu sehen.
»Es ist so weich! Ich glaube, ich habe noch nie etwas Weicheres berührt.« Olivers Blick verklärte sich. Sibylla beobachtete abwechselnd ihn und seinen Sohn. Wie Oliver das Baby vorsichtig mit einem Finger streichelte und die Anspannung, die ihn schon seit Monaten wie ein Schatten begleitete, nach und nach verschwand. In seinen Wangen erschienen endlich wieder die Grübchen, die sie so liebte.
»Was für ein Wunder.«
»Ja.«
Er nahm wieder auf dem Bett Platz, und Sibylla lehnte sich an ihn. Gemeinsam hielten sie ihren Sohn im Arm. »Du darfst nie wieder weggehen, hörst du, Oliver?«, sagte sie träge. Eine große Müdigkeit kam über sie. Sie fühlte sich so sicher in seinen Armen.
»Jetzt ist ja erst einmal Wochenende, und dann beantrage ich einige freie Tage, versprochen.«
Sibylla hörte seine Worte noch nachhallen, während sie sich mit dem wohligen Gefühl, dass Oliver auf sie aufpasste, der Müdigkeit überließ.
5
1. September 1939
Die Figuren des neuen Nixenbrunnens glichen einem wahr gewordenen Traum. Goldschimmernd glänzten sie in der Mittagssonne, während sie von einem einfachen Kran auf den betonierten Sockel gehoben wurden.
Francis packte selbst mit an. Seine Jacke hatte er längst abgelegt, Schweiß klebte ihm das weiße Hemd an den Rücken und lief unter dem Druck der Hosenträger seine Haut hinunter. Er hielt mit beiden Händen ein Seil gefasst, mit dem sich die an der Aufhängung schwankende Statue lenken ließ. Sein Vorarbeiter Robert Jones, ein in die Jahre gekommener Boxer, der sich seinen Lebensunterhalt nun als Maurer und Gartenbauer verdiente, zerrte an einem weiteren Seil.
»Halt! Noch ein kleines Stück nach Nord!«, brüllte Francis. Sosehr er auch Ruhe hatte bewahren wollen – nun schrappte das kostbare Kunstwerk zum dritten Mal knapp an der bereits positionierten ersten Figur vorbei.
»Himmelherrgott, weiß denn keiner, wo Norden ist?«
»Ich fürchte, nein, Sir«, meldete sich Jones von der anderen Seite. Seine zerschlagene Visage, die krumm und schief zusammengewachsen war, leuchtete puterrot.
»Dann zeig es ihnen! Bin ich hier denn nur von Idioten umgeben?«
Jones übergab das Seil an einen Gehilfen, der so jung und unschuldig aussah, als sei er das exakte Gegenteil des alten Boxers.
»Die Verrohrung muss genau passen«, mahnte Francis ihn.
Die Figur ruckelte noch einmal nach oben, doch nun, mit Jones am Kran, schwebte sie endlich an ihren Platz.
Francis wagte kaum, zu atmen. Er ließ sich auf die Knie sinken, um besser unter die Figur schauen zu können, zerrte und zog …
Wenn nun etwas schiefging, würde er womöglich nicht nur einen Fuß, sondern gleich sein Leben verlieren. Doch daran dachte er nicht. Dies war sein Projekt, sein eigenes. Die Visitenkarte, mit der er sich einen Namen in der Welt der Gartenarchitekten machen würde.
»Nach unten! Jetzt!«, rief er heiser.
Die Figur drehte sich ein wenig, etwas knirschte unheilvoll, dann ließ der Druck auf den Seilen nach. Es war geschafft.
Sofort sprang Francis auf und umrundete den Brunnen, der das Zentrum der Wasserspiele bildete. Wie die Bühne eines Amphitheaters, hinter dem sich die wilde Natur erhob, die er natürlich ebenfalls geformt hatte, aber so unauffällig und geschickt, dass man das menschliche Wirken kaum bemerkte.
Er untersuchte den Schaden an der anderen Figur. »Das muss auspoliert werden, Jones.«
»Ich kümmere mich, Sir. Soll ich die Gießerei …?«
Er nickte nur. Robert Jones hatte er seit einem halben Jahr unter Vertrag. Der Mann war ein ungeschliffenes Juwel. Tüchtig bis zur völligen Erschöpfung, und sein brutal erscheinendes Gesicht flößte den Arbeitern einen Respekt ein, den sie Francis niemals entgegengebracht hätten. Francis wusste um seine eigenen Fähigkeiten ebenso wie um seine Mängel. Er war Gärtner, Architekt, Wasserkünstler, aber kein Grobian. Er brauchte Jones, und Jones brauchte ihn, denn kaum jemand wollte ihn für mehr als einfachste Arbeiten einstellen. Francis aber hatte sein Talent und den wohlverborgenen Sinn für Feines erkannt.
»Alles in Ordnung?«, fragte er den Klempner, der bereits in den engen Figurensockel hineingekrochen war und mit einer Lampe die Verbindungen besah.
»Leicht verbogen, nichts, was sich nicht mit ein paar Handgriffen richten ließe.«
»Sehr gut.«
Erleichtert überließ er den Anschluss der Verrohrung dem Handwerker und ging weiter zu einer alten Silberweide, die bereits auf dem Gelände vorhanden gewesen war, bevor er mit den umfangreichen Bauarbeiten begonnen hatte. Hier war ein Tisch mit Erfrischungen aufgebaut, daneben ein einfacher Zuber aus Zinn. Francis trank etwas, zog Hemd und Unterhemd aus und wusch sich mit Wasser aus dem Zuber, bis er das Gefühl hatte, den Bauherrn entgegentreten zu können. Er holte frische Wäsche aus seiner Tasche und kleidete sich neu ein, kämmte sich das nasse Haar glatt und machte sich dann auf den Weg zur Villa der Familie Linnhurst.
Auf dem Weg dorthin kam er an Erdhaufen, Kies und Steinen vorbei, die für die spätere Gestaltung des Gartens gebraucht wurden. Er versuchte, sich die Schuhe an vereinzelten Rasenflecken zu säubern, und gab es schließlich auf. Er würde das Anwesen auf Socken betreten müssen. Er hoffte nur, dass sie keine Löcher hatten. Doch selbst die Aussicht, sich zu blamieren, konnte seine Freude nicht schmälern, den Auftraggeber vom erfolgreichen Aufstellen des Brunnens in Kenntnis zu setzen.
Er erreichte den Seiteneingang, der Bediensteten vorbehalten war, und klopfte laut. Dabei entledigte er sich bereits der Stiefel. Der Butler öffnete mit einer kleinen Verbeugung.
»Ich möchte Mr Linnhurst sprechen.«
»Treten Sie ein, Sir. Sie hätten doch Ihre Stiefel …«
»Unsinn. Damit Sie mich mit einem verkniffenen Lächeln hereinbitten und danach jemand die Teppiche reinigen kann? So ist es doch besser für alle.«
»Aber, Sir«, protestierte der Butler und lächelte dann. »Ich lasse Ihnen von der Köchin etwas einpacken. Warten Sie hier, ich gebe den Herrschaften Bescheid.«
»Er soll reinkommen«, rief Mr Linnhurst, bevor der Butler den Salon betreten hatte. Francis folgte auf Socken, die zum Glück ohne Löcher waren.
Die Familie war um ein Radio versammelt. Die Eltern und die beinahe erwachsenen Söhne lauschten mit ernsten Mienen.
»Kommen Sie her, Boyle.«
»Die Brunnenfiguren sind aufgestellt, vielleicht möchten Sie …«
»Nicht jetzt.« Linnhurst, ein kräftiger Mann mit einem weichen, rundlichen Gesicht und wasserblauen Augen, hieß ihn mit einer knappen Geste, still zu sein und sich zu setzen. Etwas musste geschehen sein, wovon er draußen auf seiner Baustelle nichts mitbekommen hatte.
Plötzlich fühlte Francis seinen Puls bis hinauf in die Schläfen klopfen. Eine diffuse Angst breitete sich in ihm aus.
Im Radio knisterte es, dann wiederholte der Nachrichtensprecher die Mitteilungen. Hitler hatte Polen angegriffen. Seine Truppen waren schon weit ins Land vorgedrungen. Es wurden Städtenamen und Landstriche genannt, die Francis nichts sagten. Es klang, als ginge es um gewaltige Flächen.
Mrs Linnhurst hielt ein zerknittertes Spitzentaschentuch in den Händen und beobachtete mit glasigem Blick ihren ältesten Sohn. Francis musste kein Hellseher sein, um ihre Gedanken zu kennen. Sie fürchtete um sein Leben und das seines jüngeren Bruders. Das Gespenst des Krieges ging um in England.
»Sie wissen, was der Einmarsch in Polen bedeutet, Boyle?«, fragte Linnhurst.
»Natürlich. England wird den Krieg erklären. Wir können gar nicht anders. Ich hoffe, die Franzosen ziehen mit und lassen uns nicht hängen.«
»Es hätte schon viel eher passieren müssen! Diesem Hitler hätte man nie so viel Macht geben dürfen. Spätestens diesen März hätte doch jedem klar sein müssen, dass die Deutschen gestoppt werden müssen«, wetterte Linnhurst.
Francis setzte sich und dachte daran, mit welcher Unruhe er davon gelesen hatte, dass Hitler Böhmen und Mähren annektierte und fünf Tage darauf von Litauen das Memelland zurückgewann.
Ende der Leseprobe