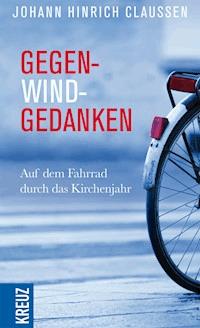14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Niemand hat die Absicht, einen seltsamen Ort zu schaffen. Es passiert einfach. Der älteste Steingarten Japans wird von Moos überwuchert, Bäume erweisen sich plötzlich als heilkräftig, Kirchen müssen vor Verfolgern versteckt werden. Das Buch führt seine Leserinnen und Leser zu 39 christlichen und nichtchristlichen Orten, die wie von einem anderen Stern sind.
«Shan-ti … ooooooooooooom!» Wo die heiligen Flüsse Ganges und Yamuna mit dem unsichtbaren Fluss Sarasvati zusammenfließen, ist der Nabel der Welt. Wer zur richtigen Zeit in diesem «Honig der Unsterblichkeit» badet, kann erlöst werden. Aber Vorsicht: 100 Millionen Pilger wollen zur gleichen Zeit dasselbe tun. Im Kongo erreicht man nach einsamer Fahrt über Schotterpisten das himmlische Jerusalem: einen riesigen Tempel mit 37.000 Sitzplätzen. Ebenso abgelegen ist das Heiligtum der Difunta Correa, der Lastwagenfahrer Keilriemen, Felgen und ganze Trucks darbringen. Johann Hinrich Claussen lädt uns ein zu einer kurzweiligen Weltreise in eine andere Dimension. Ob Tierfriedhof oder Rattentempel, Kathedrale aus Müll oder Einsiedelei aus Weltkriegstrümmern, Überlebensort oder Sterbeort, in der Wüste oder gleich nebenan: Die seltsamsten Orte der Religionen lassen uns Gründe und Abgründe der menschlichen Existenz entdecken und zeigen uns ganz nebenbei, dass der Evangelische Kirchentag eine ziemlich deutsche Seltsamkeit ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Johann Hinrich Claussen
Die seltsamsten Orte der Religionen
Von versteckten Kirchen, magischen Bäumen, und verbotenen Schreinen
Mit Illustrationen von Lukas Wossagk
C.H.Beck
Zum Buch
Niemand hat die Absicht, einen seltsamen Ort zu schaffen. Es passiert einfach. Der älteste Steingarten Japans wird von Moos überwuchert, Bäume erweisen sich plötzlich als heilkräftig, Kirchen müssen vor Verfolgern versteckt werden. Das Buch führt seine Leserinnen und Leser zu 39 christlichen und nichtchristlichen Orten auf der ganzen Welt, die wie von einem anderen Stern sind.
«Shan-ti … ooooooooooooom!» Wo die heiligen Flüsse Ganges und Yamuna mit dem unsichtbaren Fluss Sarasvati zusammenfließen, ist der Nabel der Welt. Wer zur richtigen Zeit in diesem «Honig der Unsterblichkeit» badet, kann erlöst werden. Aber Vorsicht: 100 Millionen Pilger wollen zur gleichen Zeit dasselbe tun. Im Kongo erreicht man nach einsamer Fahrt über Schotterpisten das himmlische Jerusalem: einen riesigen Tempel mit 37.000 Sitzplätzen. Ebenso abgelegen ist das Heiligtum der Difunta Correa, der Lastwagenfahrer Keilriemen, Felgen und ganze Trucks darbringen. Johann Hinrich Claussen lädt uns ein zu einer kurzweiligen Weltreise in eine andere Dimension. Ob Tierfriedhof oder Rattentempel, Kathedrale aus Müll oder Einsiedelei aus Weltkriegstrümmern, Überlebensort oder Sterbeort, in der Wüste oder gleich nebenan: Die seltsamsten Orte der Religionen lassen uns Gründe und Abgründe der menschlichen Existenz entdecken und zeigen uns ganz nebenbei, dass der Evangelische Kirchentag eine ziemlich deutsche Seltsamkeit ist.
Über den Autor
Johann Hinrich Claussen ist Kulturbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland und Honorarprofessor an der Humboldt-Universität zu Berlin. Bei C. H.Beck erschienen von ihm u.a. «Das Buch der Flucht» (2018), «Gottes Häuser» (2. Aufl. 2012) und «Gottes Klänge» (2. Aufl. 2015). Durch seine Beiträge für die Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung und den SPIEGEL ist er einer großen Leserschaft bekannt.
Inhalt
Reisehinweise
1. Orte für Lastwagen und Motorräder
Die Heilige der Lastwagenfahrer: Vallecito, Argentinien – 31° 44ʹ 17ʺ südlicher Breite; 67° 59ʹ 9ʺ westlicher Länge
Ein Gottesdienst nur für Motorradfahrer: MOGO, Hamburg – 53° 32ʹ 54ʺ nördlicher Breite; 9° 58ʹ 41ʺ östlicher Länge
2. Verstecke des Überlebens
Wo sich die letzten iberischen Juden versteckten: Belmonte, Portugal – 40° 20ʹ 8ʺ nördlicher Breite; 7° 20ʹ 56ʺ westlicher Länge
Eine verschworene Täufergemeinschaft auf dem Mont Soleil, Schweiz – 47° 9ʹ 32ʺ nördlicher Breite; 6° 59ʹ 24ʺ östlicher Länge
3. Pilgerziele für Millionen
Die größte Wallfahrt der Muslime: Kerbala, Irak – 32° 35ʹ 54ʺ nördlicher Breite; 44° 5ʹ 30ʺ östlicher Länge
Die unglaublichste Menschenansammlung aller Zeiten: Allahabad, Indien – 25° 26ʹ 17ʺ nördlicher Breite; 81° 50ʹ 2ʺ östlicher Länge
4. Geteilte Gotteshäuser
Die Grabhöhle der Patriarchen in Hebron – 31° 31ʹ 29ʺ nördlicher Breite; 35° 6ʹ 37ʺ östlicher Länge
Simultan Gottesdienst feiern: St. Michael, Hildesheim – 52° 9ʹ 10ʺ nördlicher Breite; 9° 56ʹ 40ʺ östlicher Länge
5. Dem Erdboden gleichgemacht
Die verbotenen Schreine in Xinjiang – 41° 45ʹ 27ʺ nördlicher Breite; 87° 10ʹ 3ʺ östlicher Länge
Die vernichteten Kirchen im syrischen Ar-Raqqa – 36° 0ʹ 40ʺ nördlicher Breite; 38° 53ʹ 8ʺ östlicher Länge
6. Traumatisierte Städte
Terror und Kuscheltiere in Nizza – 43° 41ʹ 36ʺ nördlicher Breite; 7° 15ʹ 18ʺ östlicher Länge
Der Riss vor der Kirche: Breitscheidplatz, Berlin – 52° 30ʹ 18ʺ nördlicher Breite; 13° 20ʹ 7ʺ östlicher Länge
7. Unheimliche Gedächtnisstätten
Die Porzellankirche St. Nikolai in Meißen – 51° 9ʹ 29ʺ nördlicher Breite; 13° 28ʹ 14ʺ östlicher Länge
Umstrittene Gedenktafeln: Windhoek, Namibia – 22° 34ʹ 39ʺ südlicher Breite; 17° 5ʹ 14ʺ östlicher Länge
8. Gipfel des Heiligen
Der Kampf um den Mauna Kea auf Hawaii – 19° 49ʹ 15ʺ nördlicher Breite; 155° 28ʹ 5ʺ westlicher Länge
Der Berg der nächtlichen Gebete: Paju, Südkorea – 37° 45ʹ 36ʺ nördlicher Breite; 126° 46ʹ 49ʺ östlicher Länge
Der Hügel der Kreuze in Litauen – 54° 28ʹ 31ʺ nördlicher Breite; 21° 48ʹ 48ʺ östlicher Länge
9. Retro-Utopia
Ein Heiligtum für Rechtsextreme: Die Externsteine in Horn-Bad Meinberg – 51° 52ʹ 9ʺ nördlicher Breite; 8° 55ʹ 2ʺ östlicher Länge
Altslawisches Neuheidentum in Janino, Russland – 59° 56ʹ 51ʺ nördlicher Breite; 30° 33ʹ 41ʺ östlicher Länge
10. Sakralbauten von Eigenbrötlern
Eine russische Einsiedelei im Münchner Olympiapark – 48° 10ʹ 2ʺ nördlicher Breite; 11° 32ʹ 56ʺ östlicher Länge
Das Mausoleum des Postboten: Hauterives, Frankreich – 48° 28ʹ 39ʺ nördlicher Breite; 0° 11ʹ 56ʺ östlicher Länge
Der alte Mann und seine Kathedrale: Mejorada del Campo, Spanien – 40° 23ʹ 50ʺ nördlicher Breite; 3° 29ʹ 23ʺ westlicher Länge
11. Paradiesische Gärten
Ein Stück des Reinen Landes: Das EKŌ-Haus in Düsseldorf – 51° 14ʹ 23ʺ nördlicher Breite; 6° 44ʹ 44ʺ östlicher Länge
Der Tempel des unendlichen Grüns: Kokedera, Japan – 35° 33ʹ 42ʺ nördlicher Breite; 135° 8ʹ 38ʺ östlicher Länge
12. Heilende Bäume
Der Druiden-Baum von Herchies, Belgien – 50° 31ʹ 42ʺ nördlicher Breite; 3° 51ʹ 28ʺ östlicher Länge
Wahrheitssuche unter dem Affenbrotbaum: Tensuk, Ghana – 10° 40ʹ 24ʺ nördlicher Breite; 0° 49ʹ 1ʺ westlicher Länge
13. Geister-Städte
Das Himmlische Jerusalem in Nkamba, Kongo – 5° 27ʹ 60ʺ südlicher Breite; 14° 53ʹ 15ʺ östlicher Länge
Glaubensstadt am Highway: Lagos, Nigeria – 6° 29ʹ 11ʺ nördlicher Breite; 3° 23ʹ 8ʺ östlicher Länge
14. Verschobene Orte
Wo Kunst eine Kirche ersetzt: Der Bethlehemkirchplatz in Berlin – 52° 30ʹ 33ʺ nördlicher Breite; 13° 23ʹ 20ʺ östlicher Länge
Kunst für einen Missionar: Godaedo, Südkorea – 36° 20ʹ 21ʺ nördlicher Breite; 126° 21ʹ 20ʺ östlicher Länge
15. Räume der Berührung
Wo der Heilige Geist begraben liegt: Das St.-Michaels-Heim in Berlin – 52° 29ʹ 18ʺ nördlicher Breite; 13° 16ʹ 38ʺ östlicher Länge
Umarmungen in der Münchner Zenith-Halle – 48° 11ʹ 41ʺ nördlicher Breite; 11° 36ʹ 28ʺ östlicher Länge
16. Spielplätze, nicht nur für Kinder
Ein Puppenschrank für Jesus: Miranda do Douro, Portugal – 41° 29ʹ 36ʺ nördlicher Breite; 6° 16ʹ 26ʺ westlicher Länge
Krapfen für die Krippe: Obere Pfarre, Bamberg – 49° 53ʹ 21ʺ nördlicher Breite; 10° 53ʹ 3ʺ östlicher Länge
17. Orte für Menschen und Tiere
Um Hunde und Katzen trauern: Tierfriedhof Jenfeld, Hamburg – 53° 34ʹ 14ʺ nördlicher Breite; 10° 8ʹ 50ʺ östlicher Länge
Die heiligen Ratten von Deshnok, Indien – 27° 47ʹ 25ʺ nördlicher Breite; 73° 20ʹ 19ʺ östlicher Länge
Tieropfer in Bariyarpur, Nepal – 26° 56ʹ 12ʺ nördlicher Breite; 85° 20ʹ 59ʺ östlicher Länge
18. Orte des Sterbens und der Unsterblichkeit
Wo man das ewige Leben kaufen kann: Scottsdale, USA – 33° 37ʹ 2ʺ nördlicher Breite; 111° 54ʹ 38ʺ westlicher Länge
Wo Deutsche zum Sterben hinfahren: Die Blaue Oase in Pfäffikon – 47° 20ʹ 42ʺ nördlicher Breite; 8° 44ʹ 31ʺ östlicher Länge
19. Virtuelle Räume
Der Gebetsraum der Post-Evangelicals – rachelheldevans.com
Eine ziemlich deutsche Seltsamkeit: Der Evangelische Kirchentag – 360° möglicher Breite; 90° toleranter Länge
20. Ein sicherer Ort
Die versteckte Kapelle im Grenzdurchgangslager Friedland – 51° 25ʹ 27ʺ nördlicher Breite; 9° 54ʹ 37ʺ östlicher Länge
Orte der Information
Dank
Für Peter Stolt
Reisehinweise
Die Welt ist voller Religion, ob es einem gefällt oder nicht. Man muss sich bloß neugierig umschauen. Der westeuropäische Blick ist allzu oft gefangen in der Vorstellung, dass es gegenwärtig nur religiöse Traditionsabbrüche und kirchliche Bedeutungsverluste zu verzeichnen gebe. Wohin er sieht, kann er lediglich Säkularisierung erkennen. Doch diese ist ein Aspekt unter vielen. Man sollte sich deshalb aufmachen und in anderen Weltgegenden umsehen. So viel Religion, die einem anderswo begegnet – zum Staunen, manchmal auch zum Erschrecken. Wer aber in der Ferne seinen Sinn für Religion geschärft hat, der sollte sich von neuem auch zu Hause umtun. Denn dort wartet manche religiöse Überraschung auf ihn. Religion ist und bleibt ein Menschheitsthema, in all ihren Zwiespältigkeiten. Auch als spätmoderner Zeitgenosse wird man die Gretchenfrage nicht los, deshalb muss man sich ihr stellen – unbefangen, aber nicht unkritisch: «Wie hast du’s mit der Religion?» Auch ein vermeintlich aufgeklärter Westeuropäer sollte sich dafür interessieren, wo Religion heute noch eine lebendige Kraft ist, was dies für ihre jeweilige Heimat und deren Bewohner bedeutet – und was dies einen selbst angehen könnte. Dieses Buch möchte einige Anregungen geben, darüber nachzudenken.
Religion gibt es nicht an und für sich, sondern immer nur in einer konkreten Gestalt, als diese oder jene Religion, und das heißt auch: an diesem oder jenem Ort. Auch wenn der Geist des Glaubens weht, wo er will, sucht er sich doch zu beheimaten. Religionen sind ohne eigene Landschaften nicht zu denken: mit Bergen, auf deren Gipfeln die Götter wohnen, Flüssen, deren Wasser ewiges Leben spendet, riesigen Steinen, die vom Himmel gefallen sein müssen, Quellen, die unerklärlich aus Felsen sprudeln und Sünden abwaschen, Gräbern von Urahnen, an denen man Heilung erfahren kann. Solche religiösen Orte sind alle auf ihre Art seltsam, befremdlich oder erschreckend, aber auch anrührend, liebenswert und faszinierend und wollen dies sein, denn sie stellen mitten auf dieser Erde ein Stück der Überwelt dar.
Als ein Reiseführer anderer Art präsentiert dieses Buch einige besonders seltsame Orte der Religion in Deutschland und auf der ganzen Welt. Einige dieser Orte erscheinen uralt, andere hochmodern, die meisten aber sind beides zugleich in den seltsamsten Mischungen aus Archaischem und Avanciertem. Natürlich stellt der Großteil dessen, was man religiöses Leben nennt, sich nicht als besonders, exotisch oder spektakulär dar. Zumeist vollzieht es sich auf ganz unscheinbare Weise: als stilles Gebet, gewissenhafte Nachdenklichkeit, unaufgeregtes Tun des Guten, selbstverständliches Ritual, gewohnheitsmäßiges Feiern der Feste. Da aber vielen heutigen Westeuropäern Religion an und für sich schon seltsam vorkommt, will dieses Buch die Schraube ein wenig weiterdrehen und wirklich Seltsames vorstellen, um neu auf religiöse Phänomene und Fragen aufmerksam zu machen. Das Lesen dieses Buches sollte Freude bereiten (wie es auch das Schreiben getan hat). Deshalb spielt es mit dem Reiz des Exotischen, sucht und genießt es den Zauber des Reisens. Doch eine freak show sollte es nicht werden. Sich über Fremdes, das man nicht versteht, nur zu amüsieren, ist ein Zeichen von Ignoranz. So möchte dieses Buch die Augen öffnen für die Vielfalt des religiösen Lebens heute. Dabei zielt es auf eine hilfreiche Verstörung. Es ist ja allzu menschlich, sich selbst für normal und nur die anderen für seltsam zu halten. Doch wer sich mit religiösen Orten heute beschäftigt, dem kann der beunruhigende Gedanke aufgehen, dass es sich vielleicht andersherum verhält und man selbst der Seltsame ist.
Damit verbindet sich ein zweites Anliegen dieses Buches, nämlich für Respekt zu werben. Bei allem, was einem an fremder Religion als kritikwürdig erscheinen mag, sollte man doch auch einen Sinn für die Schönheit, Tiefe und Lebensdienlichkeit dessen entwickeln, woran Menschen glauben, die unter ganz anderen Bedingungen leben. Gerade die Volksfrömmigkeit auf der südlichen Erdhalbkugel bietet dazu reiches Anschauungsmaterial.
Und schließlich möchte dieses Buch zum Nachdenken über uns selbst anregen: Vielleicht gibt es in unserer Nähe mehr Religion, vielleicht geht sie uns mehr an, als wir uns bisher vorstellen konnten. Zu diesem Zweck wird in diesem Buch einem seltsamen religiösen Ort aus dem deutschsprachigen Raum meist ein Pendant aus der weiten Welt gegenübergestellt. So kann sich das eine im anderen spiegeln. Doch eine strenge Methode soll dies nicht sein, denn nicht bei jedem Thema ist dies möglich oder angebracht.
Nur einige der hier vorgestellten religiösen Orte habe ich selbst besucht. Zu meiner großen Freude aber habe ich für fast jeden einen Reiseführer gefunden: eine Künstlerin, einen Journalisten, einen Wissenschaftler, eine Freundin oder Bekannte, die dort gewesen sind und mir davon berichten konnten. Ich musste bloß hartnäckig genug suchen, manchmal aber auch nur geduldig warten, bis ich jemanden fand, der diesen oder jenen seltsamen Ort der Religion aus eigener Erfahrung kennt.
Christliche Orte haben in diesem Buch ein Übergewicht. Das ist eine offenkundige Einschränkung, die sich bei einem christlichen Autor aus Deutschland kaum vermeiden ließ. Andererseits ist das globale Christentum heute von einer so überwältigenden Vielfalt, dass manches davon einem deutschen Protestanten oder Katholiken als ziemlich seltsam erscheinen dürfte. Um sich exotisch befremdet zu fühlen, muss man nicht zu fremden Religionsgemeinschaften am anderen Ende der Welt reisen und dort an einem schamanistischen Ritus teilnehmen, es genügt schon der Besuch einer Migrationsgemeinde in der eigenen Nachbarschaft oder der Blick zu afrikanisch-christlichen Mega-Churches oder zu den Gebetsbergen charismatischer Christen in Südkorea. Zudem ist es auch ein Zeichen des Respekts und der Einsicht in die eigenen Grenzen, wenn man über manche Orte anderer Religionen nicht schreibt. Man findet eben nicht zu allem eine Tür.
Es ist eine irrige, wenn auch besonders unter wohlhabenden Westeuropäern und Nordamerikanern verbreitete Vorstellung, anzunehmen, man dürfe überallhin, sei an jedem Ort willkommen, habe ein Recht, sich alles einmal anzusehen, nur weil man es kann. Langsam aber öffnen sich viele Menschen der Einsicht, dass es auf dieser Erde Orte gibt, die für andere Menschen so bedeutsam, kostbar, heilig sind, dass Touristen sie nicht betreten sollten. Denn Tourismus ist Konsum, und konsumieren heißt: dasjenige aufzehren und vernichten, was man benutzt und genießt. Die Reiseeinschränkungen, die während der Corona-Pandemie erlassen wurden, haben das Ihre dazu beigetragen, um mehr Menschen nachdenklich werden zu lassen. Auch für das Reisen gibt es Grenzen, sinnvolle und schmerzliche. So war plötzlich der Zutritt auch zu den religiösen Orten verwehrt, die Gläubige während einer Seuche eigentlich als Erstes aufgesucht hätten: zum Beispiel die Basilica Santuario dei SS. Vittore e Corona im Venezianischen Feltre, wo die heilige Corona als Nothelferin in Pestzeiten verehrt wird. Dieses Buch weiß um die Grenzen des Reisens und versteht sich deshalb als ein antitouristischer, religionsökologischer Cicerone. Er führt zu abgelegenen Orten, möchte aber gerade nicht dazu auffordern, selbst dorthin zu fahren. Die beste, bildungsreichste und zugleich umweltschonendste Art des Reisens ist immer noch das Lesen. Übrigens ist das Lesen seit jeher in vielen Religionen eine der wichtigsten religiösen Übungen überhaupt und das Buch einer der bedeutsamsten und manchmal seltsamsten religiösen Orte.
Dies ist nun ein unordentliches Buch geworden. Es folgt keiner strengen Methode und unterwirft seinen Inhalt keiner klaren Gliederung. Denn die Orte, um die es hier geht, entziehen sich einem systematischen Zugriff. Sie sind zu viele, passen nicht zusammen, fügen sich nicht, sind alle im Fluss. Dies zu zeigen ist ja ein Anliegen dieses Buches. Deshalb ist dieses Buch eine kleine Einübung in religiöse Vielfalt, Unterschiedlichkeit, Widersprüchlichkeit und Gegensätzlichkeit. Jedem werden beim Lesen weitere Orte einfallen, die eigentlich auch in dieses Buch gehört hätten. Religion ist, musikalisch gesprochen, ein Thema in unendlichen Variationen. Deshalb soll dies kein Buch sein, das zu Ende ist, wenn man seine letzte Seite gelesen hat – denn dann sollte das eigene Suchen und Finden erst beginnen.
1. Orte für Lastwagen und Motorräder
Die Heilige der Lastwagenfahrer: Vallecito, Argentinien
31° 44ʹ 17ʺ südlicher Breite; 67° 59ʹ 9ʺ westlicher Länge
Es ist lange her, aber die Bilder stehen immer noch lebendig vor meinem inneren Auge: Haufen von Wasserflaschen an Parkplätzen und Straßenrändern. In der Weite und Leere der argentinischen Landschaft sah ich oft diese Flaschen, ein bisschen schmutzig, das Wasser darin schon leicht bräunlich. Als deutscher, in säuberlicher Müllentsorgung geübter Gast konnte ich darin zunächst nur eine Umweltverschmutzung erkennen. Aber dann hörte ich von der Difunta Correa. Ich entdeckte die vielen kleinen Schreine am Wegesrand, mir begegneten an ungezählten Lastwagen ihr Namenszug und ihr Bild: eine auf dem Rücken liegende junge Frau mit geschlossenen Augen und einem Säugling an der Brust.
Überall waren diese Flaschen zu sehen, aber ich konnte mit niemandem über sie sprechen. Denn diejenigen, die sie an den Wegesrand stellten, schienen einer anderen Welt anzugehören als der, zu der ich einen Zugang hatte: der Welt der deutschstämmigen, protestantischen Bauern. Auch jetzt, als ich mich nach vielen Jahren wieder mit der Difunta Correa beschäftigte, konnten mir meine deutschargentinischen Freunde kaum etwas über sie sagen. Natürlich kannten sie alle diese Flaschen, aber selbst hatten sie noch nie mit jemandem gesprochen, der sie mit Wasser füllte und einzeln oder in Haufen ablegte. Auch war keiner von ihnen je in Vallecito gewesen, dem zentralen Heiligtum der Difunta Correa, im wüstenhaften Nordwesten des Landes, gleich neben der Provinzhauptstadt San Juan. Es war, als ob eine gläserne Wand uns von diesem seltsamen Kult trennte, der in Argentinien vor allem von Lastwagenfahrern und armen Menschen gepflegt wird.
Aber einer fiel mir ein, den ich noch fragen konnte: der argentinische Priester und Dichter Hugo Mujica. Ein Student aus Kolumbien hatte mich auf seine Verse aufmerksam gemacht, deren Verbindung aus Mystik und Moderne mich faszinierten. Als Pfarrer einer Gemeinde in Buenos Aires, deren Mitglieder der Mittel- und Oberschicht angehörten, hatte er zwar ebenfalls keine direkte Berührung mit dem volkstümlichen Kult der Difunta Correa. Aber einige Hinweise konnte er mir doch geben.
Der Kult gründet auf einer Legende. Es war im Jahr 1841, in Argentinien herrschte ein elend langer, zäher Bürgerkrieg, da verließ eine junge Frau namens María Antonia Deolinda y Correa fluchtartig ihr Heimatdorf im fernen Nordwesten. Ihr Mann war verschleppt und zwangsrekrutiert worden. In Sorge um ihn und aus Angst, vom örtlichen Machthaber zur Geliebten gemacht zu werden, eilte sie ihm nach, hinein in die Wüste. Sie hatte keine Zeit gehabt oder einfach nicht daran gedacht, Proviant und vor allem Wasser mitzunehmen. Nur das gemeinsame, erst vor kurzem geborene Kind trug sie in ihren Armen. Der unerbittlichen Hitze war sie wehrlos ausgeliefert. Nach wenigen Tagen war sie so furchtbar erschöpft, dass sie sich unter einen Baum legte und verdurstete. Einige Tage später entdeckten Hirten die beiden. Die Mutter war tot – aber das Kind, es lebte noch! Es lag an der Brust seiner Mutter und trank deren Milch. Über ihren Tod hinaus hatte die Difunta Correa, die «verstorbene Correa», ihr Kind gestillt. Bei einem Hügel gleich in der Nähe, in Vallecito, dem «kleinen Tal», begruben die Gauchos die tote Frau. Nur ein einfaches Holzkreuz schmückte ihr Grab. Das gerettete Kind nahmen sie mit und erzählten allen von dem Wunder, das sie erfahren hatten.
Wie es mit diesem Kind oder seinem Vater weiterging, erzählt die Legende nicht mehr. Denn viel wichtiger waren andere Wunder, die die Difunta Correa nach ihrem Tod bewirkte. Sie führte Gauchos zu verlorenen Tieren und half Bauern in Not. So wurde sie zur Patronin der armen argentinischen Landbevölkerung. Bei welchem Unglück auch immer riefen sie die Difunta Correa an und baten sie um Hilfe. Mit Gebeten wie diesem:
«O liebenswürdige Frau, Difunta Correa, hervorragende Beschützerin derer, die leiden und weinen, wir bitten dich, nimm unser flehentliches Gebet gnädig an. Durch die Vermittlung unseres Herrn Jesus Christus gewähre uns die Gnade, um die wir dich bitten! Ich vereinige mich mit dir und flehe: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade …»
Doch umsonst gibt die Difunta Correa nichts, das wissen ihre Anhänger genau. Sie erwartet Gegengaben, zum Beispiel Flaschen mit Wasser am Wegesrand. Nach größeren Gnadenerweisen hat man sie zu besuchen. So wurde Vallecito mit der Zeit zu einem sehr beliebten Wallfahrtsort. Man nennt es auch «das argentinische Mekka» – jeder Argentinier, zumindest wenn er katholisch geprägt ist, sollte es in seinem Leben einmal besucht haben. Zu Ostern, in der «Heiligen Woche», kommen Hunderttausende in die heiße, trockene Menschenleere von San Juan. Über das Jahr sollen es eine Million Besucher sein. Sie alle haben die Difunta Correa um etwas gebeten, ihr Wunsch wurde erfüllt, nun kommen sie, um ihr Versprechen einzulösen und eine Gegengabe zu bringen. Sie steigen den Hügel, der über und über mit kleinen Schreinen bedeckt ist, hinauf zu ihrer Kapelle. Manche quälen sich die siebzig Stufen auf den Knien empor. Einige robben sogar auf dem Rücken und mit einem kleinen Kind auf ihrem Bauch nach oben.
In der wichtigsten der insgesamt siebzehn Kapellen liegt die Difunta Correa: eine große, bunt bemalte Gipsfigur mit einem Säugling an der nackten Brust. Die Wände sind übersät mit kleinen Dankestafeln, Fotos von geheilten oder beschenkten Menschen und Plastikblumen. Unter Tränen, gerührt und andächtig streicheln die Verehrer – Männer, Frauen, Alte und Junge – ihre Nothelferin, küssen sie, geben ihr kleine Schlucke Wasser zu trinken, bekreuzigen sich anschließend, oder auch nicht.
Die übrigen Kapellen sind unterschiedlichen Anliegen gewidmet. Besonders bedeutsam ist die Auto-Kapelle. Denn die Difunta Correa gilt insbesondere als Patronin der Reisenden und speziell der Lastwagenfahrer. Das ist natürlich in ihrer Geschichte begründet, aber auch in der Tatsache, dass man difunta correa heute auch mit «gerissener Keilriemen» übersetzen kann. Vallecito gleicht einem Autofriedhof. Als Votivgaben werden Autokennzeichen, Felgen und ganze Wagen herangebracht, aber auch Motorräder und Fahrräder in Mengen. Wer die Difunta Correa erfolgreich um ein eigenes Haus gebeten hat, stiftet ihr ein Modell aus Holz – der Berg ist übersät damit. Wem ein Hochzeitswunsch in Erfüllung ging, schenkt ein Brautkleid und hängt es in die dafür vorgesehene Kapelle. Sie wirkt deshalb eher wie ein unaufgeräumtes Lager als wie ein Andachtsraum, ebenso wie die mit alten Uniformen vollgestopfte Kapelle der Polizisten und Sicherheitsleute. Eine weitere Kapelle ist mit Schulzeugnissen gepflastert, eine andere quillt über von Fußballtrikots, Boxhandschuhen und Sportpokalen. Und wohin man in Vallecito schaut, hängen Dankesplaketten für eine gewährte Genesung, die Rettung bei einem Unfall oder die sehnlich erwartete, endlich eingetroffene Rente. Hinter jeder dieser Tafeln, dieser Gaben steht ein Menschenschicksal aus Verzweiflung, Schmerz, Angst, Armut, Hoffnung, Heilung und Glück. Das ergibt einen seltsamen Effekt: hier die Leere und Dürre der Landschaft, dort die Überfülle des Dankes.
Der Glaube an die Difunta Correa braucht keine Institution. Ihre Wunder wirken wie von selbst, ihre Botschaft geht von Mund zu Mund, der fromme Handel von Gabe und Gegengabe funktioniert ohne offizielle Vermittler. Wer mitmachen will, braucht nur eine Flasche mit Wasser zu füllen oder in den Norden zu reisen. Inzwischen regelt allerdings eine Difunta-Correa-Stiftung den Pilgerbetrieb von Vallecito. Bis 1940 gab es nur ein Holzkreuz, heute läuft hier ein mittelständischer Betrieb mit etwa fünfzig Angestellten, und es ist ein richtiges Dorf entstanden mit Kirche, Schule, Restaurants und Souvenirshops. Das alles will organisiert sein. Da der Pilgerbetrieb in dieser armen Provinz ein erheblicher Wirtschaftsfaktor ist, engagieren sich die örtlichen Behörden, vor allem das Tourismusamt, massiv für diesen Kult. Aber in die eigentliche Verehrung der Difunta Correa mischen die Beamten sich nicht ein. Das ist eine Angelegenheit allein der Gläubigen. Die allermeisten sind katholisch, jedoch erkennt ihre Kirche die Difunta Correa nicht als Heilige an. Zwar hält ein Ortspriester jeden Sonntag hier eine Messe, aber ihren Namen spricht er niemals aus. Auch wenn er Lastwagen segnet, nimmt er keinen Bezug auf die unheilige Heilige dieses Ortes.
Inzwischen gibt es in der katholischen Kirche eine Debatte, ob man nicht den kirchenrechtlichen Prozess einer Seligsprechung einleiten solle. Wunder gebe es ja genug. Der Erzbischof von San Juan erklärte vor wenigen Jahren, dass er in der Verehrung der Difunta Correa einige schöne Elemente entdecken könne: die Treue der Ehefrau zu ihrem Ehemann, die Fürsorge der Mutter für ihr Kind oder die Hingabe des eigenen Lebens für andere. Das sei nun klassisch argentinisch, wie mir Hugo Mujica schrieb: Man verehrt die gute und reine mamma (über 60 Prozent der Argentinier haben italienische Wurzeln), die das eigene Leben für die Ihren opfert, und man verachtet – und begehrt – die verführerische «böse Frau». Man mag sich fragen, wie lange sich solche Vorstellungen noch halten werden, und man kann sich ebenfalls fragen, ob lobende Worte wie die des Erzbischofs nicht zu spät kommen. Die Gläubigen haben ihre Heilige längst anerkannt. Einen Widerspruch zum Katholizismus dürften die wenigsten empfinden. Auf YouTube finden sich einige Clips, in denen Besucher von Vallecito ihren Glauben an die Difunta Correa bekennen und von deren Wundern Zeugnis ablegen. Weitergehende Fragen scheinen sie sich nicht zu stellen. Es geht ihnen offenkundig allein um das Wunder, das die Richtigkeit dieser Verehrung beweist. Eine Spannung zu den biblischen Wundergeschichten scheinen sie nicht wahrzunehmen: Bei den Wundertaten Jesu geht es nie um das Mirakel an sich, vielmehr sollen sie grundsätzliche Fragen stellen und in notwendige Auseinandersetzungen führen. An der Difunta Correa dagegen sind allein ihre unglaublichen Geschenke interessant. Deshalb wird kaum einer ihrer Verehrer sich theologische Gedanken über ihr Verhältnis zu Gott, Jesus Christus oder Maria machen. Es dreht sich alles um Kraft und Nähe. Die Difunta Correa wirkt Wunder, und sie ist ihren Verehrern näher als die drei göttlichen Personen der Trinität oder die herrliche Himmelskönigin: Sie ist eine von uns – eine arme Gaucho-Frau, die wie wir unter politischen Kämpfen und gewalttätigen Machthabern leidet, die wie wir gefährliche Reisen antreten muss, die wie wir alles für ihre Familie tun würde.
Die Difunta Correa wendet sich denen, die zu ihr beten, einzeln zu. Regelmäßig aber werden diese zu einer Gemeinschaft. Zu Ostern oder am Nationaltag der Lastwagenfahrer – fast jede Berufsgruppe in Argentinien hat solch einen eigenen Feiertag – kommen sie in großer Zahl in Vallecito zusammen. In der Kirche wird eine Messe gefeiert und nach draußen übertragen, rote Bänder mit ihrem Namen werden verteilt, Folkloremusik mit Liedern über sie tönt aus ungezählten Lautsprechern, auf großen Feuern werden erstaunliche Fleischmengen gegrillt – das typisch argentinische asado –, es gibt Autokorsos und Miss-Wahlen. Alles zusammen ergibt das eine spontane, fröhliche Gemeinde der Armen.
Soll man da noch Anstoß nehmen am Handelscharakter dieses Kultes? Die Difunta Correa gewährt ja keine reine Gnade, sie erwartet bestimmte Werke der Dankbarkeit. Doch wenn man sich vergegenwärtigt, welchem Geschäftsgebaren die einfachen Leute in Argentinien allzu oft begegnen, wie sie von Arbeitgebern, Beamten, Politikern und mächtigen Geschäftsleuten wieder und wieder betrogen werden, dann erscheint die Difunta Correa als eine seriöse und verlässliche Handelspartnerin. Wie wird es mit der Difunta Correa weitergehen? Die Säkularisierung gewinnt auch in Argentinien an Wucht. Zudem werden wie überall in Südamerika evangelikale Freikirchen immer stärker, die in diesem volkstümlichen Kult nur eine unreine Mischung aus Katholizismus und Heidentum erkennen können und ihn bekämpfen. Aber die Armen und Hoffnungslosen in Argentinien, die auf Wunder angewiesen sind, werden auch nicht weniger.
Ein Gottesdienst nur für Motorradfahrer: MOGO, Hamburg
53° 32ʹ 54ʺ nördlicher Breite; 9° 58ʹ 41ʺ östlicher Länge
Es ist mehr als eine Stilfrage, wenn man auf einen Gottesdienst ungern das Etikett «erfolgreich» kleben möchte. Das klingt allzu marktwirtschaftlich. Aber wenn in Deutschland ein Gottesdienst Jahr für Jahr 25.000 bis 30.000 Menschen anlockt, dann lohnt es sich, darüber nachzudenken. Natürlich gibt es christliche Feiern, die noch viel höhere Teilnehmerzahlen melden können. Doch sind dies einmalige Ereignisse – traurige im Falle von Gedenkfeiern nach nationalen Katastrophen oder freudige wie eine Papstmesse auf den fernen Philippinen mit Millionen von Gläubigen. Aber für hiesige Verhältnisse ist der Hamburger Motorradgottesdienst, abgekürzt MOGO, eine erstaunliche Erfolgsgeschichte.
Die Idee dazu wurde zu einer Zeit entwickelt, als das Motorradfahren noch Teil einer Jugendbewegung war. Der erste MOGO soll 1962 am Nürburgring gefeiert worden sein. Die Idee wurde in der Folge vielerorts aufgegriffen, mit besonderer Wirkung in Hamburg. Dort war es der damalige Polizeiseelsorger, der ausgerechnet in der Wahrzeichenkirche der Stadt, dem Michel, 1983 einen ersten Motorradgottesdienst veranstaltete. Er wollte damit auch das Verhältnis zwischen Polizisten und Motorrad fahrenden Jugendlichen verbessern. Heute ist es einem kaum mehr bewusst, aber die «Rocker» waren damals eine geschlossene und ausgeschlossene Gruppe am gesellschaftlichen Rand, als Schrecken der Bürger durchaus vergleichbar mit islamistisch-migrantischen Jugendlichen heute. «Rocker-Seelsorge» war eine Form von Sozial- und Jugendarbeit für besonders engagierte und mutige Pastoren. In diesen Zusammenhang gehörte anfangs auch der MOGO. Er ging unbefangen auf diejenigen zu, die sonst gemieden oder gefürchtet wurden, und lud sie genau mit dem ein, was ihnen das Wichtigste – um nicht zu sagen: das Heiligste – war: ihre Maschinen, Stiefel und Lederjacken. Und die Kirche ließ sich dies etwas kosten, denn es wurde eine aufwendige, teure Veranstaltung.
In über dreißig Jahren ist der MOGO eine feste Tradition geworden, mit erheblicher Breitenwirkung. Dabei hat er sich verändert. Sieht man von kriminellen Banden wie den Hells Angels oder Bandidos ab, ist das Motorrad kein Zeichen mehr für Randständigkeit, es ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen, ebenso wie das gelegentlich damit verbundene Tattoo. Die wenigsten fahren heute Motorrad, weil sie sich kein Auto leisten können. Sie halten sich zusätzlich eines. Es ist weniger ein Verkehrs- als ein Genussmittel, ein Hobby, und zwar ein nicht ganz billiges, wenn man sich die beim MOGO stolz präsentierten Maschinen ansieht. So sind heute die meisten MOGO-Besucher mittleren oder fortgeschrittenen Alters, haben Familie und Beruf, ein festes Einkommen. Das Motorradfahren aber gehört immer noch zu ihrem Lebensstil, in dem sich ein Freiheitsgefühl mit Reiselust, Gemeinschaftserlebnissen, einer Easy-Rider-Nostalgie und auch einer eigenen Religiosität verbindet.
So trifft man sich alljährlich an einem Sonntagmorgen im Frühsommer. Die vierspurige Straße vor der Hauptkirche St. Michaelis ist gesperrt und überfüllt mit Tausenden von Motorrädern. Um 12.30 Uhr beginnt der Gottesdienst, der sich von herkömmlichen evangelischen Feiern gar nicht so besonders unterscheidet, auch wenn die Ansprache freier und die Musik poppiger ist (und die Anwesenden bei den Liedern kaum mitsingen). Sein Hauptreiz liegt wahrscheinlich immer noch in dem seltsamen Kontrast der Kulturen, zwischen dem barocken Kirchenraum innen und den lauten Maschinen draußen, zwischen der hanseatischen Halskrause der Pastoren und den schwarzen Monturen in der Gemeinde. Da die Kirche nicht alle Menschen fassen kann, werden die Gebete, Lesungen, Lieder und die Predigt nach draußen übertragen. Bestimmt gibt es auch einige, die lieber mit einem gewissen Sicherheitsabstand daran teilnehmen.
Von Anfang an verfolgte der MOGO eine verkehrspädagogische Absicht. Mit Slogans wie «Fahre nie schneller, als dein Schutzengel fliegen kann» sollen die Teilnehmer zu mehr Vor- und Rücksicht angeleitet werden. Wer Gottesdienst ausschließlich als heiliges Ritual, als Anbetung und Andacht versteht, mag darin eine moralische Funktionalisierung sehen: Gottesdienst als Verkehrsunterricht. Dagegen steht eine lange evangelische Tradition seit der Aufklärung, nach der ein Gottesdienst nicht nur der «seelischen Erhebung» dienen soll. Auch für die Bewusstseinsbildung und die Gewissensschärfung im Alltag – hier beim Verhalten im Straßenverkehr – hat er sich als nützlich zu erweisen.
Vor allem jedoch möchte der MOGO die Teilnehmenden zur Besinnung bringen. Sein Gründer brachte dies in die leicht fassliche Formel: «Der Tank unserer Seele muss gefüllt werden, damit wir auf der Straße unseres Lebens nicht liegen bleiben.» Solche Slogans scheinen anzukommen – nicht zuletzt bei Nichtchristen, wie man in Motorrad-Blogs lesen kann. Doch das wichtigste, existentiellste Motiv dürfte das Totengedenken sein. Jedes Mal wird der Motorradfahrer gedacht, die im zurückliegenden Jahr bei einem Unfall ihr Leben verloren haben. Das verleiht diesem sonst so fröhlichen und vergnüglichen Tag einen unbedingten Ernst. Hieran schließt sich die Bitte um einen Segen an, einen Reisesegen ganz speziell für Motorradfahrer. Der Hamburger MOGO-Pastor kann dabei jedoch nicht, wie etwa sein katholischer Kollege in Köln, die Maschinen segnen. Das ist nach evangelischem Verständnis ausgeschlossen. Aber er kann gelbe Bänder als Zeichen der gemeinsamen Segensbitte verteilen lassen.