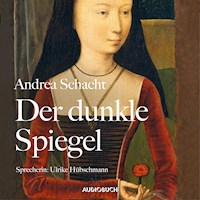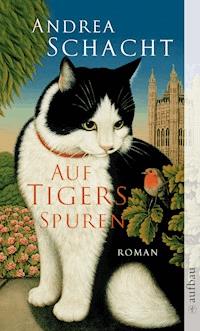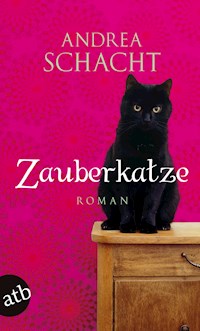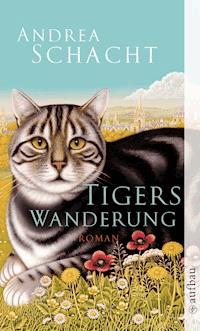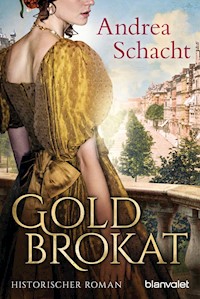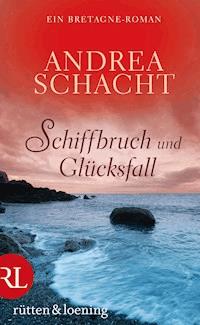8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Myntha, die Fährmannstochter
- Sprache: Deutsch
Mord im mittelalterlichen Köln: Fährmannstochter Myntha ermittelt wieder …
Köln 1420. Bei der Stammheimer Rheinmühle wurde ein grausiger Fund gemacht: Im großen Holzrad hängt die Leiche des Brotbeschauers Schroth. Die Würgemale an seinem Hals deuten darauf hin, dass sein Tod kein Unfall war. Unter Mordverdacht steht seine Geliebte, die ehrbare Witwe Ellen, ihr droht die peinliche Befragung und Folter. Doch die kluge Fährmannstochter Myntha glaubt nicht an Ellens Schuld und beginnt, nach dem wahren Mörder zu forschen. Dabei steht ihr der geheimnisvolle Rabenmeister Frederic zur Seite, und er ist auch zur Stelle, als Myntha selbst in tödliche Gefahr gerät …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 391
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Buch
Der Bäckermeister und Brotaufseher der Bäckergaffel, Joseph Schroth, ist tot aus dem Rhein geborgen worden. Offensichtlich wurde er erwürgt. Frau Ellen, die einstige Geliebte des Ermordeten, wird als Verdächtige in den Gefängnisturm gesperrt. Doch die kluge Fährmannstochter Myntha glaubt nicht an ihre Schuld und will der Gefangenen helfen. Dabei steht ihr der Rabenmeister Frederic zur Seite: Gemeinsam stellen sie Nachforschungen an, um dem wahren Mörder Joseph Schroths auf die Spur zu kommen: Ist es der Bäckermeister Gottschalck, der der grausamen und demütigenden »Bäckertaufe« unterzogen wurde? Oder einer der Gaukler, die in Mülheim ihre Possen getrieben haben? Als auf dem Grundstück von Mynthas Vater ein Feuer ausbricht – ganz offensichtlich ein Fall von Brandstiftung –, spitzen sich die Ereignisse dramatisch zu. Schließlich verschwindet Myntha selbst spurlos. Doch ihre Freunde lassen sie nicht im Stich …
Autorin
Andrea Schacht war lange Jahre als Wirtschaftsingenieurin und Unternehmensberaterin tätig, bis sie sich ihren seit Jugendtagen gehegten Traum erfüllte und Schriftstellerin wurde. Mit ihren lebenssatten historischen Romanen um die scharfzüngige Begine Almut Bossert und ihre nicht minder gewitzte Tochter Alyss eroberte sie auf Anhieb die Herzen von Lesern, Buchhändlern und Journalisten und mit schöner Regelmäßigkeit die Bestsellerlisten.
Andrea Schacht lebt mit ihrem Mann und zwei Katzen in der Nähe von Bonn.
www.andrea-schacht.de
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Andrea Schacht
Die silberne Nadel
Historischer Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
1. Auflage
© 2015 by Blanvalet Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Redaktion: Dr. Rainer Schöttle
Umschlaggestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign,
unter Verwendung von Motiven von akg-images und Bridgeman Images
wr ∙ Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-13664-2
www.blanvalet.de
»Die Rede lasst bleiben« · sprach sie, »Herrin mein. Es hat an manchen Weiber · gelehrt der Augenschein, Wie Liebe mit Leide · am Ende gerne lohnt; Ich will sie meiden beide · so bleib’ ich sicher verschont!«
Nibelungenlied
Dramatis Personae
Myntha, Fährmannstochter, die gegen den Ruf ankämpfen muss, eine Wiedergängerin zu sein, seit sie vom Tod auferstanden ist.
Reemt van Huysen, Fährmeister von Mülheim, der an das verschollene Rheingold der Nibelungen glaubt, aber ansonsten ein aufrechter Mann ist.
Witold und Haro,die Söhne des Fährmanns von bäriger Gestalt.
Enna van Huysen, Reemts alte Mutter, die ihren Geist mit dem Rezitieren langer Gesänge munter hält.
Rickel und Swinte Moelner,Besitzer einer der Rheinmühlen. Rickel wandert auf Freiersfüßen, doch Schwester Swinte fuchst Pfennige.
Lore, Köchin im Fährhaus mit einem ungebärdigen Schnabel gesegnet.
Frederic Bowman, der Herr der Raben, der sich bemüht, der Welt ein düsteres Bild von sich zu zeichnen. Was ihm nicht immer gelingt.
Emery, Frederics zehnjähriger Sohn, im Rudel ein Schabernack, alleine ein netter Kerl.
Leander, auch so ein Teufelsbalg.
Henning,des Rabenmeisters Gehilfe mit vielen interessanten Fähigkeiten.
Agnes, eine Pilgerin aus dem Frankenland, die ganz langsam zugibt, wer sie wirklich ist.
Bilke, Mynthas Freundin, die bei den Beginen lebt und Mühe hat, Haro zum Sprechen zu bringen.
Arnold von Lunerke, Bilkes Vater, ein kugelrunder Ritter.
Gottschalck,der frisch getaufte Bäckermeister.
Joseph Schroth,unseliger Brotaufseher der Bäckergaffel.
Der Gobelin, Reisebäcker, der unrecht Gut besitzt.
Rufus,Anführer der Gaukler, der eine hübsche rote Perücke trägt.
Imme,Seiltänzerin, die eine neue Stellung sucht.
Volmarus,von Dämonen gehetzterVikar von Mülheim.
Hermanus de Arcka,ein mit Dummköpfen unnachsichtiger Diakonus.
Lodewig,Abt von Groß Sankt Martin und ein guter Freund.
Gevatterin Ellen,eine würdige Witwe mit Heimlichkeiten.
Frau Josepha,Meisterin im Beginenkonvent am Eigelstein.
Rixa und Jorgen,zwei fleißige Zeidler mit einem Pfirsichbaum.
Sybilla,die alleine in der Heide lebt und viele Antworten auf nicht gestellte Fragen hat.
Robb und Crea, Ron und Cress, Raky und Creky,Frederics Wachmannschaft.
Mico,der immer wieder notwendige Kater.
Und natürlich:
Alyss vom Spiegel und Master John mit ihren Kindern Thomas, Jehanne und Gauwin. Und Marian vom Spiegel,der Herr des Handelshauses am Alter Markt.
Vorwort
»Unser tägliches Brot gib uns heute«, heißt es im Vaterunser. Das tägliche Brot war die Hauptnahrung der Menschen im Mittelalter. Ein knappes Kilo pro Person und Tag berechnete man. Brot wurde mit Fett bestrichen – Butter, Schmalz, Quark – oder diente dazu, Soße aufzutunken. Man belegte es mit Fleisch, Käse oder Wurst, man brockte es in Wasser, Milch oder Wein zur Brotsuppe. Brot wurde aus den unterschiedlichsten Mehlsorten gebacken. Aus weißem Weizenmehl entstand das Herrenbrot, aus Gerste oder Hafer das mindere Brot, das die Armen sich leisten konnten. Oft wurden Zusätze hinzugegeben, Erbsen oder Kleie etwa. Oder es wurde mit getrocknetem Obst, Nüssen oder Rosinen veredelt.
In den Städten lieferten gewerblich arbeitende Bäcker das Brot, boten es auf den Märkten feil und unterlagen der Qualitätsaufsicht der Bäckergilde. Ein Brotaufseher achtete darauf, dass das vorgegebene Gewicht der Laibe eingehalten wurde und die Mehlmischung rein blieb. Verstöße gegen diese Regeln wurden recht drastisch bestraft. Geldstrafen waren noch das Geringste, Pranger war schon hässlicher, besonders demütigend aber war die Bäckertaufe, bei der der Delinquent in einem Gewässer zur Belustigung des Publikums halb ersäuft wurde.
Aber nicht nur in den Backstuben wurde Brot hergestellt. Klöster und Güter hatten ihre eigenen Bäckereien, und auf dem Land war dann auch die Hausfrau schon mal damit beschäftigt, das Brot für die Familie zu backen. Oft gab es an einem Ort einen Backofen, in dem man die Laibe gemeinsam buk.
Backwaren aber beschränkten sich nicht nur auf das Brot, auch die Feinbäckerei erfreute sich großer Beliebtheit. Edles Gebäck – Honigkuchen, süße Wecken, Pasteten, Pfannkuchen – wurde von besonders kunstfertigen Bäckermeistern hergestellt. Sie waren auch in der Lage, besondere Formen, die sogenannten Gebildbrote, anzufertigen, die zu besonderen Anlässen verzehrt wurden. Gebäck in Form von Lämmern, Halbmonden (Hörnchen), Hasen und vor allem Brezel bot man an.
Die Brezel war dann auch das Wappenzeichen der Kölner Bäckergaffel und spielt im hier folgenden Roman eine entscheidende Rolle.
Eng zusammen mit dem Bäckerhandwerk stehen die Mühlen. Hier bot Köln auch eine Besonderheit. Findige Müller nutzten die Strömung des Rheines dazu, die Mühlsteine anzutreiben. Sie bauten Plattformen mit riesigen Wasserrädern, die sie im Fluss verankerten, um das Getreide zu mahlen. Eine solche Rheinmühle warf einen reichen Gewinn ab, denn sie gewährleistete einen stetigen Betrieb. Lediglich heftiger Eisgang konnte ihr zur Gefahr werden, doch meist wurden die Boote dann rechtzeitig ans Ufer gezogen. Wer eine solche Mühle besaß, war ein reicher Mann. Einige dieser Mühlen gehörten mehreren Eignern, bekannt ist auch, dass Beginen sie betrieben.
Und in den Wasserrädern fing sich wohl auch häufig bemerkenswertes Treibgut.
Von einem solchen handelt die folgende Geschichte.
1. Kapitel
Juli 1420
Bäckermeister Gottschalck hielt die Luft an und betete. Dann schlug das Wasser über ihm zusammen. Als der Stuhl sich wieder aus den Rheinfluten hob, prustete er und fluchte.
Die Zuschauer lachten.
Widerlinge, die!
Tropfend hing er jetzt, gefesselt an den Tauchstuhl, in der Sonne und wurde an dem Galgen über eine stinkende Pfütze geschwenkt. Das alles unter Johlen und derben Sprüchen. Ein Klumpen schimmeligen Brotes traf sein Knie, ein abgenagter Apfelstrunk seine Wange, ein stinkender Fischkopf landete auf seinem Schoß.
Und das fanden diese Idioten lustig.
Bäcker Gottschalck war im Rhein getauft worden, weil er Kleie in den Brotteig gemischt hatte. Das wiederum hatte der Brotbeschauer Joseph Schroth festgestellt und der Obrigkeit gemeldet. Schroth war ebenfalls Bäcker und ein Zunftbruder. Verdammt, er hätte ein Auge zudrücken können. Jetzt hing der Brotpanscher hier, gedemütigt und dem Spott der Kundschaft ausgesetzt. Wer würde in den nächsten Wochen noch ein Brot von ihm kaufen? Um seine Familie zu erhalten, musste er wohl für eine Weile über Land ziehen und seine Dienste als fahrender Bäcker anbieten. Was für ein Elend!
Dass er sich die Sache mit der Kleie hätte sparen können, kam ihm nicht in den Sinn. Das fand Bäckermeister Gottschalck nicht ehrenrührig, sondern hielt es für eine sinnvolle Sparmaßnahme. Die Gören aus dem Findelhaus brauchten kein hochwertiges Brot, die sollten froh sein, dass sie überhaupt was zu fressen bekamen. Aber seine Tochter, die blöde Ziege, die hatte einen Korb mit den Laiben für die Kirche mit auf den Markt geschleppt, und da hatte der Brotbeschauer das entdeckt.
Überhaupt, der Joseph Schroth …
Hochnäsiger Kerl, der mit seinem Feingebäck.
Da vorne stand er und sah ihn grimmig an, während die Büttel die Fesseln lösten, die ihn an den baumelnden Stuhl banden.
»Springt, Meister Gottschalck. Und backt fürderhin ordentliches Brot«, sagte der miese Hund.
Springen. Klar, in die Jauchepfütze.
Es würde ihm nichts anderes übrig bleiben.
Aber diese Demütigung würde er nicht vergessen.
Mit rabenschwarzen Rachegedanken sprang Bäckermeister Gottschalck unter dem dröhnenden Gelächter der Zuschauer in die hoch aufspritzende Jauche.
2. Kapitel
Auf der anderen Rheinseite, in Mülheim, fand kein Strafgericht statt. Aber Zuschauer hatten sich auch hier eingefunden, und sie bestaunten den gelenkigen Jongleur mit seiner dreischwänzigen Narrenkappe, der allerlei Gegenstände kunstvoll durch die Luft zu wirbeln verstand. Darunter auch die Holzpantinen, die er Myntha abgeschwatzt hatte. Die stand barfüßig neben Agnes, kicherte vergnügt über die Kapriolen des Gauklers und fing geschickt ihren linken Schuh wieder auf. Agnes war nicht so geschickt, die rechte Pantine traf sie mitten auf der Brust.
»Huh!«, sagte sie und bückte sich eben im rechten Moment, da ein süßer Wecken über sie hinwegsegelte. Den schnappte sich ein Gassenjunge mit einem Juchzer.
»Genug der Kurzweil, Agnes, wir müssen unsere Besorgungen machen«, mahnte Myntha und nahm den Korb auf. Agnes griff nach dem ihren, und gemeinsam drängten sie sich durch die gaffende Menge. Die Marktstände waren nicht besonders gut besucht an diesem Morgen, die Gaukler lenkten die Kunden ab, und so hatten sie ihre Einkäufe bald erledigt. Beladen mit Wachskerzen, zwei Enten, Büschel von roten Zwiebeln, einem Honigtopf und einem Fässchen gesalzener Butter wandten sie sich zum Rheinufer, um den Heimweg anzutreten.
Doch wieder wurden sie von einem Pulk Menschen aufgehalten, der sich auf dem Platz vor der Kirche eingefunden hatte. Hier wurde jetzt ein neues Schauspiel geboten. Zwischen zwei Pfosten war ein durchhängendes Seil aufgespannt, und darauf hampelte ein Geschöpf herum. Eine Gestalt in gelben Pluderhosen, einem kurzen, grünen Jäckchen und einem mit glitzernden Steinchen bestickten Turban um den Kopf führte höchst kunstvoll vor, wie man gerade noch eben nicht vom Seil fiel. Es war eine meisterliche Leistung, die der Künstler mit dramatischer Mimik, großem Augenrollen und gelegentlichen Quietschern vorführte. Untermalt wurde die Vorführung von einer Alten mit einer sägenden Fidel und einem Bengel mit einem Tamburin, das er immer dann zu schlagen wusste, wenn gerade eben ein Sturz vermieden worden war.
Gelächter und jubelnder Applaus begleiteten die komische Darbietung, und auch Myntha und Agnes mussten vor Lachen nach Luft schnappen. Dann aber hüpfte das Geschöpf anmutig vom Seil und machte eine tiefe Verbeugung. Der Bengel drehte das Tamburin um und ging Münzen heischend zu den Zuschauern. Es klimperte reichlich, und auch Myntha warf ein paar Kupferstückchen in den Behälter.
»Das ist ja ein Mädchen«, sagte Agnes plötzlich und betrachtete das bunte Wesen, das noch immer seine Verbeugungen exerzierte.
»Sieht so aus. Ein sehr junges, würde ich sogar sagen. Aber von großem Talent.«
Zwei Männer entfernten das schlappe Seil, und drei wüst verkleidete Schauspieler sprangen zwischen die Pfosten – zwei Männer und ein fettes Weib. Sie begannen lauthals einen Streit, der an Obszönität ihrer Maskerade in nichts nachstand. Der mit dem Zottelbart in der Kutte mimte den Verführten, den das Weib auf derbste Weise belästigte. Der mit der brandroten Perücke versuchte, dessen nicht vorhandene Tugend zu retten.
Myntha war nach wenigen Augenblicken angewidert, und auch Agnes schüttelte den Kopf.
»Gehen wir. Ich finde das nicht lustig.«
Sie kämpften sich den Weg durch die Zuschauer frei, und dabei bemerkte Myntha, dass am Kirchenportal der Vikar Volmarus lehnte und mit einem geradezu hingerissenen Blick dem üblen Spiel folgte. Ein kalter Schauer flog ihr über den Rücken. Sie schubste einen Baderknecht und einen Fischer zur Seite und zog Agnes mit sich auf den Karrenweg.
»Pfui!«, stieß sie hervor.
»Den Männern gefällt’s.«
»Ja, den Männern. Und dem Vikar. Mir nicht.«
»Aber die Kleine auf dem Schlappseil, die war wirklich gut.«
Schweigend schleppten sie ihre schweren Körbe Richtung Fährhaus.
Myntha gewann ihre gute Laune wieder und freute sich an dem sonnigen, warmen Julitag. Im Garten reiften die Himbeeren und Johannisbeeren, und am Nachmittag würden sie den Saft einkochen. Sie war inzwischen recht glücklich darüber, dass Agnes bei ihnen geblieben war. Den Kochlöffel schwang diese nämlich weit geschickter als sie selbst. Vor drei Monaten hatte ihre Freundin Bilke die kranke, halb verhungerte Pilgerin zu ihnen ins Fährhaus gebracht. Einige Wochen hatten sie gebraucht, um sie aufzupäppeln, und langsam, ganz allmählich hatte Agnes sich ihnen anvertraut. Nun – nicht alles, aber sie wussten inzwischen, dass sie aus dem nördlichen Frankreich aufgebrochen war, um in Köln zu der heiligen Ursula zu beten, jener Märtyrerin, die aus Agnes’ Heimat stammte und mit ihren elftausend Begleiterinnen in Köln für ihren Glauben gestorben war. Noch nicht ganz sicher war Myntha sich, wes Standes die Frau war. Sie kannte sich mit edleren Gewändern aus, beherrschte die feinsten Nadelarbeiten, aber sie konnte auch zupacken und in der Küche tatkräftig mithelfen. Warum sie blieb, war ihr auch nicht ganz klar. Aber eines war sicher: Irgendwas faszinierte Agnes an den Geschichten ihres Vaters, dem Fährmeister Reemt van Huysen, der oft, vor allem nach reichlichem Weingenuss, von dem Gold der Nibelungen schwatzte, das er im Rhein versunken zu sehen glaubte.
Aber gut, die Erzählungen ihres Vaters waren farbenprächtig und spannend, und er wusste immer neue Varianten hinzuzuspinnen, die die Zuhörer ergötzten. Dass er dann und wann von seiner eigenen Mär so überzeugt war, dass er mitten auf dem Rhein ins Wasser zu springen pflegte, um mit den Rheinnixen zu plaudern, wussten seine beiden älteren Söhne, Haro und Witold, inzwischen zu verhindern. Er durfte die Fähre nicht ohne ein festes Seil um seine Mitte geknotet betreten, an dem sie ihn immer wieder herausfischten.
Myntha und Agnes hatten das letzte Stück Treidelpfad erreicht, und das Fährhaus, ein stattliches Fachwerkgebäude, kam schon in Sicht, als Agnes plötzlich mit einem leisen Kichern sagte: »Wusstest du, dass die Gevatterin Ellen einen heimlichen Liebsten hat?«
»Hat sie? Woher weißt du das?«
»Letzte Woche bin ich in der Früh wach geworden und konnte nicht mehr schlafen – es ist ziemlich stickig in der Kammer. Da bin ich zum Rhein runter, hab mich ans Ufer gesetzt und auf den Sonnenaufgang gewartet. Du weißt schon, da, wo die Fähre vertäut liegt. Von da kann man das Haus der Gevatterin sehen. Na, jedenfalls ging plötzlich die Tür auf, und ein stämmiger Mann trat heraus. Ellen folgte ihm, und er gab ihr einen langen Kuss.«
»Soso!« Myntha grinste. »Gevatterin Ellen ist eben eine lebensfrohe Witwe. Ich habe mich schon manchmal gefragt, warum sie sich keinen neuen Ehemann sucht.«
»Weil sie eine lebenslustige Witwe ist?«
»Oh, ach ja. Männer können auch sehr lästig sein.«
Agnes blieb stehen und setzte den schweren Korb ab. Ihr Gesicht war verschwitzt, und eben lag ein Hauch von Trauer auf ihren Zügen.
»Wohl nicht alle?«, sagte Myntha leise und fügte in Gedanken zu dem Bild, das sie sich von Agnes gemacht hatte, einen geliebten Gatten hinzu. Kinder hatte sie, das wusste Myntha aus ihren Erzählungen, ob der Vater dieser Kinder jedoch verstorben, in jenen bösen Schlachten in der Normandie gefallen oder gefangen genommen worden war, dazu hatte sie nie etwas verlauten lassen.
»Du vermisst ihn?«
»Was …?« Irritiert sah Agnes auf.
»Deinen Ehemann.«
Agnes’ Miene wurde verschlossen, sie nahm den Korb wieder auf und ging auf das Fährhaus zu. Milde verärgert trabte Myntha hinter ihr her. Warum musste sie so zugeknöpft sein? Was musste sie verbergen? War sie ihm womöglich weggelaufen? War er ein Schuft, ein Gesetzloser, ein Verräter? Wollte sie ihn schützen? Oder floh sie vor ihm?
Immer diese Geheimnisse!
3. Kapitel
Vikar Volmarus war sprachlos. Starr und unbeweglich stand er im Portal der Kirche von St. Clemens und konnte sich nicht losreißen von dem wüsten Spektakel, das die drei Gaukler vor den Stufen aufführten. Vollkommen sittenlos und äußerst unzüchtig führten sich das Weib und die beiden Männer auf. Ihre Reden waren Unflat, der die Zuschauer in brüllendes Gelächter versetzte, ihre Handlungen zuchtlos und anstößig, was Wogen von Erregung erzeugte.
Auch bei Vikar Volmarus. Sein Mund war trocken, das Schlucken fiel ihm schwer, und seine Lenden pochten.
Er musste eingreifen. Eigentlich sollte er mit Feuer und Schwert zwischen die Sünder fahren, aber gefesselt blieb er stehen und starrte auf das obszöne Geschehen. Die fette Hure, schamlos wie eine läufige Hündin, verführte als dämonischer Sukkubus den Mageren, der in Schwarz einen geilen Mönch darstellte, während der Rothaarige geradezu besessen ekelhaft ihre Aufmerksamkeit auf sich zu lenken versuchte.
Das Johlen und Klatschen wurde immer wilder, selbst ehrbare Handwerker und Matronen, vor allem aber seine Messdiener, stampften mit den Füßen und kreischten vor Lachen.
Und dann war das Gaukelspiel schließlich zu Ende, und Vikar Volmarus holte tief Luft. Mit laut hallender Stimme verdammte er die Schausteller, verdammte die lüsternen Männer und unzüchtigen Weiber, die sich an solch gottlosem Tun erfreuten. Er rief den Zorn des Himmels auf die Zuschauer wie auf die Gaukler herab, sprach von Hölle und Versuchung, von der Vergeltung Gottes und dem zu erwartenden Strafgericht.
Die Menge zerstreute sich schweigend, die Gaukler lösten sich irgendwie in Luft auf, der Platz vor der Kirche lag mit einem Mal leer und still und staubig in der Sonnenglut.
»Du bist das Schwert Gottes«, flüsterte jemand in Vikar Volmarus’ Ohr. »Du wirst Rache üben an jenen, die sich aufgeilen an wilden Worten und unrechtem Tun.«
Verstört sah Volmarus sich um. Niemand stand hinter ihm, niemand flüsterte in sein Ohr. Und doch verfolgte ihn die Stimme mit ihren Aufträgen und verlangte sein Handeln.
War es die Stimme Gottes? Oder die eines seiner Engel?
Nein, nein, nun sprach ein anderer, und der gebot ihm, sich der Unzucht hinzugeben. Er lockte mit ebenso schamlosen Worten, sich zu nehmen, wonach ihm gelüstete. Nach einem fetten Weib, einer scheuen Jungfer, sogar nach einem kecken Knaben.
Volmarus hielt sich die Ohren zu, doch die Flüsterstimme wollte nicht schweigen.
Wie von Dämonen gehetzt rannte er zum Pfarrhaus und schloss sich in seiner Studierstube ein. Zitternd entzündete er Weihrauch und fiel auf die Knie, um lauthals zu beten.
Die Stimmen verklangen.
4. Kapitel
Das heitere Sommerwetter wurde in den folgenden Tagen schwüler, die Luft klebrig, und kein Hauch bewegte die Blätter im Garten des Fährhauses. Träge pflückte Myntha die letzten Johannisbeeren von den Sträuchern. Die Großmutter hockte auf einem Schemel am Beetrand und verscheuchte ein paar brummelnde Hummeln, während sie die Beeren von den Stielen befreite. Die Beerensträucher waren ein Geschenk der früheren Äbtissin von Machabäern, einer Base von Mynthas jung verstorbener Mutter, die von der Heilwirkung der schwarzen Früchte überzeugt war. Bei Erkältungen und bei Schmerzen im Gedärm brachte der Saft tatsächlich Linderung, und sogar der Aufguss aus getrockneten Beeren und Blättern schmeckte, mit Honig gemischt, an kalten Tagen ziemlich lecker.
Weshalb Myntha die schwärzliche Färbung ihrer Finger in Kauf nahm und bei dieser brütenden Hitze die Früchte erntete. Mico, der kleine weiße Kater, sonnte sich zufrieden auf einem niedrigen Mäuerchen, und von der Werkstatt klang gedämpftes Hämmern herüber. Ihr Vater überholte eines der Fährboote.
»Es ist drückend«, murrte die Großmutter und erhob sich ächzend. Und mit dumpfer Stimme rezitierte sie: »›Mir tut vor starker Hitze der Durst so schrecklich weh; ich fürchte, mein Leben in diesen Nöten zergeh!‹«
»Wessen Blut gedenkst du zu trinken?«, fragte Myntha, die die Verse des Nibelungenlieds zur Genüge kannte, das die Großmutter so gerne aufsagte.
»Traubenblut aus Burgund. Deine Brüder haben heute Morgen ein Fässchen von drüben mitgebracht.«
Myntha wischte sich über die feuchte Stirn, hinterließ dabei einen blutroten Streifen und folgte der alten Frau in die Küche. Ob es wirklich ratsam war, in der drückenden Schwüle einen Becher schweren Wein zu trinken, mochte fraglich sein, eine Pause hatte sie aber ganz gewiss verdient.
Lore, die im Mörser irgendwelche wohlriechenden Gewürze zerkleinerte, gab einen leicht erschrockenen Laut von sich, als sie Mynthas ansichtig wurde. Dann grinste sie.
»Ihr wolltet wieder mit dem Kopf durch die Wand?«
»Ich? Niemals. Wie kommst du darauf?«
»Die hübsche rote Schliere auf Eurer Stirn. Oder möchtet Ihr Euch den Gauklern anschließen mit dieser Maskerade?«
Myntha betrachtete ihre schwärzlich roten Hände und zog eine böse Grimasse.
»Gehe ich als Dämonin durch? Dann besuche ich gleich mal unseren Vikar Volmarus.«
»Geh dich am Brunnen waschen, Kind. Und spar dir solche Bemerkungen. Du weißt, wie verschroben der Vikar ist«, herrschte sie die Großmutter an, und Myntha nickte. Volmarus war sie ein Dorn im Auge, und mehrmals schon hatte dieser verbissene Geistliche versucht, ihr den Teufel auszutreiben. Mit ihm war nicht zu spaßen.
Das kühle Brunnenwasser erquickte sie, sie schrubbte ihre Hände mit feinem Rheinsand und kühlte sich das Gesicht mit einem gut ausgewrungenen Lappen. Aber lange hielt die Erfrischung nicht an. Inzwischen verhüllte Dunst die Sonne, und die Luft wurde fast zu dick, um sie einzuatmen. Reemt schlurfte von der Werkstatt hin zum Brunnen, haspelte sich einen Eimer hoch und goss sich den Inhalt über den Kopf.
»Wird ein Gewitter geben. Noch vor der Vesper, denk ich.«
Myntha folgte seinem Blick zum Himmel.
»Ja, es dräut ein Unwetter. Hoffentlich verhagelt es nicht die Ernte.«
»Ich geh zur Anlegestelle. Haro und Witold müssen die Boote vertäuen und die Pferde in den Stall bringen.«
»Sie werden bis zum letzten Moment übersetzen, Vater.«
»Sie werden auf den obersten Fährmeister hören.«
Reemt stapfte davon, und Myntha sah ihm nach. Er war ein guter Vater. Auch wenn er seine Eigenheiten hatte. Und er war auch ein verantwortungsvoller Fährmeister, der weder seine Leute noch seine Boote in Gefahr brachte. Wenngleich er auch schon Heldentaten vollbracht hatte – beispielsweise damals vor fünf Jahren, bei dem Eisgang, als sie und ihr Verlobter von der Fähre gerissen worden waren. Gernot war in den eisigen Fluten umgekommen, Myntha hatten der Vater und die Brüder wie leblos herausgefischt.
Auch in einem Unwetter hatte er schon Fährgäste übergesetzt, wenn es denn dringend schien. Aber gewöhnlich mied er die Gefahr. Sturm, Hagel, Blitze waren nicht zu unterschätzen; der Rhein, aufgepeitscht durch den wilden Wind, konnte zu einem reißenden Strom werden, und schon manches Boot war gekentert, die Besatzung ertrunken.
Auf dem Rückweg in die Küche nahm Myntha den halb vollen Korb mit den Beeren mit und schenkte dem Strauch einen müden Blick. Viel hing nicht mehr in den Zweigen. Sei’s drum, der Regen würde den letzten Beeren den Garaus machen.
Als sie die Küche betrat, schwatzte Lore mit der Großmutter über die Gaukler, die noch immer in Mülheim weilten.
»Dieser Rufus ist ein übler Geselle. Ich glaub, der spielt nicht nur den Teufel. Es heißt, dass er der Anführer der Gruppe sei. Und wie man sagt, ist er hinter den Frauen her.«
»Der mit den roten Haaren?«
»Pff, die sind nicht echt.«
»Woher weißt du solche Dinge, Lore? Hast du mit ihm getändelt?«, wollte Myntha wissen.
»Leever Jott, nee. Henning hat ihn beobachtet. Er sagt, er schleicht nachts aus den Häusern von Frauen.«
»Na, hier wird er sich nicht einschleichen. Oder, Großmutter?«
»Freches Ding!«
Die Großmutter hatte schon einen Becher Wein geleert, nippte an dem zweiten und kicherte fröhlich.
Myntha erinnerte sich an Agnes’ Bemerkung von vor einer Woche, und es entfuhr ihr: »Hat er auch die Gevatterin Ellen besucht?«
»Bestimmt nicht, die hat einen anderen Liebsten.«
»Ach, das weißt du auch schon?«
Lore zuckte mit den Schultern.
»Muss ich ja nicht allen erzählen, oder?«
»Doch. Man weiß ja gerne, womit man die Gevatterin aufziehen kann.«
»Sie ist deine Freundin, Myntha«, mahnte die Großmutter. »Verscherz es dir nicht mit ihr.«
»Nur weil du die weichen Wecken nicht missen willst, die sie backt …«
Das Geplänkel wurde von Agnes unterbrochen, die mit einem weiteren Korb Beeren eintrat.
»Hat mir der Bauer Egbert überlassen. Wo ist der Kessel?«, fragte sie. Kurz darauf zog der süßherbe Duft des köchelnden Saftes durch die Küche, und Myntha wusch die ersten Steingutkrüge aus, in die die heiße Flüssigkeit abgefüllt werden sollte. Einkochen war eine klebrige, farbenfrohe und schweißtreibende Arbeit, darüber zog draußen eine schwarze Wolkenwand auf. Als die ersten Blitze vom Himmel zuckten, wuschen die Frauen sich schließlich den dunkelroten Saft von Händen und Armen und den Schweiß von den Gesichtern. In der Vorratskammer kühlten Dutzende von Krügen ab, und Mico putzte sich ungehalten ebenfalls rotes Zeug von den weißen Pfoten.
Haro und Witold polterten mit einem kräftigen Windstoß in die Küche, der Fährmeister lehnte sich gegen die Tür und drückte sie mit seinem gesamten Gewicht zu. Ein Donner grollte durch das Rheintal.
»Wird heftig«, meinte Haro und schloss die Läden vor den Fenstern. Witold schielte auf den Kessel, in dem noch ein Rest Saft simmerte.
»Nehmt euch«, bot Myntha an und stellte Becher auf den Tisch.
Lore und Agnes zündeten die Lichter in den Sturmlampen an, und schon prasselte der erste Regenguss nieder.
Nein, Angst hatte Myntha nicht, auch wenn draußen der Wind heulte und die Blitze zuckten. Das Fährhaus war fest aus Holz und Stein gebaut und hatte schon viele Jahre derartigen Unwettern getrotzt. In der Küche war es zwar stickig, aber sie waren alle beisammen, und wie so oft begann ihr Vater mit einer seiner fantastischen Geschichten. Von der Höhle in den Bergen begann er zu berichten, jenen Bergen, die sich südlich von Mülheim entlang des Rheines erhoben und in denen von alters her die Zwerge zu Hause waren. Jene knorrigen, kleinwüchsigen Männer, die die Geheimnisse der Erde ergründet hatten, gruben tiefe Stollen und fanden dort Gold und glitzernde Steine, aus denen begabte Schmiede köstliches Geschmeide formten. Mit Leidenschaft schilderte Reemt den Schmuck, der für Könige und Kaiser gemacht, für Prinzessinnen und Edelfrauen geschaffen wurde. Oft schon hatte Myntha ihn von diesen Schätzen schwärmen gehört, und eigentlich hätte sie ihm Einhalt gebieten müssen, doch waren seine Worte so eindringlich, seine Schilderungen so bildhaft, dass sie atemlos zuhörte und vermeinte, ihre Hände in Truhen voll schimmernder Kostbarkeiten aus edlem Metall und leuchtenden Juwelen tauchen zu können. Und ebenso, stellte sie mit einem schnellen Blick in die Runde fest, erging es den anderen Zuhörern. Na gut, ihre Brüder wirkten etwas gelangweilt. Doch auch ihre Aufmerksamkeit wusste der Vater gleich darauf zu wecken, denn eben begann er, das Eintreffen des jungen Helden zu schildern, der bei der Suche nach dem Gold auf den Wächter der Höhle traf. Der Kampf Jung-Siegfrieds mit dem Drachen machte auch Haro und Witold zu seinen Sklaven. Untermalt von Donnergrollen und dem Heulen des Windes, dem Prasseln von Hagel und grellen Blitzen rang Siegfried mit der stachelhäutigen, feuerspeienden Echse, das Schwert triefend von Blut. Ein gewaltiges Krachen untermalte schließlich den Sieg des Helden, und er badete im dampfenden Blut des getöteten Lindwurms, das seine Haut unverwundbar machen würde. Nur ein kleines Lindenblatt senkte sich auf seine Schulter und ließ einen Fleck dort unbenetzt.
Agnes seufzte.
Lore grinste.
Die Großmutter rezitierte leise:
»Noch ein Abenteuer ist mir von ihm bekannt:
Einen Linddrachen schlug des Helden Hand;
Da er im Blut sich badete, ward hörnern seine Haut:
Nun versehrt ihn keine Waffe: das hat man oft an ihm geschaut.«
»Und ihr Weibsen liebt hornhäutige Männer?«, wollte Haro wissen.
»Man muss einen guten Bimsstein zur Hand haben, bei solchen Gesellen«, knurrte Myntha ihn an. »Ich werde Bilke darauf hinweisen.«
Im flackernden Licht der Lampe vermeinte sie eine tiefe Röte im Gesicht ihres Bruders aufsteigen zu sehen. Er hatte eine heimliche Zuneigung zu ihrer Freundin entwickelt, die drüben am Eigelstein das Leben einer Begine führte. Doch seine entsetzliche Schüchternheit Frauen gegenüber drehte ihm jedes Mal wieder Knoten in die Zunge und machte ihn zu einem stammelnden Narren, wenn er ihr begegnete. Aber Myntha hatte da so ihre eigenen Pläne.
Das Donnergrollen wurde leiser, der Regen zu einem sanften Plätschern. Reemt riss die Läden auf, und ein frischer, kühler Luftstrom drang in die Küche.
»Es klart auf«, sagte er. »Gehen wir an die Anlegestelle und sehen nach dem Rechten.«
Die drei Männer platschten über den nassen Hof, um die Fähre zu begutachten. Myntha half der Großmutter die Stiege hoch in ihre Kammer und brachte ihr anschließend noch eine Schüssel mit dem Abendbrei.
Flammendrot färbten die letzten Sonnenstrahlen den Himmel, als sie später in einem Schaff Wasser am Brunnen die Platten und Löffel abspülte, und ein bleicher, voller Mond erhob sich aus dem Dunst. Misstrauisch beäugte sie ihn. In manchen Vollmondnächten überkam sie im Schlaf der seltsame Drang, aufzustehen und zu wandeln. Das hatte ihr den üblen Ruf eingetragen, eine Verrückte, gar eine Wiedergängerin zu sein. Doch bisher hatte sich stets eine freundliche Seele gefunden, die sie aufgehalten und sacht ins Haus zurückgeführt hatte. Nichtsdestotrotz hatte sie nach solchen Anwandlungen meist Zuflucht im Benediktinerinnenkloster von Machabäern gesucht.
Nun, vielleicht würde sie nach dem Gewitter aber tiefer schlafen und nicht durch die Dunkelheit irren. Aber etwas Vorsicht konnte nicht schaden.
»Lore, würdest du bitte heute Nacht in meiner Kammer schlafen?«
»Damit Ihr über mich stolpert, wenn Ihr wieder Nachtmahr spielt?«
»Ich würde mich sicherer fühlen.«
»Dann hole ich meine Decken.«
Imme hatte sich vom Lagerfeuer davongeschlichen. Die bunten Kleider, in denen sie auf dem Schlappseil ihre tölpelhaften Künste darbot, hatte sie gleich nach der Vorführung gegen einen grauen, verwaschenen Kittel und Beinkleider getauscht und sich aus einem langen, schmuddeligweißen Schal eine Kopfbedeckung gewunden. Man mochte sie für einen der Jungen halten, die um das Lager der Gaukler lungerten und auf Sensationen warteten. Doch es gab keine, sondern nur das alltägliche Gezänk, Stopfarbeiten an den Kostümen und altbackenes Brot. Rufus, der Anführer, hielt nicht viel davon, seine Mannschaft ordentlich durchzufüttern. Die eingesammelten Münzen raffte er an sich und überließ es den Mitgliedern seiner Gauklertruppe, sich auf eigene Faust zu verköstigen. Der fetten Lale gelang das ausgezeichnet, hatte Imme bemerkt. Doch die Art, wie sie sich ihr Zubrot verdiente, erfüllte sie mit Ekel. Und sie selbst musste sich wieder und wieder gegen deren Versuche wehren, sie an mögliche Freier zu verkaufen. Was ihr den ärgerlichen Ruf eingebracht hatte, eine prüde Jungfer zu sein. Damit konnte sie leben, mit dem knurrenden Magen weniger.
Und so schlich sie durch die nasse Dunkelheit, in der Hoffnung, irgendwo etwas zu essen zu finden. Gärten gab es einige, und es war die Zeit der Reife. Mit dem ihr eigenen Geschick kletterte sie über die Mauer, die den Garten des Fährhauses umgab, und im fahlen Licht des Mondes zog sie drei süße Möhren aus dem Boden. Möhren mochte sie gerne, und krachend biss sie hinein, während sie die anderen Pflanzen musterte. Die Äpfel waren noch zu grün, aber die Pflaumen hingen reif in den Ästen des Baumes. Wie ein Äffchen schwang sie sich ins Geäst und erntete die Früchte. Sie kletterte eben kauend wieder hinunter, als sie eine weiße Gestalt über den gekiesten Gartenweg schweben sah. Einen Augenblick hielt sie den Atem an. Trogen sie ihre Augen? Begegnete ihr hier ein nächtlicher Geist? Einer der Untoten, die die Seelen der Menschen fingen und fraßen?
Oder …?
Der Geist murmelte leise Worte, die Imme nicht verstehen konnte, und wurde gefolgt von einem ebenso weißen Katzengeist, der nach ihrem Hemdzipfel haschte.
Katzengeist – so’n Quatsch!
Vorsichtig ließ Imme sich auf den Boden gleiten und folgte dem wunderlichen Pärchen. Die Frau – es war eine ganz leibhaftige, junge Frau mit schönen, langen, blonden Haaren, die im Mondlicht wie gesponnene Seide schimmerten – öffnete das Tor zur Gasse, trat hinaus und wandte sich dem Fluss zu.
»Die spinnt doch«, flüsterte Imme und folgte ihr. Immer weiter ging die Frau, und schon netzte das Wasser des Rheines ihre bloßen Füße.
»Halt!«, sagte Imme leise, doch die Verrückte hörte nicht auf sie. Also lief sie vor und packte sie am Arm. Einem sehr menschlichen, recht kräftigen Arm. Und als sie ihr in das ruhige Gesicht sah, dämmerte Imme, was passiert war.
»Ach, du Arme. Du schläfst ja«, flüsterte sie. »Komm, ich bring dich ins Haus zurück. Das Wasser ist viel zu kalt, um darin zu baden.«
Willfährig ließ die Frau sich zurückführen, und als sie durch das Törchen traten, stürmte eine weitere weiße Gestalt auf sie zu.
»Gottlob, du hast sie gefunden!«, sagte diese mit unterdrückter Erregung. »Ist sie mir doch entwischt.«
»Sie wollte ins Wasser gehen.«
»Nein, gewiss nicht. Sie wandert in Traumlanden.« Und dann traf Imme ein nachdenklicher Blick. »Ich kenn dich doch. Du gehörst zu den Gauklern.«
»Das Seil«, sagte Imme und nickte.
»Besser, du treibst dich nicht an den Häusern herum, Mädchen. Man hat schon von einigen Diebstählen gehört, seit ihr hier lagert.«
Imme ließ den Kopf hängen.
»Ein paar Möhren, werte Frau. Nur ein paar Möhren wegen dem Hunger.«
»Soso. Nun, ich will darüber hinwegsehen, wenn du mir versprichst, von diesem Vorfall hier nichts zu berichten.«
»Ich hab nichts gesehen, werte Frau.«
»Gut. Warte hier.«
Die Schlafwandlerin wurde auf die Bank neben der Tür gesetzt, und die Frau brachte Imme einen Kanten frisches Brot und ein Stück Käse.
»Und nun lauf, Mädchen.«
Imme folgte dieser Bitte umgehend und wanderte zum Ufer hinunter. Hier kletterte sie auf einen Findling und mampfte zufrieden Brot und Käse, während der Mond einen silbernen Streifen auf das Wasser warf.
Erst als dieser schimmernde Streifen in tausend Splitter zerbrach, wurde sie aus ihrer stillen Andacht gerissen.
5. Kapitel
Die sechs Sperber auf dem Sprenkel hatten ihre Flügel ausgebreitet, um sie in der Sonne zu trocknen. Die Raben saßen krächzend auf dem First und schmähten die an den Füßen gefesselten Raubvögel. Oder bedauerten sie. Ganz sicher war sich Frederic nicht. Eine Weile beobachtete er seine gefiederten Begleiter, dann wandte er sich den zwei Kaninchen zu, die es zu häuten und zu zerlegen galt. Futter für seine Meute.
Das Gewitter am Vorabend war auch für ihn einigermaßen glimpflich verlaufen. Zufrieden betrachtete er den Anbau an der Hütte, dessen Dach er und Henning am Vortag gerade eben noch mit Holzschindeln gedeckt bekommen hatte, bevor der Regenguss niederging. Nun hatte der Junge seine eigene Kammer, wenn auch noch nicht sein eigenes Bett. Aber bisher hatte er sich über die Strohsäcke und Decken nicht beklagt, die sein Lager im Unterstand der Pferde bildeten.
Sieben Wochen war der junge Mann nun schon bei ihm. Als Taschendieb gestellt und vom Fährmeister begnadigt, hatten die Fährleute ihn Frederic als Gehilfen angedient. Er war ein schweigsamer Bursche, doch seltsam willig und gehorsam, ja, für manche Selbstverständlichkeiten sogar unerwartet dankbar. So nach und nach hatte Frederic eine Reihe von nützlichen Fähigkeiten an ihm entdeckt, etwa die Tatsache, dass er mit Jagdvögeln umzugehen wusste, ein geborener Reiter war und ausgesprochen flinke Reaktionen aufwies. Er konnte jagen und fischen und mit dem Messer umgehen, stellte sich bei der Anfertigung von Pfeil und Bogen äußert geschickt an und hatte eine höfliche Art den Frauen gegenüber. Alles in allem ließ Frederic vermuten, dass er eine gründliche höfische Ausbildung genossen hatte, möglicherweise der Knappe eines Edelmanns war und damit vermutlich von hoher Geburt. Warum er die Rolle eines Taschendiebs und Taugenichts – mehr schlecht als recht – gespielt hatte und sich auch noch dabei hatte ertappen lassen, hatte Frederic bisher noch nicht herausgefunden. Henning mochte zwar höflich sein, er war aber auch gründlich verschlossen und gab nichts über sich selbst preis. Andererseits – Frederic war ein guter Beobachter, aber auch er konnte schweigen. Und schweigen, das hatte er herausgefunden, brachte manchmal mehr als fragen. Dazu kam, dass er den Jungen mochte. Sein stoisches Annehmen von Leid und Widrigkeiten nötigte ihm Respekt ab.
An diesem Morgen hatte er ihn zur Fähre geschickt, um dort eine Lieferung von Köchern abzuholen, die er bei einem Lederer am Alter Markt in Auftrag gegeben hatte, und als er den Raben die Innereien der Kaninchen vorwarf, hörte er den Hufschlag und sah auf. Wieder einmal beeindruckte ihn, mit welcher Grazie Henning auf seinem Ross saß. Mühelos lenkte er das starke Tier, hielt sich aufrecht, beinahe königlich auf dem bloßen Rücken. Einen Sattel verschmähte er meist. Über seine Schultern hatte er die sechs Köcher geschlungen und glitt nun direkt neben ihn auf den Boden. Meuric schnaubte und stieß Frederic zur Begrüßung in die Seite. Offenbar war auch er mit seinem Reiter zufrieden.
ENDE DER LESEPROBE