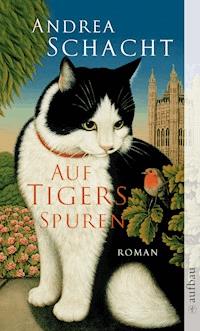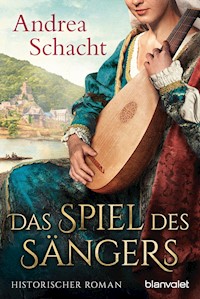8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Alyss, die Tochter der Begine Almut
- Sprache: Deutsch
Die Fortsetzung von »Gebiete sanfte Herrin mir«
Während Köln sich für die Erntedankfeiern schmückt, hängt im Hauswesen derer van Doorne der Segen schief. Ausgerechnet zur bevorstehenden Weinlese erfährt Alyss, dass ihr Gatte Arndt den geliebten Weingarten verkauft hat, um Geld für seine undurchsichtigen Geschäfte in den Beutel zu bekommen. Alyss’ Zorn entzieht er sich, indem er eilends auf Handelsfahrt geht. Nach seiner Abreise nimmt Alyss vorübergehend den sechsjährigen Kilian auf. Doch der goldlockige Sohn eines befreundeten Kürschners sorgt gleichermaßen für Unruhe: ein veritabler Satansbraten, der nur Unfug im Sinn hat.
Dann wird Kilian entführt. Und mit ihm zusammen verschwindet Alyss’ Brautkrone, der wertvollste Bestandteil ihrer Mitgift. Wer steckt dahinter – und warum?
Hartnäckig und gewitzt lässt Alyss nicht locker, bis sie den Fall gelöst hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 495
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Nehmt, Herrin, diesen Kranz, so sprach ich zu der wohlgetanen Magd, so zieret Ihr den Tanz, mit den schönen Blumen, die Ihr tragt. Hätt’ ich viel edle Steine, die müsst’ auf Euer Haupt. Ob Ihr mir’s glaubt, bei meiner Treue, dass ich’s meine.
Walther von der Vogelweide
Dramatis Personae
Alyss – Weinhändlerin und Siegelführerin, die sich mit einem ungebärdigen Hauswesen und einem ungnädigen Gatten herumschlagen muss.
Marian– Alyss’ Zwillingsbruder, der sich der Heilkunst widmen möchte und dabei seltsame Wege beschreitet.
Das Hauswesen
Arndt van Doorne – Alyss’ Ehemann, der ungefragt über sein und anderer Eigentum verfügt und sich der Verantwortung durch weite Reisen entzieht.
Merten van Doorne – Arndts Stiefsohn, der mehr Gefallen an der Jagd und den Frauen findet als an den Anstrengungen der Geschäftstätigkeit.
Hilda – die Haushälterin, die gerne Omen deutet.
Peer – Handelsgeselle, der auf das Vieh und auch auf die männliche Jugend ein Auge hält.
Leocadie – Alyss’ liebliche Base aus Burgund, deren Herz romantisch erblüht.
Frieder und Lauryn – Geschwisterpaar, das den höflichen Umgang lernen soll, was nicht immer gelingt.
Hedwigis – Alyss’ Base mit der langen Patriziernase und dem bösen Mundwerk.
Tilo – Alyss’ ordentlicher Vetter, der sich nach der Ferne sehnt.
Magister Hermanus – der Hauspfaff, der für Recht und Ordnung sorgen möchte.
Magister Jakob – ein pergamenttrockener Notarius mit einem versteckten Herzen.
Malefiz – Kater, schwarz vom Fell, doch nicht vom Charakter.
Benefiz – junger Spitz, der sich zum Wachhund aufschwingt.
Jerkin – ein weißer Jagdfalke, der über den Dingen schwebt.
Herold – ein martialischer Hahn, der Patriarch auf dem Hof.
Freunde, Bekannte, Verwandte
John of Lynne – ein englischer Tuchhändler und Falkner, der unterschiedlichsten Arten von Vögelchen zugeneigt ist.
Catrin von Stave – eine Begine, Alyss’ und Marians gute Freundin, die stillen Rat und Trost zu spenden weiß.
Mats Schlyffers – ein Messerschleifer mit allerlei bemerkenswerter Kundschaft.
Gislindis – des Messerschleifers Tochter, die gewagte Tändeleien eingeht.
Niclas Aldenhoven – Buntwörter (Kürschner), der sich einen guten Ruf verschafft hat.
Greta – seine Frau, die sich um die Familie kümmert.
Kilian – engelsgleicher Satansbraten.
Johann Houwschild – ein Pelzhändler, der auf Sicherheit bedacht ist.
Mechtild – Alyss’ Tante, geschäftstüchtige Gattin des Tuchhändlers Reinaldus Pauli.
Pater Henricus – Franziskaner und langjähriger Beichtiger derer vom Spiegel, dessen empfindsames Gemüt man schont.
Fabio – Reliquienhändler, der über allerlei nützliche Kenntnisse verfügt und die maurische Sprache beherrscht.
Meister Hans – der Henker.
Arbo von Bachem – ehrenwerter Ritter mit einem romantischen Herzen, das zum Schmollen neigt.
Pitter – Bader und Mann vielseitiger Interessen und Informationen.
Susi – Pitters Schwester und Baderin.
Franziska – Wirtin des Gasthauses »Zum Adler«, die ein gutes Auge für Kappes hat.
Simon – Adlerwirt und Schmied.
Ebby und Heini – zwei Hausarme, ein bisschen tumb und leichtgläubig.
Trine und Jan van Lobecke – Apotheker-Ehepaar am Neuen Markt, die Augen und Ohren offen halten.
Lore – ein Lumpenkind mit feuerroten Haaren.
Janis Fuhrer – ein geschundener Mann.
Und natürlich dürfen nicht fehlen
Almut und Ivo vom Spiegel – Alyss’ und Marians liebende Eltern.
Vorwort
Berufstätige Frauen waren im Mittelalter keine Seltenheit. Sie trieben Handel, wirkten im Handwerk, erbrachten Dienstleistungen in vielerlei Bereichen. Allerdings waren sie – außer wenn sie als Beginen derartigen Tätigkeiten nachgingen – zumeist verheiratet oder verwitwet.
Eine Frau brachte, wenn sie heiratete, eine Mitgift in die Ehe ein, die ihre finanzielle Absicherung im Falle der Verwitwung darstellte. Üblicherweise war die Ehefrau der Vormundschaft ihres Gatten unterstellt, sodass der auch über das eingebrachte Geld verfügen konnte. Doch mit dem Aufstieg der Handelsstädte und der stark wachsenden Kaufmannstätigkeiten, an denen immer mehr auch die Frauen teilhatten, gewannen diese an Selbstständigkeit. Sie handelten auf eigene Rechnung, führten ihre Siegel und konnten selbst Rechtsgeschäfte abwickeln.
In Köln taten sie das in großer Anzahl.
Und da nicht alle Ehegatten ehrbare und redliche Kaufleute waren, gab es dann und wann ausgewachsenen Streit darüber, womit die Schulden dieser Schlawiner bezahlt werden sollten.
Edith Ennen1 schreibt dazu: »Der Kölner Rat hat sich am 18. Dezember 1406 in einer Morgensprache mit der gegenseitigenHaftbarkeit der Eheleute in Schuldsachen befasst. Das geschah interessanterweise infolge des Verhaltens und einer einschlägigen Initiative der Frauen …«
Offensichtlich kein Sonderfall, denn die Kauffrauen verlangten Brautschatzfreiung. Was es damit auf sich hatte, erklärt Edith Ennen im selben Kapitel: »Die Brautschatzfreiung bedeutete, dass die Frau, wenn ihr Mann bei unbeerbter Ehe starb, ihr gesamtes Eingebrachtes aus dem Nachlass herauszog, bevor sie den Rest mit den übrigen Erben teilte … Die Herausgabe des Brautschatzes konnte die Frau nicht nur im Todesfall verlangen, sondern auch bei Schuldnerflucht des Mannes, ja auch bei einer Überschuldung des Mannes, ja sogar bei erwiesener Verschwendungssucht des Ehegatten, weil darin eine Gefährdung des Brautschatzes lag. Die Frau haftete also mit ihrem Brautschatz nicht für die Mannesschulden.«
Meine Heldin, eine selbstständige Weinhändlerin, hat einen solch verschwenderischen Gatten. Und sie hat von ihren Eltern eine reiche Mitgift erhalten, zu der nicht nur Geld, sondern auch wertvoller Schmuck gehören. Darunter ist das Prunkstück die Brautkrone, gewöhnlich aus dünnem Golddraht und Flitter hergestellt. Doch Almut und Ivo vom Spiegel wollten ihre Tochter nicht mit solch einem Firlefanz auf dem Haupt in die Ehe geben, sondern hatten eine schwere Krone anfertigen lassen, ein Erbstück für zukünftige Generationen und im Wert von Haus und Hof.
Um diese Brautkrone und ihr abenteuerliches Schicksal geht es in diesem Roman.
1. Kapitel
Mit sorgsam gespitzter Feder trug der Händler seine Verkäufe in den Registerband ein. Seine Bücher waren von ausgesuchter Akkuratesse, seine Handschrift konnte sich mit denen der hochgelehrten Mönche im Skriptorium von Groß Sankt Martin messen, seine Berechnungen stimmten selbstredend bis auf die letzte, noch so kleine Münze, welcher Währung sie auch immer angehören mochte.
Und doch war er unzufrieden, denn es nagte beständig der grüne Wurm des Neides an seinen Gedärmen. Niemand wusste zu würdigen, wie sorgsam er seine Geschäfte führte, wie solide seine Einkäufe waren, wie ehrbar er zu handeln pflegte, wie getreulich er alle Vorgaben einhielt, die Gaffeln und Marktaufsicht aufgestellt hatten. Er war ein frommer Mann, der regelmäßig die Messe besuchte, morgens und abends seine Gebete mit klarer Stimme sprach und den Armen stets die ihnen zustehenden Almosen zukommen ließ.
Und doch hatte alle Welt sich gegen ihn verschworen.
Mit zusammengebissenen Zähnen legte er die Feder nieder und starrte aus dem kleinen Fenster in seinem Kontor, allerdings ohne das Treiben auf der Gasse zu sehen. Bitterkeit wallte in ihm auf.
An diesem Morgen hatten sie ihm erneut eine schmähliche Niederlage beschert, trotz all seines aufopfernden Fleißes, seines unermüdlichen Einsatzes für die Gemeinschaft, seiner Treue und Loyalität.
Er drückte eine Hand auf seinen schmerzenden Magen. Die Galle, hatte der Medicus gesagt, die schwarze Galle überwältigte ihn wieder einmal.
Und er begann zu zweifeln.
War es das alles wirklich wert – diese Rechtschaffenheit, diese Pflichterfüllung, diese Unbestechlichkeit? Nichts erreichte man damit. Nichts, gar nichts.
Und so keimte die Frage in dem verbitterten Mann auf, ob es wirklich eine so große Sünde sei, sich sein Recht auf andere Art zu ertrotzen.
2. Kapitel
Der Tag begann mit dem üblichen Getöse. Es erklang aus der Kehle eines riesigen schwarzen Hahns, der die Morgendämmerung mit seinem Schlachtruf begrüßte, und nicht nur seine Hennen flatterten darob empört auf ihren Stangen auf.
Alyss knurrte in ihren Federn unwillig: »Mistvieh!«, und strampelte sich aus den Betttüchern. Das blasse Morgenlicht kroch durch die Ritzen der Holzläden. Sie tappte auf bloßen Füßen zum Fenster und stieß es auf.
Der Himmel war klar, blassblau, und von einigen von der aufgehenden Sonne geröteten Wölkchen betupft. Sie sog die klare, kühle Luft ein. Ein Rotkehlchen landete auf dem mit leeren Weinfässern beladenen Wagen unter ihrem Fenster und schmetterte ebenfalls aus voller Kehle sein Morgenlied – weit schöner als der schwarze Kämpe, der mit stolz geschwellter Brust über den Hof marschierte und dem weißen Falken, seinem Erzfeind, in seinem Verschlag eine Beleidigung entgegenkrähte. Malefiz, ebenso teuflisch schwarz und ebenso ein erklärter Feind des Hahns, den Alyss’ Hauswesen auf den passenden Namen Herold getauft hatte, schlich sich auf leisen Pfoten an den Patriarchen des Hühnervolks heran, mit der bösen Absicht, ihm mindestens eine Feder aus dem üppigen Schwanz zu rupfen.
Vereitelt wurde dieses Vorhaben durch Benefiz, den schwanzlosen Spitz, der zum Spielen aufgelegt war. Nachsichtig belächelte Alyss die kleine Szene. Benefiz war noch sehr jung, er wusste es nicht besser. Den Kratzer auf seiner Nase würde sie gleich verarzten und den jungen Hund mit einem Wurstzipfel trösten.
Entschlossen drehte sie sich zu ihrem Wasserkrug und der Schüssel um, um sich den Schlaf aus dem Gesicht zu waschen. Ein grober Kittel würde heute ihr Gewand sein, denn harte Arbeit stand an. Harte, aber äußerst befriedigende Arbeit.
Der Tag war wie gemacht für den Beginn der Weinlese.
Leise verließ sie ihr Gemach und blieb auf dem Treppenabsatz stehen. Aus dem Zimmer nebenan klang sonores Schnarchen. Ihren Gatten hatte der martialische Weckruf nicht aus dem Schlummer gerissen – er hatte sich wie üblich am Abend zuvor eine ordentliche Bettschwere angetrunken. Auch Alyss sah sich nicht bemüßigt, ihren Ehegemahl zu wecken, weshalb sie mit den Pantinen in der Hand die Treppe hinunterschlich.
Nicht Rücksichtnahme auf den Herrn des Hauses ließ sie so handeln, sondern der Wunsch, ihm nicht schon am frühen Morgen in die Quere zu kommen. Im Hause van Doorne hing der Haussegen seit zwei Monaten merklich schief.
Arndt van Doorne war Weinhändler und zog es vor, seine Ware direkt bei den Winzern in der Pfalz oder in Burgund einzukaufen. Als er Anfang August nach Köln zurückgekommen war, hatte er ohne Bewegung den Mord an seinem Bruder Robert hingenommen; zwischen den Brüdern hatte keine große Herzlichkeit bestanden. Anders war seine Reaktion auf die höchst unbequemen Tatsachen, mit denen ihn sein Weib konfrontiert hatte.
Im Zuge der Aufklärung des Mordes an Robert hatte Alyss seinen unlauteren Handel mit den Tuchwebern aufgedeckt und ihm ebenso die schlampige Führung seiner Geschäfte unter die Nase gerieben. Das alleine hatte schon zu einem cholerischen Anfall ohnegleichen geführt und hätte sicher damit geendet, dass er ihr eine herbe Tracht Prügel verabreicht hätte, wäre bei dem Gespräch nicht Marian, ihr Zwillingsbruder, zugegen gewesen, dessen grüne Augen ihn eisig durchbohrten.
Mehr aber noch hatte er seinen brüllenden Zorn über Alyss ergossen, als er bemerkte, dass sie das eheliche Gemach verlassen und sich in dem Zimmer des Verstorbenen eingerichtet hatte. Die Tür zu diesem Raum blieb ihm von nun an gründlich verschlossen. Das hatte Alyss ihm mit frostklirrenden Worten klargemacht.
Seither gingen sich die Eheleute so weit wie möglich aus dem Weg, und Alyss sehnte jeden Tag mehr den Zeitpunkt herbei, an dem Arndt sich wieder auf die Reise nach Burgund machen würde, wo er gerne Herbst und Winter verbrachte.
Unten in der Küche wirtschaftete bereits Hilda, die Haushälterin, am Herd. Ein Feuerchen brannte, im Kessel erwärmte es langsam den Brei, der ihnen allen als Morgenmahl diente, und wie erwartet schlich sich Benefiz winselnd an Alyss heran und wies seine zerschrammte Nase vor.
»Ich dreh ihm heute Mittag den Hals um, dieser Ausgeburt der Hölle!«, knurrte Hilda.
»Nein, das wirst du nicht. Er ist laut, er ist schrecklich, und er ist fruchtbar. Und weil wir alle Eierkuchen mögen, bleibt er am Leben!«
»Schwarze Hähne wecken die Dämonen auf!«
»Unsinn, der Herr schläft noch tief und fest.«
»Frau Alyss!«, begehrte Hilda auf und schlug ein Kreuzzeichen über ihrer voluminösen Brust.
Frau Alyss hingegen zeigte sich nicht beeindruckt, sondern kraulte Benefiz und schmierte ihm dann einen Klecks Gänseschmalz auf die blutige Nase, das der Spitz jedoch nicht als Heilmittel betrachtete, sondern begeistert ableckte.
Nach und nach versammelten sich die anderen Hausbewohner in der geräumigen Küche. Frieder und Tilo, die beiden halbwüchsigen Rabauken, kabbelten sich wie üblich, und Benefiz beteiligte sich mit einem erfreuten Kläffen an der Balgerei. Alyss ermahnte sie kurz, worauf die beiden sich setzten und hungrig nach dem Kessel äugten. Leocadie hatte bereits eine Rose gepflückt und drehte sie verträumt in den Fingern, Lauryn ergriff den langen Holzlöffel und rührte den Brei um, und Hedwigis zeigte wie üblich eine mürrische Miene, als Hilda sie anwies, Honig und Mandelmilch aus der Speisekammer zu holen. Peer, der Handelsgeselle, trat leise ein, einen Korb mit Brennholz am Arm.
Alyss wies Leocadie an, die Schüsseln mit Brei zu füllen, und schnitt für sich selbst einen Apfel in kleine Stücke, um ihr Mahl damit zu versüßen. Als alle am Tisch saßen, sprach sie ein kurzes Gebet, dann trat Stille ein. Man löffelte.
Draußen krähte Herold noch einmal, und über ihnen tat es einen dumpfen Plumps und einen derben Fluch.
Alyss ließ sich zwar nicht anmerken, was sie dachte, aber Lauryns mitfühlender Blick sagte ihr, dass das Hauswesen geschlossen auf ihrer Seite stand. Sie straffte die Schultern, überging ihren Unmut und verteilte die Aufgaben.
»Der Wein ist reif genug, um ihn zu lesen. Wie es aussieht, werden wir einige Tage trockenes Wetter haben, darum werden wir alle zusammen heute Vormittag in den Weingarten gehen und so viel wie möglich ernten. Frieder und Lauryn, ihr wisst, wie man die reifen Trauben erkennt und sie schneidet. Zeigt es Leocadie und Tilo. Ich werde Hedwigis anleiten. Kiepen und Körbe findet ihr im Schuppen, desgleichen scharfe Scheren.«
»Ich werde mir Blasen an den Fingern holen«, murrte Hedwigis.
»Das werden wir alle«, beschied Alyss sie kurz. »Das wird vergessen sein, wenn wir den ersten Most trinken.«
Einen ganzen Tag lang war es Alyss und ihren jungen Helfern vergönnt, im sorgsam gepflegten Weingarten, dem ganzen Stolz der Hausherrin, süße, saftstrotzende Trauben zu ernten.
Einen Tag nur.
Denn am nächsten Vormittag, als Alyss mit ihrem kleinen Trüppchen Helfer in die Reben gehen wollte, fand sie ihren Gatten an der Mauer vor, die den Garten umschloss. Mit energischen Hammerschlägen nagelte er das Tor zu und grinste sie dann hämisch an.
»Ich habe meinen Weingarten verkauft, Weib. In Eurem Kontor findet Ihr die Summe vor, die ich Euch angeblich schulde. Und nun verschwindet hier.«
3. Kapitel
Wie benommen suchte Alyss den nüchternen Raum auf, in dem sie ihre Abrechnungen zu machen pflegte. Hier, neben den Lagerräumen, in denen Robert van Doorne einst seine Tuchballen gestapelt hatte, stand ein Schreibpult, und auf dem Bord an der Wand reihten sich die Haushaltsbücher der vergangenen Jahre. Die Truhe in der Ecke barg die Lederbeutel mit den Münzen, die für den Unterhalt des Hauswesens nötig waren, und nun, wie angekündigt, auch den mit dem Betrag, der einst ihre Mitgift ausmachte.
Mechanisch zählte sie die Gold- und Silberstücke nach – ja, die Summe stimmte.
Doch um welchen Preis hatte sie sie zurückerhalten!
Langsam ließ sie sich auf den harten Schemel sinken und stützte die Wangen in ihre Hände.
Natürlich, der Weingarten, genau wie das Haus, waren Arndt van Doornes Eigentum. Er konnte darüber verfügen, wie es ihm gefiel. Worüber er nicht verfügen konnte, war ihre Mitgift. Dennoch hatte er es getan. Mit seinem unüberlegten Handel und seinem mangelnden Empfinden für Preise und Werte hatte er sich seit Jahren aus der gut gefüllten Schatulle bedient. Dass ihm das nicht zustand, hatte Alyss ihm nach seiner Rückkehr überdeutlich klargemacht und die Rückzahlung ihrer Mitgift gefordert.
Das hatte er nun getan, und eigentlich sollte sie sich nicht grämen.
Sie tat es dennoch.
Vor fünf Jahren, als sie Arndt geheiratet hatte, herrschte zwischen ihnen noch eitel Sonnenschein, und er hatte mit nachsichtiger Gutmütigkeit ihre Anstrengungen unterstützt, die verwilderten Reben hinter seinem Haus wieder in einen ertragreichen Weingarten zu verwandeln. Dieses Vorhaben hatte Alyss mit Stolz erfüllt, hatte sie doch ihre Jugend auf dem Gut ihrer Eltern in Villip verbracht, wo ihr Vater ihr und Marian schon früh beigebracht hatte, die biegsamen Reben zu erziehen, die Blätter zu lichten, die Trauben zu lesen, den Most zu keltern. Einen Garten zu hegen erfüllte sie mit Genugtuung, mehr noch, nach dem Tod ihres kleinen Sohnes war die Arbeit darin monatelang ihr einziger Trost gewesen.
Dieses Jahr nun hatten die Reben erstmals so viel Frucht getragen, dass sie nicht nur als Rosinen für die Küche reichen würden, sondern wirklich der erste Wein daraus hätte entstehen können.
Sie hätte Arndt Zeit gelassen mit der Rückzahlung, hatte nicht erwartet, dass er vor der nächsten Lieferung nach England seine Schulden beglich. Und schon gar nicht hatte sie erwartet, dass er dafür seinen Grund verkaufen würde. Doch er hatte es getan, und es war seine Form der Strafe für ihr in seinen Augen unbotmäßiges Verhalten.
Er hatte ganz genau gewusst, wie weh er ihr mit diesem Verkauf tat, das hatte sie in seinen böse glitzernden Augen gesehen.
Heilige Jungfrau Maria, wie weit war es mit ihnen gekommen!
Einst hatte sie ihren Mann geachtet, geliebt und sogar begehrt. Doch all das war nun zu kalter Asche verbrannt, zu einem Häufchen grauem, schmierigem Rückstand, in dem kein Fünkchen Leidenschaft mehr glomm.
Oder wenn, dann nur noch der des Hasses.
Und es gab kein Entrinnen.
Müde schloss Alyss die brennenden Augen, aber sie konnte es nicht verhindern, dass die Tränen ihr über die Wangen liefen.
Leise knarrte die Tür. Sie schreckte auf, versuchte, ihr nasses Gesicht zu verbergen, aber schon legte sich eine scheue Hand auf ihre Schulter.
»Nicht weinen, Frau Alyss. Nicht!«
Frieder, manchmal tollpatschig, oft übermütig und ungebärdig, hockte sich neben sie.
Mit dem Schürzenzipfel wischte Alyss sich über die Augen.
»Ich finde für Euch heraus, wem er den Weingarten verkauft hat, und dann redet Ihr mit dem neuen Besitzer. Warum sollte er den schönen Wein an den Reben verderben lassen?«
»Weil er ein Haus darauf bauen will. Oder Kappes anbauen. Oder Ziegen halten will, Frieder. Wem nützt schon so ein kleiner Weingarten?«
Der vierzehnjährige Frieder, Sohn des Pächters in Villip, senkte den Kopf. Er wusste, wie groß die Weingärten ihres Vaters, Ivo vom Spiegel, waren. Dieser hier, der zu dem Haus gehörte, war ein Spielzeug dagegen und tatsächlich wenig von Nutzen. Einst hatte er die doppelte Größe besessen, aber Robert van Doorne hatte seine Hälfte bereits vor Jahren verkauft. Auf diesem Grund wuchsen nun Kohlköpfe.
»Trotzdem, Frau Alyss, wir werden es herausfinden. Vielleicht lässt er Euch die Ernte.«
Alyss schniefte leise und versuchte Haltung anzunehmen.
»Ist schon gut, Frieder. Erst einmal habe ich meine Mitgift wieder. Das ist auch schon etwas.«
In Frieders Augen blitzte es auf.
»Könnt Ihr sie nicht verwenden, um das Land zurückzukaufen? Dann gehörte der Weingarten Euch und nicht dem Herrn.«
»Frieder, ich bin sicher, er kostet weit mehr als der Betrag, den ich erhalten habe. Der Herr wird schon so gehandelt haben, dass für sein Geschäft ein erkleckliches Sümmchen herausgesprungen ist.«
Frieder erhob sich und ging zum Bord mit den Registerbänden. Nicht, dass er sich besonders damit auskannte, aber jetzt nickte er.
»Ja, Tilo hat gesagt, er braucht Geld, um neuen Wein einzukaufen, und dass Ihr ihm keines mehr vorstreckt.«
»Tilo sollte nicht über diese Dinge sprechen.«
»Macht er ja nicht. Nur mir hat er es gesagt.«
»Auch dir gegenüber hat er zu schweigen!«
»Aber Frau Alyss, er ist doch mein Freund!«
Das kam so treuherzig aus dem Jungen heraus, dass um Alyss’ Augen ein winziges Lächeln spielte.
»Kaum zu glauben, wenn man euch beide zusammen erlebt.«
»Ach, das sind doch nur Katzbalgereien!«
»Ja, das sind es wohl. Und da ist schon der Nächste, mit dem ich katzbalgen werde. Ich grüße dich, lieb Brüderlein!«
»Schwesterlieb, was machst du im schönsten Sonnenschein im dumpfigen Kontor? Hat dieser junge Tunichtgut ein Strafgericht über sich ergehen lassen müssen?«
»Nein, der junge Herr Frieder hat mir Trost gespendet.«
»Herr Marian, der Herr van Doorne hat den Weingarten verkauft !«
Marian sah seine Schwester prüfend an.
»Daher der vernagelte Eingang. Ich dachte schon, du habest das angeordnet, um heimliche Naschmäuler fernzuhalten. Was trieb den ehrenwerten Gemahl dazu?«
»Meine Forderung nach Begleichung von Schulden.«
Alyss wies auf den prallen Geldbeutel.
»Verlass uns, Jung Frieder. Ich habe persönliche Dinge mit meiner Schwester zu klären.«
»Ja, bitte, Frieder. Und schließ die Tür hinter dir. Und die Ohren, verstanden?«
»Ja, Frau Alyss.«
Frieder polterte hinaus, und Marian setzte sich auf die Bank am Fenster.
»Arndt hat den Charakter eines räudigen Hammels«, stellte er kalt fest.
»Eines verwurmten, an Huffäule leidenden, räudigen, abdeckreifen Hammels, um es genauer zu sagen«, zischte Alyss. »Aber bedauerlicherweise bin ich an dieses Getier gefesselt.«
»Mich kommt soeben der Wunsch an, dem hochwerten Herrn eine Behandlung mit dem Instrumentarium meines neuen Lehrherrn zu verabreichen.«
Alyss’ finstere Miene hellte sich ein klein wenig auf.
»Du bist bei einem Zahnbrecher in der Lehre?«
»Nein, lieb Schwesterlein, bei einem Mann mit weit profunderen Kenntnissen der peinlichen Qualen.«
»Oh.«
»Die Anatomia, insbesondere der Knochenbau des Menschen, hat meine Wissbegier geweckt, und wer weiß wohl besser, wo die Gelenke sitzen und welche Knochen gerne brechen, als Meister Hans?«
»Oh!«
Alyss starrte ihren Bruder an. Vergessen war der Weinberg, vergessen die Lese, vergessen die Mitgift. Marian grinste sie herausfordernd an.
»Oh!«, sagte sie noch einmal und räusperte sich dann. »Weiß der Allmächtige Vater davon?«
»Er hat mich noch nicht gefragt.«
Alyss’ linke Augenbraue wanderte wie ein schwarzes Samträupchen nach oben und verharrte kurz unter ihrem Haaransatz.
Marian lachte.
»Wenn du das tust, siehst du ihm erschreckend ähnlich, Schwesterlieb. Ich beginne zu zittern und zu zagen.«
Das Samträupchen kehrte an seinen angestammten Platz zurück.
»Nun, er wird begeistert sein, wenn er herausfindet, dass du bei unserem Scharfrichter in die Lehre gehst.«
»Er wird es verstehen, denke ich. Einem solchen Mann verdankt er schließlich, dass meine Knochen wieder an ihren richtigen Stellen sitzen.«
»Es wird seinen Ruhm mehren und seinen Ruf festigen, wenn es herauskommt, dass sein Sohn und Erbe sich mit dem unehrlichen Volk gemein macht.«
»Kann den Ruhm und die Ehre unseres Herrn Vaters auch nur irgendetwas unter Gottes Sonne schmälern?«
Alyss bedachte diese Frage und antwortete mit einem schlichten: »Nein.«
»Siehst du? Und nun verrate mir, an wen der verwurmte Hammel das Grundstück verkauft hat.«
»Ich weiß es nicht.«
»Dann werden wir es herausfinden.«
»Das schlug Frieder auch schon vor. Einschließlich dem Ansinnen, es mit meiner Mitgift zurückzukaufen.«
»Eine für den jungen Rabauken nicht unkluge Idee, doch fürchte ich …«
»Du fürchtest zu Recht, mein Bruderherz.«
»Ich habe Geld, Alyss.«
»Ich weiß. Dennoch, Marian, wenn wir jetzt ein derartiges Unterfangen beginnen, wird Arndt es bemerken.«
»Und verhindern. Ich verstehe. Wann macht er sich wieder auf seine Hammelbeine?«
»Nach Erntedank, wenn ich Peer richtig verstanden habe. Mich unterrichtet er ja nicht mehr über seine Geschäfte und Reisen.«
»Gut, nach Erntedank. Bis dahin führst du dein Hauswesen, spielst die geduldige Gattin und kümmerst dich um deine Geschäfte. Im Turm, am Eigelstein, halten durstige Kehlen Wache. Liefere ihnen ein Fässchen von deinem Pfälzer.«
»Wer soll bestochen werden?«
»Aber, aber! Sie zahlen den üblichen Preis.«
»Na gut.«
»Und an Erntedank, liebes Schwesterlein, werden wir alle nach Villip fahren. Soll ich der mater ultrix von den Transaktionen deines räudigen Gatten berichten? Es gibt dort einen hübschen Schweinestall, wie du weißt.«
Alyss fuhr entsetzt auf.
»Da seien die himmlischen Heerscharen vor… Marian, du foppst mich!«
Diesmal ahmte Marian ihre hochgezogene Braue nach, was aber seine Wirkung verfehlte, denn die seine war braun, nicht schwarz. Und außerdem grinste er dabei.
»Wir haben alle unsere kleinen Geheimnisse, nicht wahr?
»Ich möchte nicht, dass Mutter als die Rächerin über Arndt kommt. Das Vergnügen möchte ich lieber selber auskosten, wenn es an der Zeit ist.«
»Ja, Liebes, das wirst du – und dir selbst damit weiteren Tort antun. Aber nun gräme dich nicht wegen der Lese. Die Trauben können noch einige Tage hängen bleiben und werden an Süße gewinnen. Und wenn der wohledle Herr erst wieder auf Reisen ist, wird sich schon ein Weg finden, die Ernte einzubringen.«
»Wir werden sehen.«
»Ja, das werden wir. Und ich muss nun zu Bruder Markus und ihm ein gelehrtes Werk über die Krankheiten der Knochen abschwatzen.«
»Ich habe auch genug getrödelt. Es gibt noch mehr Arbeit neben dem Weingarten.«
Der Besuch ihres Bruders hatte Alyss ein wenig aufgemuntert, und so konnte sie einigermaßen gefasst ihrem Tagewerk nachgehen.
4. Kapitel
Am Sonntag herrschte noch immer ein liebliches Herbstwetter, mild wehte der Wind durch das Rheintal, süß dufteten die späten Rosen im Hof, und rotbackige Äpfel warteten darauf, vom Spalier gepflückt zu werden.
Marian hatte ein Bad genommen und stand, mit noch feuchter Haut und tropfenden Haaren, am Fenster seines geräumigen Gemachs im Hause derer vom Spiegel. Ein Hausknecht kümmerte sich um den Zuber und bemühte sich, dem nackten Rücken des jungen Herrn keine Aufmerksamkeit zu schenken. Marian beachtete ihn nicht, er war in Gedanken versunken.
Seit knapp einem Jahr lebte er wieder in seinem Elternhaus, und dann und wann beschlich ihn das Gefühl, dass es eigentlich ein jämmerliches Verstecken vor der Welt war.
Andererseits – er hatte das Leben als Fernhändler aufgegeben, nachdem er bei einem Überfall auf der Rückreise von Spanien verletzt worden und gebrochen an Leib, Seele und Herz nach Köln zurückgekehrt war.
Sein Körper war genesen, Narben hatte er behalten, doch sie schmerzten nicht mehr. Oder doch nur wenig noch. Er hatte Glück gehabt, dass einige äußerst kundige Heiler sich um ihn gekümmert hatten. Und diese Erfahrung hatte in ihm den Wunsch geweckt, selbst als Heiler tätig zu werden. Nicht als Mediziner, denn das Studium dieser Kunst schien ihm wenig hilfreich zu sein. Er zog die Praxis der Theorie vor: Mit gelehrten Vorträgen brachte man weder Kinder zur Welt noch renkte man gebrochene Knochen ein.
Überraschenderweise hatte sein Vater seinem Vorhaben zugestimmt, obwohl er sich von seinem Sohn und Erben erhofft hatte, er möge einst das florierende Handelshaus übernehmen, das die Familie derer vom Spiegel über Generationen aufgebaut hatte.
Die Beschäftigung mit den Krankheiten und Gebrechen anderer war für Marian anstrengend genug, das theoretische Wissen eignete er sich aus den voluminösen Folianten in der heimischen Bibliothek an oder griff auf die Schriften des Benediktinerklosters zurück, zu dem Ivo vom Spiegel noch immer gute Beziehungen unterhielt. Vor einigen Monaten war sogar Catrin, seine und Alyss’ ältere Ziehschwester, jetzt Begine am Eigelstein, seine Lehrerin gewesen, denn sie verstand sich ausgezeichnet auf die Arbeit einer Hebamme. Lediglich die Gefahren, die damit verbunden waren, wenn ein Mann bei einer Geburt anwesend war, hatten ihn dazu gebracht, diese Kapitel nun in der praktischen Arbeit abzuschließen.
Ja, sein Körper und sein Geist waren gesund und munter, beweglich und kräftig. Auch seine Seele war dank der Fürsorge und Gebete seiner Mutter und Schwester genesen, die Schrammen, die das Grauen hinterlassen hatten, peinigten ihn zwar dann und wann noch, ließen sich aber ertragen. Das Herz aber… nun, daran mochte er nicht rühren. Er würde es wohl nie verwinden, dass er hilflos hatte zusehen müssen, wie die Frau, der er es geschenkt hatte, vor seinen Augen einen qualvollen Tod starb.
Marian schauderte und griff nach dem Handtuch aus weißem Leinen und rubbelte sich kräftiger als nötig ab.
Er hatte – neben dem Erlernen der medizinischen Künste – noch eine weitere Aufgabe zu der seinen gemacht, von der noch nicht einmal seine Schwester wusste, dass er sie verfolgte.
Sein Schwager Robert war ermordet worden – wie sie herausgefunden hatten, von einem zugereisten Nordmann, der seinen heidnischen Glauben geschmäht wähnte. Yskalt, ein junger nordischer Riese, war überführt und gestellt worden, und bei dem Kampf mit ihm hatte Marian ihm die Schwerthand abgeschlagen. Seither lag der Mann im Turm gefangen, nicht nur durch starke Mauern, sondern auch durch heftiges Wundfieber, das es den Obrigkeiten unmöglich machte, ihn zu befragen.
So weit hatte er die Nachricht von Hans Scherfgin, gemeinhin ehrfürchtig als »Meister Hans« tituliert, erhalten. Marian hätte die Sache auf sich beruhen lassen können, doch der Keim des Zweifels hatte sich in seinem Kopf eingenistet, und die Frage, warum ein fremder Nordmann wohl so einfach einen angesehenen Kölner Bürger mit dem Hammer erschlagen hatte, trieb ihn um. Richtig, man vermutete, dass Yskalt seinen Hammer fanatisch als das Symbol des nordischen Thor verehrte, und er war als gewalttätig bekannt. Aber wann hätte Robert ihn beleidigen sollen?
Alle anderen hatten sich mit der Erklärung zufrieden gegeben – Marian nicht.
Und aus diesem Grund forschte er weiter. Unauffällig, heimlich, beharrlich.
Heute war der Tag, an dem er einen weiteren Hinweis erhalten sollte. Und daher bürstete er seine schulterlangen, rotbraunen Locken sorgfältig, kleidete sich in blattgrünen Samt und füllte einen Korb mit süßen Kuchen und Wein. Darauf legte er einige der späten Rosen von dem großen Busch im Hof.
Sein Besuch galt nämlich einem Menschen von vielfältigem, zumeist ungewöhnlichem Wissen, und dieser Mensch war weiblich.
Marians Herz mochte gebrochen sein, doch sein Körper war jung und kräftig, und sein Interesse an der Anatomia beschränkte sich nicht ausschließlich auf das Studieren staubiger Schriften. Gislindis, die Tochter des Scheren- und Messerschleifers Mats Schlyffers, kam viel herum und hatte ein offenes Ohr für allerlei Gerüchte. Vielleicht verfügte sie sogar über einen zusätzlichen Sinn, der ihr Geheimnisse offenbarte, die andere bedeckt halten wollten. Oder sie war nur eine außergewöhnlich gute Beobachterin. Jedenfalls hatte sie ihm angeboten, die Ohren aufzuhalten, was den Gefangenen im Turm anbelangte. Und am gestrigen Tag hatte er ihre Nachricht erhalten, dass sie ihn sprechen wollte.
Je nun, sprechen…
Alles hatte seinen Preis, und Gislindis verlangte den ihren. Nicht in Gold oder Silber, sondern in der Form persönlicher Aufmerksamkeit. Kein unbotmäßig hoher Preis, fand Marian, denn Gislindis war ein hübsches Weib, und er hatte genügend Selbstvertrauen, ihr einen wonniglichen Nachmittag bereiten zu können. Feurige Küsse wollte sie und sanftes Kosen, mochte sein, dass sie auch weitere Aufmerksamkeiten zärtlicher Art zu würdigen wusste.
Gewiss aber Honigkuchen und gewürzten Wein.
Und Rosen.
Beschwingt machte er sich auf den Weg zur alten Burgmauer, wo Mats Schlyffers ein kleines Häuschen bewohnte. Marians Mutter zufolge hatte einst ihre Halbschwester Aziza darin gelebt, doch dann war es bei einem bösen Anschlag auf ihr Leben niedergebrannt worden, und sein Großvater, Conrad Bertolf, hatte es wieder aufgebaut. Indes – Aziza hatte Leon de Lambrays geheiratet und war mit ihm nach Burgund gezogen.
Das Häuschen schmiegte sich in eine ganze Zeile recht gepflegter Fachwerkbauten, in denen Handwerker, kleine Händler und Geldwechsler ihre Geschäfte betrieben. Als er an die hölzerne Tür pochte, stellte Marian tatsächlich so etwas wie ein leichtes Herzklopfen fest, das nicht nur etwas damit zu tun hatte, dass er neugierig auf die Nachrichten war, die Gislindis ihm angekündigt hatte.
Die junge Frau öffnete ihm selbst, und für einen Moment verschlug es ihm die Sprache.
Üblicherweise begleitete Gislindis ihren Vater auf die Märkte, durch die Straßen und Höfe, gekleidet in einen Kittel, dessen Saum oft staubig war, mit bloßen Beinen, die blonden Haare mit einem Kopftuch bedeckt. Heute hatte sie sich ein blaues Gewand angezogen, das sauber und adrett bis auf die lederbeschuhten Füße fiel, und zwei schimmernde Zöpfe wanden sich zu einer Krone um ihr Haupt. Sie lächelte ein wenig spöttisch.
Er nahm die Blumen aus dem Korb und reichte sie ihr.
»Die Rosen, schöne Gislindis, steckt in Euer Haar. Dort gehören sie hin, um ihren Zauber zu mehren.«
»Eine Dornenkrone für mich, Herr Marian?«
»Ich nahm ihnen den Stachel, nur Duft und Süße sind ihnen geblieben und samtzarte Blätter.«
»Samtzart wie Eure Zunge, Herr!«
»Glaubt Ihr?«
»Hören tue ich es schon, das Weitere wollen wir im Hause klären. Tretet ein, Herr Marian.«
Das untere Geschoss war, wie in den Handwerkerhäusern üblich, dem Werken gewidmet, und so fand sich denn auch ein Schleifstein nahe dem Fenster, und vielerlei Klingen und Scheren lagen aufgeräumt auf Wandborden. Doch vor dem Kamin stand ein breiter Tisch, bleich geschrubbt, schimmernd gewachst und mit einem bestickten Tuch belegt. Auf den Holzbänken lagen ein wenig abgenutzte Polster, und eine Schale mit Äpfeln und Trauben lud zum Zugreifen ein.
»Euer Vater…?«
»Besucht am Sonntag seinen Freund.«
Gislindis nahm Marian den Korb ab und blickte neugierig hinein.
»Noch mehr Süße, Herr Marian? Ihr kommt mit großzügigen Gaben. Oder wollt Ihr Euch damit loskaufen?«
»Aber nimmermehr, liebliche Gislindis. Unser Haus hat den Ruf, ehrlichen Handel zu treiben.«
Gislindis nickte unerwartet ernst und setzte sich. Marian nahm auf der anderen Seite des Tisches Platz.
»Ja, Herr Marian, das habt Ihr. Und auch Mats Schlyffers ist ein ehrlicher Mann, dem ich keine Schande machen werde. Und darum wird unser Handel kurz sein. Denn ich habe Euch nichts zu bieten.«
»So sagt Ihr.«
»So sage ich. Denn mein Angebot lautete, Euch zu berichten, wer den einhändigen Mörder gedungen hat. Und diese Frage kann ich Euch nun nicht mehr beantworten.«
»Verstarb der Nordmann im Kerker?«
»Nein, Herr Marian. Er entkam ihm.«
Mit Mühe unterdrückte Marian ein hässliches Wort. Dann dachte er schweigend nach, während die junge Frau ihn still beobachtete. Schließlich sagte er: »Der Turm ist gut bewacht, die Mauern dick, der Mann lag im Fieber – so war meine letzte Kenntnis.«
»Und so war es auch. Doch gestern Nacht verschwand der Heide.«
»Doch nicht durch die Macht seiner barbarischen Gottheit?«
Ein hauchdünnes Lächeln zeigte sich in Gislindis’ Gesicht.
»Warum glaubt Ihr das nicht?«
»Ich glaube viel, Liebliche, doch weder an Geister noch Dämonen und schon gar nicht an heidnische Götter, die durch Mauern greifen und halbtote nordische Riesen entführen.«
»Die Wachen aber glauben genau dies.«
»Tröpfe.«
»Wohl kaum.«
»Goldgierige Tröpfe!«
»Schon eher.«
»Wer?«
Gislindis zuckte mit den Schultern.
»Ich höre viel, ich sehe viel, Mats Schlyffers spricht seine eigene Sprache.«
»Ein neuer Handel?«
»Wenn Ihr wollt.«
»Zum selben Preis?«
»Wenn Ihr könnt.«
Marian lachte laut auf.
»Wollt Ihr eine Probe, liebliche Gislindis?«
Gislindis schenkte ihm einen langen Blick aus ihren Augen. Grün waren sie nicht, grau waren sie nicht, blau auch nicht. Sie schillerten im Licht der Sonne, das durch die kleinen runden Glasscheiben des Fensters fiel.
Marian fühlte sich schwindelig. Gislindis war ein seltsames Weib. Spöttisch und herausfordernd auf den Gassen, geheimnisvoll in ihren dunklen Andeutungen, flink an Geist und Zunge, bereit zu jedweder Tändelei – und doch entzog sie sich einem jeden, der ihr näher kam. Er hatte es sich leichter vorgestellt, mit ihr zu verhandeln, dachte, bei einem heiteren Spiel in den Federn ihr Lust zu bereiten. Aber nun fühlte er sich befangen und wie gelähmt von ihrem verwirrenden Blick.
»Gebt mir von dem gewürzten Wein, Herr Marian. Und einen Honigkuchen.«
Ihre Stimme war leise, rau und lockend. Doch sie blieb sitzen, regungslos.
Marian löste sich aus dem Bann ihres Blickes, stand auf, nahm zwei tönerne Becher vom Kaminsims und füllte Wein aus dem Steinkrug, den er mitgebracht hatte. Die Kuchen legte er vor sie hin.
Sie nahm den Wein und nippte daran.
»Eure Mutter weiß Tränke zu mischen«, murmelte sie.
»Wein und Most, ja. Mit Kräutern aus ihrem Garten und Gewürzen aus unseren Truhen.«
»Ja, ja, doch die Zutat, die Liebe weckt, verrät sie nicht!«
Gislindis’ schillernde Augen glitzerten.
»Was wollt Ihr damit sagen?«, fragte Marian sie streng.
»Nicht, dass sie eine Zaubersche ist. Da gibt es ganz andere. Trinkt mit mir, Herr Marian. Es ist nur der Wein Eurer Mutter.«
Natürlich – er hatte ihn selbst abgefüllt, hergetragen und in die Becher gegossen.
Er trank.
Dann erhob er sich. Sie tat es ihm gleich.
»Ich werde Euch Nachricht senden, wenn ich etwas höre.«
»Tut das, liebliche Gislindis.«
Er stand vor ihr. Sie waren gleich groß, denn Marian war ein zierlicher Mann. Einen Augenblick lang war er versucht, ihr einen Kuss auf die Lippen zu drücken, doch eine ungewöhnliche Scheu hielt ihn zurück.
»Sagt Eurer Schwester, die Scheren und Messer, mit denen die Trauben geschnitten werden, soll Mats Schlyffer bald schleifen.«
Verblüfft sog er den Atem ein.
»Was wisst Ihr?«
»Was ich der wohledlen Frau Alyss sage, wenn sie mir einen Silberling gibt und mich in ihre Hände schauen lässt.«
Dann lachte Gislindis, drehte sich mit schwingenden Röcken um, ging zur Haustür und öffnete sie.
5. Kapitel
Das Erntedankfest war vorüber. Man hatte eine ganze Woche auf dem Gut derer vom Spiegel in Villip verbracht, eine heitere Zeit, für Alyss auch deshalb, weil ihr Gatte es vorgezogen hatte, sie nicht zu begleiten. Nun aber hatte der Himmel sich bewölkt, und ein heftiger Herbststurm hatte just eingesetzt, als sie wieder in Köln eingetroffen waren. Die tägliche Arbeit wurde um das Schaffen von Vorräten für den Winter erweitert. Die Körbe voll Pilze, die sie mitgebracht hatten, mussten gesäubert und zum Darren aufgefädelt werden, ebenso Apfelringe und Birnenschnitze. Trauben vom Gut wurden auf Binsenmatten ausgebreitet, damit sie zu Rosinen trockneten, die Nüsse verlesen und in Jutesäcke abgefüllt. Die wollenen Winterkleider und Umhänge wurden aus den Truhen geholt und gelüftet; hier und da musste ein Mottenloch gestopft werden, eine zerschlissene Nestel ersetzt oder ein Saum neu umgenäht werden. Hedwigis und Leocadie füllten die Leinenbeutelchen mit getrocknetem Lavendel, damit die Sommergewänder vor Ungeziefer geschützt wären, Lauryn erntete die letzten Kräuter und hängte sie gebündelt im Lagerraum auf, und Alyss bereitete nach einem Rezept ihrer Freundin Catrin aus feinstem Schmalz, weichem Bienenwachs und allerlei Heilkräutern eine Salbe, die gegen Frostbeulen helfen würde. Tilo und Frieder mussten die Dächer von Hühner- und Pferdestall ausbessern, und Arndt kümmerte sich um seine Weinfässer, die über den Rhein zu den niederländischen Häfen transportiert werden sollten.
Man ging einander aus dem Weg, bis auf die abendliche Mahlzeit. Die allerdings verlief zumeist in tiefem Schweigen. Auch die üblichen Gäste blieben aus – Merten, Arndts Stiefsohn, ein fröhlicher Hallodri, hatte nur einmal in den vergangenen Wochen am Tisch gesessen, just am Abend jenes Tages, an dem der Weingarten verkauft worden war. Obwohl nie um eine leichtfertige Geschichte verlegen, hatte auch ihm die gedrückte, angespannte Stimmung die Zunge gelähmt, und er war nicht wieder aufgetaucht. Magister Hermanus, ebenfalls ein Verwandter des Hausherrn und Mesner von Lyskirchen, hielt sich fern, obwohl er zu den gefräßigsten ihrer Tischgenossen gehörte. Ihm trauerte Alyss jedoch nicht sonderlich nach: Der Hauspfaff hatte kein einnehmendes Wesen, er neigte zu moralisierenden Tischpredigten, die allen außer ihm den Appetit raubten.
Und Master John of Lynne war nach England zurückgereist.
Alyss gestand es sich nicht gerne ein, aber ihn vermisste sie wirklich – ein ganz kleines bisschen aber nur. Nicht besonders. Nein, nicht sonderlich. Eigentlich kaum.
Aber die jungen Leute hätten seine abenteuerlichen Geschichten von Piraten und stürmischen Seefahrten, Räubern in dunklen Wäldern und solch wunderlichen Dingen wie Dracheneier sicher aufgemuntert.
Weit mehr als das säuerliche Gesicht des Hausherrn, der sich Abend für Abend an den schweren Rotweinen aus Burgund erfreute.
Am Sonntag nach ihrer Rückkehr von Villip ruhten die Arbeiten, wie Gott es befohlen hatte, und nach der Messe beschloss Alyss, den drei Jungfern eine kleine Freude zu bereiten. Sie bat die Mädchen in ihre Kammer und sah mit ihnen die Winterkleider durch, um zu prüfen, was neu angeschafft werden sollte.
»Meine Mutter hat mir ein Gewand mit Pelzbesatz versprochen«, erklärte Hedwigis und zupfte an dem wollenen grünen Surkot, den man ausgebreitet und begutachtet hatte.
»Das Kleid ist noch wie neu, Hedwigis. Du hast es erst letzten Christtag erhalten. Aber ein kleiner Pelz am Ausschnitt möchte es aufputzen.«
»Dann will ich aber weißen Fuchsschwanz haben.«
»Was dich hässlich blass machen würde!«, warf Lauryn ein. »Roter Fuchs würde zu deinen braunen Haaren besser aussehen. Und billiger ist er ebenfalls.«
»Ich will aber nicht billig aussehen.«
»Du wirst mit einem solchen Pelzbesatz keineswegs billig aussehen«, sagte Alyss. »Und Lauryn hat recht. Weiße Fuchspelze kommen aus dem Norden und sind sehr wertvoll. Eine Jungfer sollte nicht damit protzen.«
»Aber meine Mutter hat gesagt, ich darf mir aussuchen, was mir gefällt.«
Um den Trotz des Mädchens nicht weiter zu schüren, nickte Alyss und meinte: »Wir gehen morgen auf den Markt und schauen, was uns die Pelzhändler anbieten können. Lauryn, ich habe die Befürchtung, dass du diesem Sommer gesprossen bist wie eine junge Bohnenranke. Dieser Surkot ist geradezu unzüchtig kurz.« Sie hielt ein braunes Gewand an die Schulter und schüttelte den Kopf. »Da ist etwas Neues vonnöten.«
»Ich helfe dir beim Nähen«, bot Leocadie sogleich an, denn alle im Raum wussten, dass Lauryn zwar einen grünen Daumen bei allem bewies, was aus dem Boden wuchs, aber mit Nadel und Faden das Geschick eines tollpatschigen Hundes an den Tag legte.
»Wir werden einen Gewandschneider aufsuchen und ein warmes Tuch aussuchen. Ich schneide dir das Kleid zu, Lauryn.«
»Danke, Frau Alyss.«
»Und dieses hier, Leocadie, sieht schon ein wenig zerschlissen aus. Wann hast du es bekommen?«
»Vor drei Jahren, Frau Alyss. Aber wenn ich eine Borte oder Bänder haben könnte, geht es noch sehr gut. Ich mag das Rot so sehr.«
»Mhm – ja, das steht dir auch gut. Nun, wir werden nach Borten Ausschau halten. Oder auch nach einem Pelz?«
Leocadies Augen leuchteten auf.
»Gut, auch nach einem Pelz für Lauryn und dich.«
Alyss sah, dass Hedwigis einen Schmollmund zog, aber solange die Mädchen unter ihrer Obhut standen, sollten sie in gleicher Weise gekleidet sein – die Patriziertochter genau wie die des Pächters und die des Weinbauern. Und das, was sie als Nächstes vorhatte, würde Hedwigis’ Laune sogar noch weiter verschlechtern, fürchtete sie. Aber sei’s drum – sie musste lernen, dass sie nicht der Mittelpunkt der Welt war. Diese Aufgabe hatte der Vater des Mädchens, Peter Bertolf, Baumeister und Stiefbruder ihrer Mutter Almut, ihr ans Herz gelegt. Unseligerweise hatte seine Frau, eine reichlich dünkelhafte Matrone, in ihrer Tochter die Saat gelegt, dass sie gegenüber anderen Mädchen ganz selbstverständlich Privilegien für sich beanspruchte.
Aber Ritter Arbo hatte nun mal ein Auge auf die sanfte Leocadie geworfen.
»Und nun, meine fleißigen Jungfern, räumt die Gewänder vom Bett, ich will euch etwas Hübsches zeigen.« Mit diesen Worten holte Alyss aus ihrer Truhe eine Schatulle heraus und stellte sie auf die Polster.
»Das hier haben mir meine Eltern zu meiner Hochzeit geschenkt, und wenn eine von euch heiratet, soll sie sie als Leihgabe bekommen.«
»Eure Brautkrone?«, fragte Lauryn andächtig.
»Meine Brautkrone.«
Alyss wählte den kleinen Schlüssel aus dem Bund, den sie immer am Gürtel trug, und schloss die Schatulle auf. Mit dunkelblauem Samt war sie ausgeschlagen, und in ihm schimmerte Gold. Alyss hob die Krone heraus und hielt sie so, dass das Licht aus dem Fenster auf sie fiel.
Nicht wie üblich aus dünnem Golddraht und Flitter, Glassteinchen oder Wachsperlen war das kostbare Stück gefertigt, sondern einen massiven goldenen Reif hielt sie in den Händen. Eine ganze Handbreit hoch ragten die sechs stilisierten Lilien auf, dazwischen, niedriger, sechs Blätter, die das Gebilde zu einer Krone würdig einer Fürstin machten. Rosige, beinahe vollendet runde Perlen zierten die Blattspitzen, kleinere umgaben den Stirnreif wie eine Kordel. In der Mitte der Lilien aber blitzten grüne, sorgfältig geschliffene Steine auf.
Es war ein Meisterwerk der Goldschmiedekunst.
»Heilige Jungfrau Maria!«, wisperte Leocadie.
»Die ist ja ein Vermögen wert!«, flüsterte Hedwigis.
»Oh, ist die schön!«, seufzte Lauryn.
»Ja, sie ist schön und wertvoll und der Krone einer Gottesmutter-Statue nachgeformt.«
»Ihr müsst Euch gefühlt haben wie eine Königin, Frau Alyss.«
Ja, das hatte sie damals. Sie hatte sich stolz und erhaben, vor allem aber geliebt gefühlt.
»Wie eine Braut, Leocadie.«
Lauryn streichelte ihren Arm. Natürlich war den Mädchen der dauerhafte Streit zwischen Arndt und ihr nicht entgangen, aber alle drei waren so rücksichtsvoll, das nie zu erwähnen. Alyss schüttelte die Traurigkeit ab und setzte die Krone wieder in ihr Behältnis zurück. Dann ließ sie die Erde erbeben.
»Mein Vater hat zugestimmt, Ritter Arbos Besuch wohlwollend aufzunehmen.«
Die Jungfern sahen sie mit großen Augen an, und Leocadie liefen die Tränen über die Wange.
1. Auflage
Originalausgabe Juli 2010 bei Blanvalet Verlag, München, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH
© 2010 by Blanvalet Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH Redaktion: Dr. Rainer Schöttle Umschlaggestaltung: Hilden Design, München, unter Verwendung von Motiven von akg-images lf ∙ Herstellung: sam Satz: Uhl + Massopust, Aalen
eISBN: 978-3-641-04790-0
www.blanvalet.de
www.randomhouse.de
Leseprobe
Frauen im Mittelalter, München 1984, S. 150 f.