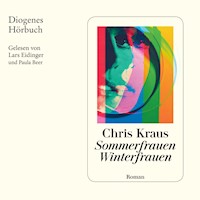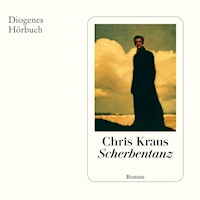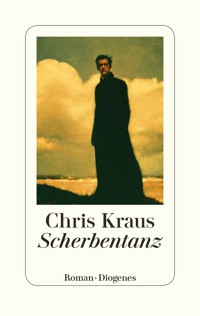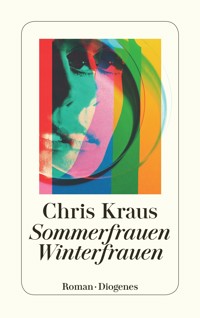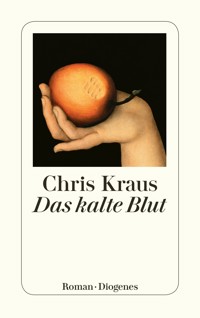21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie waren beste Freundinnen, starteten gemeinsam eine Bühnenkarriere, doch dann kam der Bruch. Sonja, genannt Sonne, wurde von Jana von Mond verraten. Jahre später steht Jana – inzwischen ein Comedy-Star – vor der Tür von Sonnes Bestattungsunternehmen und bittet sie, die Trauerfeier für ihren Liebsten auszurichten. Alte Wunden brechen auf, neue werden zugefügt. Die Sonne und die Mond können ihre Umlaufbahn nicht verlassen, sie leuchten weiter, jede auf ihre Art, mal kalt, mal warm.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 618
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Chris Kraus
Die Sonne und die Mond
Roman
Diogenes
Für Uta Schmidt
31.10.1965 – 14.11.2023
Deiner
»Man muss akzeptieren, endlich zu sein:
hier und nirgendwo anders zu sein,
nur dieses Leben zu haben.
Die Unsterblichkeit gehört den Träumen,
die uns treiben,
den Mythen, die über uns hinaus existieren,
der unverletzbaren Fantasie,
die uns in den Stand setzt,
uns unser eigenes Ende überhaupt vorzustellen.
Dass dies uns ermöglicht,
nach der Schönheit des Lebens zu suchen,
die man doch nicht halten kann,
ist der Trost eines jeden Tages,
der uns widerfährt.«
André Gorz
DERERSTETAG
1
Es gibt Menschen, die sich wichtig nehmen. Und es gibt Menschen wie Sonne.
Vor einem Vierteljahrhundert, drei Tage nach ihrem siebzehnten Geburtstag, an einem überaus freundlichen Septembermorgen, hängte sich ihr Vater in seiner Garage auf.
Um ihn, den gewesenen Herrn Dipl.-Psych. Jonathan Meling, kümmerte sich umgehend das bewährte Beerdigungsinstitut Leberschön, beflissen und mit der zupackenden Reibungslosigkeit eines seit drei Generationen erfolgreichen Familienbetriebs. Der Chef persönlich, Herr Leberschön jun., repräsentierte die kollektive Erwartung an eine vernünftige Bestattung, indem er in allererster Linie einen sehr traurigen Gesichtsausdruck einbrachte.
Er hatte ihn von seinem Vater geerbt.
Und der wiederum hatte ihn von seinem Vater geerbt.
Ohne diese genetisch bedingte physiognomische Katalepsie auch nur ein einziges Mal zu lockern, abgesehen von dem irdischen Moment, als ihn eine altersschwache Schnake in den Hals stach, bettete Herr Leberschön jun. den tragisch Verstorbenen dezent unter die Erde, wie es sich für einen Selbstmörder gehört, sekundiert von einem übergewichtigen Pastor, der sich auf das Schnäpschen danach freute.
Sodann wurde ausgiebig das Diesseits gewürdigt.
Im Gasthof Ravenna servierten etwas zu heiter gestimmte Aushilfskräfte zum Leichenschmaus Pasta und Kalbsschnitzel, inklusive stärkender Getränke, wobei Herr Leberschön jun. nach dem vierten Weißbier zeigen konnte, über wie viele Gesichtsausdrücke er außerdem verfügt.
Sonne wollte ihren Vater noch einmal sehen – es war ihr ein großes Bedürfnis, da er Sonne einst »Sonja« getauft, sie dann aber Tag für Tag und Jahr für Jahr und sogar einen Abend vor seinem Tod noch mit diesem viel strahlenderen, goldgelben Namen gerufen hatte, den sie immer mit seiner weichen, sehnsüchtigen und auch etwas schwachen Stimme verbinden würde.
Um sie jedoch vor bleibendem Schrecken zu bewahren, wurde ihrem Wunsch nicht entsprochen.
Besser, du behältst ihn so in Erinnerung, wie er war, Kleines.
Diese Worte hat sie nie vergessen.
Blitz und Donner wären auch passende Namen für Sonne gewesen. Aber sie redete nicht über ihre Unwetter. Nicht über ihren Vater, ihre Kindheit, ihren Geburtsort. Höchstens über ihre Gegner.
Dazu brauchte sie nicht einmal viele Worte.
Sie konnte auch stumm die Lippen schürzen, die Schultern unwillkürlich nach vorne ziehen, wenn sie Gegnern begegnete. Gegnerschaft war das Persönlichste, was sie über sich preisgab. Darüber schärfte sie ihre Kontur.
Beerdigungsinstitute wie das von Herrn Leberschön jun.empfand Sonne als Gegner, auch gewisse Friedhofsämter und überhaupt Vorschriften, die dem Sterben galten.
Oftmals wussten ihre Gegner gar nicht, dass sie welche waren, meistens waren das die, denen es eh egal gewesen wäre. Schwätzer, Angeber, unverbesserliche Rechthaber zum Beispiel. Oder Leute, die einen Jagdschein hatten und tatsächlich auf Ansitze stiegen, um aus zweihundert Metern Entfernung ein äsendes Reh zu schießen.
Sonne schlug keine Tiere tot. Sie aß auch keine Tiere.
Sie fand das logisch, denn sie aß ja auch keine Menschen.
Ihr größter Gegner, das war der Tod. Sie fand ihn grauenhaft, obwohl er gut zu ihr war. Als nicht mal 42-jährige Bestatterin hätte sie ihn auch als Freund sehen können. Er sorgte für ihren Unterhalt, er ernährte sie, er brachte die Dinge in Schwung, und er ließ ihr noch viel Zeit, hoffentlich.
Aber was er anrichtete, gefiel ihr nicht, und sie kümmerte sich immer um das, was er wie Abfall hinterließ.
Der Tod liebt das Töten, nicht die Leichen. Der Tod ist ein Krimineller.
Einerseits.
Andererseits führt er die Menschen auch über die Ziellinie, manchmal mit Zärtlichkeit, oft grausam. Und ob sie nun Dickhäuter mit schnappenden Zähnen und kastriertem Gewissen waren oder frisch von ihren Lovern verlassene Selbstmörderinnen mit Integrität und Wärme – am Ende sind sie wie alle Leichen eine sympathische Version ihrer selbst: so authentisch, so willensschwach, so menschlich, so harmlos, so ausgeglichen – voller Niederlagen und künstlicher Hüften und ein bisschen langweilig.
Im Grunde hatte Sonne ein Autoritätsproblem, und das ausgerechnet mit der größten Autorität des Lebens, dem Herrn Gevatter. So nannte sie ihn. Nicht oft natürlich, denn sie sprach nicht viel. Aber sie mochte alte, ausgestorbene Wörter wie »Drangsal« oder »Saumseligkeit«, vielleicht gerade deshalb, weil es ihren Widerstand herausforderte, dass der Herr Gevatter keine Gnade kennt. Selbst die Wörter kommt er holen, selbst die Berufe kommt er holen, und zuallererst die Moden.
Sonne konnte mit Moden wenig anfangen. Die waren für sie Dead Men Walking.
Sie trug die immer gleichen schwarzen Sachen. Shirts. Hoodies. Klar und schlicht. Seit ihrem achtzehnten Geburtstag hatte sie als einzigen Schmuck einen Ring im rechten Nasenflügel, aus Silber.
Sie ist stets nah an sich drangeblieben. Das sagten alle, die sie kannten.
Gleichzeitig war da dieses Stilgefühl.
Stilgefühl war Sonnes Atombunker gegen die Unordnung der Welt.
Wer die Anmut von Proportionen erkennt, hält sie auch für genauso wichtig wie ein Mittel gegen Krebs. Ihre Meinung.
Kam jemand in einen Trauerraum herein, den sie eingerichtet hatte, betrat er ein vergrößertes Modell ihres Schädels. Nicht ihres Herzens. Aber ihres Schädels. Alles hell, übersichtlich und von Licht durchflutet. Das galt auch für das Arrangement der Blumen. Oder für die Wahl von Farben und, wie sie sie nannte, Mitarbeiter:innen.
Wenn Sonne an einem Obdachlosen vorbeikam, so wusste sie sofort, ob er lieber ihr soeben gekauftes Tofu-Brötchen oder Kleingeld haben wollte – denn auch Mitgefühl ist Stilgefühl. Meistens gab sie beides. Sie war eher freundlich als herzlich. Und oft musste sie all ihre Freundlichkeit aus sich herauspressen wie aus einer Zitrone. Sie konnte dann erschöpft und unaufdringlich zugleich sein.
Im Freundlichen steckt so viel Schönheit.
Nirgendwo jedoch gab es für sie weniger von beidem als im konventionellen Bestattungswesen, das Herr Leberschön jun. einst in idealer Weise in einen einzigen, unwandelbaren Gesichtsausdruck gegossen hatte.
Dieses Gewerbe zog Menschen mit stoischer Wangenmuskulatur und ausgeprägter Einfühlungsdisziplin an, die tollkühnen Geschmack mit diskretem Phlegma und der reinen und ungebremsten Freude am Verkaufen nicht nur von Särgen, sondern auch von Trauerwaren aller Art verbanden. Dabei bildeten Sarggarnituren aus Unisex-Glanzseide oder mit Loden- und Spruchbändern, mit Fußballmotiven oder mit in der Tat unsterblichen Swarovski-Steinen nur die Spitze des Eisberges. Sargmatratzen, Füllkissen, Fußpolster, Kinnstützen, Handschmeichler und schwarze Luftballons mit und ohne Kreuz wollten an die geduldige Kundschaft gebracht werden.
Und noch immer bekamen viele Verstorbene (einfach, weil es bei »Gundolf Köppele Nachf. – Spezialist für Sterbewäsche, Bestattungsbedarf und Friedhofstechnik seit 1849!« im Sortiment geführt wurde) sinnlose Leichenhemden in weißem Linnen übergestreift, anstatt würdig in ihrer abgefuckten Lieblingsjeansjacke oder dem Frack, in dem sie einst geheiratet hatten, verbrannt zu werden.
Nichts war Sonne wichtiger, als dass alle, die es wollten, von ihrem verstorbenen Menschen Abschied nehmen durften, so wie ihn Gott gedacht, das Leben geformt und womöglich ein Intercityexpress nach dem Aufprall hinterlassen hatte. Ihr Beitrag war es, einen Rahmen für die Würde dieses Moments zu schaffen, und ihr Wissen um die Wirkung von Licht, Schatten und Inszenierung half ihr dabei.
Sie hatte einst Produktdesign studiert und war einige Jahre lang eine mehr als passable Fotografin gewesen. Auch Topmodels musste sie ablichten. Eine Zumutung für jemanden, der mit Moden nichts anfangen kann. Ihr völlig unankratzbares Stilgefühl hat es außerdem beleidigt, für Agenturen unterernährte Idiotinnen zu knipsen, die allesamt, ob sie nun Gisèle, Nathalie, Marie-Caro oder Thymiane hießen, exakt den gleichen tristen, an Verdrossenheit grenzenden Gesichtsausdruck wie seinerzeit der fettleibige Herr Leberschön jun. aufsetzten. Die äußerst begrenzte Mimik dieses Mannes wollte Sonne eigentlich in keiner Visage der Welt mehr wiedersehen, und sei sie noch so apart.
Darüber hinaus hat junges Fleisch sie nie interessiert, denn für sie war junges Fleisch nichts anderes als altes Fleisch, Ballast, den wir durch die Gegend schieben, bis wir ihn abwerfen, wenn wir am Ende angekommen sind.
Seit sie einmal Heidi Klum unter einem Regenbogen fotografieren musste, der in ihrem geöffneten Mund endete, hasste sie Kitsch wie jede andere Lüge.
Ihr kleines Berliner Studio für zugewandtes Begraben hat Sonne nicht Halleluja oder Sonja Meling Bestattungen GmbH, sondern nach einem alten Toten-Hosen-Song getauft. Es hieß Sommernachtstraum und befand sich in einer ehemaligen Bäckerei im Prenzlauer Berg. Manche behaupteten, dass es dort immer noch nach Mehl roch. Ihr einziger Mitarbeiter Samuel nannte den Laden nur die »Totenbäckerei«.
Der Schreibkram der Totenbäckerei wurde in der einstigen Backstube erledigt, dem sogenannten »Office«. Dort standen in großen Regalen die nach den Farben des Regenbogens sortierten Aktenordner und hin und wieder unter dem Tisch auch jemand in fein gemahlenem Zustand, der in einer Urne auf seinen letzten Auftritt wartete.
Der Verkaufsraum spiegelte Sonnes Bedürfnis nach ästhetischer Klarheit wider. Es gab einen alten Holztisch, eine gusseiserne Bahnhofsuhr, einen Modellgrabstein und zum Anschauen einen offenen Sarg aus Kiefernholz. Er duftete nach Harz und Wind und schien wie ein finnisches Kanu auf austrainierte Sportler zu warten. An der hellen, kamillenteegelben Wand hingen einige Kunstobjekte Samuels.
Samuel schnitzte gerne Sachen, die wie vom Meer angespültes Treibholz aussahen. Er sah selbst ein bisschen nach Strandgut aus, schrundig, mitgenommen, vom Salzwasser und den Elementen gezeichnet. Er blickte auf eine Karriere als Punk, als Leadgitarrist der Band Satanic Sex Toys, als Filmbeleuchter, Rekordlangzeitstudent, Computergrafiker und als Trauerredner zurück, und wie Sonne hatte er in der Jugend seinen Vater an den Suizid verloren.
Es war keine Berufsvoraussetzung für einen guten Totenbäcker, dass sich Elternteile in der Jugend umgebracht haben mussten. Aber Samuel fand dieses verbindende Element zwischen ihm und Sonne bemerkenswert, so als hätten sie beide, wie er einmal sagte, »riesige Leberflecken in Form eines Sowjetsterns auf derselben Höhe der linken Arschbacke«. Er machte eigenartig makabre Scherze darüber, brachte einmal zu ihrem Geburtstag, nur um sie aufzuheitern, Schilder mit dadaistischen Werbetexten im Schaufenster an wie Hier tötet sich der Chef noch selbst oder Suizide in Familienbesitz seit Ende des 20. Jahrhunderts.
Leider fühlte sich Sonne durch solche Aktionen niemals aufgeheitert, sondern hängte die Schilder sofort erschrocken wieder ab. Sonne fand Samuel eher selten lustig. Er wiederum liebte es, ihrem durch ihn so leicht auszulösenden Humorverlust beizuwohnen. Denn das war die intensivste emotionale Wirkung, die er bei ihr erzielen konnte.
Sie kannten sich seit vielen Jahren, und sie kannten sich gut. Die Verletzung, die Sonne ihm einst zugefügt hatte, lag unter einer Art Straßenpflaster verborgen, auf dem sie gemeinsam zur täglichen Arbeit gingen.
Ansonsten war Samuels immer noch mädchenhafte Verliebtheit in Sonne das bestgehütete Geheimnis seiner schwerblütigen, etwas übergewichtigen, betont maskulin ramponierten wie auch durch und durch gutmütigen Erscheinung. Er verbarg es unter einem schwarzen Krabbenfischermützchen, das er einfach immer trug, und hinter der Fassade von gelegentlich schroffer Direktheit, gutturaler Sprachmelodie und jener manchmal nur aufgesetzt schlechten Laune, die ihn immer dann anfiel, wenn seine Chefin ihn durch die Wahl ganz besonders unerträglicher Gegner eigentlich entzückte.
Außerdem halfen ihm ein unattraktiver Vollbart und kleine, listige Seemannsaugen, die Sonne oft heimlich musterten, in seinen Gefühlen unentdeckt zu bleiben. Dass er entlassen werden würde, und zwar Knall auf Fall, wenn seine Schwäche für sie ans Licht käme, schien ihm eine ausgemachte Sache zu sein, so wie seine Chefin über emotionale Abhängigkeit urteilte.
»Emotionale Abhängigkeit«, sagte Sonne nämlich oft, »heißt nichts anderes, als dass es kein Leben vor dem Tod gibt.«
Ein Leben nach dem Tod gab es aus ihrer Sicht aber ebenfalls nicht. Sie bestattete ohne betende Hände von Dürer und ohne Rosenkranz, ohne priesterlichen Beistand und ohne Ave-Maria.
Deshalb fasste Sonne auf ihrer Webpage ihre Firmenphilosophie wie folgt zusammen: »Wir von Sommernachtstraum sind Eure Helfer:innen, Wegbegleiter:innen und Unterstützer:innen im Prozess von Sterben, Tod und Trauer. Wir wissen, was zu tun ist, und kümmern uns. Auch um alle Formalitäten. Vor allem aber kümmern wir uns um Euren verstorbenen Menschen und um Euch und Eure Bedürfnisse. Denn das Wichtigste ist, dass Ihr so viel wie möglich selbst entscheiden könnt: so, dass sich jeder Schritt für Euch richtig anfühlt. Individuell und selbstbestimmt.«
Sonne meinte immer alles genau so, wie es geschrieben stand. Sie war eine Kümmerin und liebte es, ihre Stille und Geradheit in Zuwendung zu verwandeln, sogar in Demut. Wie die Toten aussahen, ob sie bei einem Unfall verstümmelt oder bei einem Verbrechen enthauptet worden waren, nahm ihr nicht die Unerschrockenheit. Für sie waren wir alle nur eine Hülle.
Allerdings mochte sie Haare, auch ihre eigenen, leicht krautigen, buchenrindenbraunen. Es war ihr wichtig, dass ihre Kundinnen schöne Haare hatten, wenn sie im Sarg lagen. Sie hatte extra eine Zusatzausbildung gemacht, um Frisuren zu reparieren, gerade dann, wenn Teile der Schädeldecke fehlten, war es ihr wichtig.
Außerdem liebte sie Augen. Für jemanden wie sie, die nicht gerne sprach, waren sie mehr als nur Fenster, sie waren ein Treibhaus voll mit dunklen Begierden und Fragen und Ressentiments. Ihre eigenen Augen waren nichts Weltbewegendes, fand sie, und wenn andere in ihre Augen blickten und es mit Schmelz oder Flirt versuchten, dann schaute sie zurück, mit einem Ernst und einer Unverfügbarkeit, dass man sie am liebsten mit Steinen bewerfen wollte.
Eine Brille mit Fensterglas gab ihr zusätzlich eine gewisse Strenge. Weshalb sie eine sinnlose Sehhilfe trug, die beim Sehen einfach gar nichts half, erklärte sie nur wenigen. Aber für irgendwas schien es gut zu sein. Denn man konnte an der Sorgfalt, mit der sie die Fensterglasbrille behandelte, für die ein in bunten Farben lackiertes Etui immer von ihrer leicht nervösen Hand aus der Jacke gefummelt, betrachtet und zurückgesteckt wurde, durchaus ahnen, dass es etwas für sie sehr Wichtiges sein musste.
Wenn sie durch diese Imitation einer Brille ihre Kundschaft betrachtete, dann änderte sich ihr Blick. Einer ihrer Ex-Freunde hatte mal gesagt, ihr Blick sei dann wie ein Schwarm Flamingos, der aus einem dunkelgrünen, fast schwarzen See auffliegt. Kein Wunder, dass sie ihn verlassen hat. Sie mochte schwülstiges Gerede nicht.
Sie fand, dass die Menschen meistens so sterben, wie sie gelebt haben, und das sei interessant. Überhaupt könne man nur eine gute Bestatterin sein, wenn man Menschen mag. Und Sonne mochte Menschen, wenn auch auf eine eher verschrobene Art.
Zum Beispiel störte sie der menschliche Atem. Er roch einfach oft nicht gut, weshalb sie auch gerne mindestens einen Meter von fremden Gesichtern entfernt blieb.
Sie liebte hingegen Gedanken und Gefühle, die sich wie feste Körper anfühlten, wie eigene Personen fast, die durch ihr Herz spazierten und dort hängen bleiben konnten, jahrelang, wie gute Freunde, nur ohne Körpergeruch, ohne Mundgeruch, ohne jede Art von Miasmen.
Und bis heute las sie Bücher aus dem 19. Jahrhundert auf der Suche nach solch trotz der Abgänge der Verfasser weiterhin existierenden Gedanken und Gefühlen, aber auch schräges Zeug von Bukowski. Und ab und zu, sehr heimlich, einen schlechten Liebesroman.
Am meisten jedoch liebte sie Märchen. Aber das hatte mit ihrem Vater zu tun.
Dass sie einst eine Einserschülerin gewesen war, Klassensprecherin, bereit für den Tigersprung in die Meute der hyperehrgeizigen Karrieristinnen – nicht einmal Samuel konnte sich das vorstellen.
Im Umgang mit den Angehörigen der Verstorbenen war Sonne die Nummer eins unter den alternativen Bestattern Berlins.
Sie musste, obwohl sie so beherrscht, rational und kontrolliert wirkte, oft gegen die Tränen kämpfen, wenn sie in ihrer Totenbäckerei die Geschichten über die Verstorbenen hörte. Die Leute rannten ihr daher die Bude ein, um sie als Klageweib zu ordern.
Georgine vom lesbischen Bestattungsunternehmen Last Dance sagte immer ganz spitz, Sonne sei wie eine Hafennutte, die bei jedem Freier einen Orgasmus bekommt.
Das war der übliche Umgangston. Das Bestattungsgewerbe blieb auch in seiner achtsamsten Variante rau und hartgesotten.
Sonne mochte Georgine und musste oft über sie lachen. Aber sie konnte nun einmal in keinem Toten einen Gegner erkennen, weil ihr alles Verstorbene gereinigt schien von der Dummheit, die unseren Alltag am Laufen hält.
Es gibt keine dummen Toten.
Die Dummheit der Toten liegt ausschließlich im Auge des Betrachters und ebenso ihre Größe und Schönheit.
So dachte Sonne bis zu jenem Tag, als sich alles änderte.
2
»Wir gleich da.«
Der Mann salzte seine Gleichgültigkeit mit einer Prise Hinwendung.
Er teilte seine Fahrgäste in Kategorien ein, und diese Frau hinter ihm gehörte eindeutig zur Klasse der »Gizhi«. So nennt man in seinem Land die Verrückten.
Sie summte leise und ohne jede Fröhlichkeit vor sich hin. Trotz des Unwetters trug sie eine Brille mit dunklen Gläsern, außerdem kreischend bunte, ihre gleichmäßige Blondheit zertrümmernde Lockenwickler. Und das, was von ihrer Stirn noch frei war, stieß in langsamem Rhythmus wie ein Verhaltensgestörter gegen die Seitenscheibe, an die von außen der Regen schlug.
Es kann nicht schaden, einer Gizhi das Fahrziel ein bisschen näher zu zaubern, als es in Wirklichkeit ist, dachte der Taxifahrer.
»Wir ganz gleich da!«, versprach er noch kriecherischer als zuvor. »Ganz gleich!«
»Immer langsam«, sagte die Frau düster, ohne das Pendeln des Kopfes zu unterbrechen, »sonst wir ganz gleich tot.«
Er verstand nicht ganz, wieso sein gebrochenes Deutsch retourniert wurde. Ob es sich um Verarsche, Rassismus oder einfach was Verrücktes handelte. Dennoch lachte er nur sein beschwichtigendes Lachen, das ihm schon einmal geholfen hatte, als jemand aus derselben Kategorie plötzlich ein Bowiemesser gezogen und ihm ans Ohr gehalten hatte, um zu zeigen, was ein konvexer Schwertschliff ist.
»Gurt?«, fragte er so vorsichtig wie möglich, inzwischen zum dritten Mal seit Beginn der Fahrt. »Gurt, please?«
Die Gizhi hatte offenbar beschlossen, nichts mehr zu sagen. Anschnallen gehörte ebenso wie andere Formen der Unterordnung nicht zu ihren Tugenden. Sie stoppte ihr Summen und auch die gegen das Fenster pumpende Stirn.
In ihrer Hand lag das Kettchen.
Alle in ihrer Familie besaßen solch ein Kettchen mit Kreuz. Ein silbernes. Auch sie hatte es von ihrer frommen Großmutter zur Geburt bekommen. Sie trug es, weil sie es immer getragen hatte. In Zeiten des inneren Aufruhrs jedoch war es mehr als eine Gewohnheit.
Jetzt rieb sie die winzigen, ordentlich sortierten Kettenglieder zwischen Daumen und Zeigefinger, während sie aus dem Fenster in den Regen sah. Sie dachte: Gleich kommt es wieder um den Hals. Aber jetzt noch nicht. Es macht so ruhig. Es fühlt sich schön an in der Hand. Fein und kühl zugleich. Und ohne Gewicht. So hat es sich auch angefühlt, als ich noch so klein war wie dieser Taxifahrer. Der ist unfassbar klein. Eine Art Zwerg. Wie kommt er überhaupt mit dem Fuß an das Bremspedal, dachte sie. Wenn er jetzt bremsen muss, weil die Reifen blockieren wegen des Aquaplanings auf der Straße, und er rutscht runter mit seinem winzigen Körper, nein, er springt runter, um das Bremspedal zu erreichen, und er schafft es nicht rechtzeitig, und wir knallen an einen Lichtmast – dann wird er vom Sicherheitsgurt im Bruchteil einer Sekunde stranguliert. Und ich fliege einfach wie eine Rakete zwischen den Vordersitzen durch, rums, in die Windschutzscheibe. So wie Mahm und Paps.
Sie musste lächeln. Immer brachten sie solche Gedanken zum Lächeln. Sie inspirierten sie zu ihren besten Gags. Einmal hatte sie sogar einen ganzen Sketch über abruptes Sterben geschrieben und in der Kantine improvisiert. Die Lachsäcke aus dem Writers’ Room hatten sich weggejodelt. Nur der Regieassistent schluckte und schaute sie an. Seine Tochter war, wie sie später erfuhr, an Leukämie erkrankt.
Ich sollte mich wirklich anschnallen, dachte sie. So wie der Mini-Georgier es alle paar Minuten anmahnt mit diesem Akzent, den sie mal ausprobieren müsste.
Vielleicht entspannt es mich auch.
Georgisch hatte sie noch nie im Programm.
Er starrt immer in den Rückspiegel, als sei er auf der Hut. Gewiss erkennt er mich nicht.
Natürlich sah sie auch komisch aus, weil sie den wavy hairstyle noch im Haar hatte. Die Papilloten hätte sie ja wenigstens rausnehmen können. Sie denkt zu wenig nach. Sie macht einfach irgendwelche Sachen.
Sie haben da bestimmt eigene Fernsehclowns in Georgien. Ob die auch nur halb so lustig sind wie ich?
Sie wunderte sich über ihre eigenen Gedanken und überlegte dennoch, ihn zum Lachen zu bekommen. Sie konnte das mit links. Sie bräuchte eigentlich nur das Temperament seiner Augenbrauen zu imitieren.
Andererseits hatte Said sich auch nicht angeschnallt.
Es wäre wirklich zu seltsam, wenn sie wie er enden würde. Wie er und wie der Rest der Familie.
Allerdings hatte ihre fromme Großmutter immer gesagt: Ein Erdbeben kommt selten allein.
Und auch über Saids letzte Sekunden hatte sich ein Unwetter gekrümmt.
Sie fühlte an ihrer Daumenkuppe das Kreuz. Sie drückte es übertrieben stark, um das christliche Metall in ihr Fleisch zu stempeln. Sie mochte Abdrücke auf ihrer Haut, immer schon, und liebte es, dabei zuzusehen, wie sie langsam verschwanden. Sie machte eine Faust.
Dann öffnete sie die Hand, zog seufzend die Silberkette an zwei Fingern in die Höhe, zieselte sie auseinander und schloss sie sich wieder um den Nacken. Ob sie das Richtige tat? Ihr war schlecht, aber das lag an den Drogen. Es lag an der Aufregung. Es lag an everything.
Ich muss mal die Augen schließen.
»Wir da«, sagte der kleine Taxifahrer nach einer Ewigkeit und schaltete den Motor ab.
Sie blickte auf. Sie standen in zweiter Reihe auf einer kopfsteingepflasterten Straße, gegenüber einer grauen, mehr als ein Jahrhundert alten Mietskaserne. Hinter dem Film aus schnürendem Regen sah sie das Firmenschild. Sie hatte es sich so sehr angewöhnt, in ihren Blick etwas Erwartungsvolles zu legen, dass dieses Erwartungsvolle auch jetzt nicht verschwand. Was aber erwartet man sich von einem Bestattungsinstitut? Service, klar. Leise Stimmen. Irgendeine Art von Ankunft, während man vorher nur durchs Weltall rauschte. Aber sonst? Überhaupt, warum sagte man »Institut«? Und nicht »Laden« oder wenigstens »Boutique«? Wenn es eine »Metzgerei«, »Konditorei« oder »Wäscherei« gab, warum dann keine »Bestatterei«?
»Institut« klang hochtrabend. So nach Professor Doktor Soundso und seinem akademischen Hauptseminar. Als könnte man in einem Bestattungsinstitut was lernen. Als würde man klüger herauskommen, als man hineingegangen ist.
Wenn es den Tod gibt, welchen Sinn hat dann das Leben? Warum hat es Said überhaupt gegeben?, dachte sie und spürte, wie die Kopfschmerzen und die Übelkeit immer stärker wurden.
»Wir da«, wiederholte der Mann erneut, eine Spur drängender als zuvor, und zeigte auf den Taxameter.
Sie nickte, obwohl ihr Kopf dabei dröhnte, und riss ihren Blick vom Regen los. Sie griff nach ihrem Portemonnaie und gab dem Fahrer ihre Platin-Kreditkarte.
Er staunte nicht schlecht, vor allem, weil sie ihm das Doppelte des Fahrpreises als Trinkgeld spendierte.
So etwas machte sie sonst nicht. Aber für einen Moment hatte sie das überwältigende Gefühl, dass vielleicht überhöhtes Trinkgeld der eigenen Existenz kurz Sinn verleihen könnte. Zumindest sorgte es für Motivation.
Der Georgier sprang heraus und wurde sofort vom Wolkenbruch bis auf die Knochen durchnässt. Er eilte zum Kofferraum, öffnete ihn, zog einen Regenschirm heraus, klappte ihn auf und half als fleischgewordener Eifer dieser großzügigen Gizhi aus dem Wagen.
Im selben Augenblick sah auch Samuel den Schirm. Er stand hinter seinem Schaufenster, mit verschränkten Armen, und kaute wie fast immer Kaugummi. Er liebte es, kaugummikauend in den schweren Septemberregen zu schauen, die Sturzbäche auf dem Asphalt und an der Scheibe zu betrachten.
In die Glasfront war vor Jahrzehnten als Zunftzeichen der Bäckerinnung eine Art DDR-Brezel hineingraviert worden, und im Loch des linken Knotens sah Samuel undeutlich ein rotes, grünes, gelbes und violettes Durcheinander auf einem Kopf, den er irgendwo schon mal gesehen hatte. Der Kopf gehörte zu einer Gestalt, die gekrümmt aus einem Taxi stieg und sich von einem überstreckten, auf Zehenspitzen balancierenden und klatschnassen Gnom den tänzelnden Regenschirm über ihr Haupt spannen ließ. Trockenen Fußes, aber leicht torkelnd, mit Daumen und Zeigefinger an der Nasenwurzel, marschierte sie durch das Gewitter auf die Brezel zu.
Alles an ihrem Erscheinungsbild ließ Samuel zu der Erkenntnis kommen, dass er das Kaugummi ausspucken musste.
Er befürchtete, dass eine perfekte Gegnerin Sonnes auf dem Weg in die Totenbäckerei war.
Die Frau öffnete die Tür und spazierte herein wie ein Magnet, der kurz zuvor durch ein Shoppingcenter geworfen worden war, sodass die teuersten und am wenigsten zusammenpassenden Klamotten wie Eisenspäne völlig willkürlich an ihm hängen geblieben sind.
Trotzdem wirkte sie auf Samuel nicht wie eine Oligarchengattin. Sonst hätte auch sie Kaugummi gekaut. Sie trug einen Mantel aus erschossenen Nerzen, die zwar alle noch lebten, weil es eine weiße Faux-Nerz-Simulation war. Aber trotzdem. Und sie hatte große Ohrringe.
Im Verkaufsraum nahm die Frau die Sonnenbrille ab. Sie steckte sie ein, und man sah gletscherblaue Augen, die sich zu Schlitzen verengten und ins Nichts blickten.
Der Taxifahrer ließ den Schirm nicht sinken. Er starrte betroffen auf den Ausstellungssarg und tropfte mitfühlend eine riesige Pfütze auf die Dielen. Dann bekreuzigte er sich, und die totenbleiche Frau musste zweimal aufstöhnen, bevor sie ihre Monstermigräne mit einer kurzen Geste andeutete und sich geräuschlos übergab. Samuel hatte rechtzeitig eine leere Urne der Marke Ciao mit dem Motiv Wald-Lokomotive zur Hand, die sich auch geruchsdicht verschließen ließ.
Als Sonja Meling wegen des Tumults aus der Backstube kam, war die Frau noch über die Urne gebeugt. Aber Sonne erkannte sie sofort. Schon an den Knöcheln der Hände, die das Gefäß hielten. Auf den linken Knöcheln war L-O-V-E eintätowiert worden, auf den rechten H-A-T-E, genauso schief und krumm, wie sie das in Erinnerung hatte.
Und als die Frau aufschaute, wäre die halbe Fernsehnation im Bilde gewesen. Jeder, vielleicht von einem TV-Hasser wie Samuel Petersen und einigen georgischen Taxifahrern abgesehen, kannte Jana von Monds Fernsehgesicht, das sich seit Jahren durch die Comedys der Republik alberte. Die RTL-Mond-Schein-Show hatte alle Quotenrekorde gebrochen. Jedenfalls früher.
Jetzt allerdings war Jana weiß wie ein Reiskorn.
Viele Jahre lang hatte Sonne nichts nachhaltiger trösten können als die Vorstellung, dass Frau von Mond dermaleinst in einer weit entfernten Galaxie von Raben zerhackt oder von Insekten zerfressen im Nirgendwo liegen würde. Von niemandem bestattet.
Und nun saß sie direkt vor ihr. Eine Jacke wie Schnee, rosafarbene Sandalen, orangener Perlmuttlack an ihren Fußnägeln, als würde der Sommer niemals enden. Und dann diese Ohrringe.
Dennoch hing an ihrem Elend eine riesige Portion Unbefangenheit, selbst als sie Samuel die gefüllte Urne reichte.
Wie unglaublich unbefangen du wirkst, wunderte sich Sonne. Denn fast alle Menschen, die in ihren Laden traten, waren in irgendeiner Form von Befangenheit gezeichnet.
Jana jedoch schien nicht die Spur von Sorge zu haben, dass sie oder ihre Kotze nicht erwünscht sein könnten, trotz allem, was geschehen war.
»Hi«, quetschte der etwas schräg gestellte Mund hervor.
Statt einer Erwiderung reichte ihr Sonne eines der Papiertaschentücher, die dezent in Griffweite lagen.
Jana nahm das Taschentuch, tupfte sich die Mundwinkel ab, schaute auf, und Sonne sah, dass sie immer noch gelenkig war. Gelenkig im Kopf. Es war schwer zu erklären. Sie erlaubte jedem jede Projektion, jede Wunschvorstellung ihrer Person, sicher das Geheimnis ihres Erfolgs.
Janas geweitete Pupillen musterten den Empfangsraum. Vier 50-Watt-Birnen strahlten gegen den blauschwarz verhangenen Himmel an, der den Morgen in einen späten Abend verwandelte. Der hellste Punkt des Raumes war die schneeweiße Kleenex-Packung, die unter dem Tisch stand.
»Super, dass hier überall Taschentücher sind«, sagte Jana, während sie ihr Kinn abwischte. »Wie im Puff.«
Niemand antwortete ihr. Man hörte nur das Rauschen an den Scheiben, und in der Nähe donnerte es.
»Sieht toll aus. Ehrlich. Erinnert mich an eine sehr coole Bar in Madrid, in der ich mal war.«
»Ja, du hast immer gerne in Paellas gereihert.«
Jana verzog die Mundwinkel.
»Peace, Sonne. Peace, ja?«
Jana verließ sich wie immer auf ihre unmittelbare Wirkung.
Bei Samuel zumindest schien es zu funktionieren. Sonne bemerkte, mit welcher Akkuratesse er die missbrauchte Urne auf den Mustergrabstein stellte. Als wäre es eine Ming-Vase.
Jana war nicht überschön, nicht mal schön. Aber immer noch hübsch. »Vorläufig hübsch« hatte man sie in der Abizeitung genannt. Weil niemand wusste, in welche Richtung sie erblühen würde. Dieser viel fotografierte Mund, den man frisch nennen könnte. Schon wegen der Farbe, aber auch, weil er etwas schief saß, die linke Oberlippenseite breiter als die rechte, wie eine gebogene rote Peperoni, wenn sie den Mund verzog. Ihr Kinn war runder als früher. Und noch immer hatte sie eine Stirn, als könne man sich darauf einen Schnupfen holen.
Trotz des bunten Plastiks, der sich um ihren Kopf ringelte, strahlte sie eine brüchige Überlegenheit aus, die einen wahnsinnig machen konnte.
Sonne schickte Samuel nach hinten. Sie ging zur Eingangstür, drückte dem Taxifahrer zu dessen ungläubiger Freude ein weiteres fürstliches Trinkgeld in die Hand. Mit ernster Miene schob sie ihn in den Regen, drehte das Geschlossen-Schild nach außen und dachte an den Satz von Schopenhauer, wonach blauäugige Blondinen inmitten der überwiegend dunkelhaarigen und dunkeläugigen Menschheit eine Abnormität ausmachen, den weißen Mäusen analog. Sie setzte sich zu ihrer weißmausigen Besucherin. Ihr ganzes Dasein, korrespondierend mit der Vergangenheit, die in ihr aufstieg, sträubte sich gegen diese Begegnung.
»Was willst du, Jana?«
»Fragst du das auch die andern, die hier reinkommen?«
»Von den andern, die hier reinkommen, weiß ich das.«
»Ich will das Gleiche.«
Sonne blickte sie prüfend an.
Jana schien noch immer Ecstasy, LSD und Glaskapseln mit Amylnitrit im Kühlschrank zu haben. Oder wo auch immer. Offensichtlich hatte sie irgendwas eingeworfen. Etwas, das den Höhepunkt noch nicht erreicht hatte.
Diese Pupillen.
Drogen hatte sie schon früher in möglichst unangemessener Umgebung zu sich genommen. Das Mittagessen, das Mama immer für sie beide gekocht hatte, war oft garniert von Krümeln ihrer Halluzinogenpillen. Sonne sah plötzlich diese kleine, blau tapezierte Essecke in der Küche vor sich, an der sie stets nebeneinandergesessen und wie die Hühner gegackert hatten, während alles um sie herum so unwiderstehlich nach Harmonie duftete.
»Es gibt über tausend Bestatter in Berlin. Und du kommst ausgerechnet zu mir?«
»Ja klar.«
»Ich würde nicht zu dir kommen, wenn ich eine Ukulelespielerin bräuchte.«
»Aber Sonne, ich bin keine Ukulelespielerin.«
»Aha.«
»Das war einfach nur eine Nummer. Ein Sketch, weißt du? Ich mache Sketche. Klar, die Ukulele hat fünf Millionen Klicks bekommen oder so. Daher kennst du das Video wahrscheinlich. Aber ich kann gar nicht Ukulele spielen. Ich erzähle Witze. Das ist alles.«
»Ich würde auch nicht zu dir kommen, wenn ich dringend Witze bräuchte.«
Jana verwandelte sich in eine ihrer TV-Parodien, die Honky-Tonk-Jana, schnippte mit den H-A-T-E-Fingern und summte: »Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside, two trailer park girls go round the outside, woo!«
Sonne sah sie mit unbewegter Miene an.
Janas Haut war ganz durchsichtig, keine Schminke. Wirklich gute Haut, trotz der Drogen. Sie wäre eine schöne Leiche. Ob sie wohl das Kettchen noch hatte?, dachte Sonne. Das Kettchen von ihrer Oma mit dem Kreuz dran?
Wenn es ihr sehr schlecht ging, hatte Jana dieses Kettchen stundenlang in der Faust behalten. Selbst beim Sport. Sogar beim ersten Sex hatte sie diese Faust geballt, und nur Sonne wusste, was sie darin umschloss, ganz im Gegensatz zu dem Typ, der sie vernaschte. Schmuck kann man verfeuern, auch das Kettchen, falls es das noch gab, sogar die grässlichen Ohrringe. Also hätte man Jana so, wie sie war, ins Krematorium fahren können, samt Lockenwicklern und all den schrecklichen Klamotten. Sie würde gut brennen.
»Steht dir super, diese Brille«, sagte Jana und beendete ihre kurze Gesangseinlage.
»Danke.«
»Macht dich irgendwie weise.«
»Ich kann dir einen Kollegen empfehlen. Nicht weit weg von hier.«
»Ja, aber den ganzen Wahnsinn kannst nur du übernehmen«, erklärte Jana, die ihre Schultern hob wie eine flugunfähige Möwe, um Invalidität zu simulieren.
»Ist dir nicht klar, dass du hier nicht willkommen bist?«, fragte Sonne kühl.
»Schon. Aber müssen so Leute wie du nicht helfen, wenn man in Not ist? Ich meine, ist das nicht … ist das nicht ethisch geboten?«
»Du willst mir was von Ethik erzählen? Dein Ernst?«
»Es gibt den hippokratischen Eid.«
»Ja, für Ärzte.«
»Eben.«
»Wenn ich Ärztin wäre und du hättest eine Schusswunde im Bauch und ich müsste dich operieren, damit du nicht verblutest, dann wäre ich in der Tat verpflichtet, das zu tun.«
Jana blickte Sonne besorgt an. »Du willst sagen, du bist keine Ärztin?«
»Genau. Ich bringe Leute unter die Erde. Ärzte machen das Gegenteil. Mein Beruf ist weniger geschützt als der einer Bratwurstverkäuferin.«
Sie schüttelte den Kopf.
»Ich bin ganz bestimmt keine Ärztin.«
»Aber mir geht es sehr schlecht, und ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann. So wie früher.«
»Ich bin auch ganz bestimmt nicht so wie früher.«
»Da drin ist so viel Wut, Spätzchen«, flüsterte Jana bekümmert und zeigte auf Sonnes im Schatten liegenden Kopf, der ihr inmitten des psychedelischen Sturms, der hinter ihrer Netzhaut aufzog, wie eine afrikanische Kriegermaske vorkam.
Sonne hörte, wie Samuel drüben im Büro ans Telefon ging. Die Anfragen. Die Aufträge. Diese alte Plattitüde, dass das Leben weitergeht. Und auch das Sterben.
Sonne erhob sich, um ein Signal auszusenden. Sie stellte sich vor Jana auf und versuchte, den Abschied einzuleiten.
»Wir helfen Leuten, die wir mögen, Jana.«
»Du hättest Said gemocht.«
Ein Blitz schlug in der Nähe ein. Im selben Augenblick krachte die Straße, und die DDR-Brezel klirrte in ihrer Scheibe.
»Du hättest ihn ganz bestimmt gemocht, weil er mich nicht mochte.« Jana erhob sich nicht. Sie blieb trotzig sitzen und hörte zu, wie der Donner ausrollte. Sie würde auch sitzen bleiben, bis das ganze Unwetter vorbei wäre und noch ein weiteres halbes Jahr, dachte Sonne.
Diese unerträgliche, unveränderte Sturheit.
Sonja Meling kratzte mit ihrem Daumen leicht über die Kehle. Ihr war klar, dass sie Samuel nicht zu rufen brauchte. Der war mental nicht in der Lage, einer verloren wirkenden Frau Anfang vierzig die um die Stuhlbeine gekrallten Finger zu brechen, sie hochzuhieven und hinaus in das Gewitter zu werfen.
Sie ließ die Hand sinken, stemmte sie in die Seite und versuchte, das Geräusch ihres nervösen Atems zu dämpfen.
»Ich muss jetzt weitermachen.«
»Bitte setz dich, Sonne.«
»Jana!«
»Bitte setz dich. Das hätte dein Vater auch gesagt.«
»Lass meinen Vater aus dem Spiel.«
»Das hat er immer gesagt. Erst mal hinsetzen und zuhören. Das hat er gesagt, wenn er seine Märchen vorgelesen hat. Immer. Bitte!«
3
Also gut.
Dann fange ich mit dem Ende an. Dem Anfang vom Ende. Mir ist etwas blümerant. Etwas scheiße sozusagen. Aber ich krieg’s schon hin.
Der Anfang vom Ende begann, als ich nach einer Party morgens splitterfasernackt im Bett aufwachte. Und irgendwas war anders. Ungewohnt. Ich spürte ein Kribbeln auf der Stirn.
Erst hielt ich es für eine Fliege.
Da es keine Fliege war, dachte ich, ich hätte die Nachtcreme vergessen und meine Haut, die viel Nachtcreme braucht, würde einfach in ihren eigenen Worten nach Aloe vera rufen.
Aber als ich im Badezimmer die Zahnbürste in den Mund steckte, sah ich, dass mir jemand im Schlaf in blauer Schrift das Wort I-C-H auf die Stirn geschrieben hatte. Und zwar spiegelverkehrt. So konnte ich es ganz bequem im Spiegel lesen.
I-C-H.
Ich ließ die Zahnbürste sinken und sah weitere Schriftzüge auf meinem entblößten Körper. Keine Ahnung, weshalb ich dermaßen nackt war. Aber darüber dachte ich in dem Moment nicht nach. Stattdessen dachte ich darüber nach, wieso auf der mopedkennzeichengroßen Stelle zwischen Schlüsselbein und meinen Brüsten das Verb W-I-L-L stand. Und auf meinem Bauch las ich W-E-K.
Ich rieb an dem peinlichen K, das aber aus wasserunlöslicher Farbe bestand.
ICHWILLWEK.
Ich hasse die Orthografieprobleme meines Mannes.
Also ging ich immer noch so was von unbekleidet ins Büro hinüber. Ich fand auch gleich den blauen Edding, den er auf den Schreibtisch gefeuert hatte. Also war ich nicht faul, nahm den Stift, strich das K durch und ersetzte es durch ein etwas windschiefes G. Und weil noch viel Party und Irritation in mir steckten, bemerkte ich nicht, dass es elf Uhr war und unsere Putzfrau Krystyna bereits am Boden kniete, um die Dielen zu wischen. Aber nun wischte sie natürlich nicht, sondern saß da wie diese Sandskulpturen, du weißt schon, und starrte mich leicht rieselnd an, wie ich einen neuen Buchstaben auf mich draufmalte.
ICHWILLWEKG.
Sie blickte von schräg unten und versuchte, mir wie ein Kaninchen ununterbrochen in die Augen zu schauen und sonst nirgendwohin.
Ich fragte sie, ob noch irgendwas auf meinem Rücken stand, auf Polnisch vielleicht, oder doch eher auf Arabisch, oder ob jemand eine Maori-Schildkröte auf meinen Allerwertesten gemalt hatte, um mir Fruchtbarkeit, Frieden und ein langes Leben zu wünschen.
Ich drehte mich um und spürte, dass sie hinter mir meine bemalte oder unbemalte Blöße betrachtete.
Krystyna ist Polin und sehr katholisch, noch viel katholischer als meine fromme Oma, und sie hat mir mal gesagt, dass man Dämonen daran erkennt, dass sie keinen Rücken haben, weshalb sie einem immer nur die Schauseite zeigen. Vielleicht dachte sie ja, dass ich keinen Rücken habe. Ich hörte sie nicht atmen und hörte sie doch atmen, und ich war froh, dass ihr für 138 Kilogramm Lebendgewicht ausgelegter Atem nicht meine Haut erreichte.
Also von der eigenen streng katholischen Putzfrau am nackten Gesäß angepustet zu werden, ich weiß nicht. Es war sicherlich völlig verrückt und beschämend. Ich war eigentlich noch gar nicht bei mir. Ich träume immer weit über das Erwachen hinaus, und irgendwas in mir braucht eine Ewigkeit, um zu begreifen, was gerade los ist.
Krystyna händigte mir später ihren Schlüssel zu unserer Wohnung aus. Sie wollte wohl so etwas nie wieder erleben müssen.
Vielleicht wollte sie mich auch nie wieder weinen sehen oder schreien hören. Beides tat ich ausgiebig, während ich die Buchstaben mit ATA-Scheuerpulver abschrubbte, bis die Haut zu bluten begann.
Aber ich schweife ab.
Said wollte also weg, obwohl er für gewöhnlich das Durchhaltevermögen einer städtischen Kanalisation hatte. In jeder Form war er einer der anpassungsfähigsten und sanftesten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Und es gab eine Zeit, da habe ich ihn sehr geliebt.
Du musst dir vorstellen: Dieser Mann schaffte es, sich über seine, sagen wir mal, betrunkene, schnarchende, psychisch defekte, gelegentlich untreue und delirierende Ehefrau zu beugen wie über eine Porzellantasse – und in dieser unbequemen Haltung wartete er womöglich stundenlang darauf, dass sich die Tasse auf den Rücken dreht. Denn nur in dieser Position wollte er sie partiell beschriften (anstatt sich an sie zu schmiegen, sie zu beschützen und zu inhalieren, was ich mir lange Zeit gewünscht habe).
Als wir uns vor vielen Jahren kennenlernten, war Said nicht jener Glenn-Gould-Klon, für den er sich später halten sollte. Sondern er war ein mittelloser Immigrant. Ein No-Name-Pianist aus Damaskus, der einfach in der Band unserer Show saß und My Funny Valentine intonierte, wenn es von ihm verlangt wurde.
Ich denke schon, dass er einen Teil seiner nicht allzu steilen Karriere mir zu verdanken hat, jedenfalls jenen Teil, der auf Banketten und Stehpartys geschmiedet wird, aber das ist egal.
Man weiß erst, was man empfindet, wenn es zu spät ist. Das hört man ja immer wieder, und es ist wahr.
Mir ging es, als wir uns zum ersten Mal begegneten, nicht gut. Mir ging es sogar kacke. Ich spürte, dass ich am Ende einer persönlichen Epoche stand, die über das bloße Ende meiner Rolle als Sidekick eines unglaublich minderbemittelten, selbstverliebten Moderatorenarschlochs im Entchenkostüm hinausging. Er hatte mich rausgeschmissen. Und der einzige Grund war, dass ich witziger war als er.
Ich galt aus Sicht der Branche noch als umhertreibender Straßenmüll, junges Nachwuchsunkraut, jederzeit ausrottbar. Und irgendwo fand am Abend des Rausschmisses eine Party statt, voll mit Pseudofreunden und geheucheltem Mitleid.
Vielleicht vermisste ich irgendjemanden, der mir Halt geben konnte. Vielleicht vermisste ich Tiefe.
Nicht, dass ich glaube, besonders tief zu sein, aber ich mag gerne Leute, von denen ich denke, dass sie es sind.
Jedenfalls fühlte ich mich isoliert und provinziell und sah um mich herum nichts anderes als imperiale Paare. Das Leben schien hoffnungslos. Ich leerte sieben Gläser mit Getränken aus unterschiedlichen europäischen Weinanbaugebieten und arrangierte sie gemächlich vor mir zu einer Art Familienaufstellung.
Und als ich dann hackedicht durch die herbstliche Nacht stromern wollte, kam mir im Hausflur ein leuchtender Schatten entgegen, in dem ein weiches Lächeln glomm. Ein Lächeln, das mich an dich erinnerte, Sonne. Weil es so ernst war. Und so hilfsbereit. Und ein ganz klein wenig unerklärlich. Und ich hatte solch eine Sehnsucht, gegen die ich mich nicht wehren konnte, und ich dachte, wenn jemand so sehr in deinem Lächeln wohnt, dann muss es da auch noch andere Zimmer geben, die ich betreten möchte.
Anscheinend bin ich genau in dem Moment umgekippt, jedoch nicht, ohne zuvor in das Lächeln hineinzuküssen.
Das war Said.
Said war nicht Mubi, falls du das glauben solltest. Aber dennoch hatte ich Angst, dass sich die Wunde, die Mubi vor Jahren gerissen hatte, schnell wieder mit Blut füllen könnte. Ich weiß, dass du nicht an Mubi erinnert werden möchtest. Aber Said war nicht Mubi, auch wenn er Palästinenser war und dieselbe Gabe wie unser alter Freund hatte, es sich eher in der Sehnsucht häuslich einzurichten anstatt im wirklichen Leben.
Said kam aus Syrien, nicht wie unser alter Freund aus dem Libanon. Er war Musiker, nicht Schauspieler. Er war wundervoll, wenn er in den Regen lachte. Aber er verstand keinen Spaß mehr, sobald er Bach spielte.
Manchmal sagte er, in ihm sei viel Rauch. Er sagte auch noch viel rätselhaftere Dinge.
Er liebte es, von morgens bis abends Dinge zu lernen. Er lernte, Roggenbrot von Weizenbrot zu unterscheiden, und er lernte, meine selbst induzierten, eigenhändig präparierten Vollkatastrophen aufzufangen und in lange, verständnisvolle Erörterungen beim Italiener umzudekorieren. Er lernte Deutsch, und er lernte Auto fahren, vielleicht nicht gut genug, wie man jetzt befürchten muss.
Aber er gab niemals Versuche auf. Versuche waren Versuche, die irgendwann gelangen, und wenn sie nicht gelangen, wurden sie fortgesetzt. Ad infinitum.
Das Gelingen fand er widersprüchlicherweise überschätzt. Aber vielleicht sagte er das nur, um sich zu schützen. Er hatte Angst vor dem Versagen – und das als Pianist, dem an den Tasten einfach alles gelang. Er fand, dass das Unglück sehr zur Bereicherung des Menschen beiträgt. Dennoch mochte ich so sehr, wenn er ab und zu Glück ausdünstete.
Er wollte immer viel mehr Küsse haben, als er brauchte, und eine ganze Zeit lang bekam er die auch. Ich muss schon sagen, wir wurden von der Liebe wie von einem heißen Schraubstock umklammert, mindestens drei Jahre lang.
Wie du früher trug auch Said gerne Kleidung von mir. Du kannst dir nicht vorstellen, was für ein schmales Hemd er war. Ständig streifte er sich meine Kapuzenpullover über, obwohl er selber Kapuzenpullover hatte. Er mochte meinen Geruch, sagte er, und er mochte meine Seife. Obwohl ich wirklich keine Nilpferdstatur habe, wirkte er noch zierlicher als ich in dem Zeug. Er bewegte sich anders als du, jedenfalls wenn er schlenderte oder gemessen ausschritt. Wenn er aber zu rennen anfing, dann hatte er die gleiche Art wie du, die Finger zu spreizen beim Sprint.
Und er war immer in allem der Bessere, so wie auch du immer in allem die Bessere gewesen bist.
Aber ich war die Erfolgreichere, weshalb mich die meisten für die Bessere hielten.
Oder sogar für die Beste.
Das ist voll tragisch.
Jetzt, wo Said tot ist, denke ich natürlich in diesem brodelnden Gehirnrest darüber nach, was Erfolg überhaupt bedeutet. Aber wenn alle am Leben sind und wenn daher das Leben keinen Wert zu haben scheint, weil man es gewissermaßen umsonst bekommt und ohne Begrenzung, wird Erfolg, der immer einen Preis hat, mindestens den der Anstrengung, nicht hinterfragt. Mir jedenfalls geht es so.
Mein Erfolg, also mein wirklicher Erfolg, begann tatsächlich erst, nachdem ich Said kennengelernt hatte. Und das ist absonderlich, weil Said eben ein eher jenseitiger junger Mann war, womit ich sein Riesenreservoir an Zärtlichkeit und Tränen, verbunden mit einer Überdosis Selbstmitleid, nicht diskreditieren möchte. Er war auch nicht hypochondrisch veranlagt. Das bin eher ich. Auch verträumt war er nicht, dafür aß er viel zu systematisch.
Aber sein Geist steckte doch eher in den Wolken, ganz oben, wenn du weißt, was ich meine. Ganz oben.
Also zum Beispiel:
Ich mochte Partys.
Er mochte Beerdigungen.
Ich liebte den Frühling und den Sonnenschein.
Er liebte den Herbst und den Sonnenschein – den Sonnenschein aber nur, weil er in Syrien geboren wurde.
Ich fand es schön, wenn ich die Menschen mit Seifenblasen ablenken konnte, ein Feuerwerk für sie abbrannte, sie sich den Bauch hielten vor Lachen, den ich durch eine letzte Pointe wie einen Luftballon mit einer Nadelspitze zum Platzen brachte.
Er hingegen hasste Luftballons, Seifenblasen, Feuerwerk. Obwohl er beachtlich fand, dass die Chinesen das Schwarzpulver immerhin nur erfunden hatten, um die Nacht zu illuminieren und die Geister zu vertreiben.
Said hat sich immer gerne auf Friedhöfen herumgetrieben. Er hätte sich bestimmt in seine Bestatterin verliebt, vor allem in eine wie dich, Sonne, die so viel Wert auf Details legt, so wie gewisse Krankenschwestern ebenfalls viel Wert auf Details legen, weshalb er sich auch in Krankenschwestern schnell verschoss, aber blöderweise auch in mich, gewissermaßen das Gegenteil einer Krankenschwester.
Für ihn waren alle Menschen von Natur aus verstimmt, wie Instrumente.
Vielleicht konnte er es deshalb so lange mit mir aushalten, weil ihn falsche Töne nicht gleich wegtrieben, sondern anspornten.
Aber ich, weißt du, ich sehe Menschen vor allem als Publikum.
Na ja, natürlich nicht, das ist Blödsinn. Said aber war dieser schrecklichen Ansicht, und die war natürlich verletzend, zumal er sie trotz seiner sonstigen klösterlichen Schweigsamkeit auch immer äußerte, weil er immer alles äußerte, anders als ich, die ja nicht alles äußert.
Während er neben mir immer trauriger wurde und selbst in den Augen der regionalen Musikkritik zu einem »misanthropischen Lüstling« in seiner Interpretation von Beethovensonaten zusammenschrumpfte, bekam ich zwei Grimme-Preise, den Deutschen Comedypreis und um ein Haar auch ein Kind von einem amerikanischen Rockstar, wobei das weiß Gott keine Auszeichnung gewesen wäre.
Es war ein einziges Desaster.
Es fiel uns beiden schwer, mir zu vergeben.
Ich will mich wirklich nicht verteidigen. Sicher trifft mich die größte Schuld.
Aber immer wieder vorgeworfen zu bekommen, banal zu sein, oberflächlich zu sein, kein Licht der Erkenntnis, sondern eine Art Parkplatzbeleuchtung für im Dunkeln abgestellte Kleinsthirne zu sein, das zermürbt einen, zumal wenn es von jemandem geäußert wird, dessen Miete du mit all deiner Banalität erwirtschaftest.
Einmal sagte mir Said, ich erinnere ihn an einen Schweinekopf. Einen Schweinekopf mit geschlossenen Augen, der in der Auslage einer Schlachterei läge, und mit meiner heraushängenden Zunge berührte ich den Kranz der obszön um mich herumliegenden kleinen armen Würstchen, und das seien meine Fans.
Ich meine, er sagte das als Muslim, der einen Schweinekopf noch einmal ganz anders liest als Frau Kubitschek aus Gelsenkirchen.
Natürlich stritten wir uns. Wir liebten uns noch, aber wir stritten uns fürchterlich. Wir spritzten einander Gift in die Augen und in die Arterien, und irgendwann besuchte ich auch seine Konzerte nicht mehr, weil die Leute um mich herum ihn andächtig anglotzten, aber mich um Autogramme baten.
Und ehrlich gesagt, und das mag eine berufliche Deformation sein: Ich halte eine Ansammlung von Menschen, die einer künstlerischen Darbietung beiwohnen und weder gemeinsam lachen noch gemeinsam weinen, sondern einfach nur still und konzentriert dasitzen, als wären sie alleine auf dem Klo, nicht für ehrfürchtig Staunende, sondern für Kretins.
Noch nie hat mich irgendjemand stumm angestaunt. Aber deshalb ist das, was ich tue, noch lange nicht die Müllabfuhr.
Um unsere Ehe zu retten, versuchten wir einiges. Wir zogen auch eine Paartherapeutin zurate, die uns aber nur erzählte, wie entsetzlich sie von ihrem Mann behandelt wurde und dass Männer zwar keine schlechteren Menschen seien als Frauen, aber bessere Monster.
Das brachte uns einander auch nicht näher.
Saids Vorschlag jedoch, einfach ein Kind in die Welt zu setzen, hielt ich für geisteskrank. Für komplett gestört.
Ich meine, eine Schwangerschaft hat doch noch nie eine poröse Beziehung stabilisiert, oder? Und ein Kind mit jemandem, der Lust und Strafe für das Gleiche hält? Der im Scheitern Freude verspürt? Und jede andere Freude unerträglich findet? Dein Ernst?
Ehrlich gesagt wollte ich auch keinen Nachwuchs haben. Noch nie. Schon damals in der Schule kam uns das absurd vor. Weißt du noch, wie wir über Frau Teckenheim gelacht hatten, die Mathelehrerin? Sie erklärte uns mit ihren schlafenden Zwillingen im Kinderwagen Trigonometrie und ließ sich zwischendrin immer hinter der Tafel ihre Brüste leer nuckeln.
Und was ich erlebt hatte mit meinen Eltern, muss ich dir nicht sagen.
Du weißt das am besten.
Es war der Horror.
Ich hatte einfach Angst.
Said jedoch wollte unbedingt das Kind. Er wünschte es sich so sehr, so inbrünstig. Zu Weihnachten schenkte er mir das Buch »Erziehen ohne Schimpfen«, eingepackt in UNICEF-Geschenkpapier. Auch ein ernst gemeinter Strampelanzug lag daneben, rot-gelb gestreift, sodass mein Kind darin wie eine giftige Made ausgesehen hätte.
Es war wirklich krank, und ich war unendlich unglücklich und stürzte mich mithilfe verschiedenster Substanzen in meine eigene Blutbahn, um durch mich durchzufließen.
Said ließ keine Sexualität mehr zu, sondern verbarrikadierte sich vor mir.
Oft, wenn ich in der Nacht aufwachte, saß er unserem Bett gegenüber auf der Stuhlkante, den glasigen Blick auf mich gerichtet, und schüttete unislamische Getränke in sich hinein. Wahrscheinlich überlegte er damals schon, wie er mich anmalen könnte.
Er sah aus wie das letzte Blatt an einem Baum.
Seine Haut bekam die Farbe von Karamell (tagsüber) oder von zwei Jahre altem Karamell (nachts), und er sagte zu mir, ich sei keine Frau mehr für ihn, weil ich nicht die Mutter seiner Kinder sein wolle.
Das Schlimmste aber war: Er hörte auf zu komponieren. Er hörte sogar auf, Klavier zu spielen.
Und es stieg die Ahnung in mir hoch, dass schreckliche Dinge geschehen würden.
Und die geschahen dann auch.
Weißt du, Sonne, ich plaudere hier vielleicht lustig vor mich hin, aber innerlich sieht es anders aus.
Nachdem mich Said an jenem fatalen Morgen mit großer Sorgfalt und unter Zuhilfenahme eines blauen Edding-Textmarkers hatte wissen lassen, dass er auf der Flucht war, schnitt ich mir am nächsten Morgen kurz vor Aufzeichnungsbeginn im Studio den Arm ab.
Also na gut, der Arm war nicht ab. Denn mit einem Teppichmesser kann man sich gar nicht den Arm abtrennen. So ein Knochen lacht ja nur über ein Teppichmesser. Aber schau es dir an. Hier unten, die Narbe. Ich habe die Augen zugemacht und gesägt. Ich wollte irgendwas spüren. Der Schnitt ging tief. Er musste mit vier Stichen genäht werden, und ich blutete und blutete und kam ins Krankenhaus, und es erschien auch ein Foto in der BILD-Zeitung, und die Ausfallversicherung weigerte sich, die Kosten für die entstandene Drehunterbrechung zu übernehmen, wegen angeblicher Vorsätzlichkeit meinerseits. Der Sender wollte später 120000 Euro Schadensersatz haben. Von mir. Das muss man sich mal vorstellen. Es war der Schlussakkord der RTL-Mond-Schein-Show.
Einige Tage später bat ich meine Freundin Ying Shu, sich mit Said zu treffen und ihn vor meinem bevorstehenden Selbstmord zu warnen. Ich hoffte, dass er zurückkommt. Dass er sich um mich kümmert. So wie er das immer gemacht hatte. Irgendwie fand ich, dass das sein Job war in unserer Beziehung, mich zu retten.
Ying Shu war auch meine Psychologin, seit Jahren schon, und ich war sicher, sie würde die richtigen Worte finden. Mein Gott, ich glaube, er hat mich gerade wegen meines heimlichen Talents zum Suizidieren so sehr geliebt, das glaube ich wirklich.
All dies geschah vor einem Jahr, und danach begann erst die Hölle auf Erden.
Wenn ich Ying Shu nicht gebeten hätte, sich mit Said zu treffen, noch dazu in unserem Lieblingsrestaurant, einem Inder in der Oranienburger Straße, ich bin sicher, dass sie noch leben würde. Und Said auch noch.
Aber sie bestellten sich fatalerweise beide Chicken Makhani, mein Lieblingsgericht, bei dem ein Hühnchen in einer milden, cremigen Currysoße mit viel Butter und Tomaten gekocht wird.
Und vielleicht bestellten sie das Gericht aus Taktgefühl, da das Hühnchen auf dem Teller ja keine Knochen mehr hatte und sie deshalb nicht zwangsläufig auf meinen angesägten Unterarm zu sprechen kamen, was zum Beispiel beim Paulaner Bräu schräg gegenüber, wo man jedes Hühnerflügelchen einzeln abnagt und an den Spitzen krachend zwischen den Kiefern zermalmt, nicht zu vermeiden gewesen wäre.
Weil das Chicken Makhani ihnen aber auf der Zunge zerging, sie kein Fleisch zerschneiden mussten und daher auch keine Assoziationen an Teppichmesser in ihren Köpfen explodierten, konnten sie mein Leid aus diesem Abend gänzlich heraushalten. Und meine Abwesenheit in Verbindung mit Kerzenschein und den Ganesha-Skulpturen in den Restaurant-Nischen, deren Elefantenrüssel Stärke und Sensibilität und auch eine gewisse Erektionsfreude symbolisierten (denn ich kenne keine Frau, die nicht an einfühlsame Penisse denkt, wenn sie einen Elefantenkopf sieht), führten am Ende dazu, dass sich Said und Ying Shu furchtbar ineinander verliebten.
Als sie so frisch verliebt in der Nacht auseinandergingen oder besser gesagt auseinanderschwebten, glaubten sie, innerlich zerrissen, wie sie beide waren, den Menschen ihres Lebens gefunden zu haben.
Jetzt stecke ich, während ich dir von diesem Irrwitz berichte, gedanklich in Deggendorf fest. In diesem Drecksbayern unserer Kindheit. Ich schaue in unsere Träume von damals, in unsere Ängste und Fragen und in unsere tiefen Gefühle. Und ich glaube nicht, dass irgendwas von dem, was mir widerfahren ist, damals schon vom Grund des Deggendorfer Sees aufschimmerte, in dem wir unsere Sommer wegschwammen und wegdösten.
Das Dunkle habe ich mir selbst auferlegt, aber ich habe es auch meinen liebsten Menschen auferlegt: mit einer schlechten Idee, einem falschen Restaurant und einer fatalen Speise, die, obwohl ich sie nicht gewählt habe an jenem Abend, doch mit mir und meinem Gaumen verbunden ist, so als wäre meine persönliche Vorliebe für indische Gewürze ein Auslöser für diese Katastrophe gewesen. Denn eine Katastrophe ist es, eine Dunkelheit der Welt, die ich, im Gegensatz zu einigen anderen Dunkelheiten, die mir und nur mir widerfahren sind, nicht erhellen kann.
Doch die Dunkelheit zwischen uns, die kann ich noch erhellen, und die will ich auch erhellen, und deshalb bin ich hier, liebe Sonne, liebe alte Sonne, meine unendliche hippokratische Freundin.
Und ich bitte darum, dass du dich um Said und Ying Shu kümmerst, denn niemand anderen als dich wollen sie und brauchen sie für ihren letzten Gang.
4
Das Grau wurde heller. Die Straße. Die Häuser. Die Fenster. Es hatte aufgehört zu regnen.
Die beiden Frauen waren wie in Stein gemeißelt. Alabaster die eine. Die andere eher wie aus rotem Sandstein, an dem ein Vorhang aus hin- und herschwingendem Efeu hing. Das war das wenige an Sonne, das sich bewegte: zwei Stirnlocken, als sie den Kopf hob und wieder senkte, um zu sprechen. Aber dann sprach sie doch nicht.
Draußen flogen zwei kreischende Kinderstimmen am Laden vorbei. Das Signalgelb ihrer Anoraks blitzte von links nach rechts quer über das Schaufenster und war schon wieder verschwunden. Die Kinderstimmen verebbten, und man hörte nur noch den gedämpften Strom der Worte aus dem benachbarten Office.
»Wieso redet dein Freund so viel?«, fragte Jana zögernd.
»Er telefoniert. Und Samuel ist nicht mein Freund.«
»Und wieso klingt er so aggressiv?«
»Er spricht mit der Friedhofsverwaltung. Da klappt nichts.«
Der Alabaster nickte stumm, beladen von den beiden Toten, die in Gestalt ihrer Namen Said und Ying Shu langsam aus dem glatten Stein hinausglitten, ihn dadurch aufweichten.
»Dass man so viel telefonieren muss in deinem Beruf«, sagte der Alabaster. »Fast wie beim Fernsehen.«
»Kann sein.«
»Er hat eine gute Stimme.«
»Ja«, sagte Sonne.
»Eine Stimme für die Abendnachrichten. Oder fürs Wetter.« Janas eigene mineralisch feste Stimme brach. Sie wollte es nicht wahrhaben. »Du stehst doch so auf Stimmen, oder? Dieser kleine, heisere Engländer damals? Hieß er Jim?«
»Jana?«, sagte Sonne leise.
»Was?«
»Ich verstehe nicht, was passiert ist.«
Jana wendete den Blick nach draußen. Der aufklarende Himmel diffundierte durch das Schaufenster in Sonnes Sterbe-Biotop hinein. Sie war kein Alabaster mehr, nicht einmal Geröll oder Kies. Sie verflüssigte sich.
»Hörst du mich, Jana? Ich verstehe es nicht.«
Jana beugte sich nach vorne, als sie überlief. Ihr Rücken begann zu wogen beim Schluchzen. Sonne sah, wie ein Tropfen Flüssigkeit auf die Dielen fiel. Und noch einer.
»Was – verstehst – du – nicht?«, stieß Jana hervor.
Sonne wusste nicht, ob es Tränen waren oder irgendwas aus Janas Nase, was den Fußboden benetzte. Sie stand auf, blickte aus dem Brezelfenster, sah den nassen Asphalt. Wie gerne würde sie jetzt auf diese Straße gehen, in die Pfützen springen, auf Autodächer steigen und der Zeit und dem Ort entkommen.
Sie seufzte, machte zwei Schritte nach vorne zum Tisch, zupfte frische Taschentücher aus der Packung, kehrte zurück, reichte sie Jana.
»Weshalb sind die beiden gestorben? Was ist passiert?«
»Ach ja – immer – das Wichtigste – zuerst.«
Jana faltete eines der Taschentücher auseinander, achtsam, als könnte ein verborgenes Geschenk herausfallen. Sie wurde ruhiger.
»Du bringst es natürlich – gleich auf den Punkt. Ich quatsche und quatsche, und du – siehst gleich die schwache Stelle. Du bist genial. Ich habe das immer sehr bewundert, dass jemand, der keinen Piep sagt, so klug sein kann.«
»Willst du es mir nicht sagen?«
»Doch, schon. War ja kein Verbrechen.«
»Da bin ich froh.«
»Spinnst du? Glaubst du, ich könnte jemanden umbringen? Ich versau mir doch nicht den Wikipedia-Eintrag.«
»Gut.«
»O Mann«, keuchte Jana verzweifelt auf, »was für ein scheiß Scherz. Entschuldige. Ich bin das Letzte, echt jetzt.«
Sie hielt das quadratische Taschentuch wie einen riesengroßen Schmetterling und schnäuzte vorsichtig hinein, um ihm fast huldvoll ihr Nasensekret zu schenken.
»Es war wie bei meinen Eltern.«
Sonnes Blick sog sich voll mit Ungläubigkeit.
»Im Auto?«
»Ja. Nur kein Baum, sondern ein ganzer Wald.«
Sonne stöhnte leise auf. Sie fuhr sich mit den Fingern durch die krautigen Haare.
»Vor einer Woche. In meinem Tesla. Deshalb musste ich jetzt mit dem Taxi kommen.«
»Ich dachte, ein Tesla kann gar nicht verunglücken?«
»Keine Ahnung, ob es ein Unglück war. Also ein Unglück im engeren Sinne vielleicht nicht. Sie suchen gerade nach Bremsspuren. Und checken den Autopilot, ob er an war. Und forschen nach, ob irgendwelche seltenen Wanderkröten traumatisiert wurden durch den Vorfall, was weiß ich. Bei den Carabinieri kann das Jahre dauern.«
»Wir reden von Italien?«
Jana bestätigte Italien mit einem Blick, während sie den Schmetterling in die Tasche steckte und ein zweites Taschentuch öffnete. Taschentücher schienen einen dämpfenden Einfluss zu haben. Sie beruhigte sich langsam.
»Toskanische Bergstraße. Einsam. Keine Leitplanken. Der Wagen schoss über die Klippen. So.« Sie zeigte es mit ihrer flachen, taschentuchlosen Hand, die in einem Bogen nach vorne flog, bis der Arm ganz gestreckt war. »Wie in einem James-Bond-Film.« Die Hand sank herab. »Leider öffnete sich kein Fallschirm oder irgendeine Geheimwaffe. Sie krachten mitten in ein Naturschutzgebiet. Die Pinien oder Zypressen oder was weiß ich brannten zwei Stunden. Was da halt wächst. Ein Hubschrauber mit Löschwasser kam sogar geflogen. Aber das Wasser traf einen der Polizeiwagen und spülte ihn den Hang hinunter. Da muss viel los gewesen sein. Ein richtiges Spektakel.«
Sie seufzte traurig und begann, sich mit dem zweiten Taschentuch die Wangen trocken zu reiben.
»Das heißt, die beiden sind noch in Italien?«, fragte Sonne.
»In Florenz, ja. In einem Kühlraum. Aber immerhin Florenz. Dieser weiße Marmortyp vor dem Palazzo Vecchio, dieser nackte David mit der krass naturalistischen Vorhaut, den hat Leonardo da Vinci ja echt super hingekriegt.«
»Michelangelo?«
»Michelangelo, genau. Was du immer weißt, Sonne. Die volle Kunstkennerin. Der David von Michelangelo. Voll Saids Ding.«
»Die Überführung könnte kompliziert werden.«
»Ja. Ich freu mich schon darauf, wenn dein Freund die Italiener anschreit.«
»Er ist nicht mein Freund. Und wir können diesen Auftrag nicht übernehmen, Jana.«
Janas Blick glich einem Erdrutsch.
»Aber das ist doch kein Auftrag.«
»Die Anfrage.«
»Es ist mein rausgerissenes Herz, liebe Sonne. Das liegt vor dir. Das kannst du doch nicht einfach so in Streifen schneiden.«
»Es ist nicht möglich. Leider. Wirklich furchtbar, was geschehen ist. Aber ich schaffe das nicht.«
»Ich verstehe schon«, erwiderte Jana mit Eiter in der Stimme. »Du magst mich nicht mehr, und du hast völlig recht.«
»Jana, hör auf.«
»Aber du willst mich doch mögen, oder? Ich hab es gerade so nötig, gemocht zu werden.«
»So wie ich das sehe, wird die Presse hinter dir her sein. Dein Sender wird sich einschalten. Irgendwelche Leute werden hier rumlungern. Aber …« Sie hielt einen kurzen Moment inne, gerade lange genug, um sich darüber klar zu werden, wie sie Jana das Märtyrerinnenhafte nehmen könnte. »Aber ich würde dich an Becks vermitteln. Was denkst du, Samuel? Wäre das was für Becks?«
Ihr Mitarbeiter war gerade aus dem Office getreten. Er kratzte sich am Kopf, durch die Wolle des Kutterfischermützchens hindurch, lehnte sich an die Laibung der Schiebetür wie ein Speer. Er wirkte empfänglich, und Sonne hasste es, wenn er empfänglich war und gleichzeitig der Speer. Sein Blick wurde dann so sanftmütig, das grenzte schon an Debilität, und gleichzeitig schwoll sein Eigensinn.
»Becks macht doch viele Promis, nein?«, setzte sie nach.
»Ich will mich nicht einmischen, Boss.«