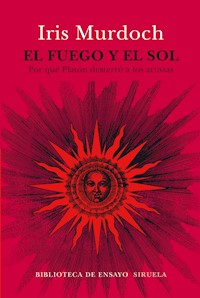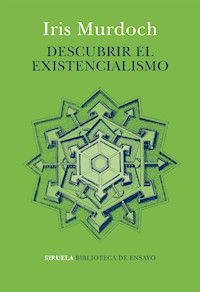16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In diesem nun erstmals in deutscher Übersetzung vorliegenden Klassiker der Philosophie des 20. Jahrhunderts offenbart Iris Murdoch die Unzulänglichkeiten der analytischen Moralphilosophie und fordert einen Richtungswechsel. Wir können Moral nicht verstehen, wenn wir uns rein auf naturwissenschaftliche und sprachphilosophische Methoden beschränken. In Auseinandersetzung mit Wittgenstein, Kant, Sartre, Weil oder Platon argumentiert Murdoch, dass die Moral nicht darin besteht, rationale Entscheidungen in einer wertneutralen Welt zu treffen. Stattdessen besteht sie in der Orientierung an der objektiven Idee des Guten, in der selbstlosen Zuwendung und der aufmerksamen Beobachtung der Wirklichkeit mit dem Ziel, ihr gerecht zu werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cover
Titel
3Iris Murdoch
Die Souveränität des Guten
Aus dem Englischen und mit einem Nachwort von Eva-Maria Düringer
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Zur Gewährleistung der Zitierfähigkeit zeigen die grau gerahmten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Die Originalausgabe erschien erstmals 1970 unter dem Titel The Sovereignty of Good bei Routledge & Kegan Paul in London. Die Übersetzung folgt der Ausgabe von 2014 in der Reihe Routledge Great Minds mit einem Vorwort von Mary Midgley.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2023
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe der Bibliothek Suhrkamp 2023.
Originalausgabe© Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2023© 1971 Iris Murdoch© 2014 Vorwort, Mary MidgleyAlle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlag nach Entwürfen von Willy Fleckhaus und Rolf Staudt
eISBN 978-3-518-77455-7
www.suhrkamp.de
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Mary Midgley
:
Vorwort zur Routledge Great Minds Edition
Vorwort
1. Die Idee der Vollkommenheit
2. Über »Gott« und »Gut«
3. Die Souveränität des Guten über andere Begriffe
Eva-Maria Düringer
:
Nachwort zur deutschen Ausgabe
Danksagung
Namenregister
Fußnoten
Informationen zum Buch
3
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
7Mary Midgley
Vorwort zur Routledge Great Minds Edition
Viele Jahre sind vergangen, seit mir zum ersten Mal klar wurde, wie sehr sich doch Iris Murdochs Moralverständnis – gemeinsam mit meinem eigenen – von der gängigen ethischen Mode entfernt hatte.
In meiner Erinnerung durchflutet helles Mondlicht die St.-Giles- Straße, als Iris und ich nach einem anstrengenden Tag im Juni 1942 den Heimweg nach Somerville entlangstolperten. Wir waren beide am Ende unseres Studiums und erschöpft von den letzten Prüfungen. Hinzu kam, dass unser netter Tutor uns etwas Gutes tun wollte und uns eingeladen hatte, mit zwei höchst angesehenen Koryphäen zu Abend zu essen, und wir also den ganzen Abend lang ihren höchst angesehenen Meinungen gelauscht hatten. »Nun«, sagte ich, »was meinst du? Haben wir was Neues gelernt heute Abend?« »Oh ja, ich glaube schon«, sagte Iris, während sie zum riesigen Mond emporblickte. »Ja, ich glaube schon. X ist ein guter Mensch und Y ist ein schlechter Mensch.« Auf dieses korrekte, aber grotesk altmodische Urteil hin erfasste uns ein derartiger Lachanfall, dass sich die wenigen Passanten erschrocken umsahen und alle Katzen davonliefen.
Das Problem zu dieser Zeit war nicht nur, dass moralische Urteile dieser Art kontinuierlich angefochten und als bloße Gefühlsregungen oder leerer Idealismus abgetan wurden. Das Problem war auch, dass das innere Selbst, das solche Urteile vornimmt – die wesentliche Person, das aktive Selbst, das von zentraler Bedeutung ist –, irgendwie ignoriert und vergessen wurde. Angeblich moderne, angeblich wissenschaftliche Denkansätze waren bereits damals mit dem Versuch beschäftigt, das Vertrauen in unsere direkte Wahrnehmung unseres eigenen Lebens zu schwächen und die innere Evidenz, von der all unser übriges Wissen abhängt, in Verruf zu bringen. Wenn ich nun auf diese Zeit zurückblicke, so verblüfft es mich zu sehen, dass diese absurden Ansichten, die damals zur Unterstützung dieser Bemühungen herangezogen wurden – Ansichten, die Iris vor vierzig Jahren so wirkungsvoll auf den Punkt gebracht hat –, heute noch immer wachsen und gedeihen und noch immer als von der Naturwissenschaft gefordert betrachtet werden. 8Kein Geringerer als Francis Crick – Mr. DNA höchstpersönlich – hat kürzlich ein ganzes Buch mit dem Titel Was die Seele wirklich ist geschrieben, in dem er dafür argumentiert, dass das Selbst »nichts anderes als« das Verhalten von Nervenzellen und ihren assoziierten Molekülen ist. Während sich Akademiker:innen früher Sorgen machten, dass sie die zehn Gebote übertreten könnten, plagen ihre Nachkommen heute Schuldgefühle einer anderen Art: Wehe, wenn sie auch nur ansatzweise versucht sein sollten zu vermuten, dass irgendwo ein wirkliches Subjekt vonnöten sein könnte, um mit dieser aseptischen Welt von Objekten zurechtzukommen. Die Hoffnung, einen Zweig der Naturwissenschaften zu finden, der dieses Subjekt wegerklärt, behält die Oberhand gegenüber jeder schüchternen Tendenz, einfach zu akzeptieren, was unsere Vermögen uns mitteilen. Und so schreibt uns die aktuelle Mode noch immer vor, dass die wirkliche Komplexität des Selbst ungeprüft bleibe.
Iris hingegen kümmerte sich nie um Moden. Das ist es, was Die Souveränität des Guten so gut macht – was es noch immer zu einem der wenigen modernen philosophischen Bücher macht, die Menschen außerhalb der akademischen Philosophie wirklich hilfreich finden. Es teilt diese Auszeichnung mit C.S. Lewis’ kleinem Büchlein Die Abschaffung des Menschen, das mit ähnlich tödlichem Pfeil auf dasselbe Ziel schießt. Beide Bücher entlarven die farbenfrohe, fantastische Bilderwelt angesagter reduktiver Ideen, innerhalb derer wir leben – eine Bilderwelt, die sich trotz einer Menge Oberflächenaktivität seither kaum verändert hat. Wie Iris sagt, »ein gewieftes Set an Begriffen kann ein höchst effizientes Instrument der Verderbung sein«. So erklärt sie:
Wir sind von ständigen Sorgen geplagte Tiere. Unser Geist ist rund um die Uhr aktiv, webt kontinuierlich einen angstgetränkten, meist zwanghaft mit dem Selbst beschäftigten, oft verfälschenden Schleier, der die Welt zum Teil verhüllt. (S.99)
Was den Schleier vor allem durchdringt, ist eine klare, direkte Wahrnehmung von Dingen, die nicht Teil unseres eigenen Wesens sind. Zum Beispiel:
In einer aufgewühlten, verärgerten Stimmung sehe ich aus dem Fenster. Meiner Umgebung bin ich kaum gewahr, vielleicht grüble ich nach über einen Ansehensverlust, den ich erlitten habe. Dann 9sehe ich plötzlich einen schwebenden Falken. Mit einem Mal ist alles verändert. Das grübelnde Selbst mit seiner verletzten Eitelkeit ist verschwunden. Jetzt gibt es nichts außer dem Falken. Und wenn ich dann meine Gedanken über die andere Sache wieder aufnehme, scheint sie weniger wichtig. (S.100)
Doch der Schleier ist widerstandsfähig und es ist furchtbar schwer, ihn selbst in den Blick zu bekommen. Geschickt ebnet er uns in jedem Alter neue, unbemerkte Pfade, auf denen wir die Wirklichkeit umgehen können. Diese neuen Pfade zu entdecken, ist die oberste Aufgabe der Philosophie, nur fällt Philosoph:innen das natürlich häufig nicht viel leichter als anderen Menschen:
Es ist bei allen Philosoph:innen wichtig zu fragen, wovor sie sich fürchten. (S.88)
Während des zwanzigsten Jahrhunderts boten intellektuelle Moden Fluchtmöglichkeiten, indem sie Individuen nach und nach immer mehr isolierten, zunächst von Gott, dann von ihrer Gesellschaft (»So etwas wie Gesellschaft gibt es nicht«) und schließlich vom Rest der Natur. Auf diese Weise wurde Individuen eine außergewöhnliche, übernatürliche Art von Unabhängigkeit angedichtet. Auf jeder Stufe waren die Reformierenden damit beschäftigt, genuin unterdrückende Behauptungen zurückzuweisen. Doch auf jeder Stufe wurden die echten, praktischen Gründe für diese Zurückweisung nach und nach vergessen, während ein Theoretiker nach dem anderen (Nietzsche, Freud, Skinner, Heidegger, Sartre, Hayek, Dawkins) sich schwelgerisch in einer übertriebenen Rhetorik erging, die in der Kombination dieser Elemente in einen extremen und reduktiven Individualismus mündete.
Dieser Extremismus machte es immer schwerer, eine intelligente Versöhnung zu denken, die das Beste der verschiedenen Lager zusammenzubringen vermochte. Was wir stattdessen bekamen (wie Iris hervorhebt), war ein seltsamer, halbbewusster Mischmasch aus den dramatischsten Bestandteilen jeder Doktrin, weil diese Teile am aufregendsten und am leichtesten zu merken waren.
Dieses sehr mächtige Bild, das uns hier begegnet, […] ist behavioristisch insofern, als es Bedeutung und Wesen von Handlungen mit dem öffentlich Beobachtbaren verbindet, es ist existentialistisch in10sofern, als es das substantielle Selbst eliminiert und den einsamen, omnipotenten Willen betont, und es ist utilitaristisch insofern, als es annimmt, dass Moral nur mit Akten, die die Öffentlichkeit betreffen, zu tun hat und haben kann. (S.24)
Die Namen dieser Doktrinen mögen uns nicht allen vertraut sein, doch kennen wir alle, wie Iris sagt, die Idealfigur, die diese Doktrinen personifiziert, weil sie die Geschichten dominiert, die wir lesen und schauen:
[E]r ist der Held beinahe jedes zeitgenössischen Romans. […D]ieser Mensch [weilt] noch immer unter uns, frei, unabhängig, einsam, mächtig, rational, verantwortungsvoll, mutig, der Held so vieler Romane und moralphilosophischer Bücher. Nach der Raison d’Être dieses attraktiven, aber trügerischen Menschentyps müssen wir nicht lang suchen. Er ist das Kind des Zeitalters der Naturwissenschaft, auf selbstbewusste Weise rational und sich doch gleichzeitig seiner Entfremdung von dem materiellen Universum, das seine Entdeckungen ihm offenlegen, bewusst […]. (S.96)
Seit Iris das schrieb, hat der Klimawandel unsere Sorgen bezüglich dieser letzteren Art der Entfremdung deutlich vergrößert. Doch die Machtfantasie, die sie beschreibt, ist potent wie eh und je und wird noch immer hochgehalten von der »Vorherrschaft der Naturwissenschaft: oder vielmehr [der] Vorherrschaft unpräziser Vorstellungen von Naturwissenschaft, die in den Köpfen von Philosoph:innen sowie anderer Denker:innen umherspuken« (S.42).
Denn es ist nicht die Naturwissenschaft selbst, die diese wilde, schmeichlerische Flucht notwendig erscheinen lässt. Diese Forderung kommt von Ideologien (wie der behavioristischen Ideologie von B.F. Skinner), die den Namen der Wissenschaft benutzen und deren Macht auf groteske Weise übertreiben. Um es einfach auszudrücken: Was uns Angst macht, ist unsere abergläubische Überzeugung, dass es ein einzelnes, riesiges, unfehlbares System namens Naturwissenschaft gibt, das die menschliche Existenz in ihrer Gänze erklärt und damit die uns so vertrauten Arten der Freiheit, die wir jeden Tag erleben, als Illusionen entlarvt. Um dieser Bedrohung zu entkommen, haben Theoretiker:innen eine besondere Art metaphysischer Freiheit erfunden, die uns wie autonome Heißluftballons in eine Stratosphäre schickt, die jenseits der Reichweite von 11Natur und Wissenschaft liegt. Wollen wir dort wirklich leben? Iris kommentiert:
Ich finde das Menschenbild, das ich skizziert habe, sowohl fremdartig als auch unplausibel. Genauer gesagt: Ich habe einfache empirische Einwände (ich glaube nicht, dass Menschen notwendigerweise oder essentiell »so sind«), ich habe philosophische Einwände (ich finde das Argument nicht überzeugend) und ich habe moralische Einwände (ich glaube nicht, dass Menschen sich selbst so sehen sollen). Es ist eine heikle und knifflige Angelegenheit, diese Arten von Einwänden im Kopf auseinanderzuhalten. (S.24)
Dieser Schwierigkeit sehen sich alle gegenüber, die versuchen, einen gegenwärtigen Mythos zu durchdringen. Intellektuelle und emotionale Aspekte des aktuellen Schleiers sind so sehr ineinander verwoben, dass man kaum eine Beobachtung anstellen kann, ohne scheinbar etwas moralisch Fragwürdiges zu sagen.
Während des gesamten letzten Jahrhunderts wurde dem Begriff der Freiheit eine solch unbedingte Ehrerbietung dargebracht, dass es unter allen Umständen als verboten erscheint, nur danach zu fragen, welche Freiheit gemeint ist. Freiheit wovon? Freiheit von Skrupel? Freiheit von Freundschaft und den Fesseln der Zuneigung? Freiheit von Prinzipien? Freiheit von aller Tradition? Freiheit von Gefühlen? Diese Freiheiten sind das natürliche Privileg von Psychopath:innen, Dummköpfen und Depressiven. Den Prophet:innen, die der Freiheit als höchstem oder einzigem Wert huldigen, geht es aber nicht um diese Privilegien. Das machen sie anhand ihrer Beispiele deutlich. Was aber (fragt Iris) wollen sie dann?
Der Existentialismus, sowohl in seiner kontinentalen wie auch in seiner angelsächsischen Version, ist ein Versuch, das Problem zu lösen, ohne sich ihm wirklich zu stellen: es zu lösen, indem man dem Individuum eine leere, einsame Freiheit zuspricht, eine Freiheit »selbst den Tatsachen zu trotzen«, sollte es das wünschen. In Wirklichkeit zeichnet er ein Bild von der angstvollen Einsamkeit des Individuums, wie es auf einer winzigen Insel inmitten eines Meeres naturwissenschaftlicher Tatsachen ausgesetzt ist, und von einer Moral, die der Wissenschaft nur durch einen wilden Sprung des Willens entkommt. Aber dieses Bild entspricht nicht unserer Lage. (S.42)
12Sie fasst unter dem Ausdruck Existentialismus eine weite Tradition, die von Dostojewski, Kierkegaard und Nietzsche bis hin zu Heidegger und Sartre reicht, eine Tradition, die heute nur deshalb seltener als früher erwähnt wird, weil ihre plumpen Elemente im Großen und Ganzen akzeptiert und als selbstverständlich gesetzt sind. In neuem sprachlichen Gewand finden wir sie auch bei amerikanischen Libertären wieder. Iris gibt zu, dass wir in der Konfrontation mit harten Dilemmata tatsächlich das Gefühl haben können, dass unsere Situation hoffnungslos unverständlich und irrational ist. Doch das ist deshalb so (führt Iris aus), weil wir uns willkürlich auf den Moment der augenscheinlichen Entscheidung konzentrieren und dabei die Fülle an imaginativer Arbeit ignorieren, die diesem Moment vorausgegangen ist, eine Arbeit, die vor allen Dingen auf bewusster und selektiver Aufmerksamkeit aufbaut. Als Beispiel führt sie eine Frau an, die halbbewusst ihre Schwiegertochter verabscheut und die, auf die Befürchtung hin, dass sie unfair sein könnte, »ganz bewusst über S nachdenkt, bis sich ihre Sicht auf S allmählich verändert« (S.33). Diese Frau sieht nun Tatsachen, die sie vorher nicht sah, nicht weil sie sich etwas vormacht, sondern weil sie mit ›gerechter und liebender Aufmerksamkeit‹[1] schaut. Das heißt, unsere Vorstellungskraft hilft nicht nur dabei, den Schleier, der uns die Sicht nimmt, zu verdichten – sie hilft uns auch dabei, Löcher in ihn zu stechen und ihn zu entwirren. Sie ist nicht nur ein Täuschungsinstrument oder ein Luxusgut, mit dem sich Humanist:innen die Zeit vertreiben. Sie ist selbst ein lebenswichtiges Organ, eine Werkstatt, in der wir unsere Sicht auf die Welt und damit unsere Handlungen formen.
Es ist natürlich zuvorderst diese Art reflektierender, imaginativer Aufmerksamkeit – nicht beliebige, plötzliche Entscheidung –, die Menschen, die relativ frei und verantwortungsbewusst handeln, von denen unterscheidet, die dies nicht tun. Gewiss haben wir nur begrenzte Kontrolle über unsere Aufmerksamkeit. Aber nicht einmal die Fanatischsten und Fatalistischsten unter den Determinist:innen haben jemals wirklich daran gezweifelt, dass wir sehr viel bewegen können, wenn wir dieses Maß an Kontrolle auch ausüben, 13und dass die Fähigkeit hierzu Teil unseres natürlichen Erbes ist. Es ist die Aufgabe der verschiedenen Wissenschaften (wie seriöse Wissenschaftler:innen wissen), einander dabei zu helfen, solche natürlichen Prozesse zu verstehen, und nicht zu leugnen, dass sie überhaupt stattfinden. Diese Art der Leugnung ist Ideologie, nicht Wissenschaft. Über weite Strecken des letzten Jahrhunderts kämpften Libertäre verschiedener Couleur hier einen Geisterkampf, nicht gegen die Wissenschaft selbst, sondern gegen falsche szientistische Prophet:innen. Ein Blick in Die Souveränität des Guten könnte sicher dabei helfen, sie zu befreien, und ihnen bessere und fröhlichere Beschäftigungen erschließen.
Mary Midgley 2014
15Vorwort
Diese drei Aufsätze sind bereits in gedruckter Fassung erschienen. Ich danke dem Herausgeber für die Erlaubnis des Nachdrucks von »Die Idee der Vollkommenheit« aus dem Yale Review 1964, den Syndizi der Cambridge University Press für die Erlaubnis des Nachdrucks von »Die Souveränität des Guten über andere Begriffe«, der die Leslie-Stephen-Vorlesung von 1967 war, und Professor Majorie Greene und der Arbeitsgemeinschaft über die Fundamente kultureller Einheit sowie Routledge und Kegan Paul für die Erlaubnis des Nachdrucks von »Über ›Gott‹ und ›Gut‹«, veröffentlicht 1969 in The Anatomy of Knowledge. »Die Idee der Vollkommenheit« basiert auf der Ballard-Mathews-Vorlesung, die ich am University College of North Wales 1962 hielt.
Iris Murdoch
161. Die Idee der Vollkommenheit
Es wird gelegentlich behauptet, dass die Philosophie keine Fortschritte mache. Mal geschieht das mit Verdruss, mal mit einer gewissen Genugtuung. Sicherlich zutreffend und meiner Ansicht nach ein bleibendes und kein beklagenswertes Charakteristikum des Fachs ist es, dass es gewissermaßen immer wieder versuchen muss, zum Anfang zurückzukehren: ein keineswegs leichtes Unterfangen. Es gibt ein Pendel in der Philosophie, das in zwei Richtungen schwingt. Es bewegt sich hin zur Konstruktion elaborierter Theorien, und es bewegt sich zurück zur Betrachtung einfacher und offensichtlicher Tatsachen. McTaggart behauptet, die Zeit sei unwirklich, Moore antwortet, er habe gerade gefrühstückt. Beide Aspekte der Philosophie sind für sie notwendig.
Ich möchte in dieser Diskussion den Versuch einer Rückkehr unternehmen, eines Zurückverfolgens unserer Schritte, um zu sehen, wie eine bestimmte Position erreicht wurde. Die Position in der aktuellen Moralphilosophie, um die es geht, scheint mir auf zwei miteinander verwandte Weisen unbefriedigend zu sein: Sie ignoriert bestimmte Tatsachen und nötigt uns dabei eine einzige Theorie auf, die weder eine Auseinandersetzung mit rivalisierenden Theorien erlaubt noch uns Fluchtwege dorthin offenlässt. Wenn es stimmt, dass die Philosophie mehr oder weniger immer schon so gearbeitet hat, dann stimmt es auch, dass Philosoph:innen dies noch nie besonders lang hingenommen haben. Beispiele für Tatsachen, wie ich sie kühnerweise nennen werde, die mich interessieren und die scheinbar vergessen oder »wegtheorisiert« wurden, sind die Tatsache, dass ein ungeprüftes Leben tugendhaft sein kann, und die Tatsache, dass Liebe ein zentraler Begriff in der Moral ist. Zeitgenössische Philosoph:innen verbinden häufig Bewusstsein mit Tugend, und obwohl sie andauernd über Freiheit reden, reden sie fast nie von Liebe. Doch es muss eine Verbindung zwischen diesen beiden letzten Begriffen geben, und es muss möglich sein, sowohl Sokrates als auch dem gutherzigen Landarbeiter gerecht zu werden. In einem »Muss« wie diesem liegen die tiefsten Quellen und Motive der Philosophie. Wenn wir aber versuchen, unser Blickfeld zu erweitern, und uns kurzzeitig philosophischen Theorien außerhalb 17unserer eigenen Tradition zuwenden, fällt es uns meist sehr schwer, erhellende Zusammenhänge herzustellen.
Im vorletzten Kapitel von Thought and Action sagt Professor Hampshire, dass »es die konstruktive Aufgabe einer Philosophie des Geistes ist, eine Menge von Ausdrücken bereitzustellen, mithilfe derer man endgültige Werturteile klar formulieren kann«.[1] Wenn man Philosophie des Geistes so versteht, dann bildet sie den Hintergrund zur Moralphilosophie; und die Gründe für die Tendenz der modernen Ethik, eine Art Neusprech zu etablieren, innerhalb dessen bestimmte Werte nicht mehr ausdrückbar sind, liegen in der aktuellen Philosophie des Geistes und in der faszinierenden Macht eines bestimmten Bildes der Seele. Man bekommt allerdings den Verdacht, dass die Philosophie des Geistes nicht wirklich die von Professor Hampshire empfohlene Aufgabe des Sortierens und Klassifizierens fundamentaler moralischer Fragen erledigt; sie ist vielmehr damit beschäftigt, uns ein bestimmtes, als Theorie der menschlichen Natur verkleidetes Werturteil aufzunötigen. Ob Philosophie jemals irgendetwas anderes machen kann, ist eine Frage, über die wir nachdenken müssen. Aber solange moderne Philosoph:innen bekunden, analytisch und neutral zu sein, verdient es jedes diesbezügliche Versagen, kommentiert zu werden. Und ein Versuch, der zwar keine umfassende Analyse, aber doch wenigstens ein rivalisierendes Seelenbild entwickelt, das ein größeres oder anderes Gebiet abdeckt, sollte neue Räume für philosophische Reflexion erschließen. Wir wüssten gern, was wir als moralische Akteure aufgrund der Logik tun müssen, was wir aufgrund unserer menschlichen Natur tun müssen und was wir selbst wählen können. Ein solches Programm ist leicht aufzusetzen und vielleicht unmöglich umzusetzen. Aber allein schon um herauszufinden, was wir mit diesem Kurs erreichen können, benötigen wir zweifellos ein deutlich komplexeres und subtileres begriffliches System als all jene, die uns aktuell zur Verfügung stehen.
Bevor ich nun im Weiteren die Probleme der Philosophie des Geistes erörtere, die für die Momente der Sprachlosigkeit der modernen Ethik verantwortlich sind, möchte ich noch einige Worte 18zu G.E. Moore verlieren. Moore bildet gleichsam den Rahmen des Bildes. Sehr viel ist geschehen, seit er seine Abhandlungen schrieb, und wenn wir ihn nun erneut lesen, so ist es verblüffend zu sehen, wie viele seiner Überzeugungen mittlerweile unaussprechlich geworden sind. Moore war der Überzeugung, dass gut[2] eine Realität jenseits der Sinne sei, eine mysteriöse, nicht abbildbare und undefinierbare Eigenschaft, von der wir Erkenntnis erlangen können. Implizit angelegt in seiner Position ist die Annahme, dass die Fähigkeit, das Gute sehen zu können, gleichbedeutend damit ist, es zu besitzen. Moore betrachtete das Gute in Analogie zum Schönen, und er war ganz gegen seine eigene Absicht ein »Naturalist«, weil er die Eigenschaft, gut zu sein, für einen wirklichen Bestandteil der Welt hielt. Wir wissen, wie heftig und in welchen Hinsichten Moore von seinen Nachfolgern korrigiert wurde. Moore unterschied ganz zu Recht (so wurde gesagt) die Frage »Was bedeutet ›gut‹?« von der Frage »Welche Dinge sind gut?«, aber es war falsch von ihm, neben der ersten auch die zweite Frage zu beantworten. Er sagte zu Recht, dass gut undefinierbar sei, aber es war falsch von ihm zu behaupten, dass es die Bezeichnung einer Eigenschaft sei. Gut sei deshalb undefinierbar, weil Werturteile vom Willen und den Entscheidungen des Individuums abhängig sind. Moore lag falsch damit (so seine Kritiker:innen weiter), das Gute mittels des quasiästhetischen Bildes des Sehens fassbar machen zu wollen. Eine solche Ansicht, die das Gute in Analogie zum Schönen auffasst, würde auf Seiten des moralischen Akteurs scheinbar eine kontemplative Haltung ermöglichen, wohingegen doch der Punkt bei dieser Person gerade sei, dass sie essentiell und unausweichlich Akteur ist. Das Bild, mit dem Moral zu verstehen ist, so wird argumentiert, sei nicht das Bild des Sehens, sondern das Bild der Bewegung. Die Eigenschaft, gut zu sein, und die Eigenschaft, schön zu sein, seien nicht analog, sondern zwei in scharfem Kontrast stehende Ideen. Gut dürfe nicht als Bestandteil der Welt gedacht werden, sondern 19als willkürlich verwendbares Label, das der Welt angehaftet wird, denn nur so könne der Akteur als Verantwortung tragend und frei vorgestellt werden. Und tatsächlich habe Moore diese Wahrheit zum Teil erfasst, als er die Denotation von der Konnotation von »gut« trennte. Der Begriff »gut« sei nicht die Bezeichnung eines esoterischen Gegenstands, er sei das Werkzeug eines jeden rationalen Menschen. Die Eigenschaft, gut zu sein, sei kein Gegenstand von Einsicht oder Wissen, sie sei eine Funktion des Willens. So verläuft die Korrektur von Moore, und ich möchte vorwegnehmen, dass ich in fast jedem Punkt mit Moore übereinstimme und nicht mit seinen Kritiker:innen.
Die Idee, dass »gut« eine Funktion des Willens ist, überraschte die Philosophie mit ihrer Attraktivität, da sie so viele Probleme mit einem Schlag löste: Metaphysische Entitäten wurden beseitigt und moralische Urteile nicht mehr als seltsame Behauptungen aufgefasst, sondern als etwas viel Verständlicheres, etwa als Überzeugungsversuche, Gebote oder Regeln. Die Idee besitzt ihre eigene Sinnfälligkeit, aber ihre Plausibilität beruht nicht allein auf ihrer Nützlichkeit oder einem Verweis auf unsere alltägliche Kenntnis des moralischen Lebens. Sie steht im Einklang mit einer umfassenden Moralpsychologie, von der große Teile in jüngerer Vergangenheit ausgearbeitet worden sind. Ich möchte nun einige Aspekte dieser Psychologie untersuchen und zu ihrem Ursprung und ihrer Grundlage, die nach meinem Dafürhalten in einem bestimmten Argument von Wittgenstein zu finden sind, zurückverfolgen. Zunächst werde ich »den Menschen«[3] skizzieren, den diese Psychologie uns vorlegt, dann werde ich die wichtigsten Eigenschaften dieses Menschen diskutieren, und schließlich werde ich dazu übergehen, die grundlegenden Argumente für ein solches Bild zu prüfen.
Ich werde meiner Skizze von diesem Bild »des Menschen« der modernen Moralphilosophie zwei Werke von Professor Hampshire zugrunde legen, sein Buch Thought and Action und seine Vorlesung »Disposition and Memory«. Meiner Ansicht nach ist Hampshires Sichtweise recht exemplarisch und typisch, wenngleich auch sie keine ungeteilte Zustimmung genießt. Zudem hat sie den großen Vorteil, dass sie dasjenige klar darlegt und ausführt, was andere moderne Moralphilosoph:innen schlicht als selbstverständlich voraussetzen. Hampshire schlägt vor, dass wir die (den britischen Empiristen so teure) Vorstellung vom Menschen als ungebundenen, objektiven Beobachter verwerfen und ihn stattdessen als ein Objekt betrachten, das sich inmitten anderer Objekte in einem steten Fluss von Absicht zu Handlung bewegt. Berührung und Bewegung sollten unsere Metaphern sein, nicht das Sehen: »Das Berühren, Handhaben und Bearbeiten von Dingen wird falsch dargestellt, wenn wir der Analogie des Sehens folgen.« Handlungen sind, grob gesagt, Vorgänge des Herumbewegens von Dingen in der öffentlichen, allen zugänglichen Welt. Nur das zählt als Handlung, was eine »Hervorbringung erkennbarer Veränderung in der Welt« ist. Welche Arten von Dingen können solche erkennbaren Veränderungen sein? Hier müssen wir unterscheiden zwischen »den Dingen und Personen, die die externe Welt konstituieren, und den Sinneswahrnehmungen und Eindrücken, die ich oder jeder andere von einem Moment zum nächsten haben kann«. Was »wirklich« ist, steht potentiell verschiedenen Beobachtern offen. Die innere oder mentale Welt lebt zwangsläufig parasitär von der Außenwelt; sie hat »eine parasitäre und schattenhafte Natur«. Die Bestimmtheit eines jeden Gedankengangs ist abhängig »von der Möglichkeit, von Beobachtenden aus verschiedenen Perspektiven erkannt, untersucht und identifiziert zu werden; diese Möglichkeit ist für jede Art bestimmter Wirklichkeit essentiell«. »Spiele des Geistes, die nicht in hörbarer Sprache oder sichtbarer Handlung Ausdruck finden, sind wirklich, so wie Schattenspiele wirklich sind. Doch sämtliche Beschreibungen solcher Spiele leiten sich von Beschreibungen der natürlichen Ausdrucksformen des Geistes in Sprache und Handlung ab.« »Die Zustimmung, die im Geist und nicht in einem Kommunikationsgeschehen stattfindet, wenn keine Frage tatsächlich gestellt und beantwortet worden ist, ist eine schattenhafte Zustimmung und ein schattenhafter Akt.« »Im Gegensatz zu Tagträumereien kann das Denken nur als auf einen Abschluss zielend gedacht werden, ob in einer Handlung oder einem Urteil.« Ferner: Denken und Überzeugung sind getrennt von Wille und Handlung. »In unserem alltäglichen Sprechen und Denken bemühen wir uns durchaus, den Unterschied zwischen Denken und Handeln so deutlich wie möglich zu wahren.« Denken als solches ist keine Handlung, sondern eine Einleitung einer Handlung. »Das, was ich tue, ist das, 21wofür ich verantwortlich bin und was auf eigentümliche Weise ein Ausdruck meiner selbst ist. Es ist dem Denken wesentlich, dass es seine eigene Gestalt annimmt und seiner eigenen Fährte folgt, ohne dass ich mich einmische, d.h., ohne dass mein Wille sich einmischt. Ich identifiziere mich mit meinem Willen. Das Denken, wenn es am reinsten ist, lenkt sich selbst. […] Wenn die vorbereitende Arbeit des Willens verrichtet ist, geht das Denken seiner eigenen Wege, beherrscht von seinen eigenen universellen Regeln. Kein Gedankengang kann unterbrochen werden, sei es durch Willensakte oder ein freiwilliges Umlenken der Aufmerksamkeit, und den Status eines zusammenhängenden Gedankenganges behalten.« Dies sind sehr wichtige Annahmen. Hieraus wird folgen, dass eine »Überzeugung« nicht willentlich hervorgebracht werden kann. »Es scheint, dass ich meine eigene Überzeugung von etwas nicht als eine Leistung beschreiben kann, da eine solche Beschreibung sie als Überzeugung disqualifizieren würde.« Diese Zitate sind aus Thought and Action, der zweiten Hälfte von Kapitel zwei.
In der Ernest-Jones-Vorlesung »Disposition and Memory« macht Hampshire zwei Dinge: Er bringt die Argumente aus Thought and Action polemisch auf den Punkt und er führt mit freudscher Rückendeckung den Gedanken einer »personalen Verifizierung« ein, die ich weiter unten ausführlich diskutieren werde. Aus »Disposition and Memory«: »Absicht ist der einzige Begriff, der vor jeglichem Beigeschmack des nicht ganz Bewussten bewahrt werden sollte.« Und »im Gegensatz zu physikalischen ist es für mentale Begriffe charakteristisch, dass die Bedingungen ihrer Anwendung nur dann verstanden werden können, wenn sie genetisch analysiert werden«. Dies sind kurze, prägnante Formulierungen von Thesen, für die bereits in Thought and Action argumentiert wurde. Zusätzlich präsentiert Hampshire uns nun ein Bild des »ideal rationalen Menschen«. Diese Person wäre sich »all ihrer Erinnerungen als Erinnerungen bewusst […]. Ihre Wünsche würden sich auf eindeutige Möglichkeiten in einer eindeutigen Zukunft beziehen […]. Sie würde […] ihre momentane Situation von unterbewussten Erinnerungen an Vergangenes unterscheiden […] und würde ihre Handlungsmotive in der Befriedigung ihrer instinktiven Bedürfnisse finden, die sich allein an objektiv beobachteten Eigenschaften der Situation orientieren.« Diesen idealen Menschen gibt es nicht, weil der Palimpsest der »Veranlagungen« zu fest ist, um durchdrungen zu werden: 22Und das ist nur gut so, denn ideale Rationalität würde uns »ohne Kunst, ohne Traum oder Imagination, ohne von instinkthaften Bedürfnissen unabhängige Vorlieben und Abneigungen zurücklassen«. In der Theorie, wenn auch nicht in der Praxis, könnte »eine endlose Analyse« die Maschinerie unserer Veranlagungen freilegen und eine perfekte Vorhersage unseres Verhaltens ermöglichen; aber Hampshire betont (und dies ist der Hauptpunkt der Vorlesung), dass solch ideales Wissen nicht die Form eines wissenschaftlichen Gesetzes annähme, sondern seine Basis und seine Verifikation in der Geschichte des Individuums hätte. Ich werde später dafür argumentieren, dass dieses sehr überzeugende Bild, das Hampshire uns hier vorlegt, nicht vereinbare Elemente enthält. Grob gesagt gibt es einen Konflikt zwischen der »logischen« und der »geschichtlichen« Auffassung des Geistes, einen Konflikt, der zum Teil deshalb existiert, weil Logik noch immer an einen altmodischen Begriff von Wissenschaft geknüpft ist. Aber ich greife vor.