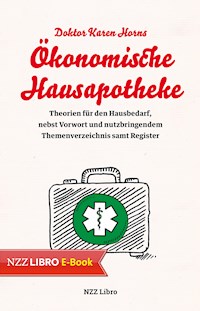Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Allgemeine Buch
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
"Nationalökonomie ist, wenn die Leute sich wundern, warum sie kein Geld haben." - Kurt Tucholsky Im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise hat der Kapitalismus an Akzeptanz verloren. Eine fundamentale Systemdebatte brach los. Viele erklärten den Neoliberalismus zur Ursache allen Übels und forderten eine Rückbesinnung auf die Soziale Marktwirtschaft. So heißt das berühmte Nachkriegs-Erfolgsmodell einer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, dem Deutschland viel verdankt, nicht zuletzt das Wirtschaftswunder der fünfziger Jahre. Die Soziale Marktwirtschaft ist ein Symbol für soziale Harmonie und gesamtwirtschaftlichen Erfolg. Und sie ist ein deutsches Markenzeichen.Was eine "social market economy" sein soll, muss man den Engländern genauso erst einmal erklären wie den Franzosen die "économie sociale de marché". Doch auch in Deutschland kann kaum jemand genau beantworten, was der Begriff "Soziale Marktwirtschaft" bedeutet und wo er herkommt. Und dass gerade die Soziale Marktwirtschaft nichts anderes ist als ein neoliberales Konzept, gehört auch nicht zum Allgemeinwissen. Karen Horn erklärt alles, was man über den Neoliberalismus und die Soziale Marktwirtschaft wissen muss, um mitreden und sich ein eigenes Urteil bilden zu können. Dass man dabei gleichzeitig etwas über deutsche Geschichte, Institutionen und wirtschaftliche Hintergründe erfährt, ist eine weitere Stärke des kurzweilig geschriebenen Buches. Alles, was Sie über den Neoliberalismus wissen sollten!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Karen Ilse Horn
Die Soziale Marktwirtschaft
Karen Ilse Horn
Die Soziale Marktwirtschaft
Alles, was Sie über den Neoliberalismus wissen sollten
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Karen Ilse Horn
Die Soziale Marktwirtschaft
Alles, was Sie über den Neoliberalismus wissen sollten
F.A.Z.-Institut für Management-,
Markt- und Medieninformationen,
Frankfurt am Main 2010
ISBN 978-3-89981-430-9
Bookshop und weitere Leseproben unter:
www.fazbuch.de
Copyright:
F.A.Z.-Institut für Management-, Markt-
und Medieninformationen GmbH
Mainzer Landstraße 199
60326 Frankfurt am Main
Gestaltung / Satz / Umschlag:
F.A.Z., Verlagsgrafik
Titelbild:
Karsten Schreurs, GROBI Grafik & Illustrationen
Satz Innen:
Nicole Bergmann
Alle Rechte, auch des auszugsweisen Nachdrucks, vorbehalten.
Inhalt
Einleitung
Aufklärung eines Missverständnisses
I DER NEOLIBERALISMUS
1 Das wissenschaftliche und politische Projekt
Eine Zeitreise in die dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts
2 Ohne Freiheit ist alles nichts
Wesentliche Prämissen von Neoliberalismus und Ordoliberalismus
II DIE WETTBEWERBSORDNUNG
3 Eine ganzheitliche „Ordo“
Das zeitlose Ordnungssystem von Walter Eucken
4 Alles dreht sich um den Preis
Die konstituierenden Prinzipien der Wettbewerbsordnung
5 Wo die Politik nachhelfen muss
Die regulierenden Prinzipien der Wettbewerbsordnung
III DIE SOZIALE MARKTWIRTSCHAFT
6 „Die Freiheit auf dem Markte mit sozialem Ausgleich verbinden“
Alfred Müller-Armacks friedensstiftende Formel
7 Ein politischer Siegeszug
Von Ludwig Erhard bis Wolfgang Schäuble
IV GEFÄHRDUNGEN UND HERAUSFORDERUNGEN
8 Fehlgriffe, Fehlsteuerungen und Fehlanreize
Die Gefährdungen der Sozialen Marktwirtschaft lauern überall
9 Die Herausforderungen der Zukunft
„Was die Weltwirtschaft angeht, so ist sie verflochten“
Schlusswort
Ein Appell
Literatur
Register
Die Autorin
Meinen Eltern gewidmet
Einleitung
Aufklärung eines Missverständnisses
Angesteckt von der Immobilienkrise in den Vereinigten Staaten, erlitt die Welt 2008 einen gigantischen Finanzmarktcrash, der an 1929 erinnerte. Die Weltwirtschaft rutschte in eine große Rezession. Vermögen wurden vernichtet, Arbeitsplätze gestrichen, Lebensträume zerschlagen und Sicherheiten zerstört. Und noch etwas geschah, womit ebenfalls niemand gerechnet hatte: In der eigentlich uralten Debatte über die Gegensätze von Markt und Staat, von Liberalismus und Dirigismus, schlug das Pendel nochmals um. Nach dem Zusammenbruch des Sozialismus hatte der amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama noch einigermaßen frohgemut von einem „Ende der Geschichte“ gesprochen, in der Annahme, nun habe sich die Frage nach dem besseren gesellschaftlichen System ein für alle Mal erledigt. Weit gefehlt.
Nach dem Zusammenbruch der amerikanischen Bank Lehman Brothers und der dadurch ausgelösten Abwärtsspirale im September 2008 bröselten in aller Welt die über viele Jahre in quälend mühsamer Überzeugungsarbeit erreichten Erfolge der Liberalisierung aus den Vorjahren dahin. Regierungen aller Couleurs sahen sich zu dirigistischen Eingriffen in die Wirtschaft veranlasst – zu Eingriffen, die sich jedem bisher bekannten und geduldeten Maß entzogen. Besonders im Bankgewerbe kam es zu Verstaatlichungen auf breiter Front. Diese Gelegenheit, die wirtschaftlichen Zügel politisch wieder fester in die Hand zu nehmen und dafür recht unangefochten Legitimität beanspruchen zu können, bedeutete eine unerwartete Renaissance des Etatismus. Das Ende der liberalen Marktwirtschaften schien gekommen oder doch wenigstens nah.
Diese Entwicklung war getragen von einem spürbaren Wandel der Befindlichkeiten in der Öffentlichkeit. Im Zuge der Krise erlitt die Zustimmung zur Marktwirtschaft in der Bevölkerung noch einmal einen schweren Schlag. Die ohnehin in Deutschland nicht sonderlich stark ausgeprägte Skepsis gegenüber dem Staat schwand zusehends; die fundamentale Systemdebatte brach von neuem los. Wie eine Umfrage des Meinungsfor-schungsinstituts Allensbach ergab, fanden in Deutschland nach Ausbruch der Krise nur ganze 8 Prozent der Bevölkerung, der Staat greife zu viel ein; drei Jahre zuvor waren es noch 28 Prozent gewesen.
Bei diesem Meinungsklima stand auch in Windeseile die Pauschalverurteilung der Marktwirtschaft fest, ganz wie es der österreichische Ökonom Joseph Schumpeter (1883–1950) einmal prägnant beschrieben hatte: „Der Kapitalismus ficht seinen Prozess vor Richtern aus, die das Todesurteil bereits in der Tasche haben.“ Und so frönten zahlreiche Stimmen aus Politik wie Intelligenz einer geradezu obszönen Häme; da wurde der Zusammenbruch einer angeblichen neoliberalen Verschwörung ebenso ausgerufen wie das lange vorhergesehene Ende von Privatisierung, Deregulierung, Liberalisierung und Globalisierung. Der damalige Bundesfinanzminister Peer Steinbrück (SPD) verkündete, dass ein „maßloser Kapitalismus, … mit all seiner Gier, sich am Ende selbst auffrisst“, und er sprach auch gleich noch von einer „Bankrotterklärung des Laissez-faire-Kapitalismus“. In den großen Feuilletons der Republik war zu lesen von der „Vernichtung der Grundvertrauens in die Rationalität ökonomischen Handelns“ und davon, dass wir uns von der „neoliberalen Ideologie“, die wir aus dem Amerika des George W. Bush importiert hätten, verabschieden müssten. Schließlich habe sie einen irreführenden, rein ökonomisch begründeten Vernunft- und Glückszusammenhang zwischen Individuum und Globalisierung hergestellt.
Sehnsucht nach der Sozialen Marktwirtschaft
Die weniger hitzigen Köpfe beriefen sich in dieser Lage sehnsüchtig auf die „Soziale Marktwirtschaft“. So firmiert bekanntlich das berühmte Erfolgsmodell einer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung aus der Nachkriegszeit, dem Deutschland viel verdankt, nicht zuletzt das angeb-liche Wirtschaftswunder der fünfziger Jahre. Die Soziale Marktwirtschaft ist ein Symbol für gesellschaftliche Harmonie und gesamtwirtschaftlichen Erfolg. Sie ist ein wahres deutsches Markenzeichen. Was eine „social market economy“ sein soll, muss man den Engländern genauso erst einmal erklären wie den Franzosen die „économie sociale de marché“.
In Deutschland jedoch hat der Begriff Tradition – auch wenn er schillert. Seine Dehnbarkeit scheint ihn womöglich eher noch populärer zu machen; möglicherweise hat ihm diese Elastizität das Überleben über sechs Jahrzehnte gerettet. So ist durchaus nicht immer klar, ob jemand, der die Soziale Marktwirtschaft beschwört, von der gegebenen, gelebten Wirtschaftsordnung Deutschlands spricht, so, wie sie sich heute darstellt, oder von einem etwas ferneren Ideal, dem ursprünglichen Konzept. Wie dem auch sei, der Begriff der Sozialen Marktwirtschaft gehört zur Bundesrepublik wie der Name Bundesrepublik selbst. Das Grundgesetz, die deutsche Verfassung, hat 1949 alle notwendigen Weichen für eine Wirtschaftsverfassung nach dem Konzept der Sozialen Marktwirtschaft gestellt, freilich ohne dieses als solches ausdrücklich zu benennen und auch ohne eventuelle politisch gewollte Abweichungen von vornherein zu unterbinden. Doch im Staatsvertrag von 1990 zur Wirtschafts- und Währungsunion von Bundesrepublik und DDR wurde die Soziale Marktwirtschaft dann ausdrücklich kodifiziert.
Zwar haftete dem Konzept der Sozialen Marktwirtschaft der vielleicht etwas altbackene Geruch der fünfziger Jahre, der Aufbaujahre, der Bonner Republik an. Es galt nicht nur als allzu dehnbar, sondern eben auch als ein wenig angestaubt, theoretisch überholt und wirklich interessant allenfalls noch für Wirtschafts- und Dogmenhistoriker. Regelmäßig wurden – allerdings immer nur halbherzige – Anstrengungen unternommen, das Konzept der Sozialen Marktwirtschaft zu modernisieren. Im Auge des Sturms der großen Rezession aber holten dann Vertreter aller Parteien und aller Denkrichtungen das alte Konzept wieder aus der Schublade. Und siehe da, die Fans kamen in Scharen. Sie stellten damit freilich die Dehnbarkeit des Begriffs neuerlich auf die Probe. Der Begriff lädt einfach dazu ein, dass man ihn opportunistisch zieht wie ein Gummiband, so weit es geht. Von einem Marketinggesichtspunkt her betrachtet ist diese Elastizität eine Stärke. Konzeptionell aber ist sie, wenn sie zu weit geht, durchaus eine Schwäche. Wie viel Markt, wie viel Soziales soll es denn sein? Der Begriff allein gibt hier keine klare Anleitung. Wenn er aber irgendeine Bedeutung bewahren soll, dann gilt es zu verhindern, dass das Gummiband irgendwann reißt.
Nach der Krise wurde das Konzept der Sozialen Marktwirtschaft dann in der öffentlichen Diskussion zum Gegenentwurf zum Neoliberalismus erhoben, der offenbar abgewirtschaftet habe. Den langjährigen Rufen nach Deregulierung und Privatisierung, dem allzu naiven Vertrauen auf die Selbstheilungskräfte des Marktes, der zumindest so empfundenen Verantwortungslosigkeit und der Kälte eines ungezügelten Kapitalismus stellte man nun die wiederentdeckte Soziale Marktwirtschaft entgegen. Damit war freilich, bei Lichte besehen, die Begriffsverwirrung komplett. Denn man vergaß bei dieser Polarisierung etwas ganz Wesentliches: Das Konzept der Sozialen Marktwirtschaft ist ein neoliberales Konzept.
Die Soziale Marktwirtschaft, ein neoliberales Konzept
Die Soziale Marktwirtschaft ein neoliberales Konzept? Diese Nachricht mag auf den ersten Blick schockieren. Sollte sie aber nicht. Und die Soziale Marktwirtschaft muss damit jetzt nicht auch noch unter den Bannstrahl derer fallen, die im Neoliberalismus bloß Verantwortungslosigkeit und stereotype Kälte sehen. Im Gegenteil. Es gilt den Neoliberalismus neu zu entdecken. In seiner Entwicklung, seiner Vielfalt, seiner ganzen Breite. Dafür muss man ein wenig tiefer graben, als es in ideologischen Stammtischdebatten üblich ist. Man muss sich von der allzu schlichten und irrigen Vorstellung lösen, der Neoliberale sei ein unangenehmer Mensch, ein herzloser, unsolidarischer Eigenbrötler, dem die Effizienz des Marktes mehr bedeutet als die Seelenwärme, für die der Sozialstaat sorgt. Wenn man sich diese Mühe macht, erlangt man so auch ein besseres Verständnis von dem gar nicht veralteten Konzept der Sozialen Marktwirtschaft. Denn diese hat in der Tat ihre theoretischen Wurzeln in der Tradition des Ordoliberalismus – und der ist nichts anderes als eine spezifische deutsche Ausformung des Neoliberalismus.
Die späteren, vor allem angelsächsisch geprägten Entwicklungen innerhalb der breiten Strömung des Neoliberalismus haben zwar dazu geführt, dass das ordoliberale Denken der Deutschen heute vielleicht nicht mehr repräsentativ ist für den Neoliberalismus insgesamt. Viele andere Strömungen haben sich dazugesellt, von den Lehren der zeitweilig dominanten Chicago School bis hin zu den Ideen der Libertären und der Anarchokapitalisten. Aber daraus darf man nicht voreilig den Schluss ziehen, dass Ordoliberalismus und Neoliberalismus, einst ein Zwillingspaar, heute geschiedene Leute sind. Das ist eine verkürzte und somit falsche Perspektive, und man tut vor allem dem Neoliberalismus damit Unrecht. Denn diese Denkrichtung ist viel breiter als das, was man heute in fataler Engführung landläufig darunter zusammenfasst. Und so fallen auch die jetzt überall angestellten Überlegungen, wie man den Ordnungsrahmen der Wirtschaft so justieren kann, dass derart gewaltige Krisen wie 2008 nicht wieder geschehen können, ganz originär in die Domäne des Neoliberalismus.
Man mag sich auf den Standpunkt stellen, dass der Kampf um die angemessene, sowohl historisch als auch inhaltlich korrekte Nutzung des Begriffs Neoliberalismus längst verloren ist. Dass der Versuch, einen verengten und über Jahrzehnte daher stark verzerrten Sprachgebrauch wieder umzudrehen, von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Dass also niemals Schluss sein wird mit dem populistischen Zerrbild vom Neoliberalismus. Das mag alles zutreffen. Nur sollten möglichst viele Menschen um diese Verzerrung wissen. Und sie sollten wissen, dass all das, was heute allzu einfach als neoliberal gebrandmarkt wird – also die komplette Regellosigkeit, das blinde Vertrauen darauf, dass „der Markt es schon richten wird“ – in der politischen Philosophie in eine Schublade fällt, die nur einen winzigen und damit keinesfalls repräsentativen Teil des modernen Neoliberalismus ausmacht: nämlich den Anarcho-kapitalismus, die gedankenspielerische Utopie von der vollkommen herrschaftsfreien Selbstkoordination von Wirtschaft und Gesellschaft. Hierfür wird der Neoliberalismus insgesamt unfairerweise gleichsam in Sippenhaft genommen; alles andere wird verdrängt. Wie zum Beispiel die wichtige Tatsache, dass sich die Vertreter jener Schule, die sich in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts den Namen Neoliberalismus gegeben hat und die in Deutschland viele Jahre als Ordoliberalismus maßgeblich die Politik prägte, sich gerade nicht für eine kollektive Regellosigkeit aussprachen, wie manch einer der Öffentlichkeit heute weismachen will.
Im Gegenteil. Der Name Neoliberalismus beschreibt vielmehr das sozialwissenschaftliche und realpolitische Projekt, einen Ordnungsrahmen für die Gesellschaft zu erdenken und praktisch aufzubauen, der die Grundwerte der Freiheit und der Gerechtigkeit, der Verantwortung und der Solidarität auch in der Wirtschaft als wichtigem Aspekt des Miteinanders zu verbinden erlaubt.
Zurückblicken, um nach vorne zu schauen
In diesem Buch soll nun eine Begriffsklärung stattfinden. Unter dem Titel „Der Neoliberalismus“ wird deshalb im ersten Teil noch einmal nachgezeichnet, wie Neoliberalismus und Ordoliberalismus seinerzeit entstanden sind und worin die wesentlichen, nach wie vor so relevanten Säulen dieser politischen Philosophie bestehen. Systematisch wird dabei hier und auch in den weiteren Ausführungen auf die historische Situation und auf die Lehren der Vordenker zurückgegriffen – aber nicht nur. So wichtig der historische Hintergrund ist, in den Vordergrund gehören schließlich stets die Argumente. Da die theoretische Entwicklung seit der Frühzeit des Neoliberalismus nicht stillgestanden hat, werden deshalb auch die modernen Fortentwicklungen und Ausprägungen der damals begründeten Argumentationen mit in die Darstellung eingebunden. So gefasst, sollte auch klar sein, dass der historische Rückblick keinerlei Rückwärtsgewandtheit ausdrückt. Es gilt zurückzublicken, um nach vorne zu schauen. Der Blick zurück erlaubt auch keineswegs, die Dinge nach der Betrachtung einfach zu den Akten zu legen. Er dient allein der gerade heute wieder so dringend notwendigen geistesgeschichtlichen Verortung des Denkgebäudes, um das es hier geht.
Im zweiten Teil dieses Buches findet dann die Wettbewerbsordnung, wie sie der Freiburger Ökonom Walter Eucken entwickelt hat, breiten Raum. Der Begriff „Soziale Marktwirtschaft“ stammt zwar nicht von ihm, sondern von Alfred Müller-Armack. In Euckens Vorstellungen von der Wettbewerbsordnung aber ist das Leitbild, das erst später den Namen „Soziale Marktwirtschaft“ bekam und sich dann auch entsprechend erweiterte, am präzisesten ausformuliert. Die Darstellung folgt strukturell seinem – in seiner Stringenz weiterhin unübertroffenen – Konvolut an „konstituierenden“ und „regulierenden Prinzipien“, die es zur Verwirklichung der Wettbewerbsordnung zu beachten gilt. In diese Struktur sind jedoch außerdem Erläuterungen eingeflochten, die das Verständnis dieser Prinzipien grundsätzlich erleichtern, zum Beispiel zu der Frage, warum Geld überhaupt notwendig ist, welchen Zweck der Kredit erfüllt, was eigentlich „Marktversagen“ bedeuten soll und was man unter „externen Effekten“ zu verstehen hat.
Das Konzept der Sozialen Marktwirtschaft, wie es sich in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg herauskristallisiert hat, ist der Gegenstand des dritten Teils. Im vierten Teil des Buches geht es dann um einige vorrangige Gefährdungen und Herausforderungen, denen die Soziale Marktwirtschaft ausgesetzt war und aktuell ausgesetzt ist. Bei alledem soll beileibe kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden. Viele wichtige Aspekte können in der Kürze dieses Buches nicht oder nur kur-sorisch abgehandelt werden. Daher galt es Schwerpunkte zu setzen – und das im Blick auf das erklärte Ziel, wesentliche, zum Teil wenig bekannte oder in der öffentlichen Diskussion schlicht vergessene Aspekte der Sozialen Marktwirtschaft neu zu beleuchten, einzuordnen und zu erklären. Dabei wird auch klar Position bezogen, in der Hoffnung, gelegentlich vielleicht ein wenig aufrütteln, überzeugen und mitreißen zu können.
Der Markt braucht einen Ordnungsrahmen
Es ist ein Irrglaube, dass der Staat in einer Sozialen Marktwirtschaft nichts zu tun braucht. Ganz im Gegenteil. Denn die Marktwirtschaft braucht einen geeigneten Ordnungsrahmen. Einen solchen zu setzen und zu pflegen und den Geist der Sozialen Marktwirtschaft auch immer wieder in die aktuellen politischen Antworten auf die Herausforderungen hineinzutragen, die sich neu stellen, das ist die vornehmste Aufgabe jeder verantwortlichen Wirtschaftspolitik. Auch hierüber soll dieses Buch aufklären.
Nebenbei, eingeflochten in die einzelnen Kapitel, ist es auch Aufgabe dieses Buches, ein wenig Grundwissen über die wirtschaftlichen Vorgänge, Institutionen und Zukunftsfragen in Deutschland allgemein zu vermitteln. Dabei gilt es sicher einige heimliche Vorbehalte zu überwinden. Die Wirtschaft ist vielen Leuten noch immer ein wenig unheimlich, und die große Rezession von 2008/2009 hat das sicher eher noch verschlimmert. Kaspar Hauser alias Kurt Tucholsky hatte einst spottend formuliert: „Nationalökonomie ist, wenn die Leute sich wundern, warum sie kein Geld haben.“ Und damit hat er sogar recht: Wirtschaft ist etwas ganz Alltägliches. Jedermann muss haushalten. Unpraktischerweise sind die Mittel endlich: Man muss arbeiten, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Wirtschaft ist somit etwas, an dem jedermann teilhat, ständig und meistens ohne lange nachzudenken.
Wirtschaft folgt schlichten logischen Gesetzen. Im Kleinen geht es immer darum, wie Einzelpersonen, Haushalte oder auch Unternehmen ein bestimmtes Ziel möglichst sparsam, das heißt mit möglichst geringen Mitteln, erreichen. Im Großen, aus der Vogelperspektive, geht es darum, wie das eine hier zum anderen passt. Wie kommt es eigentlich, dass die meisten Bedürfnisse der Menschen in Deutschland doch sehr ansehnlich befriedigt werden? Wie bringt eine Gesellschaft mit gut 80 Millionen Bürgern die unzähligen wirtschaftlichen Entscheidungen unter einen Hut? Wie kann es überhaupt sein, dass das, was der eine kaufen möchte, ein anderer tatsächlich herstellt, ohne dass jemand dies „von oben“ festlegt oder dass darüber vorher eine öffentliche Beschlussfassung stattfinden muss? Wie passt sich das riesige Getriebe der Wirtschaft daran an, dass die Verbraucher ständig ihre Vorstellungen und Wünsche ändern? Wieso ergibt das kein permanentes Chaos?
Das Wunderwerk des Wettbewerbs
Knapp zusammengefasst sei jetzt schon einmal gesagt: In der Marktwirtschaft ist es das Zusammenspiel der Preise, die sich im Wettbewerb spontan herausbilden, das für diesen gesamtwirtschaftlichen Ausgleich von Angebot und Nachfrage sorgt. Es ist für jeden Staatsbürger und Stimmbürger wichtig zu verstehen, wie das funktioniert. Wer nicht versteht, wie die Koordination von Märkten durch den Preismechanismus abläuft, der kann auch nicht ahnen, was alles aufs Spiel gesetzt wird, wenn die Politik diesen Koordinationsmechanismus kurzerhand aushebelt, um „außerökonomische Ziele“ zu erreichen, zum Beispiel auf dem Gebiet des Umweltschutzes. Und dann kann man auch nicht wirklich kreativ darüber nachdenken, wie sich das eine mit dem anderen auch noch anders verbinden lässt, Ökologie und Ökonomie.
Ein wesentliches Anliegen dieses Buches ist es, dem Leser die Angst vor dem Neoliberalismus zu nehmen. Es will erklären, dass es mit einem richtigen Verständnis des Neoliberalismus immer nur darum gehen kann, sich auf die Soziale Marktwirtschaft zurückzubesinnen – mit Krise oder ohne Krise. Aber auf die ursprüngliche, die wohlverstandene Soziale Marktwirtschaft, die sich mittlerweile allerdings ein wenig von der gelebten Realität in Deutschland unterscheidet. Auf eine Soziale Marktwirtschaft, die klaren, bewährten, nachvollziehbaren, begründeten Prinzipien folgt. Die keine bloße intellektuelle Spielerei ist, sondern ausdrücklich dem Gemeinwohl dient. Denn nichts anderes bedeutet Neoliberalismus.
1Das wissenschaftliche und politische Projekt
Eine Zeitreise in die dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!