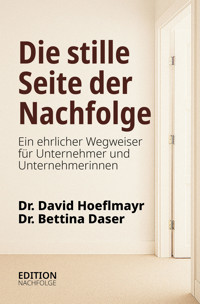
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION NACHFOLGE
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Hier geht es um die Seite der Unternehmensnachfolge, über die selten gesprochen wird: die leise, persönliche, oft entscheidende. „Die stille Seite der Nachfolge“ richtet sich an Inhaber mittelständischer Unternehmen, die ihr Lebenswerk in neue Hände geben wollen, ohne Kultur, Leistungskraft und Beziehungen zu beschädigen. Statt bloßer Checklisten für Verträge und Bewertungen bietet das Buch Orientierung in den Fragen, die wirklich tragen: Was ist mein Motiv und mein Timing? Welche Option passt zu mir und zum Unternehmen (Familie, Verkauf, externe Führung)? Wie bereite ich Team, Familie, Kunden und Beirat so vor, dass Vertrauen entsteht statt Gerüchte? Sie erhalten klare Entscheidungsbilder, präzise Fragen und griffige Werkzeuge für die Umsetzung: Kommunikation entlang der Stakeholder, saubere Governance für Übergabe und Übergangszeit, Rollenklärung für Unternehmer, Nachfolger und Beirat, Umgang mit Investoren und Banken sowie Leitplanken für Preis, Bedingungen und Unabhängigkeit. Beispiele aus realen Übergaben zeigen, wie typische Konflikte entschärft werden können und wie Sie Stolpersteine wie Loyalitätsdruck, verdeckte Machtkämpfe oder hektischen Aktionismus vermeiden. Besonders wertvoll ist der Fokus auf die Gestaltung der Phase nach der Übergabe: Welche Rolle passt zu Ihnen als Eigentümer a. D. — Beirat, Mentor, Investor oder bewusst Abstand zum Unternehmertum? Wie schaffen Sie einen persönlichen Neuanfang, ohne Ihre unternehmerische Identität zu verlieren? Dieses Buch macht die komplexe Nachfolge handhabbar: strukturiert, gelassen, fair. Für Unternehmer, die rechtzeitig vordenken, klug entscheiden und ein gutes Erbe hinterlassen wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Vorwort
Nachfolge ist mehr als ein Vorgang. Sie ist ein persönlicher und unternehmerischer Wendepunkt.
Wir schreiben dieses Buch für Menschen, die etwas aufgebaut haben. Für Unternehmerinnen* und Unternehmer, die nicht nur eine Firma gegründet oder fortgeführt haben, sondern ihr Lebenswerk mit besonderer Energie, Mut, Beharrlichkeit – und oft auch mit schlaflosen Nächten – geprägt haben. Menschen, die über Jahrzehnte Verantwortung getragen, Arbeitsplätze geschaffen und viele kleine und große Entscheidungen getroffen haben.
Und wir schreiben für den Moment der Verantwortungsübergabe. Der Moment, der oft lange hinausgezögert wird – aus Sorge, ob der richtige Nachfolger gefunden wird. Aus Ungewissheit, ob das Unternehmen ohne einen selbst weiterläuft. Oder weil man schlicht nicht weiß, wer man ohne diese Rolle sein wird.
In unserer täglichen Arbeit als Beirat, Coach und Berater für mittelständische Unternehmer haben wir unzählige Nachfolgeprozesse begleitet – von der ersten vagen Idee bis zum finalen Vertragsabschluss. Doch eines ist uns dabei immer wieder aufgefallen: Die größten Herausforderungen liegen nicht in den Zahlen, Verträgen oder Steuermodellen. Sie liegen unterhalb der Oberfläche. In der emotionalen Bedeutung der Zahlen. In der Seele der Beteiligten. In den unausgesprochenen Erwartungen, in den Ängsten, im Zögern und im Loslassen.
Dieses Buch widmet sich deshalb der stillen Seite der Nachfolge. Es geht nicht um juristische Details oder steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten. Sondern um das, was Unternehmer wirklich bewegt:
Wer bin ich ohne mein Unternehmen?
Wird mein Unternehmen in den Händen anderer erfolgreich bleiben?
Wird mein Nachfolger Freude an meinem Lebenswerk haben?
Was ist mein Vermächtnis – und wie verabschiede ich mich würdevoll und begrüße ein neues Kapitel meines Lebens?
Wir haben versucht, in diesem Buch sowohl tief zu graben als auch konkret zu helfen. Jedes Kapitel ist unterfüttert mit echten Erfahrungen, Fallbeispielen, Studien, Zitaten und praktischen Handlungsempfehlungen. Es soll ermutigen, zum Nachdenken anregen – und vor allem: Sie begleiten.
Denn Nachfolge ist kein einfacher Prozess. Aber sie kann – richtig vorbereitet und innerlich vollzogen – ein wertvoller dritter Akt im Unternehmerleben werden: weniger laut, aber vielleicht der wichtigste.
Wir laden Sie ein, sich mit diesem Buch auf diese Reise zu begeben.
Herzlich,
Dr. David Hoeflmayr und Dr. Bettina Daser
München, 2025
* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit haben wir im Text überwiegend die männliche Form verwendet – also z. B. „der Unternehmer“, „der Nachfolger“ oder „der Geschäftsführer“. Selbstverständlich sind damit stets auch Unternehmerinnen, Nachfolgerinnen und Geschäftsführerinnen gemeint.
Einführung
Wenn Unternehmer über Nachfolge nachdenken, passiert das selten laut. Es beginnt mit einem Gedanken am Rande: Vielleicht auf einer langen Autofahrt, nach einem Streit im Unternehmen, oder nach dem Lesen eines Artikels über einen plötzlichen Todesfall. Der Gedanke ist noch kein Plan – aber er bleibt. Er kommt wieder. Und jedes Mal bringt er eine leise, mahnende Unruhe mit.
In dieser frühen Phase wird das Thema oft verdrängt. Der Unternehmer denkt: Noch bin ich fit. Noch läuft alles. Noch ist es zu früh. Aber innerlich beginnt eine Vorahnung zu wachsen. Und mit ihr eine Mischung aus Sorge und Verantwortung.
Diese ersten Gedanken an Nachfolge sind meist mit ambivalenten Gefühlen verbunden. Auf der einen Seite steht der Stolz auf das Erreichte, das Bedürfnis, das Lebenswerk zu schützen und zu erhalten. Auf der anderen Seite die Angst vor Veränderung, ein drohender Kontrollverlust – und vielleicht auch die Unsicherheit, wer überhaupt für die Nachfolge infrage kommen könnte.
Viele Diskussionen über Nachfolge konzentrieren sich auf harte Fakten: Unternehmensbewertung, Steuergestaltung, Gesellschaftsrecht, Anteilsübertragung, Due Diligence. All das ist wichtig. Aber es ist nur die sichtbare Seite des Eisbergs.
Darunter liegt ein tieferes Terrain: die emotionalen, persönlichen und kulturellen Prozesse, die eine Übergabe begleiten – und oft entscheiden, ob sie gelingt oder scheitert. Genau darum geht es in diesem Buch.
Drei Phasen – drei Perspektiven
Die Gliederung dieses Buches folgt einem einfachen, aber wirkungsvollen Modell: Vor der Nachfolge. In der Nachfolge. Nach der Nachfolge. Oder anders gesagt:
Teil I: Die innere Vorbereitung.
Teil II: Die Zeit der Übergabe.
Teil III: Das neue Kapitel.
In Teil I geht es um die Phase, in der die Nachfolge gedanklich beginnt – oft Jahre bevor ein Vertrag unterschrieben wird. Hier stellen sich Unternehmer Fragen wie: Wann ist der richtige Zeitpunkt? Was ist vorher noch zu tun? Wer ist der richtige Nachfolger? Wie kann ich loslassen, ohne mich zu verlieren? Es geht um die innere Bereitschaft. Und darum, warum viele diesen Schritt sehr lange oder gar zu lange aufschieben – obwohl sie wissen, dass er kommen wird.
In Teil II liegt der Fokus auf der Zeit, in der der Unternehmer nicht mehr allein verantwortlich ist. Wie gelingt ein tragfähiger Generationenwechsel – in der Familie oder mit externen Nachfolgern? Wie lassen sich Rollen, Erwartungen und Emotionen klären? Wie gelingt es, Vertrauen aufzubauen, Verantwortung zu teilen – und zeitgleich die eigene langjährige Erfahrung weiterzugeben? Diese Phase ist intensiv. Sie verlangt Mut, Weitsicht, Demut, Fingerspitzengefühl – und das Bewusstsein, dass Nachfolge kein einsames Projekt ist, sondern ein Dialog.
Teil III schließlich widmet sich dem, worüber kaum gesprochen wird: dem Danach. Was passiert, wenn der Unternehmer nicht mehr Unternehmer ist? Wie geht man um mit der plötzlichen Leere, mit Fragen der Identität, mit der neuen Freizeit – oder mit dem plötzlichen Reichtum? In diesem Teil beleuchten wir den Übergang in einen neuen Lebensabschnitt und wie man ihn erfüllt und würdevoll gestalten kann, so dass er für den Unternehmer und vertraute Menschen um ihn herum stimmig ist.
Jeder dieser Teile eröffnet eine neue Perspektive auf das Thema Nachfolge. Zusammen bilden sie einen Wegweiser durch die wohl persönlichste Herausforderung im Unternehmerleben – mit dem Ziel, dass Sie am Ende nicht nur Ihr Unternehmen, sondern auch sich selbst erfolgreich in die nächste Phase führen.
Teil I: Die innere Vorbereitung.
Viele Unternehmer spüren irgendwann: Es wird Zeit, die nächste Generation ins Spiel zu bringen – oder über Alternativen wie einen Verkauf nachzudenken. Doch selbst wenn der Verstand sagt „es ist richtig“, zögert das Herz oft noch. Denn die ersten Schritte in Richtung Nachfolge berühren viel mehr als nur strategische Fragen – sie fordern die eigene Identität, Bindung zu sich selbst und zu anderen sowie klare Vorstellungen über die Zukunft heraus. In dieser Phase sind Sie noch in voller Verantwortung, mit beiden Händen am Steuer; wohl wissend, dass die Zeit naht, das Steuer anderen zu überlassen. Und gerade deshalb ist sie so anspruchsvoll: Sie müssen beginnen, den Übergang vorzubereiten, ohne dass sich schon ein klares Danach abzeichnet. Teil I dieses Buchs widmet sich genau dieser Phase: den inneren Fragen, den ersten organisatorischen Weichenstellungen – und dem Weg, den nur Sie allein gehen können, weil er tief mit Ihrer eigenen Geschichte und Ihrem Selbstverständnis als Unternehmerpersönlichkeit verknüpft ist.
1. Das Lebenswerk in neue Hände geben
Ein kühler Herbstmorgen, im Konferenzraum des Familienunternehmens Meyer: Heinz Meyer steht vor seinen langjährigen Mitarbeitenden, das vorbereitete Manuskript in den zitternden Händen. Heute ist der Tag, an dem er offiziell bekannt gibt, dass er die Geschäftsführung an seinen Nachfolger übergeben wird. Sein Blick wandert über die vertrauten Gesichter – einige überrascht, einige gerührt, manche unsicher. „Nach über 40 Jahren“, beginnt er mit belegter Stimme, „werde ich mein Lebenswerk in neue Hände legen.“
In diesem Moment spürt Heinz, was es tatsächlich bedeutet, die Firma – sein Unternehmen – loszulassen. Vielleicht standen oder stehen auch Sie, liebe Leserin, lieber Leser, vor einer ähnlichen Situation: Das eigene Lebenswerk, aufgebaut mit Leidenschaft, harter Arbeit, verbunden mit unzähligen Siegen und Niederlagen, soll in andere Hände übergehen. Allein der Gedanke daran schnürt vielen Unternehmerinnen und Unternehmern die Kehle zu. Doch früher oder später kommt für jede Gründerin und jeden Gründer dieser Zeitpunkt. Wie fühlt es sich an, sein Unternehmen – sein „Baby“ – jemand anderem anzuvertrauen? Und wie kann es gelingen, dass diese Übergabe nicht nur ein trauriger Abschied, sondern auch der freudige Beginn eines neuen Kapitels für alle Beteiligten wird?
Die emotionale Bedeutung des Lebenswerks
Ein Unternehmen zu gründen und über Jahrzehnte zu führen, ist weit mehr als ein Job – es ist ein Lebenswerk. Ihr Unternehmen ist womöglich aus bescheidenen Anfängen entstanden: Vielleicht starteten Sie in einer kleinen Garage oder mit einem winzigen Büro, und im Laufe der Jahre wurde daraus ein florierendes Unternehmen. Mit jedem Meilenstein ist auch Ihre persönliche Bindung daran gewachsen – Sie sind zum Unternehmer geworden. Es stecken neben Herzblut lange Arbeitswochen, schlaflose Nächte und mutige Entscheidungen darin. Kein Wunder, dass es Ihnen schwerfällt, Ihr Lebenswerk aus der Hand zu geben.
Wenn Inhaberinnen und Inhaber ihr Unternehmen liebevoll als ihr „Baby“ beschreiben, steht diese Metapher dafür, wie eine Mutter oder ein Vater Ihr „Baby“ großgezogen zu haben. Das bedeutet auch, es oftmals wichtiger als die eigenen Bedürfnisse genommen und Krisen durchgestanden zu haben. Beim gemeinsamen Großwerden Erfolge gefeiert zu haben. Nun soll dieses „Kind“ auf eigenen Beinen stehen – unter der Führung eines anderen. Das ruft unweigerlich gemischte Gefühle hervor: Neben Stolz darauf, was man geschaffen hat, auch die Angst davor, was daraus werden könnte, wenn man selbst nicht mehr täglich mitmischt.
„Es war, als würde ich mein eigenes Kind weggeben. Rein rational betrachtet war mir klar, dass es so sein musste, aber emotional war es ein großer Schmerz“, berichtet ein Unternehmer rückblickend über den Tag der Übergabe.
Diese emotionale Bedeutung sollten Sie keinesfalls unterschätzen. Sie ist normal und gehört dazu. Eine Unternehmensnachfolge ist immer auch ein großer Abschied von einer prägenden Lebensphase, und solche Abschiede fallen naturgemäß schwer.
Warum Loslassen so schwerfällt
Was macht es eigentlich so schwer, loszulassen? Es sind nicht die juristischen Verträge oder die finanziellen Aspekte allein, die Ihnen Bauchschmerzen bereiten. Vielmehr spielen innere, psychologische Faktoren eine große Rolle – Ihr Leben verändert sich grundlegend. Drei Aspekte sind dabei besonders wichtig:
1. Identität: Über Jahre oder Jahrzehnte haben Sie sich mit Ihrem Unternehmen identifiziert – und umgekehrt. Sehr wahrscheinlich stehen Sie mit Ihrem Gesicht und Ihrem Namen für den guten Ruf Ihrer Firma. In Ihrer Branche sowie Ihrer Region kennt man Sie als „die Chefin von X“ oder „den Inhaber von Y“. Wenn Sie dieses Amt abgeben, stellen Sie sich zwangsläufig die Frage: Wer bin ich ohne mein Unternehmen? (Genau diesem Thema widmen wir uns ausführlich später). Ihr Unternehmersein ist Teil Ihrer Identität und Ihres Selbstwertgefühls geworden, als wäre es ein Teil Ihres Körpers. Loszulassen bedeutet daher auch, einen Teil dieser Identität, und damit von sich selbst, loszulassen – oder neu zu definieren.
2. Kontrolle: Als Unternehmerin oder Unternehmer hatten Sie die Zügel jahrelang fest in der Hand. Sie haben die Entscheidungen getroffen, von der Strategie bis zur Farbe des Firmenlogos. Die Gewissheit, alles unter Kontrolle zu haben, gibt Sicherheit. Diese Kontrolle nun abzugeben, fühlt sich an, als würde der Boden unter Ihren Füßen weggezogen. Plötzlich bestimmt jemand anderes die Geschicke Ihres Unternehmens – selbst wenn es die eigene Tochter oder ein ausgewählter Nachfolger ist, kann es nicht das Gleiche sein. Die Frage drängt sich auf: Wird mein Nachfolger die richtigen Entscheidungen treffen? Kann ich darauf vertrauen, dass mein Lebenswerk in meinem Sinne weitergeführt wird? Kontrolle abzugeben bedeutet, auf Vertrauen umzuschalten – was leichter gesagt als getan ist.
3. Lebensinhalt: Ihr Unternehmen gibt Ihrem Leben als Dreh- und Angelpunkt Ihres Tuns Struktur und Sinn. Täglich gebraucht zu werden, Probleme zu lösen, Verantwortung zu tragen – all das stiftet Sinn und gibt Ihrem Leben Bedeutung. Viele Unternehmerinnen und Unternehmer fürchten, ohne die Firma ins Leere zu fallen. Der Terminkalender, einst übervoll, könnte sich bedrohlich leeren. Morgens kein klares Ziel mehr vor Augen zu haben, das einen ohne Wenn und Aber aus dem Bett treibt, keine Mitarbeiter, die auf Ihre Entscheidungen warten – dieser Gedanke verursacht Unruhe.
Diese drei Aspekte – Identität, Kontrolle, Lebensinhalt – tragen erheblich dazu bei, dass Loslassen schwerfällt. Hinzu kommt die Ungewissheit: Was kommt danach? Wird es mich gleichermaßen erfüllen, wie meine Rolle bisher? Wenn Sie nicht wissen, was Sie mit der neu gewonnenen Zeit anfangen sollen, wirkt der Schritt wie eine Zumutung (auch darauf kommen wir zurück).
Vertrauen in die nächsten Hände gewinnen
Eine zentrale Frage bei jeder Nachfolge lautet: In wessen Hände gebe ich mein Lebenswerk? Das Vertrauen in den oder die Nachfolger*in ist entscheidend für Ihr eigenes Loslassen. Stellen Sie sich vor, Sie übergeben den Staffelstab aber sind sich unsicher, ob die nächste Läuferin ihn sicher übernehmen und ins Ziel bringen wird. Dieses Bild zeigt, warum viele Senior-Chefs nur zögerlich loslassen: Solange Zweifel bestehen, hält man den Stab lieber noch ein bisschen länger fest.
Vielleicht haben Sie bereits eine Person ins Auge gefasst – sei es ein Familienmitglied, eine langjährige Führungskraft oder ein externer Käufer, der Ihr Unternehmen übernehmen könnte. In jedem Fall geht es darum, dem „Neuen“ den Boden zu bereiten und anschließend darauf zu vertrauen, dass er in Ihre frühere Aufgabe Stück für Stück hineinwachsen wird. Vertrauen muss wachsen: durch gemeinsame Erfahrungen, durch langsam übergebene Verantwortung und durch regelmäßige offene Gespräche. Jeder Nachfolger, der schlecht vorbereitet Verantwortung übernimmt, wird es schwer haben, Ihr volles Vertrauen zu gewinnen.
Deshalb beginnen viele erfolgreiche Übergaben frühzeitig. Beispielsweise übertragen Unternehmer ihren potenziellen Nachfolgern Schritt für Schritt formal mehr Verantwortung: erst die Leitung eines wichtigen Projekts, dann die gesamte Vertriebsabteilung, später vielleicht Prokura oder die operative Geschäftsführung, während man selbst als Mentor in die zweite Reihe geht. Aus dieser Position heraus können Sie daran teilhaben, wie Ihr Nachfolger agiert, und lernen, Schritt für Schritt auf seine Entscheidungen zu vertrauen und loszulassen. Gleichzeitig gewöhnt sich Ihr Team an einen neuen Ansprechpartner und lernt, im Tagesgeschäft ohne Sie auszukommen. Loslassen heißt nicht, von heute auf morgen weg zu sein – es bedeutet, verlässlich Raum zu geben.
„Am Anfang habe ich ständig ins Tagesgeschäft reingeredet“, erzählt eine Unternehmerin, die an ihre Tochter übergeben hat. „Aber mit jeder Woche, in der ich erkannte, dass sie alles im Griff hat, konnte ich mehr auf Abstand gehen. Irgendwann habe ich gemerkt: Sie braucht mich gar nicht mehr – und das war ein schmerzhafter und zugleich guter Moment.“
Diese Aussage zeigt, wie Vertrauen wachsen kann: durch die Gewährung von Freiraum, aus dem positive Erfahrungen entstehen. Natürlich kann es auch holprige Phasen geben, ganz sicher macht Ihr Nachfolger Fehler – so wie jeder von uns. Genau wie Sie und wir wird er jedoch daraus seine Schlüsse ziehen und es das nächste Mal besser machen. Wichtig ist, dass Sie ganz bewusst eine gemeinsame Basis für Vertrauen schaffen. Dazu gehören klare Absprachen, aber auch das innere Verständnis: Neben Ihrem Weg kann es andere richtige Wege geben. Ihr Nachfolger wird manches anders machen, aber ebenso erfolgreich sein wie Sie. Neue Hände können dem Unternehmen auch frischen Schwung geben.
Das Vermächtnis bewahren
Jedes Lebenswerk hat einen Kern, ein Vermächtnis, das Ihre Berufslebensphase überdauern soll. Vielleicht ist es die Firmenphilosophie, für die Sie stehen, eine bestimmte Unternehmenskultur, ein Qualitätsanspruch oder die besondere Verantwortung gegenüber Ihren Mitarbeitern und Kunden. Eine große, nicht ganz unberechtigte Sorge beim Loslassen ist: Wird dieses Vermächtnis gewahrt bleiben?
Hier hilft es, sich klarzumachen, was genau Sie weitergeben möchten. Oft lohnt es sich, das bewusst zu formulieren und vielleicht auch aufzuschreiben. Zum Beispiel: „Mir ist wichtig, dass dieses Unternehmen weiterhin familienfreundlich geführt wird und die Mitarbeiter sichere Arbeitsplätze haben.“ Oder: „Innovation und Handwerkskunst sollen auch in Zukunft unsere Markenzeichen sein.“ Kommunizieren Sie diese Werte und Prinzipien deutlich an Ihren Nachfolger. So geben Sie ihm Leitplanken mit auf den Weg und helfen ihm zu verstehen, an welche bisher im Unternehmen wirksame Werthaltung er als Nachfolger anknüpfen wird.
Gleichzeitig dürfen Sie akzeptieren, dass jede Führungspersönlichkeit eigene Akzente setzen wird. Ihr Nachfolger ist kein Klon von Ihnen – und das ist gut so. Eine Firma muss sich weiterentwickeln können. Ihr Vermächtnis besteht nicht darin, alles bis in alle Ewigkeit unverändert zu lassen, sondern die grundlegenden Werte und Visionen zu erhalten, während sich das Unternehmen an neue Gegebenheiten anpasst.
Denken Sie an berühmte Familienunternehmen: Oft hat der Firmengründer eine starke Kultur etabliert. Die nächste Generation respektiert diese Kultur, aber sie führt neue Ideen ein, passt das Geschäftsmodell an die Zeit an – und genau dadurch bleibt das Unternehmen lebendig. Ihr Ziel sollte sein, dass man auch in zehn oder zwanzig Jahren noch spürt, wofür Ihr Name stand, selbst wenn Sie nicht mehr täglich im Büro sind und nun andere Ihr Unternehmen prägen.
Die Übergabe als Meisterstück
Viele Unternehmerinnen und Unternehmer berichten, dass die Nachfolge die anspruchsvollste Herausforderung ihrer Karriere war – anspruchsvoller als so manche Unternehmenskrise. Tatsächlich verlangt die Übergabe all Ihre Fähigkeiten: strategisches Denken, langfristige Planung, menschliches Feingefühl und Mut. Man könnte sagen, eine gelungene Unternehmensnachfolge ist das Meisterstück am Ende Ihrer Unternehmertätigkeit. Es ist die letzte große unternehmerische Aufgabe, die nur Sie selbst anstoßen können.
Warum Meisterstück? Weil es Ihr Können als Unternehmer noch einmal unter Beweis stellt: Nicht nur im Aufbau einer Firma erfolgreich zu sein, sondern auch darin, sie erfolgreich in eine Zukunft ohne Sie zu führen. Es geht darum, dafür zu sorgen, dass das „Feuer“ Ihres Unternehmens weiterbrennt, auch wenn Sie selbst einen Schritt zurücktreten. Wer diese Aufgabe, sich selbst als Chef ersetzbar zu machen, meistert, darf mit Recht stolz sein – genauso stolz, wie Sie es vielleicht nach der Gründung oder Übernahme Ihres Unternehmens waren.
Das erfordert, wie jede große Aufgabe, Vorbereitung und Entschlossenheit. Es ist eine bewusste Entscheidung notwendig, die Nachfolge zu regeln, genau wie einst der bewusste Entschluss nötig war, das Unternehmen zu gründen oder fortzuführen. Viele schieben diesen Schritt hinaus, weil er unangenehm ist (dazu mehr in Kapitel 4). Doch je früher Sie sich dem Thema stellen, desto mehr Gestaltungsspielraum haben Sie. Sie können Ihren Nachfolgeprozess aktiv steuern, anstatt eines Tages von Umständen (Alter, Krankheit, Angebote von Käufern) getrieben zu werden.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Ihr Lebenswerk in neue Hände zu geben, ist emotional herausfordernd, aber es kann gelingen. Mit Verständnis für die eigenen inneren Widerstände, mit wachsendem Vertrauen in den oder die Richtige(n) sowie mit klarer Kommunikation Ihres Vermächtnisses legen Sie den Grundstein. Jeder Weg ist individuell – aber niemand muss ihn ganz allein gehen. Im nächsten Schritt wagen wir einen tiefen Einblick: Was macht Ihre Identität als Unternehmer aus, und wie können Sie Ihr Unternehmen loslassen, ohne sich dabei selbst zu verlieren?
Was Sie sich fragen sollten ...
Wie fühlt es sich an, wenn Sie daran denken, Ihr „Lebenswerk“ in andere Hände zu geben? (z.B. Stolz, Angst, Erleichterung, Trennungsschmerz)
Woran würden Sie merken, dass Ihr Nachfolger oder Ihre Nachfolgerin „der Richtige“ bzw. „die Richtige“ ist? Welche Eigenschaften, Fähigkeiten oder Handlungen würden Ihnen dieses Vertrauen ermöglichen?
Welche Aspekte Ihres Unternehmens sind Ihnen so wichtig, dass sie auf jeden Fall erhalten bleiben sollen? (Werte, Kultur, Umgang mit Mitarbeitern, Qualität, Kundenbeziehungen, etc.)
Haben Sie schon eine Vorstellung, was Sie nach der Übergabe in Angriff nehmen möchten? Wenn nein, was könnte Ihnen helfen, eine positive Perspektive auf die Zeit nach dem Unternehmerdasein zu entwickeln?
Was Sie tun können ...
Frühzeitig planen: Warten Sie nicht auf den „perfekten“ Zeitpunkt. Denn dieser wird niemals kommen. Beginnen Sie früh, über Nachfolge nachzudenken – idealerweise ein Jahrzehnt im Voraus. So bleibt genügend Zeit, einen geeigneten Nachfolger zu finden oder aufzubauen.
Kriterien definieren: Überlegen Sie sich konkret, welche Kriterien Ihr Nachfolger erfüllen sollte (fachlich, als Führungspersönlichkeit, Werteverständnis). Diese Klarheit hilft bei der Entscheidung und im Auswahlprozess.
Vertrauen aufbauen: Laden Sie einen potenziellen Nachfolger ein, schrittweise Verantwortung zu übernehmen. Vereinbaren Sie z.B. Probephasen oder Projekte, in denen Sie sich bewusst zurücknehmen und nur beobachten. So stärken Sie gegenseitig das Vertrauen.
Werte und Wissen weitergeben: Nehmen Sie sich Zeit, Ihr Erfahrungswissen weiterzugeben – sei es in gemeinsamen Gesprächen, indem Sie Kontakt zu wichtigen Geschäftspartnern herstellen oder Ihr wertvolles Erfahrungswissen dokumentieren. Dadurch stellen Sie sicher, dass Ihr Nachfolger die DNA des Unternehmens versteht.
Holen Sie sich Rat: Sprechen Sie mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern, die ihre Nachfolge bereits geregelt haben. Wie sind sie vorgegangen? Was würden sie im Rückblick anders machen? Solche Gespräche öffnen oft neue Perspektiven und zeigen: Sie sind nicht allein mit dieser Herausforderung und andere haben sie bereits gemeistert.
Planen Sie schon heute den feierlichen Übergang: Welcher Übergabe-Festakt wäre ein würdiger Abschluss? Wenn Sie heute an eine Feier mit Mitarbeitern und Geschäftspartnern oder ein anderes symbolisches Ritual denken, fühlt sich das gut an? Wie wäre ein runder Abschluss denkbar, der Ihr Lebenswerk würdigt, Ihren bisherigen Begleitern und Ihnen die Möglichkeit gibt, bewusst voneinander mit einem lachenden und einem weinenden Auge Abschied zu nehmen und Ihnen allen den Neuanfang greifbar und positiv erscheinen lässt.
2. Identität im Wandel vorbereiten – Wer bin ich ohne mein Unternehmen?
Ein Montagmorgen ohne Montagsmeeting. Anna Berger, ehemals Geschäftsführerin ihres eigenen mittelständischen Unternehmens, sitzt um 8:30 Uhr auf ihrer Terrasse mit einer Tasse Kaffee. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten hat sie keine E-Mails, die dringend beantwortet werden müssen, keine Telefonkonferenz, keine Besprechung im Kalender. Die Firma führt nun ihr Sohn weiter, offiziell seit einer Woche. Die Stille fühlt sich seltsam an. Anna blickt in den Himmel und fragt sich: „Und was jetzt?“ Ein Gefühl von Leere beschleicht sie, wo früher Tatendrang war.
Viele Unternehmerinnen und Unternehmer erleben nach der Übergabe ihres Unternehmens einen regelrechten Identitätsschock. Wer bin ich, wenn ich nicht mehr die Chefin oder der Chef bin? Diese Frage kann beängstigend sein. Schließlich haben Sie einen Großteil Ihres Lebens als Unternehmer verbracht. Ihre Arbeitstage, Ihr soziales Umfeld, ja sogar Ihr Selbstwertgefühl – all das war eng verknüpft mit Ihrem Unternehmen. Wenn diese Klammer plötzlich wegfällt – und sei es durch eigenes Zutun – kann es sich so anfühlen, als würde man ins Bodenlose fallen.
Der Übergang vom aktiven Unternehmer zum “Ehemaligen” konfrontiert einen mit der Aufgabe, sich jenseits von Umsatzkennzahlen und Entscheidungsbefugnissen neu zu verorten. Am besten, bevor es tatsächlich losgeht. Das ist ein zutiefst emotionaler Prozess, der häufig in der Planung der Nachfolge nicht mitgedacht wird. Doch gerade hochengagierte Unternehmer – wie Sie, liebe Leserin oder lieber Leser – spüren die Tiefe dieser Veränderung auf Sie zukommen. Es gilt, sich intensiv damit auseinanderzusetzen, was es bedeutet, die alte Identität loszulassen und neue Identitätsanker zu finden.
Das Ich im Spiegel meiner Verantwortung
Unternehmersein ist mehr als ein Beruf – für viele ist es die Lebensrolle. Ihr „Ich“ spiegelt sich im Spiegel der Verantwortung, die Sie täglich tragen. Als Unternehmenslenker hatten Sie das Gefühl: Alle zählen auf mich. Entscheidungen, die Sie treffen, beeinflussen Mitarbeiter, Kunden, ja das gesamte Unternehmensschicksal. Diese Verantwortung prägt die Identität. Sie gibt Struktur und Sinn: morgens aufzuwachen und zu wissen, dass man gebraucht wird, verleiht einem das Gefühl von Bedeutung.
Viele Unternehmer berichten, dass sie sich selbst in und durch die Rolle des Verantwortlichen erkannt haben. Die Position an der Spitze wurde zum Spiegelbild der eigenen Neigungen, Fähigkeiten und Werthaltung. Erfolg und Misserfolg des Unternehmens waren unmittelbar mit dem Selbstwert verknüpft. Wenn alles gut lief, stieg das eigene Selbstvertrauen – man sah sich bestätigt als kompetent und stark, ausgestattet mit einem inneren Kompass, der zu Erfolg führt: “ich bin der Kapitän, der das Schiff sicher steuert.” Doch diese enge Kopplung hat auch Kehrseiten: Wie trenne ich mich vom Steuer und was passiert, wenn ich es aus der Hand gebe?
In der täglichen Führungsarbeit verschwimmen die Grenzen zwischen Person und Position. Vielleicht haben Sie es selbst erlebt: Kollegen und Freunde behandeln einen selbst in der Freizeit in erster Linie als “den Chef”. Die Selbstwahrnehmung wird davon geprägt, wie andere einen sehen – nämlich als Entscheidungsträger, Macher und Ansprechpartner für Probleme aller Art. Im Spiegelbild der anderen werde ich in dem bestätigt, was ich ohnehin fühle: Ich bin ein Unternehmer, durch und durch. So werden wir zu dem, was wir tun, denn das Ich formt sich am Feedback zu der Verantwortung, die man trägt.
Doch was geschieht mit diesem Spiegel, wenn die Verantwortung (ver-)schwindet? Plötzlich fällt eine zentrale Quelle der Selbstbestätigung weg. Ohne die tägliche Führungsrolle fehlt das vertraute Feedback: Keine Strategie-Meetings mit herausfordernden Themen mehr, in denen alle wie gebannt auf Ihre Worte warten; keine Unterschriften mehr, die Großes bewirken; kein voller Terminkalender, der Ihnen zeigt, wie unverzichtbar Sie sind. Dieser Moment kann ernüchternd sein und sollte gut vorbereitet werden.
Beispiel: Ein Familienunternehmer, Herr Müller, der nach 35 Jahren an der Spitze sein Unternehmen an seine Tochter übergab, formulierte es so: „Plötzlich war da eine seltsame Stille am Morgen. Kein Anruf, keine E-Mails, in denen Entscheidungen von mir verlangt wurden. Ich fragte mich: Wenn mich heute niemand braucht – wer bin ich dann überhaupt?“ Diese bewegende Frage zeigt, wie eng Identität und Verantwortungsgefühl miteinander verwoben sind.
Bitte nehmen Sie sich einen Moment und fragen sich selbst: Wie groß ist der Anteil Ihrer Identität, den Sie über Ihre Rolle im Unternehmen definieren? Stellen Sie sich vor, Sie würden einem Fremden beschreiben, wer Sie sind – ohne Ihre Position oder Ihren Firmennamen zu erwähnen. Was würden Sie sagen? Welche Eigenschaften, Werte, Wünsche oder Ziele machen Sie jenseits des Unternehmerseins aus? Was berührt Ihr Herz auf vergleichbare Weise wie unternehmerisches Tun?
Diese Fragen werden möglicherweise für Sie ungewohnt sein, doch mit ihnen legen Sie den Grundstein für die kommenden Veränderungen. Indem Sie erkennen, wie stark Ihr Ich durch die Führungsverantwortung geprägt und bestätigt wurde, gewinnen Sie Klarheit darüber, was beim Loslassen dieser Verantwortung zu tun ist. Es geht nicht darum, die Vergangenheit zu negieren – im Gegenteil: nehmen Sie bewusst wahr und freuen Sie sich darüber, was Sie als Unternehmerpersönlichkeit ausmacht. Verstehen Sie aber zugleich, dass Ihre Persönlichkeit mehr ausmacht als Chef zu sein. Ihre anderen Facetten, die in den vergangenen Jahren weniger zur Geltung kamen, dürfen nun stärker gelebt werden.
Begreifen Sie das als Chance. Die Kunst ist nun, den Übergang aktiv zu gestalten, anstatt sich ihm ausgeliefert zu fühlen. Und dazu gehört, neue Quellen der Identität zu erschließen, bevor die alten ganz versiegen.
Selbstdefinition jenseits der Visitenkarte
Die vielleicht wichtigste Erkenntnis in dieser Umbruchphase lautet: Sie sind mehr als Ihre Rolle im Unternehmen. So bedeutsam Ihr Schaffen als Unternehmer war – nutzen Sie die Zeit im Übergang, die anderen Facetten Ihrer Persönlichkeit mit Leben zu füllen. Es geht um Ihre Selbstdefinition jenseits der Chef-Visitenkarte.
Stellen Sie sich vor, Sie legen Ihre bisherige Visitenkarte zur Seite. Welche “Titel” könnten nun auf Ihrer neuen, persönlichen Visitenkarte stehen? Vielleicht Mentor? Investor? Familienmensch? Hobby-Pilot? Weltreisender? Oder ganz einfach: starke Persönlichkeit mit vielfältigen Interessen, so wie es immer war. Wichtig ist nur: Es gibt ein Leben und eine Identität jenseits der Geschäftsführertätigkeit. Diese wartet darauf, von Ihnen bewusst geformt zu werden.
Der erste Schritt ist die Selbstreflexion: Welche Werte, Wünsche, Bedürfnisse und Leidenschaften haben Sie vielleicht zugunsten des unternehmerischen Alltags zurückgestellt? Worauf freuen Sie sich, wenn Sie über mehr freie Zeit verfügen? Zum anderen erfordert es Experimentierfreude: Eine neue Rolle wie ein neues Kleidungsstück auszuprobieren und herauszufinden, ob sie einem steht, bevor man sich darauf festlegt.
Identitätsentwicklungsstrategie für die Zeit danach
Meine Werthaltung und Talente ergründen: Machen Sie sich bewusst, welche Fähigkeiten und Eigenschaften Sie unabhängig von Ihrer Firmenrolle auszeichnen. Fragen Sie sich selbst und vielleicht auch Menschen in Ihrem Umfeld: Was zeichnet mich aus? Bin ich kreativ, analytisch, empathisch und visionär? Welche Werte treiben mich an – z.B. Wissensdurst, Gerechtigkeitssinn, Hilfsbereitschaft, Schaffensdrang? Diese Persönlichkeitsmerkmale bleiben Ihnen erhalten, egal ob Sie ein Unternehmen führen oder nicht. Sie bilden neben den bisher weniger gelebten Facetten das Fundament Ihrer neuen Identität. Schreiben Sie Ihre Top-5-Werte und -Talente auf. Überlegen Sie, in welchem neuen Kontext Sie diese einbringen könnten. Wo werde ich mit meinen Fähigkeiten und Neigungen gebraucht? Was von mir kam bisher eher zu kurz und kann mein Leben noch bunter machen, als ich es bisher erlebt habe? Was macht mir Freude neben den gewohnten Pfaden des Engagements?
Neue Rollen erkunden: Viele Ex-Unternehmer finden Erfüllung durch die Weitergabe ihres Wissens. Sie können planen, Mentor für junge Nachfolger anderer Unternehmen oder für Gründer zu werden, in Beiräten oder Verbänden mitzuwirken oder als Dozent an einer Hochschule Ihr Fachwissen zu teilen. Andere stürzen sich in soziale Projekte oder bringen sich in einer Stiftung ein und stellen so ihr strategisches Denken in den Dienst einer anderen großen Sache, die anders als früher nicht dem eigenen Unternehmen nutzen muss. Wieder andere nehmen geliebte Hobbies wieder auf – sei es Sport, Kunst oder Reisen – und entdecken darin neue Identitätsanker (z.B. als Fotograf, Bergsteigerin, Pilot, Musiker...). Trauen Sie sich, etwas Neues auszuprobieren, mit der Zuversicht, dass diese Rolle Sie erfüllen wird, auch wenn sie anfänglich weniger vertraut als ihre bisherige Rolle ist.
Schrittweiser Übergang: Ideal ist, wenn Sie bereits vor dem endgültigen Ausscheiden als Geschäftsführer kleine Schritte in neue Lebensbereiche machen. Zum Beispiel können Sie in den letzten Monaten Ihrer aktiven Zeit die Arbeitsbelastung etwas reduzieren und freie Tage für Neues nutzen. Nehmen Sie an Workshops teil, gehen Sie Ihren eher vernachlässigten Hobbies nach, besuchen Sie Konferenzen jenseits Ihrer Branche, knüpfen Sie Kontakte in Bereiche, die Sie interessieren. Diese Schnupperphase wird Ihnen dabei helfen, erste Eindrücke neuer Rollen und noch nicht erprobter Identitätsanker zu gewinnen. So fällt Ihnen der Sprung ins kalte Wasser nach der Übergabe leichter, weil Sie schon mal den kleinen Zeh hineingehalten haben.
Austausch und Unterstützung suchen: Sie sind nicht allein mit diesen Fragen. Vernetzen Sie sich mit anderen Unternehmern, die sich wie Sie in der Übergangsphase befinden. In vielen Regionen gibt es Austauschformate für Unternehmensnachfolger genauso wie für scheidende Gesellschafter-Geschäftsführer, oft initiiert von Kammern oder Verbänden. Der Austausch mit Gleichgesinnten, die gerade Ähnliches erleben, wirkt ungemein entlastend und verbindend. Auch ein auf die Begleitung von persönlichen Veränderungen spezialisierter Coach oder Therapeut kann bei der Ausgestaltung neuer Rollen helfen. Professionelle Begleitung ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von der Einsicht, in diesem Bereich möglicherweise kein Experte zu sein – Sie investieren damit in Ihre persönliche Zukunft.
Geduld mit sich selbst haben: Identitätsentwicklung ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Geben Sie sich Zeit, ihr neues Selbstbild zu finden und zu stabilisieren. Anfangs mag es sich noch nicht rund anfühlen. Vielleicht probieren Sie manches aus und verwerfen es wieder. Das ist normal. Mit der Zeit werden Sie spüren, was Ihnen wirklich entspricht und sich darauf zu konzentrieren.
Beginnen Sie eine Art Tagebuch, um den Übergang emotional zu verarbeiten. Notieren Sie regelmäßig Ihre Gedanken und Gefühle zum Loslassen und Neubeginn. Schreiben Sie Ihre Zukunfts-Ideen auf – überraschen Sie sich selbst, ohne Zensur, ruhig kühn und kreativ. Dieses Notizbuch wird zu Ihrem Begleiter der Identitätsveränderung. Gehen Sie darin gedanklich spazieren und freuen sich beim Lesen, welche Fortschritte Sie machen und welche neue Formen Ihr Leben nach dem Unternehmerdasein annimmt und wie sich damit Stück für Stück Ihre Perspektive auf Ihr bisheriges und neues Leben verändert. Eine Brücke zwischen Alt und Neu entsteht.
Beispiel: Herr Krauß, ein 62-jähriger Unternehmer im Maschinenbau, erkannte in seiner Übergangsphase, dass ihm vor allem die gewohnte Rolle als Problemlöser fehlte: das Gefühl, wegen seiner Fähigkeit, knifflige Situationen zu meistern, gebraucht zu werden. Weil er nicht in diesem Verlustgefühl stecken bleiben wollte, begann er, junge Startups als Business Angel zu unterstützen. Dort fand er für sich eine neue passende Aufgabe. Nach wie vor als Problemlöser, nun aber für andere Gründer. “Ich bin zwar nicht mehr CEO,” reflektiert er, “aber als Mentor und Investor habe ich eine neue Identität gefunden. Ich bin eine Mischung aus Ratgeber, Türöffner und manchmal auch Seelsorger für die Jungen – und das erfüllt mich enorm.” Dieses Beispiel zeigt: Die Kompetenz und das, wofür das Herz als Unternehmer schlägt, können in einem neuen Gewand weiterleben.
Schließlich lohnt ein Blick auf die Frage der sozialen Identität: Bisher war man “der Chef von Firma X” in seinem Umfeld. Künftig werden die Leute fragen: “Und, was machst du jetzt so?” – Diese Frage muss keinen Angstschauer auslösen. Sie ist vielmehr Ihre Chance, das Narrativ Ihrer neuen Lebensphase selbstbewusst zu gestalten. Antworten Sie nicht entschuldigend mit “Ich bin im Ruhestand” (es sei denn, das Wort Ruhestand erfüllt Sie mit Stolz und Erleichterung, was durchaus sein kann!). Sie können antworten: “Ich habe mein Unternehmen übergeben und widme mich nun neuen Projekten – ich berate zum Beispiel junge Unternehmer.” Oder: “Nach 30 Jahren in der Industrie konzentriere ich mich nun auf ehrenamtliche Arbeit und unternehme die Reisen, die ich immer machen wollte, aber keine Zeit dafür hatte.” Finden Sie eine Formulierung, die positiv und zukunftsgerichtet ist und in der Sie sich wiedererkennen. Das hilft nicht nur im Gespräch in ihrem sozialen Umfeld, sondern vor allem Ihnen selbst, Ihr neues Selbstbild zu festigen und sich selbst zu erlauben, ein anderer zu werden.
Entwerfen Sie Ihre persönliche Kurzvita (“Elevator Pitch”) für die Zeit nach der Übergabe. Stellen Sie sich vor, Sie begegnen auf einer Veranstaltung jemandem, der sich für Ihren Alltag interessiert und fragt “Was machen Sie beruflich?” – Welche kurze Antwort haben Sie parat? Probieren Sie verschiedene Varianten aus, laut vor dem Spiegel oder mit vertrauten Personen als Zuhörer. Finden Sie jene Beschreibung, die Ihre neue Rolle so auf den Punkt bringt, dass Sie innerlich nicken und sagen: “Ja, das bin ich.” Diesen Satz dürfen Sie ruhig immer wieder innerlich aufsagen – er wird Ihnen Sicherheit geben, wenn Sie ihn künftig tatsächlich verwenden.
Zum Schluss sei betont: Ihre Identität befindet sich nicht in der Auflösung, sondern in einem Umbruch, den Sie beeinflussen können. Begreifen Sie Übergänge als eine Zeit, in der Verunsicherung und Chance quasi Hand in Hand gehen. Die Psychologie kennt dafür den Begriff der Statuspassage – eine Übergangszeit, in der das Alte nicht mehr und das Neue noch nicht ist. Sobald Sie im neuen Status in einer anderen Rolle angekommen sind, werden Sie bemerken, dass Sie aus der Veränderung gestärkt hervorgehen, wenn Sie bewusst einen Schritt nach dem anderen gegangen sind. Sie haben als Unternehmer unzählige Herausforderungen gemeistert, sich ständig angepasst und weiterentwickelt – genau diese Fähigkeit hilft Ihnen nun bei der größten unternehmerischen Aufgabe in eigener Sache: der Neudefinition Ihres Selbst als „Nicht-mehr-Unternehmer“.
“Wer keinen neuen Lebensinhalt hat, kann nicht abgeben.” – Dieses treffende Wort der Nachfolge-Expertin Lioba Heinzler sei Ihnen ans Herz gelegt. Sorgen Sie also dafür, dass Sie einen neuen Lebensinhalt finden oder entwickeln. Dann wird es Ihnen leichter fallen, Ihrem Nachfolger Vertrauen zu schenken und frei agieren zu lassen. Zugleich fördern Sie Ihr eigenes zukünftiges Wohlbefinden. Identität im Wandel bedeutet Arbeit an sich selbst – aber denken Sie schon heute an die reiche Ernte und freuen sich auf den Moment, in dem Sie sagen werden: Ich bin mehr als mein Unternehmen, und ich weiß nun, wer ich jenseits davon sein und tun will.
Ihre Fragen für den Übergang
Folgende Fragen können Ihnen dabei helfen, die eigenen Gedanken zu sortieren. Steigen Sie aus dem Gedankenkarussell aus und geben Sie Ihrem Übergang eine haltgebende Ordnung:
Welche Rollen und Tätigkeiten machen mich aktuell aus – und welche davon entfallen mit der Übergabe?
Wenn ich schonungslos auf meine letzten Jahre als Unternehmer blicke: Was hat mich innerlich wirklich erfüllt – und was habe ich eher aus Pflicht oder Gewohnheit getan?
Welche Facetten meines Selbst habe ich in den letzten Jahrzehnten möglicherweise wegen meinem Fokus aufs Unternehmerische vernachlässigt (z. B. Kreativität, Spiritualität, Familie, Abenteuerlust)?
Gibt es Vorbilder in meinem Umfeld, die einen erfolgreichen Rollenwechsel gemeistert haben – und was kann ich von ihnen lernen?
Bin ich bereit, mich auf eine neue Selbstdefinition einzulassen – auch wenn sie Zeit braucht und Kraft kosten wird?
Kurz und bündig: Was Sie im Übergang tun können
Tagebuch führen: Beginnen Sie ein persönliches Reflexionstagebuch, in dem Sie regelmäßig notieren, was Sie aktuell erfüllt, worauf Sie stolz sind und was Sie vermissen. Diese Selbstbeobachtung hilft Ihnen, die Veränderung emotional zu verarbeiten.
Ihr Potenzial erkennen: Verschriftlichen Sie Ihre Fähigkeiten und Neigungen. Was liegt Ihnen? Was macht Sie wirksam und erfolgreich? Fragen Sie sich: In welchem Lebensbereich könnten Ihre Stärken künftig zur Geltung kommen – jenseits der Unternehmensführung?
Mit neuen Rollen experimentieren: Probieren Sie aktiv neue Rollen aus – zum Beispiel als Mentor, Investor, Ehrenamtlicher oder Künstler. Machen Sie erste Schritte, ohne sich gleich festzulegen. Erlauben Sie sich ein ergebnisoffenes Vorgehen, in dem kleine oder auch große Niederlagen erlaubt sind.
Die eigene Kurzvita: Entwickeln Sie eine „Visitenkarte Ihres neuen Selbst“ – eine Beschreibung Ihrer Person, die unabhängig von Ihrer bisherigen Funktion geworden ist. Üben Sie, sich in neuen Worten selbstsicher zu beschreiben.
Austausch: Tauschen Sie sich mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern aus, die die Übergabe bereits hinter sich haben oder wie Sie gerade damit Erfahrungen sammeln. Lernen Sie von ihren Wegen und Irrwegen in der Identitätsentwicklung.
3. Unbequeme Wahrheiten – Altern und Nachfolge als Tabu-Thema
Ein steriler Besprechungsraum in einer Bank, an einem verregneten Donnerstagnachmittag: Martin Scholz, 60, Geschäftsführer eines florierenden Zulieferbetriebs, sitzt mit seinem langjährigen Bankberater zusammen. Es geht um einen größeren Kredit für eine Betriebserweiterung. Der Berater blättert durch die Unterlagen, dann blickt er über den Rand seiner Brille: „Herr Scholz, wir bräuchten noch Angaben zu Ihrem Nachfolgekonzept, bevor wir den Kredit bewilligen können.“ Martin Scholz spürt, wie ihm heiß wird. Nachfolgekonzept? Er räuspert sich: „Nun ja... also, ich habe das natürlich im Blick...“ Er versucht, auszuweichen, doch der Berater lässt nicht locker: „Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, aber in Ihrem Alter... wir müssen sicherstellen, dass das Unternehmen langfristig solide geführt wird.“ – In Ihrem Alter. Diese Worte hallen in Martin Scholz nach. Was soll das denn bedeuten? Dass auf ihn als Unternehmer kein Verlass mehr ist? Er fühlt sich in der Defensive. Kaum 60 Jahre alt geworden, schon sehen andere in ihm den Chef von gestern. Der Rest des Gesprächs verschwimmt vor seinem inneren Auge. Das Thema Nachfolge – lange ausgeblendet – hat ihn kalt erwischt.





























