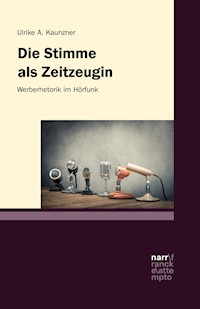
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Stimme kommt im Hörfunk eine bedeutende Rolle zu – sie prägt bis heute die Verkaufsstrategien dieses Werbeträgers und hat sich seit Beginn des Rundfunks stark verändert. Stimmen legen Zeugnis ab über gesellschaftliche Desiderate, soziale und wirtschaftspolitische Umstände; sie drücken die Gestimmtheit der Sprechenden aus und charakterisieren Rollenverhältnisse und Klischees. Dabei sind die deutlichsten Veränderungen bei weiblichen Stimmen zu verzeichnen. Die Autorin untersucht Werbespots unterschiedlicher Produktgruppen ab den 1950er Jahren, wobei neben der sprechwissenschaftlich-phonetischen Charakterisierung der Sprechstimmen die Frage nach der Rolle der Stimme als Zeitzeugin in der Verkaufsrhetorik gestellt wird. Der Band richtet sich an Studierende und Lehrende der Fächer Sprech- und Sprachwissenschaft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ulrike A. Kaunzner
Die Stimme als Zeitzeugin - Werberhetorik im Hörfunk
Umschlagabbildung: Retro old microphones for press conference or interview on the desk. BrAt83 © Adobe Stock
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2021 · Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG
Dischingerweg 5 · D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
www.narr.de · eMail: [email protected]
ISBN 978-3-8233-8269-0 (Print)
ISBN 978-3-8233-0326-8 (ePub)
Inhalt
„Sprich, damit ich dich sehe.“ (Sokrates)
Vorwort
Seit etlichen Jahren ist es mir ein Anliegen, das Thema Stimme und Sprechweise historisch zu beleuchten. Schon zu Studienzeiten – vor allem im Rahmen meines Zusatz-Studiums der Sprechwissenschaft und -erziehung – faszinierte mich die Thematik. Als Mitglied des Regensburger Verbands für Werbeforschung erkannte ich den potenziellen Reichtum des Historischen Werbefunkarchivs der Regensburger Universitätsbibliothek, das die Quelle für meine Untersuchung darstellt. Die diachrone Analyse von drei Produktgruppen wurde schließlich zum Ausgangspunkt für eine umfassendere Studie, die das Genre Werbespot als historischen Beleg und gesellschaftliches Stimmungsbarometer, und speziell die Stimme als Zeitzeugin betrachtet.
Ein großes Dankeschön gilt Dr. Christoph Draxler für die Online-Umfrage, Prof. Dr. Sandra Reimann und Dr. Christian Gegner für konstruktive Gespräche. Eine wertvolle Bereicherung war der Austausch mit Prof. Dr. Antonie Hornung, Prof. Dr. Bernhard Schwetzler und Dr. Valentino Sani. Ich möchte weiter allen danken, die bei der Transkription, der Analyse, der Interpretation der Werbespots und der Korrektur geholfen haben: Eva Maier, Christiane Portele, Livia Seeber, Hannes Philipp, Kristina Scherzer, Martina Sauer, Dr. Marcus Sauer und nicht zuletzt meinem Mann für seine Unterstützung.
Immer mehr interessante Aspekte taten sich im Laufe der Untersuchung auf, so dass eine Eingrenzung der Fragestellungen von Nöten war. Die vorliegenden Ergebnisse sind folglich zugleich als Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen zu verstehen, was nicht zuletzt durch den regen Anklang bei öffentlichen Medien deutlich wurde.
Regensburg im Mai 2021 Ulrike A. Kaunzner
1Einführung: Reflexionen über Stimme
Die Stimme sagt vieles über die Sprecherin bzw. den Sprecher1 aus, der StimmklangStimmklang und das Gesagte beeinflussen die Hörenden, sind Moden und Gemütsschwankungen unterworfen; man spricht von „stimmig“, wenn die Stimme zu dem, was man sagt, passt. Stimme kann Indikator für Wahrheit sein (dann „stimmt“ das, was man sagt), bietet schließlich die Möglichkeit der Meinungsäußerung (man will eine „Stimme abgeben“). Das Wortfeld Stimme hat immense Ausmaße und Bedeutungsebenen, von denen im Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS) vier Bedeutungsgruppen herausgefiltert werden:2
Stimme physiologisch als „durch Schwingungen der Stimmbänder im Zusammenwirken mit Resonanzerscheinungen erzeugte Laute und Töne“, sei es in Bezug auf die SprechstimmeSprechstimme als auch auf die Singstimme, auf die Stimme bei Menschen und Tieren;
Stimme in der „Musik“, wenn in der Vokalmusik die Stimmen in einem Lied (z.B. Sopran oder Bass) oder in der Instrumentalmusik die unterschiedlichen Musikinstrumente einer Partitur und die diesen zugeteilte Melodie gemeint sind;
Stimme als „Meinungsäußerung, Willensbekundung“, die eine qualitative Bedeutung hat und für die Meinung einer Person steht, die beispielsweise kritisch, zweifelnd, wohlgesonnen oder neutral eingestellt sein kann; man spricht auch von der Stimme des Herzens, der Vernunft, des Gewissens etc.;
Stimme als „Willensäußerung des einzelnen bei einer Abstimmung, Wählerstimme“, wobei hier die Quantität im Vordergrund steht.
Der Stimme wurde schon in der antiken RhetorikRhetorikantike im Schritt der pronunciacioPronunciacio gebührende Bedeutung beigemessen; sie rufe im Hörer Gefühle und Stimmungen hervor, die für die Wirkung auf andere ausschlaggebend seien. Diese schon von QuintilianQuintilian und anderen griechischen und römischen Rhetorikern beschriebenen Eigenschaften galt es bereits in der Antike in Rede und Schauspiel zu entfalten. Sie seien, so Meyer-Kalkus (2008, S. 681), bis heute von unverminderter Aktualität, auch bei audiovisuellen MedienMedienaudiovisuelle.
Die Vorstellungen, die über Stimme, Sprechstil und Sprache transportiert werden, setzen Werbefachleute gezielt bei ihren Verkaufsstrategien ein, um ihre potenziellen Kunden und Käufer anzusprechen. Werbespots aus früheren Jahren sind somit nicht zuletzt historische Zeugnisse gesellschaftlicher, sozialpolitischer und wirtschaftspolitischer Umstände und Desiderate; sie drücken die Stimmung der Sprechenden aus und charakterisieren Rollenverhältnisse und Klischees.
Beim Hörfunk, der von einer doppelten Kommunikationssituation, nämlich der mündlichen und zugleich medialen, geprägt ist, steht das Gehörte, also die Stimme, der StimmklangStimmklang und die Sprechweise, im Mittelpunkt jeglicher Kommunikation; man spricht sogar von „StimmästhetikStimmästhetik“ als Teil der „Ästhetik der Rundfunkwerbung“. WerberhetorikRhetorikWerbe- als Form von Wirtschaftsrhetorik beschäftigt sich mit Medien, wobei der Hörfunk das wohl bedeutendste der audiovisuellen Medien in den Jahren der Nachkriegszeit bis zum Aufkommen des Fernsehens und dem Anbruch des darauf folgenden digitalen Zeitalters darstellt. MehrmedialitätMehrmedialität in der Werbung ist ein in jüngerer Zeit in den Fokus gerücktes Phänomen und hat die WerbeindustrieWerbeindustrie revolutioniert (vgl. Reimann, 2008). Nach und nach hat sich die Werbung von audio- auf videogestützte Werbeträger verlagert, und das, was früher mit Hilfe des Tons kreiert wurde, übernimmt heute das Bild direkt.
Dass aber gerade die Stimmen von Frauen zurzeit im besonderen Interesse der Forschung stehen, ist kein Zufall. Hat doch Stimme viel mit Selbstdarstellung und Selbstoffenbarung zu tun. Vor allem die Stimmlage, in der sich die Stimme den Hörenden offenbart, lässt auf die dahinter stehende Person schließen; und nicht nur das, sie enthüllt auch Trends, Moden und Konventionen, deren Zeugin sie ist. Erst seit der Erfindung des Phonographen 1877 durch Thomas Alva Edison kann die Stimme als Zeitzeugin auftreten, war sie vorher nicht speicherbar gewesen.
1.1Untersuchungsgegenstand und Begriffsdefinitionen
Die vorwiegend sprechwissenschaftlich verortete Arbeit lässt sich thematisch an einer interdisziplinären Schnittstelle zwischen Rhetorik, Phonetik, Werbung und Medien positionieren. In ihr geht es, bis auf wenige Vergleiche und Exkurse in einzelnen Passagen, ausschließlich um Hörfunkwerbung und um ihre Bedeutung in der SprechwissenschaftSprechwissenschaft und MedienwissenschaftMedien-wissenschaft. In der gegenwärtigen Werbeforschung gibt es wenige Untersuchungen zur Stimme in der Hörfunkwerbung (siehe hierzu Stöckl, 2007). Die linguistische Forschung stellt sprachwissenschaftliche, aber kaum sprechwissenschaftliche Untersuchungen in den Fokus, so dass die Untersuchung von Stimme und SprechweiseStimmeund Sprechweise in der Hörfunkwerbung als Desiderat angesehen werden kann.
Nur wenige Bibliotheken verfügen über nach Schwerpunkten archivierte Werbe- und TV-Spots (Zurstiege, 2016, S. 78–79). Eine Fundgrube stellt daher das Historische WerbefunkarchivWerbefunkarchiv als Teil des Regensburger Archivs für Werbeforschung (RAW) dar, welches Hintergrund dieser Ausführungen ist und das mit über 50000 Hörfunk-Werbespots eine wertvolle Quelle für ZeitzeugnisseZeitzeugnisse darstellt, die bis in die Zeit vor 1950 zurückreichen (siehe Kap. 5.2.1).1
Was die sprachwissenschaftlichen Untersuchungen von Hörfunkwerbung betrifft, so sei auf eine Reihe an jüngeren Werken (Herausgaben und einzelne Aufsätze) verwiesen, die zum Großteil im Zusammenhang mit dem RAW entstanden sind: Reimann, 2006; 2007; Greule & Reimann, 2007; Stöckl, 2007; Reimann, 2008a,b; Reimann & Sauerland, 2010; Reimann & Šichová, 2011; Falk, 2019.2
Das Anhören und die Analyse der historischen Spots lässt die Zeit in der BRD ab den 1950er Jahren wach werden und den gesellschaftlichen Wandel nachvollziehen, wenn man den Medien und dem WerbefunkWerbefunk einen Platz im „kulturellen Gedächtnis“ einräumt (Marßolek & Saldern, 1999, S. 11). Die Werbespots zeigen die Gesellschaft der damaligen Zeit: die Menschen mit ihren Träumen und Bedürfnissen in ihrem gesellschaftspolitischen Kontext. Die Stimmen der Sprechenden dokumentieren die Entwicklung von Sprache und GesellschaftGesellschaft und damit einen Teil der Geschichte der Bundesrepublik.
Obwohl [die Werbung] sich grundsätzlich der vorhandenen Werte, Normen, moralischen Vorstellungen und des spezifischen Alltagswissens der Rezipienten bedient, spielt sie zum Zweck der werblichen Inszenierung auch mit diesen und kann sie so sowohl reproduzieren als auch aufweichen. (Siegert & Brecheis, 2017, S. 72)
Über die gegenseitige Beeinflussung von Werbung und gesellschaftlichen TrendsTrends, über Werbung als Ausdruck des soziokulturellen, wirtschaftlichen, politischen, kunst- und kulturgeschichtlichen Profils einer Epoche gibt es ausführliche Abhandlungen (Bau, 1994; Bolten, 1996; Cölfen, 1999; Fährmann, 2006; Jia, 2002; Klüver, 2009; Kriegeskorte, 1995; Schmidt & Spieß, 1996; Siegert & Brecheis, 2017; Zurstiege, 2016).3 So orientiert sich Werbung nicht nur am Zeitgeist, Moden und Trends, sie fungiert auch als Trendsetter. Zurstiege (2016, S. 80) bringt es auf den Punkt:
Werbung orientiert sich am Zeitgeist, an den Moden und Vorlieben der Menschen, an allem, was in ist. Sie folgt Trends, in manchen Fällen setzt sie sie sogar. Die Werbung ist ein einflussreicher und aussagekräftiger Kulturfaktor moderner Gesellschaften, daran besteht weder bei Praktikern noch bei Forschern Zweifel.
Jeder Werbespot hat das Ziel, die Verbraucher zu erreichen; umgekehrt bestimmen die Gewohnheiten der Menschen die WerbeindustrieWerbeindustrie der jeweiligen Epoche. Das, womit man sich verführen lässt, ändert sich im Laufe der Zeit: die Formen der Persuasion, verbale Mittel (die gesprochene Sprache) und paraverbale Mittel (Stimme und Sprechweise). Dabei geht es zum einen die Frage nach der Art und Weise, wie Aufmerksamkeit geweckt wird (es muss auffallen), wie PersuasionPersuasion erfolgt (das wiederum muss gefallen) und schließlich, was die Beeinflussung auslöst (wie man es verkaufen kann).
In den 1950er Jahren erschien das jahrzehntelange Referenzwerk des Amerikaners Vance Packards Die geheimen Verführer4 und trug dazu bei, Werbung als unterschwellige BeeinflussungBeeinflussung in ein negatives Licht zu stellen. Es war die Zeit des Kalten Kriegs, in der die Angst vor Manipulation und Verschwörung die Gesellschaft zeichnete, und Packard machte auf die Manipulationsmöglichkeiten über das Unterbewusstsein aufmerksam. Diese Werbe- und Konsumkritik hat laut Zurstiege (2015, S. 21) in den 1960er/1970er Jahren ihren Höhepunkt erreicht. Die sodann verstärkt einsetzende Internationalisierung wirkte sich auch auf Produktion und Vertrieb und somit auf die Werbung aus. Der Schritt zur Globalisierung der Wirtschaft wird mit Beginn der 1980er Jahre angesetzt (Zohlnhöfer, 2009), und seit dieser Zeit verfolgen Werbetreibende dementsprechend neue Kommunikationsstrategien, die sich durch eine weltweite Vernetzung auszeichnen.
Es gibt immer wieder Stimmen, die im Rahmen der kulturwissenschaftlichen Diskussion um Globalisierungstendenzen die Werbung als Datenquelle ablehnen, die hierin eine Verzerrung von Nationalkulturen sehen und die Dominanz des Englischen kritisieren. Diese Kritik fasst Montiel Alafont (2012, S. 402–403) zusammen:
Das Englische, heißt es etwa, beeinflusse oder dominiere in manchen Fällen sogar weltweit die WerbekommunikationWerbekommunikation, wobei Werbekommunikate, so wie sie von nordamerikanischen internationalen Werbeagenturen gestaltet würden, sich nicht nur der Sprache, sondern besonders des Lebensstils der Vereinigten Staaten bedienten. [Auch] sei Werbung als Datenquelle ungeeignet, da sie schlicht und einfach nicht authentisch sei, sondern zugunsten wirtschaftlicher Interessen der (überwiegend US-amerikanischen) Industrie verfälscht werde. In verallgemeinerter Form läuft diese These auf den Vorwurf hinaus, dass nicht nur eine Art nordamerikanischer Kulturimperialismus, sondern der gesamte Globalisierungsprozess die Authentizität oder gar den Fortbestand der Kulturen bedrohe […] Nationalkulturen lägen demzufolge im Sterben: Sie würden mithilfe der Werbung allmählich durch die globale Kultur ersetzt.
Zu erwähnen ist auch, dass die kommerzielle MarktforschungMarktforschung seit den 1950er Jahren an Bedeutung zugenommen hat, was sich auf die Argumentationspraxis von Werbetreibern auswirkt. Naab & Schlütz (2016, S. 224) sprechen von einem „Paradigmenwechsel“, der in der Mitte des 20. Jahrhunderts zu erkennen sei:
Das aktive Publikum rückte in den Vordergrund der Betrachtung. Die Nutzerinnen und Nutzer wurden nicht mehr ausschließlich als Objekte kommunikativer Bemühungen, sondern als intentional nach ihren Bedürfnissen handelnde Subjekte verstanden, die sich Kommunikationsinhalten absichtsvoll zuwenden – oder, wie gelegentlich im Fall von Werbung, auch bewusst davon abwenden. […] Ihre Auswahl wird von Wissen und Absichten geleitet (Intentionalität) und führt sie zu Angeboten, von denen sie die Befriedigung von Bedürfnissen erwarten (Nützlichkeit).
Werbung heute zeichnet sich durch ein zum Teil völlig anderes Vorgehen aus, das zum einen auf Unterhaltung, Dienstleistung und Information ausgerichtet ist, aber auch gezielt den Spaßfaktor befriedigt und mit Übertreibung und Täuschung offen umgeht; die Erwartungen und Gewohnheiten der Konsumenten haben sich gewandelt und wir erkennen eine immer härtere Konkurrenz der Marken, wobei Kopieren und Nachahmen bewährte Mittel des Erfolgs darstellen.
Für die ZielgruppeZielgruppenansprache vor allem von Kindern und Jugendlichen werden heute die Neuen MedienMedienNeue mit TikTok, Twitter, Facebook, YouTube, Google+ gewählt.
Im Kontext der neuen Medien entstehen heute neben den klassischen Werbeformen im raschen Wandel viele neue: In-game-Advertising und Advergames (Werbespiele), Branded Entertainment (Werbung in Unterhaltungsangeboten), Viral Marketing (Konsumenten verbreiten die Werbebotschaft weiter), Word of Mouth (»Mundpropaganda«) und Mobile Marketing (Werbung über mobile Endgeräte) lauten nur einige der Etiketten, die diesen neuen Werbeformen angeheftet werden. (Zurstiege, 2015, S. 18)
Ziel der vorliegenden Arbeit kann es nicht sein, die vielfältigen Problematiken der Werbung umfassend darzustellen, da eine Vielzahl an theoretischen und angewandten Wissenschaftsdisziplinen einbezogen werden müsste. So wird zwar immer wieder ein Blick auf interdisziplinäre Zugänge5 (z.B. die MedienwissenschaftMedien-wissenschaft, die MedienlinguistikLinguistikMedien-, die MedienpädagogikMedien-pädagogik, die WerbepsychologieWerbepsychologie, MarketingMarketing oder KulturgeschichteKulturgeschichte) geworfen. Diese Passagen sollen als Ergänzungen zur sprechwissenschaftlichen Analyse betrachtet werden, die im Mittelpunkt des Interesses steht.
Diese Arbeit will den gesellschaftlichen Wandel anhand der Stimme und des Sprechstils beim Werbeträger Hörfunk in Westdeutschland über drei Jahrzehnte rekonstruieren, wobei das RAWRAW als Quelle für das Korpus dient (Untersuchungsobjekte sind digitalisierte Rundfunk-Werbespots). Ein breit angelegtes Online-Experiment mit Ausschnitten dieser Spots soll ihre Stimm- und Sprechwirkung heute erfassen. Beim Vorgehen stehen als Forschungsziele folgende zwei Fragenkomplexe im Mittelpunkt der Analysen:
Welche PersuasionsstrategienPersuasionsstrategien, Themen und Topoi werden seit den 1950er Jahren in der Hörfunkwerbung eingesetzt, und wie werden sie von Stimme und Sprechweise aufgenommen?
Wie nehmen heutige Hörerinnen und Hörer Stimme und Sprechweise in der Hörfunkwerbung seit den 1950er Jahren wahr?
Nachdem zunächst in diesem ersten Kapitel der Untersuchungsgegenstand umrissen wurde, widmet sich das zweite Kapitel einem Überblick über die Geschichte des Radios und der Rundfunkwerbung bis zu den 1950er Jahren. In einem Exkurs über das Medium Hörfunk in der Werbung (2.1) geht es sowohl um den Wandel der Technik als auch um den Wandel der HörgewohnheitenHörgewohnheiten. Dem folgen grundlegende Gedanken zum Thema Medienrhetorik als Form von Wirtschaftsrhetorik (2.2) und Radiorhetorik (2.3). Ein Blick auf Persuasionsstrategien in der Hörfunkwerbung (2.4) schließt das zweite Kapitel mit einem Exkurs in die antike Rhetorik ab.
Im dritten Kapitel stehen Stimme und Sprechstil im Fokus. Nach allgemeinen Reflexionen über VortragsformateVortragsformate und SprechkunstSprechkunst (3.1) geht es um die ästhetische Dimension von Stimme und Sprechstil (3.2), wobei der Ästhetik der FrauenstimmeÄsthetikder Frauenstimme ein eigener Abschnitt gewidmet ist (3.3). Die Aussprache selbst ist ebenfalls Moden und Normierungen unterworfen, was in Abschnitt 3.4 zur Sprache kommt.
Ein historischer Rückblick auf die Zeit ab den 1950er Jahren hat im vierten Kapitel nicht nur zum Ziel, markante politische und gesellschaftliche Ereignisse wachzurufen, sondern auch die jeweiligen Moden und Trends aufzuzeigen, von denen sich die Konsumenten der jeweiligen Zeiträume angesprochen fühlten (4.1). Das so skizzierte Gesellschaftsbild gibt Zeugnis ab über den Bedürfniswandel der Zeit, der sich in den Themen (und damit auch in den mit dem Produkt angebotenen Zusatznutzen) bei Produktwerbungen niederschlägt (4.2).
Im fünften Kapitel werden exemplarisch Hörfunk-Werbespots der 1950er, 1960er und 1970er Jahre für eine Analyse im Rahmen eines triangulären Untersuchungsdesigns herangezogen und einigen Spots aus den 1980er und den 2010er Jahren gegenübergestellt. Es handelt sich um Produktwerbungen aus drei Bereichen: Haushaltshygiene (Waschmittel), Körperhygiene (Zahnpasta) und Genuss (Kaffee). Die Ergebnisse eines Online-Experiments mit einer Expertenumfrage sollen, zusammen mit einer hörphonetischen Deskription und Interpretation und der akustischen Berechnung des Parameters mean pitchMean pitch mit Hilfe der Software PraatPraat Aussagen zu den oben genannten Forschungszielen zulassen. So kann der gesellschaftliche Wandel in der Stimme, im Sprechstil und in der WerberhetorikRhetorikWerbe- exemplarisch aufgezeigt werden. Durch die sprechwissenschaftlich-phonetische Charakterisierung der männlichen und weiblichen Sprechstimmen kann auf die Frage nach der Stimme als Zeitzeugin in der Verkaufsrhetorik geantwortet werden.
Im Anhang befinden sich die analysierten Werbespots in Form von orthographischen TranskriptionenTranskriptorthographisches6 mit jeweiliger GAT2TranskriptGAT2-Transkription (mit Hilfe des Editors FOLKER). Das garantiert zum einen die Transparenz der Untersuchung und ermöglicht einen Nachvollzug ihrer Aussagen. Zum anderen sollen die Interpretation und Schlussfolgerungen als Einladung zu weiteren Analysen verstanden werden.
Schließlich soll im Rahmen einer Begriffsdefinition auf die Verwendung der zentralen Termini „Thema“, „Topos“, „Zusatznutzen“ und „USP“ hingewiesen werden:
ThemaThema wird hier auch im Zusammenhang mit GrundnutzenGrundnutzen und Zusatznutzen verwendet (siehe unten), außer die Begriffe werden differenziert gebraucht.7 Statt Thema könnte in vielen Fällen der Terminus „Werbebotschaft“, „Inhalt“, „Gegenstand“ oder „Motiv“ stehen.
In der Alltagskommunikation verhaftet ist der ToposTopos: „Da der T.[opos] auf alltagslogischen Denkmustern oder konventionellem Erfahrungswissen beruht, hat er auch bei routinemäßigem Gebrauch Überzeugungskraft“ (Bußmann, 2008, S. 745). Auf Topoi entwickelt sich Argumentation, beispielsweise in Form von Kausalschlüssen (z.B. Persil 1973: mit der roten Schleife; ein Paket mit Schleife erinnert an ein Geschenk, an etwas Besonderes) oder bei dem in der Werbung beliebten Topos der Autorität, der sog. Testimonialwerbung (beispielsweise die zufriedene Kundin in Lenor 2018: Ich fühle mich wohl in Lenor).8
Der ZusatznutzenZusatznutzen wird ergänzend zum Grundnutzen (dem jeweiligen Gebrauchswert, dem rationalen Grund) eines Produktes verkauft; hiermit bezwecken die Anbieter, weitere Bedürfnisse der Verbraucher zu befriedigen (z.B. emotionale Bedürfnisse in Form eines Glücksgefühls, soziale Bedürfnisse in Form von Anerkennung, Schönheit, Selbstbestätigung). Spang (1987, S. 75) nennt es auch die „produktfremden scheinbaren Sekundärleistungen“.
Mit Hilfe des Zusatznutzens kann ein Alleinstellungsmerkmal bzw. ein herausragendes Leistungsmerkmal erzeugt werden, das das Produkt gegenüber anderen differenziert, unter der Konkurrenz heraushebt und einen veritablen Kundenvorteil darstellt. Man spricht dann auch von USP (unique selling point oder unique selling proposition.USPunique selling point/proposition Zusatznutzen und USP sind sehr eng miteinander verwoben und werden häufig gleich gesetzt:
[der produktspezifische Zusatznutzen] wird von Werbefachleuten USP (unique selling proposition – „einzigartige Verkaufsaussage“) genannt. Über die USP/den Zusatznutzen versucht die Werbung das Problem der zunehmenden Produktähnlichkeit zu umgehen und auf irgendeine Weise das beworbene Produkt gegen Konkurrenzprodukte abzugrenzen, auch wenn kaum mehr tatsächliche Unterschiede vorhanden sind. (Janich, 2013, S. 56)
Ein AlleinstellungsmerkmalAlleinstellungsmerkmal wird regelmäßig einen Zusatznutzen auslösen, also eine Art Befriedigung eines Bedürfnisses (z.B. bei THOMY Senf, der in einem ansprechenden Glas verkauft wird, das als Trinkglas benutzt werden kann, was ihn wiederum von anderen Senf-Produkten abhebt). Aber der Zusatznutzen muss nicht zwingend zu einem USPUSP führen, vor allem, wenn das Merkmal keine Alleinstellung hat. Für die Verkaufsstrategien in der Werbung handelt es sich zwar um zwei Argumentationskonzepte, die aber so eng miteinander verwandt sind, dass die Unterschiede der beiden Begriffe auch in der vorliegenden Untersuchung vernachlässigt werden können. Daher sollen die beiden Begriffe im weiteren Verlauf der Arbeit gleichrangig nebeneinander verwendet werden.
2Radio und Rundfunkwerbung gestern und heute
Wenn von Radio, Rundfunk und Hörfunk die Rede ist, so werden diese Begriffe oft synonym verwendet, bisweilen jedoch auch differenziert verstanden: Radio als Empfangsgerät, Hörfunk als das gesendete Programm. Vor der Zeit des Fernsehens, waren wiederum Rundfunk und Hörfunk als das gleiche verstanden worden, heute umfasst Rundfunk strenggenommen sowohl Hörfunk als auch Fernsehen, wird aber dennoch meist synonym für den Hörfunk verwendet.1
Werbung fand schon einen Platz im Hörfunk, als dieser noch in Kinderschuhen steckte, also kurz nach 1900. Vorreiter der Rundfunk-Unterhaltungsindustrie waren die USA und die Niederlande, bald konnte man nach ersten vorbereitenden Schritten und dem Aufbau von Telefunkengroßstationen in den Jahren zwischen 1910 und 1920 auch in Deutschland die erste Rundfunkübertragung hören (am 29. Oktober 1923). Ein kurzer Abriss über die rasante Entwicklung der Radionutzung in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts soll den Rahmen stecken für die spätere Analyse der Werbespots.2
„Der Rundfunk war in den zwanziger Jahren das MassenmediumMassenmedien, das alles und alle in den Bann schlug, und wurde so fast zu einem Urmodell unbegrenzter Expansion und beständiger Perfektionierung“ (Prümm, 1998, S. 32). Von knapp 10000 angemeldeten Empfangsgeräten im April 1924 hatte im Februar 1932 jeder vierte deutsche Haushalt ein Radiogerät, was 12 Millionen Hörern entsprach. „So wird der Rundfunk das Leit- und Symbolmedium der Weimarer Zeit“ (Dammann, 2005, S. 8). Der Nutzen des Rundfunks erweiterte sich schnell vom anfänglichen Unterhaltungs- und Informationsmedium zu kommerziellen und militärischen Zwecken und war bald so etwas wie ein Inbegriff modernen Lebens.
Bei der Frage nach dem Profil der Hörergruppen, wurden schon in der Zeit der Weimarer Republik Frauen als primäre ZielgruppeZielgruppe genannt.
Über Radioangebote konnten Frauen im besonderen Maße angesprochen und gebildet werden. Damit sollten sie gegenüber etwaigen Verführungen durch die Massenkultur gefeit sein. […] Exzessives Radiohören wurde insbesondere Frauen zugeschrieben. […] Das Radio diente als Begleitmedium, während die Hausfrau ihren häuslichen Routineaufgaben nachkam. (Marßolek & Saldern, 1999, S. 26).
In den 1920er und 1930er Jahren kam es nicht nur zu einer Blüte für Werbeschlager, auch die ersten Ausstrahlungen von Werbespots wurden 1924 vertraglich geregelt.
Nach anfänglicher Skepsis der Politiker dem Radio gegenüber, begannen diese, den Rundfunk nicht nur zu Unterhaltungs- sondern auch zu Bildungszwecken einzusetzen. So erkannten die Nationalsozialisten auch bald die Möglichkeiten, die in diesem neuen Medium steckten und nutzten es unter Propagandaminister Joseph Goebbels für ihre ideologischen Zwecke. Mit dem in großen Mengen produzierten VolksempfängerVolksempfänger war das Radio endgültig zum MassenmediumMassenmedien geworden.
Nach dem Krieg änderte sich die Situation in Deutschland drastisch, denn die Siegermächte unterbanden die während des Nazi-Regimes missbrauchte Funktion des Rundfunks als zentrales Instrument der Informationsvermittlung.3 Sie setzten den Rundfunk im Rahmen der Demokratisierung und Aufklärungsarbeit über den Nationalsozialismus, der sogenannten re-education, als vom Staat, den Parteien und wirtschaftlichen Interessen unabhängiges Medium ein. Bald wurden Hörerbeteiligung und Diskussionen eingeführt, Bildung und Unterhaltung spielten wieder eine größere Rolle.4
Seit 1949 sind die Sender wieder unter deutscher Leitung; dies fällt zeitlich mit den Anfängen der WirtschaftswerbungWirtschaftswerbung nach der Währungsreform in Westdeutschland zusammen.5 So ist der appellative Charakter der Werbetexte zu Beginn der westdeutschen Hörfunkwerbung darauf zurückzuführen, dass sie zunächst nur als Information zu verstehen war, dass bestimmte Produkte nach dem Krieg wieder verfügbar waren (Greule, 2012, S. 343).
Am 25. Dezember 1952 strahlte der erste Fernsehsender im Deutschland der Nachkriegszeit sein Programm aus, und damit war die zukünftige Konkurrenz des Hörfunks geboren. Die 1950er Jahre zeigten laut Dammann (2005, S. 9) ein
doppeltes Gesicht: Auf der einen Seite [ist es] der Beginn eines parlamentarisch-demokratischen Systems, eine Phase rasanter wirtschaftlicher und sozialer Veränderungen. Auf der anderen Seite ist diese Dynamik geprägt von personellen und kulturellen Kontinuitäten (unter anderem in Industrie, Justiz und an den Universitäten).
2.1Das Medium Hörfunk in der Werbung
Das Radio als ältestes elektronisches MassenmediumMassenmedien wurde nach den Jahren des NationalsozialismusNationalsozialismus und des Zweiten WeltkriegsWeltkrieg, Zweiter, einer Zeit, die durch Missbrauch ideologischer Propaganda geprägt war, für Werbetreibende neben der Printwerbung das bedeutendste und am meisten eingesetzte Medium für Unterhaltung, Information und Werbung.
Was dieses neue Medium von ZeitungZeitung und ZeitschriftZeitschrift unterschied, waren der Rezeptionsmodus und vor allem das Rezeptionstempo: Bei PrintmedienPrintmedien ist die Rezeption flexibel, und ein Text kann immer wieder und mit unterschiedlicher Geschwindigkeit gelesen werden; das ist beim Radiohören nicht der Fall, denn die Rezeption erfolgt nur einmal und zur vorgegebenen Geschwindigkeit; erst die digitale Technik heute hat dies geändert. Weiter ist Werbung im Hörfunk ein Beispiel für unilaterale Kommunikation, bei der jemand (der Verkäufer) dem Konsumenten (Käufer/Adressaten) etwas (ein Produkt, eine Ware) verkaufen möchte. Was bei der schriftlichen Kommunikation der geschriebene Text und das Bild übermitteln, übernehmen in der Hörfunkwerbung Stimme, Sprechweise, Musik und Geräusche.1
Das Medium Radio ist, anders als die PrintwerbungPrintwerbung (Zeitung, Zeitschrift, Plakat etc.) eine Form der elektronischen WerbungWerbungelektronische, zu der auch das FernsehenFernsehen und heute alle digitalen MedienMediendigitale zählen. In den 1950er, 1960er und 1970er Jahren äußerst verbreitet, büßte der Hörfunk ab den 1970er Jahren mit der zunehmenden Verbreitung des Fernsehens seine Stellung als Werbemedium immer mehr ein. Viele Produkte verschwanden ganz aus dem Radio und fanden ihre neue „Heimat“ in dem nun populäreren Medium Fernsehen. Nicht selten aber wurden und werden Produkte von mehreren Medien beworben. Der Begriff MehrmedialitätMehrmedialität wird von Reimann (2008a, S. 53) wie folgt definiert: „MEHRMEDIALITÄT (in der Werbung) ist die Umsetzung einer Werbestrategie in mehreren Medien, denen in der Regel unterschiedliche Darstellungsmittel zur Verfügung stehen und die medienspezifische Differenzen aufweisen.“
Die Medienspezifik des Hörfunks ist die Stimme. Sie ist Informationsträgerin und muss, wenn sie auch in der TV-WerbungTV-Werbung vorhanden ist, im Vergleich zu ihr den visuellen Part sozusagen „übernehmen“. Die Bilder, der Film, entstehen in den Köpfen der Hörer und Hörerinnen. Die Stimme muss demnach auch die Eigenschaften des Produkts transportieren, die sonst das Bild und der Film übermitteln. Musik und Geräusche werden zusätzlich u.a. für atmosphärische Elemente eingesetzt und erfüllen Ersatzfunktionen für visuelle und akustische Ort-Zeit-Geschehnisse.
2.1.1Der Wandel der Technik im Hörfunk
Bei Fragen um die Radiotechnik kann zwischen Aufnahmetechnik, Übertragungs- bzw. Wiedergabetechnik und Studiotechnik im engeren Sinn unterschieden werden. Was die AufnahmetechnikAufnahmetechnik von HörfunkspotHörfunkspots betrifft, so haben die Tonstudios im vorigen Jahrhundert eine Reihe an Entwicklungen durchlaufen; als signifikanteste in diesem Zusammenhang ist die Weiterentwicklung des Mikrofons in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu nennen. In den 1950er Jahren war die MikrofontechnikMikrofontechnik in Deutschland daher schon auf einem mit heute zu vergleichendem Niveau angekommen.1
Ein weiteres technisches Detail ist der TonträgerTonträger. In den 1960er Jahren wurde das einspurige Magnettonband in den Tonstudios vom Mehrspurtonband abgelöst, das eine Stereophonie erlaubte, die die Sendungen bis in die 1980er Jahre prägte. Danach erst kam es zur revolutionierenden Neuerung in Form der DigitalisierungDigitalisierung der Aufnahmegeräte, die nun eine wesentlich diffizilere Aussteuerung aller akustischen Parameter erlaubte. Ab Ende der 1980er Jahre stiegen immer mehr Tonstudios auf diese Neuerung um.
Die Digitalisierung in den Studios ging schließlich einher mit einer weiteren einschneidenden Entwicklung ab den 1980er Jahren: der Koaxialverkabelung2, wodurch auch Radioprogramme übertragen werden konnten, was die Radiohörgewohnheiten der Menschen stark beeinflussen sollte.
So kann man die Geschichte der ÜbertragungstechnikÜbertragungstechnik des Radios als MassenmediumMassenmedien nach Kleinsteuber (2011, S. 86) in drei Phasen einteilen:
1. Phase: Aussendung einzelner Programme über Amplitudenmodulation (AM) auf Lang-, Mittel- und Kurzwelle, die nach dem 1. Weltkrieg begann.
2. Phase: Übergang zur Frequenzmodulation (FM) und Nutzung der Ultrakurzwelle (UKW), später Einbeziehung von Kabel und Satellit. Beginn nach dem 2. Weltkrieg heute noch dominant.
3. Phase: Digitalisierung des Signals und Übertragung terrestrisch (DAB, DRM)3, via Internet oder über Mobilnetze, Anfänge in den 80er Jahren, erste Anwendungen im Regeldienst ab ca. 2000.
Die im vorliegenden Band untersuchte Zeitspanne liegt also noch weit vor der DigitalisierungDigitalisierung und umfasst die Zeit des Aufkommens und allmählichen Ausbreitens des Konkurrenten Fernsehen. Im Hörfunk sind die oben skizzierten technischen Entwicklungsschritte für die Hörer zwar wahrnehmbar, inwieweit sie einen Einfluss auf die Wiedergabe und Wahrnehmung der StimmqualitätStimmqualität und hier in erster Linie auf die Sprechstimmlage haben, ist jedoch schwer zu sagen. In seiner Studie zur Veränderung von Artikulation und Sprechweise kommt Falk (2019, S. 40) in Bezug auf den Wandel der MikrofontechnikMikrofontechnik zu folgender Einsicht: „Konkrete Hinweise bezüglich der Auswirkungen der MikrofontechnikMikrofontechnik auf die zeitspezifische Sprechweise konnten […] nicht festgestellt werden. Die Technikgeschichte des Mikrofons scheint für Erklärungen zur sich verändernden Stimme also insgesamt auszuscheiden.“
Anders zeigt sich jedoch das Bild, wenn man die StudiotechnikStudiotechnik betrachtet. Es macht einen Unterschied, ob das Studio, wie zu Beginn der Radiogeschichte und bis zur stereophonen AufnahmetechnikAufnahmetechnik in den 1960er Jahren, als von Umweltgeräuschen abgeschotteter, fast „steriler“ Raum verstanden wurde, oder ob der Eindruck von Alltagsszenen und alltagsnahem natürlich wirkendem Gesprächston die Richtschnur bei Studioaufnahmen ist. Letzteres wurde mit der Digitaltechnik immer ausgefeilter, da jetzt Nachbesserungen und Modifizierungen stimmlicher Parameter möglich wurden. Dass sich das alles auf den Sprechstil im Radio und die jeweils geltenden Richtlinien zum Mediensprechen auswirkte, wird noch näher betrachtet werden (siehe Kap. 3).
2.1.2Radiohörgewohnheiten im Spiegel der Zeit
Die Popularität des elektronischen Massenmediums Radio wuchs sprungartig an, was an einer Reihe an Faktoren festzumachen ist: zum einen an technischen Entwicklungen, zum anderen an gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen, welche alle die HörgewohnheitenHörgewohnheiten beeinflussten.
Am Beispiel des Rundfunks kann in historischer Perspektive gezeigt werden, wie sich das Hören vom angestrengten Lauschen mit Kopfhörern vor den Detektorgeräten zum feierlichen, gemeinschaftlichen Zuhören von Konzerten im Familienkreis, bis zum Nebenbei-Hören bei anderen Tätigkeiten zu Hause, als nahezu ubiquitäre Berieselung und seit den Transistorgeräten und dem ‚walk-man‘ zum individuellen Überall-Hören wandelte. (Marßolek & Saldern, 1999, S. 13–14)
Nach dem Zweiten WeltkriegWeltkrieg, Zweiter änderte sich also die Situation rund um den Rundfunk und die Sendeanstalten drastisch, was neue Hörgewohnheiten von Seiten der Bevölkerung nach sich zog und nicht zuletzt eine Veränderung im Standard des MediensprechensMedien-sprechen und des SprechgestusSprechgestus von Seiten der Mediensprecher bewirkte (Kap. 3). Die Umstellung auf den UKW-Rundfunk in Deutschland war ein Produkt langwieriger politisch und technisch motivierter Wellenkonferenzen nicht nur in Deutschland, sondern europaweit.1 Rundfunksender, die ihre Programme vorher ausschließlich über Amplitudenmodulation (AM) ausgestrahlt hatten, stiegen in den Jahren nach dem Krieg nach und nach auf UKWUKW um, und die Entwickler der Radiogeräte zogen nach, in dem die Geräte für den UKW-Empfang ausgestattet wurden.
Die Menschen in der Zeit des Wirtschaftswunders konnten sich nun UKW-Empfangsgeräte leisten, zunächst in Form einer Nachrüstung mit UKW-Zusatzgeräten2, die man in die herkömmlichen Radioapparate einbauen konnte. Die Hördauer stieg infolgedessen auf 2–3 Stunden am Tag (Krug, 2010, S. 22) und erlangte eine solche Popularität, dass laut Seegers (1999, S. 167) über die Hälfte der Rundfunkteilnehmer im Jahre 1955 ein solches Gerät besaßen.
Einschneidend für die HörgewohnheitenHörgewohnheiten der Menschen war schließlich vor allem die Entwicklung des TransistorradiosTransistor-radio, eines Empfangsgeräts, das mit Transistoren, kleinen Halbleiterelementen, ausgestattet war. Es löste das herkömmliche Röhrenradio mit seinen schweren Elektronenröhren ab. Die Umstellung in Westdeutschland erfolgte nach Fickers (1998) in zwei großen Wellen, die man grob so skizzieren kann, dass in einer ersten Welle (1950–1955) die Röhrenradios zusätzlich mit Transistoren ausgestattet wurden, in einer zweiten Welle (1960–1965) die Röhren in den Empfängern durch Transistoren ersetzt wurden.
Transistorradios waren tragbare Kofferradios, die das Radiohören vor allem flexibler machten. Mitte der 1950er Jahre waren die ersten Modelle als Mittelwellenempfänger schon im Handel erhältlich, aber erst nach der Weiterentwicklung zum UKW-Empfänger war der enorme Markterfolg des neuen Geräts unbestritten. Die Folge war eine Revolution der HörgewohnheitenHörgewohnheiten in den 1960er Jahren. Man konnte nun fast überall Radio hören und das eigene Koffer- oder Taschenradio mitnehmen, denn es war nicht mehr wie ein Möbelstück einem Zimmer in der Wohnung zugewiesen. Jetzt wurden auch die ersten Autoradios mit Transistoren vertrieben, was in den früheren Jahrzehnten abgesehen von der unhandlichen Größe der ersten Geräte unerschwinglich war. Auch diese neue Hörsituation während des Autofahrens erweiterte das Programm-AngebotProgramm-Angebot der Rundfunksender.
Die späten 1950er und die Jahre danach waren von Seiten der Konsumenten folglich dadurch gekennzeichnet, dass sich die Hörer nicht mehr wie vorher zum Radioapparat begeben mussten, jetzt war er zu ihrem „Begleiter“ geworden, der sie gezielt und überall ihre Lieblingssendungen anhören ließ. Für die Radiosender bedeutete das, dass sie mehr Abwechslung bieten mussten, zumal das FernsehenFernsehen, der große Konkurrent des Radios, ab den 1960er Jahren die Wohnzimmer zu erobern begann und die Gewohnheiten des Medienkonsums erneut veränderte. Laut Krug (2010, S. 23) sank daher die abendliche Einschaltquote der Mittelwellensender von 50 % zu Beginn der 1950er Jahre auf unter 20 % zehn Jahre später.
Neue Sender, das sogenannte PopRadioPop- und ServiceradioRadioService, modifizierten ab den 1970er Jahren als Antwort auf die räumliche Unabhängigkeit der Radiohörer durch ihre diversifizierten Angebote und Begleitprogramme wiederum die Hörgewohnheiten. Sie richteten sich jetzt an den Individualhörer mit eigenem Gerät, nicht mehr nur an häusliche Hörer, die ihr Radio bewusst einschalteten.
Ab den 1980er Jahren schließlich revolutionierte der PrivatfunkPrivatfunk die Senderlandschaft nochmals, jetzt machte sich das duale SystemDuales System auch im Hörfunk breit und ließ die regionalen Sender erstarken. Eine Sender- und Programmfülle war und ist die Folge, die Öffentlich-RechtlichenSenderöffentlich-rechtliche sahen und sehen sich heute vor der Herausforderung, sich zum einen abzugrenzen und zum anderen ihre Attraktivität zu erhöhen, was einen starken Konkurrenzkampf gegenüber den privaten Sendern hervorruft.
Trotz der räumlichen Mobilität beim Radiohören, die sich in den skizzierten Jahrzehnten immer mehr durchsetzte, lag der nächste Schritt noch in der Zukunft: die zeitliche Flexibilität. Es wurde also bis in die 1980er Jahre zu bestimmten Zeiten gehört, da es noch kein Programm „on demand“ gab; das sollte erst mit der nun aufkommenden DigitalisierungDigitalisierung möglich werden.
Auf die beschriebenen Veränderungen der HörgewohnheitenHörgewohnheiten seit Mitte des 20. Jahrhunderts reagierten die Sendeverantwortlichen und Werbetreibenden, indem sie ihre Sendezeiten im Laufe der Jahrzehnte der Technik und den Hörgewohnheiten anpassten: In den 1950er Jahren waren Werbesendungen zu festen Terminen in bis zu 20 Minuten langen Blöcken gruppiert, in den 1960er Jahren wurden die Blöcke immer kürzer und schließlich immer mehr auf den Tag verteilt (siehe Kap. 2.3.3).
Die Hörgewohnheiten haben sich folglich in wenigen Jahrzehnten umgekehrt: Früher passten sich die Hörer dem Rundfunk an, heute ist es der Hörfunk, der sich nach den Hörgewohnheiten richtet und längere Werbepassagen zu vermeiden versucht, um die Gefahr des Ab- oder Umschaltens zu minimieren.
Das aktive Publikum rückte in den Vordergrund der Betrachtung. Die Nutzerinnen und Nutzer wurden nicht mehr ausschließlich als Objekte kommunikativer Bemühungen, sondern als intentional nach ihren Bedürfnissen handelnde Subjekte verstanden, die sich Kommunikationsinhalten absichtsvoll zuwenden – oder, wie gelegentlich im Fall von Werbung, auch bewusst davon abwenden. (Naab & Schlütz, 2016, S. 224)3
Werfen wir als Vergleich zu den skizzierten Jahrzehnten einen Blick auf die aktuelle Situation der Hörfunk-Konsumenten: Die junge Generation heute hat wieder andere RadiohörgewohnheitenHörgewohnheitenRadio. Das InternetInternet hat das Radio – zumindest für die um die Jahrtausendwende Geborenen – bereits überholt. Ständige Präsenz internationaler Radioprogramme, Livestreaming, Podcasting und Hören auf Abruf prägen heute die Hörgewohnheiten der Menschen. Kleinsteuber (2011, S. 15) spricht von einem „Ausfransen des ehemals so eindeutig definiert scheinenden Phänomens Radio“, wenn man die heutigen digitalen Formen wie Cyberradio, Radio via Handy, Radio-Podcasts oder Pay-Radio betrachtet.
Ein paar Daten und Fakten der Online-Ausgabe Media Perspektiven 3/2020 sollen das Radiohören heute beschreiben:
Mediatheken werden von mehr als einem Drittel mindestens einmal pro Monat genutzt. Mit Abstand am beliebtesten sind die Angebote von ARD und ZDF mit 25, bzw. 26 Prozent, dabei weisen die 30- bis 49-Jährigen die stärkste Nutzung auf. Video-on-Demand-Angebote hingegen werden am stärksten von 14- bis 29-Jährigen genutzt. Auch bei der Audionutzung im Internet zeigt sich, dass Jüngere stärker auf Streamingangebote setzen, Ältere eher auf das Livehören von Radio über das Internet. Podcasts werden konstant von jedem Fünften mindestens monatlich genutzt […]
Im Bereich Social MediaSocial Media sind nach wie vor WhatsApp, Facebook und Instagram am relevantesten. Drei Viertel der Bevölkerung (76 Prozent) kommunizieren täglich über WhatsApp, 21 Prozent nutzen Facebook und 13 Prozent Instagram. Dabei weist Instagram unter allen Social-Media-Angeboten die höchste Nutzungssteigerung auf und wird vor allem von unter 30-Jährigen genutzt. Snapchat, Twitch, Xing, LinkedIn und Twitter folgen mit großem Abstand. TikTok erreicht täglich 5 Prozent der 14- bis 29-Jährigen. (ARD-Werbung SALES & SERVICES, 2020)
In einer Standortbestimmung anhand einer Studienreihe zu Trends in der MassenkommunikationMassenkommunikation zeichnen Mai, Meinzer und Schröter (2019) ein detailliertes Bild der heutigen Audio- und Radionutzung. Interessant in dieser Diskussion in „Zeiten des digitalen MedienwandelsMedien-wandel und der immer stärker konvergierenden Medienwelten“ ist, dass das Radio nach wie vor den ersten Platz in der Audiowelt einnimmt, obwohl digitale Plattformen ihre Audioangebote und -formate ständig erweitern und Tonträger durch Streaming immer mehr ersetzt werden. Dennoch heißt es: „On-Demand-Angebote und Sprachassistenten verfügen über Entwicklungspotenzial“ (Mai et al., 2019, S. 406).
2.2Medienrhetorik als Form von Wirtschaftsrhetorik
„Wirtschaftsrhetorik ist die sektorale Rhetorik von Industrie-, Finanz und Dienstleistungsunternehmen und deren Verbänden in Gespräch und Rede ihrer Repräsentanten“ (Wachtel, 2004, S. 338). Man versteht darunter das Praxisfeld aller rhetorischen Kommunikationssituationen im Unternehmen, inclusive Corporate SpeakingCorporate Speaking, in denen sprechwissenschaftliche Rhetorik im wirtschaftlichen Kontext und als Führungsinstrument zum Einsatz kommt, bei internen und externen Situationen.
In der WirtschaftsrhetorikRhetorikWirtschafts- manifestieren sich unterschiedliche sprechwissenschaftlich-sprecherzieherisches Arbeitsgebiete, z.B. diverse Formen der Rede und der Gesprächsführung (z.B. Konferenz und Besprechung, Mitarbeitergespräch, Motivationsgespräch, Kritikgespräch, Coaching und Beratung, Interviewtechnik, Besprechung im Team, Feedback-Gespräch, Auswahl- und Einstellungsgespräch, Informations- und Überzeugungsrede, Storytelling, Präsentation, Radio-/Fernsehbeitrag, interkulturelle Kommunikation, Arzt-Patient-Kommunikation, sei es in einer realen oder in einer virtuellen Kommunikationssituation (Eckert, 2013; Gutenberg, 1999; Bazil & Wöller, 2008).
Thematische Verortung: Werberhetorik im Hörfunk
Sobald sich rhetorisches Handeln in oder mit Hilfe von elektronischen Medien vollzieht, spricht man heute von MedienrhetorikMedien-rhetorik, die je nach Medium und Kommunikationssituation mit unterschiedlichem Fokus, als Theorie und Praxis von Rede- und Gesprächssituationen in Rundfunk und Fernsehen, verstanden werden kann.1
[So] setzt sich kommunikativ orientierte Medienrhetorik mit Gesetzmäßigkeiten sowohl der Gestaltung wie der Rezeption von medialer Kommunikation auseinander. Darüber hinaus muss sich eine umfassende Medienrhetorik nicht nur mit sprechsprachlichen, sondern auch mit bild- und tonsprachlichen Kompetenzen befassen, die Menschen intentional einsetzen. Einerseits, um sich in der besonderen Kommunikationssituation Rundfunk anderen Menschen sinnhaft mitzuteilen, und andererseits, um diese multimedial vermittelten Sinnangebote verstehend zu rezipieren. (Dorn, 2004, S. 152)
Die zwei medialen KommunikationssituationenKommunikationmediale von Radio und Fernsehen unterscheiden sich in erster Linie darin, dass das Fernsehen zwei Kommunikationskanäle (Subsysteme der gesprochenen Sprache) einsetzt, die Bildsprache (visueller Kanal) und die Tonsprache (auditiver Kanal), während das Radio allein über den auditiven Übertragungskanal kommuniziert.
In der Medienrhetorik wird analysiert, wie in einem Medium Kommunikatoren (z.B. Redakteure, Moderatoren), Kommunikationspartner (z.B. Pressesprecher, Politiker) und Rezipienten (z.B. Radiohörer, Fernsehzuschauer) in Interaktion treten, wie sie miteinander die Bedingungen ihrer Kommunikation aushandeln, wie sie über verbale, paraverbale und nonverbale Mittel ihr Verhältnis zueinander darstellen. (Bose, 2016, S. 156)
Ein weiteres Kennzeichen und Gegenstand von Medienrhetorik ist ein technisch (elektronisch) vermitteltes Sprechen unter Vermischung der Elemente Nähe und Distanz.2 Die mangelnde Anwesenheit der Gesprächspartner bzw. Adressaten, also die örtliche Distanz zueinander, wird mit Hilfe von Ersatzelementen und -techniken ausgeglichen. Das kann auf sprachlich-verbaler Ebene das direkte Ansprechen der Hörer sein, die Wortwahl und stimmlich-sprecherische Ausdrucksweise (beispielsweise der Gebrauch von UmgangsspracheUmgangssprache oder dialektaler Ausdrücke), weiter der Einsatz von GeräuschenGeräusche und von atmosphärischen akustischen Elementen. Im Hörfunk fehlt zudem alles, was in den Bereich der nonverbalen Kommunikation fällt und muss von den anderen Elementen übernommen werden, verbal und/oder paraverbal. Im Gegensatz zu radiotypischen Genres wie Nachrichten, Interview, Feature, Dokumentation, wird im Hörfunk-Werbespot meist – ähnlich wie im Hörspiel – eine Szene arrangiert, die die Hörer zu observierenden Außenstehenden macht, die im KaufappellKaufappell schließlich direkt oder indirekt angesprochen werden.
Die Rednerin vor Mikrofon und Kamera und ihre Zuhörer am Lautsprecher sind einerseits in scheinbarer Nähe: Die sprachliche Gestaltung (von Lautstärke und Rhythmus über die Wortwahl bis zur Wahl der Gattung) muß deshalb von herkömmlichen Formen öffentlicher Rede abweichen. Andererseits sind Redner und Publikum dennoch getrennt, die Rede kann also nicht wie im unmittelbaren Publikumskontakt durch Zuhörerreaktionen reguliert werden […]. (Häusermann, 1995, S. 30)
Bei der MedienkommunikationMedien-kommunikation muss weiter bemerkt werden, dass ein einseitiges Abschalten möglich ist. Ist die Kommunikation (im Fall der Hörfunkwerbung das Wecken des Interesses mit Bereitschaft zum Zuhören und schließlich die Überzeugung zum Produktkauf) nicht gelungen, schalten die Zuhörer das Radiogerät aus. Ein verständlicher, attraktiver Sprach- und Sprechstil, eine sympathische Stimme und argumentativ wirkungsvolle und ansprechend inszenierte Kommunikation sind daher vonnöten.3
Von den drei in der Tradition der klassischen RhetorikRhetorikklassische stehenden Wirkungsarten rhetorischer Kommunikation steht, je nach Situation und Kommunikationsabsicht, immer eine im Vordergrund: das Informieren (docereDocere), das Unterhalten (delectareDelectare) oder das Überzeugen (movereMovere). „Handlungsauslösung […] – sei es Mitdenken oder reales Mittun – ist das Ziel jeglicher rhetorischer Kommunikation“ (Geißner, 1986, S. 120). Je nach Medium und – im vorliegenden Fall – Art der Sendung kommen all diese rhetorischen Ziele in der Medienrhetorik zum Einsatz, wobei das Wirkungsziel der Persuasion im Werbesektor überwiegt. Wird das Publikum (die potenziellen Kunden oder Käufer) überzeugt, erfolgt die Handlungsauslösung, meist in Form des Produkterwerbs.
Medienrhetorik im Hörfunk, wie sie im vorliegenden Band behandelt wird (mit Fokus auf dem Phänomen Stimme), untersucht folglich die intentionalen Mitteilungshandlungen des Sprechens im Kontext Werbung und zielt demnach auf die entsprechende Beeinflussung der Hörer. Die im Persuasionskonzept eingesetzten Ausdrucksmittel umfassen neben der Stimme auch Musik und Geräusche.
2.3Radiorhetorik und Radiowerbung
In der Radiorhetorik werden Kommunikationsbedingungen und Wirkungsmöglichkeiten des Massenmediums Hörfunk aus rhetorischer Sicht beschrieben und analysiert. Konkret geht es um die medienspezifische Wirksamkeit sprecherischer, sprachlicher und klanglicher Einheiten in ihrem Zusammenwirken beim Programmgeschehen. (Bose, 2016, S. 157–158).
Das von Ines Bose hiermit umrissene Fachgebiet der RadiorhetorikRadio-rhetorik deklariert sie zugleich als Desiderat für weiterführende Forschungen und weist auf Nachbardisziplinen wie KommunikationsforschungKommunikationsforschung, MedienwissenschaftMedien-wissenschaft, Publizistik und SprachwissenschaftSprachwissenschaft hin, die sich mit den für die Rhetorik des Radios charakteristischen Profilen der MündlichkeitMündlichkeit, der Öffentlichkeit und der Gleichzeitigkeit von PerformanzPerformanz und RezeptionRezeption auseinandersetzen.
Der oben erwähnte Doppelcharakter von NäheNähe und DistanzDistanz kommt hier, wie beim Fernsehen, deutlich zum Tragen. Das Publikum ist einerseits als direkte Hörergruppe anwesend, aber nicht körperlich, so dass eine räumliche und bei aufgezeichneten Sendungen auch eine zeitliche Distanz vorliegt, denn „die Radiohörer […] sind sich sowohl näher als auch ferner als Redner und Hörer in einer nicht medial vermittelten Veranstaltung“ (Bose, 2016, S. 155).
Im Rahmen der Radiorhetorik wird aus sprechwissenschaftlicher Sicht eine Reihe an Fragen diskutiert, die unter anderem folgende Punkte betreffen:1
Die rundfunkspezifische Sprechtechnik am Mikrofon;
Die Verwendung einer normgerechten Standardaussprache nach Kriterien allgemeiner Richtlinien, wobei z.B. bis gegen Ende des 20. Jahrhunderts Theodor SiebsSiebsDeutsche Aussprache als Standardwerk galt;2
Stimme, Sprechstile und Hörerwirkung unterschiedlicher Sendeformen;
HörverständlichkeitVerständlichkeitHör- und die damit verbundenen Kriterien sinnvermittelnden Sprechens (siehe auch Gutenberg, 2005);
Allgemein die Frage nach Radio-ÄsthetikÄsthetikRadio und ihres Wandels in der Zeit;
Profil und Aufgaben der Radio-Moderation;
Fragen der KompetenzKompetenz-Vermittlung in der radiorhetorischen Aus- und Fortbildung: Techniken zum Scheiben fürs Sprechen, Sprechen fürs Hören (Geißner & Wachtel, 2003; Wachtel, 2013; 2009).
Der mündliche Text im Radio, das durch die menschliche Stimme Vermittelte, kann in den meisten Sendungen als „sekundäre OralitätOralität, sekundäre“ bezeichnet werden, d.h. es handelt sich um gesprochene Sprache, die z.B. auch im Fall von Werbespots, konzeptionell schriftlicher Natur ist, also auf der Basis von schriftlich Vorgeformtem (und damit Vorgelesenem) beruht. Zum Erzielen der rhetorischen WirkungWirkung, rhetorische und der Überbrückung der Distanz bekommen (Hintergrund-)Geräusche, Musik und andere Wirkungsmittel besondere Bedeutung und helfen, den Eindruck von unmittelbarer Teilnahme zu verstärken.
Die klassische RadiowerbungRadio-werbung, mit Persuasion (movereMovere) und Handlungsauslösung als rhetorischen Auftrag manifestiert sich in der Regel in Form von Spots von 20 bis 30 Sekunden, wobei die Länge der Werbespots im Laufe der Zeit zurückgegangen ist.
Wenn auch die Sender der WerbebotschaftWerbebotschaft (als Autoren oder Sprecher) ihr imaginäres, anonymes Publikum (ihre potenziellen Käufer) mehr oder weniger direkt anzusprechen wissen und dabei Nähe suggerieren, entscheiden diese selbst, ob sie zuhören oder nicht. Um letzteres zu vermeiden, muss die Aufmerksamkeit geweckt werden. Werbung muss auffallen, um das Publikum zu erreichen.3 „Radiowerbung ist zwangsläufig monosensuelle Werbung und daher vergleichsweise reizarm“ (Stöckl, 2007, S. 179). Im Radio, das nur akustische Wirkung erzielen kann, geschieht eine „Reizung“ der Aufmerksamkeit und ein Erzeugen von Wirkung besonders durch die Stimme. Alles, was im Fernsehen über den visuellen Kommunikationskanal übertragen wird (Gestik, Mimik, Körperhaltung, Bewegung etc.), fällt hier weg und muss auf andere Weise suggeriert werden; in erster Linie über Dialoge und Szenen.
So kommt der StudiotechnikStudiotechnik und dem Einsatz von MusikMusik, Tönen und Geräuschen eine ähnlich wichtige Rolle zu wie der Stimme. Gerade in diesem Bereich kann man eine erhebliche Entwicklung verzeichnen, wenn wir Hörfunk-Werbespots ab den 1950er Jahren analysieren. Bose (2016, S. 163) weist auf die unterschiedlichen Elemente hin, die das klangliche Profil eines Senders oder Programms ausmachen und für Hörerentscheidungen von Bedeutung sind:
Themenwahl und journalistische Aufmachung, sprachliche und stimmlich-sprecherische Gestaltung, Musikfarbe und Verpackungselemente (z.B. Jingles, Tease), die mikrostrukturelle klangliche Gestaltung (sog. Broadcast Sound Design), z.B. technische Signal-Modifikationen (Wellenkompression, technische Überformungen der Stimmen), Rhythmus, Anzahl und Relation der Sendeelemente.
Nachfolgend wird ein kurzer Abstecher in die Formen und Funktionen von MusikMusik und GeräuschenGeräusche in der Radiowerbung gemacht, bevor die Rolle der Stimme näher beleuchtet wird. Dem schließt sich ein Blick auf Werbeformate im Hörfunk und auf Persuasionsstrategien an, derer sich die Werbung bedient.
2.3.1Musik und Geräusche als Werbemittel
MusikMusik und GeräuscheGeräusche werden eingesetzt als Ergänzung bei der Informationsvermittlung und zur Optimierung der Werbewirkung. Die auf drei Zeichenmodalitäten verteilten kommunikativen Aufgaben in der Radiowerbung fasst Stöckl (2007, S. 182) zusammen:
Sprache trägt – meist in dialogischer Form – die eigentliche Botschaft, Geräusche signalisieren den Kontext der Handlung und befördern die sinnliche Vergegenwärtigung der Botschaft, während Musik vor allem für die emotionEmotionale Ansprache und die Strukturierung des Gesamttexts verantwortlich ist.
Schon in den 1980er Jahren stellte Rösing (1981, S. 227) für Deutschland fest, dass etwa 70 % aller Radiowerbespots und rund 65 % der Werbespots im Fernsehen Musik beinhalteten und dass dies ein konstanter Anteil sei.1 Seine Untersuchungen betreffen die 1970er Jahre; der genaue Zeitraum seiner Ermittlungen ist unklar. Die Zahlen heute liegen jedenfalls noch weit höher, und empirische Forschungen über die Wirkung von Musik und Werbung sind nach Schramm und Spangardt (2016, S. 434) noch immer ein Desiderat in der Werbeforschung: z.B. die Auswirkung der Musik auf die Markenerinnerung; die mit der Musik verbundenen Assoziationen und Einstellungen; der Einfluss der Musik auf die Bewertung des Produkts und die Kaufabsicht.
Der kommunikative Charakter von Musik2 hängt von einer Reihe an Faktoren ab, z.B. vom Bekanntheitsgrad, dem Genre, Grad von ikonischer Verweiswirkung etc. Was ihre Funktionen betrifft, so wären laut Stöckl (2007, S. 195–196) als die fünf häufigsten zu nennen: Strukturierung (rhythmische Textur des Gesamttextes durch Musik), Illustration/Vorstellung (Förderung mentaler Bilder durch Musik), Demonstration (Versinnbildlichung der Wirkungsweise des Produkts), Grundstimmung, Aufmerksamkeit.
Wenn von Musik in der Hörfunkwerbung gesprochen wird, so handelt es sich um sogenannte funktionale MusikMusikfunktionale, da sie zur Beeinflussung der Rezipienten eingesetzt wird (Hofmann, 2010, S. 148–151). Die Wirkung ist vielfältig, vom Wecken der Aufmerksamkeit, dem Hervorrufen von Emotionen, dem Vermitteln von Informationen, bis zur Erinnerungs- und Wiedererkennungshilfe.3





























