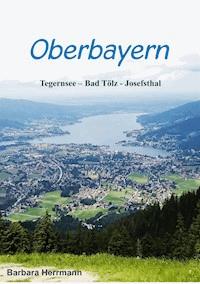Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Autorin ist auf der Suche nach sich selbst und will deshalb alles über das Schicksal ihrer Familie, die aus dem Kraichgau in Baden stammt, erfahren. Im Vordergrund stehen ihre Mutter Emma sowie ihre Großmütter Friedericke und Elisabeth. Warum haben Friedericke und Emma zu ihren dominanten Männern aufgeblickt, diese mit Gehorsam bedient und bis zu ihrem Lebensende ertragen? Wie war das damals auf dem Land, als man der jungen Friedericke ein uneheliches Kind weggenommen und sie mit dem Bauernsohn Jakob verheiratet hat? Warum hat sie ihr schweres und tristes Leben mit zwei Ehemännern und elf Kindern hingenommen und nie rebelliert? Ein zugleich einfühlsamer und spannender Roman, der die Lebenswege dreier Generationen im Rahmen der Geschichte eines ganzen Jahrhunderts nachzeichnet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Buch
Die Autorin ist auf der Suche nach sich selbst und will deshalb alles über das Schicksal ihrer Familie, die aus dem Kraichgau in Baden stammt, erfahren.
Im Vordergrund stehen ihre Mutter Emma sowie ihre Großmütter Friedericke und Elisabeth. Warum haben Friedericke und Emma zu ihren dominanten Männern aufgeblickt, diese mit Gehorsam bedient und bis zu ihrem Lebensende ertragen? Wie war das damals auf dem Land, als man der jungen Friedericke ein uneheliches Kind weggenommen und sie mit dem Bauernsohn Jakob verheiratet hat? Warum hat sie ihr schweres und tristes Leben mit zwei Ehemännern und elf Kindern hingenommen und nie rebelliert?
Ein zugleich einfühlsamer und spannender Roman, der die Lebenswege dreier Generationen im Rahmen der Geschichte eines ganzen Jahrhunderts nachzeichnet.
Über Barbara Herrmann
Barbara Herrmann ist in Karlsruhe geboren und in Kraichtal-Oberöwisheim aufgewachsen. Ihre Liebe zu Büchern und zum Schreiben begleitete sie während ihres ganzen Berufslebens als Kauffrau. Nach ihrem Eintritt in den Ruhestand sind mehrere Bücher (Romane, Reiseberichte, humorvolles Mundart-Wörterbuch) von ihr erschienen. Heute lebt die Mutter zweier Söhne mit ihrer Familie in Berlin.
Mehr Informationen unter: www.heidezimmermann.de
Danke
Aus vollem Herzen möchte ich meiner großen Familie und besonders den Familienmitgliedern danken, die über mehr als hundert Jahre mit ihren Lebensgeschichten die Grundlage für dieses Buch lieferten. Die spannenden Momente in ihrem Leben und die zeitgeschichtlichen Gegebenheiten der verschiedenen Jahrzehnte bilden die Würze für meine Erzählung. Ich habe sie allerdings mit Elementen vermischt, die meiner Fantasie entsprungen sind – einerseits, weil mir doch an manchen Stellen Aufzeichnungen fehlen und meine Erinnerung zweifelsohne Lücken aufweist, und andererseits, weil ich die für außenstehende Leser eher langweiligen Lebensabschnitte einer normalen Arbeiterfamilie ganz bewusst weggelassen habe. Damit handelt es sich bei diesem Buch mehr um einen autobiografischen Roman als um eine Autobiografie. So sind viele Namen in dieser Geschichte frei erfunden – auch aus Respekt gegenüber den zahlreichen Nachkommen und weitverzweigten Linien der Familien. Historisch wohlfundiert sind dagegen Details wie Wetter- und Brandkatastrophen sowie die Einbindung berühmter ortsansässiger Familien und Unternehmen, die durch Fotos dokumentiert sind. In diesem Zusammenhang danke ich der Stadt Kraichtal und dem Autor Anton Schneider für die Erlaubnis, Inhalte und Bilder aus dem Buch „1200 Jahre Oberöwisheim“1 verwenden zu dürfen. Wo keine Quelle angegeben ist, stammen die Fotos aus dem privaten Besitz meiner Familie.
Warum habe ich dem Buch den Titel „Planstraße 146“ gegeben? Die Planstraße existiert tatsächlich – und zwar in Oberöwisheim, das heute zur Stadt Kraichtal im Kraichgau/Baden gehört. Sie ist die Straße meines Elternhauses, und dort habe ich die ersten Jahre meiner Kindheit und Jugend verbracht.
Die Planstraße in Oberöwisheim
Meine Vorfahren haben natürlich die Mundart unserer badischen Heimat gesprochen. Daher habe ich mich entschieden, die Dialoge aus der zurückliegenden, alten Zeit überwiegend in der Mundart zu verfassen, weil sie in meinen Augen vor allem in schwierigen Situationen die Stimmungen und Gefühle der Menschen und die Härte der Zeit deutlicher widerspiegelt als das Hochdeutsche. Da das Badische eine auffällige und für Auswärtige zum Teil schwer zu verstehende Mundart ist, habe ich sie an der einen oder anderen Stelle etwas abgeschwächt, damit sie auch für Leser außerhalb der Region nachvollziehbar wird. Deshalb ist die Schreibweise der Mundart-Wörter nicht immer vollkommen „badisch korrekt“. Eingefleischte Badener mögen mir dies nachsehen.
Gerne habe ich den Erzählungen meiner Großmütter und meiner Eltern gelauscht, doch leider habe ich ihnen damals nicht die Bedeutung beigemessen, die sie heute für mich haben. Jetzt, da sie mich sehr stark interessieren, ist niemand mehr da, der mir detailliert berichten könnte, wie es gewesen ist.
Nun türmen sich in mir zahlreiche Fragen auf, auf deren Antworten wir verzichten müssen. So zum Beispiel diese: Wie wurde im Jahre 1907 eine junge Frau mit einem unehelichen Kind in ihrem Dorf behandelt, und wie hat sie unter der Situation gelitten? Wie sah es in ihr aus, und was waren ihre Gedanken? Wie hat sie den Schmerz einer Mutter ertragen? Ich bedauere, nicht mehr und nicht intensiver nachgefragt zu haben. Und auch die Generation meiner Eltern hat mir nicht alles berichtet, nicht so ausführlich, wie ich es für dieses Buch benötigt hätte. Diese Menschen lebten damit, ihre Gefühle einzusperren und nicht zu zeigen, wie es in ihnen aussieht.
Quelle: Buch „1200 Jahre Oberöwisheim“
Oberöwisheim (heute Stadtteil von Kraichtal)
Mit Erschrecken muss ich erkennen, dass ich auch aus meinem eigenen Leben so vieles vergessen habe, wie ich es niemals vermutet hätte. Meine persönlichen Erinnerungen an meine Kindheit bis zum Alter von sechs oder sieben Jahren sind lediglich bruchstückhaft vorhanden. Ich kann mich nur an einzelne kleine Geschichten, Begebenheiten und Situationen erinnern, ganz besonders aber an einprägsame und einschneidende Erlebnisse. Und man kann es kaum glauben, sogar beim eigenen Erwachsenwerden und Erwachsensein ist man mühselig gezwungen, Puzzleteile zusammentragen, weil vieles vergessen, verdrängt oder durch neue Lebensabschnitte verdeckt wurde. Es ist schade, dass ich kein Tagebuch geführt habe, denn dieses würde mir jetzt helfen.
Ich danke euch allen sehr, denn ihr hattet ein schweres, manchmal auch leidvolles, ein ereignisreiches und bisweilen auch schönes Leben. Ihr habt so gelebt, wie viele Menschen in dieser Zeit gelebt haben. Deshalb seid ihr meine Zeugen einer Zeit, die sich über mehr als hundert Jahre hinzieht. Und an den Stellen, wo wir euch anders oder gar nicht wiederfinden, spielt in diesem Buch die Theaterbühne der Fantasie ihren Akt.
Mögen wir euch am Ende in eurem Handeln verstehen und erkennen, wie schwer ihr alle an eurem Leben zu tragen hattet. Danke, dass ihr uns für unser Leben den Weg bereitet habt.
Barbara Herrmann
1 Walter, Heinz Erich (Hrsg.): Das Ortsbuch von Oberöwisheim: 1200 Jahre Oberöwisheim. Jetzt Stadtteil von Kraichtal (Kreis Karlsruhe). 7711971, Walter-Verlag GmbH Ludwigsburg, 1973
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Barbara heute
Jakobina Friedericke
Elisabeth
Emma
Barbara
Barbara
Stammbaum
Vorwort
Es ist seltsam, aber seit einiger Zeit versucht mich die Erinnerung und die Vergangenheit einzuholen. Meine Blicke und Gedanken gehen oft zurück und nicht mehr ganz so weit nach vorne, weil die Straße meines Lebens hinter mir mittlerweile viel länger ist als das Stück, das ich noch vor mir habe.
Ich weiß nicht, wo diese sentimentalen Anflüge herrühren, und ich zermartere mir den Kopf, wieso das jetzt auf einmal der Fall ist und warum diese emotionalen Gedanken plötzlich so stark sind, warum sie mich derart beherrschen und mich nicht mehr loslassen. Das Leben hat noch so viel zu bieten, da lohnt sich doch der ausschließliche Blick zurück noch nicht, zumal ich bisher ein Leben hatte wie viele andere Menschen auch. Nichts Besonderes meine ich, nichts Auffälliges, nichts, das auf irgendeine Art und Weise interessant sein könnte. Trotzdem bewege ich mich vermehrt in meiner Kindheit und stelle mir immer wieder die Frage, wer ich eigentlich bin und wo ich herkomme. Wie war meine Kindheit, was haben sie mir mitgegeben, meine Großmütter, meine Mutter, mein Vater und alle, die mich in meinem Leben begleitet haben? Wie haben sie ihr Leben gelebt? Warum haben sie so gelebt, wie sie es getan haben? Wie war die Zeit, in der sie gelebt haben? Ist mein Leben in diesen, meinen Bahnen verlaufen, weil meine Vorfahren mir gewisse Grundlagen mitgegeben haben, oder habe ich mich sehr viel später selbst in meinem Ich bestimmt? Kann ich als Mensch überhaupt alles selbst bestimmen, und spielen meine Herkunft, das Vorleben von Werten, die Liebe im Elternhaus und die Kindheit nur eine kleine Rolle? Oder ist der Einfluss größer, als ich es erahne? Ich denke, ich muss das alles entwirren, dann kann ich es vielleicht herausfinden.
Mein Leben war bisher nicht besonders auffällig, zumindest nach meiner Einschätzung. Natürlich kann ich mich in meiner Beurteilung täuschen. Das Ganze ist ja immer subjektiv zu sehen. Was ich als nicht gut empfinde, ist womöglich für andere ein Idealzustand. Sie hätten vielleicht gerne mein Leben gelebt, weil sie glauben, dass es allemal besser und spannender ist als ihr eigenes. Oder das Gegenteil ist der Fall: Sie könnten denken, dass ich ein Bruchpilot bin, mit dem man nicht unbedingt tauschen möchte. Nach meiner Empfindung könnte man durchaus angenehmer und wohlhabender aufwachsen und sein Leben gestalten, als ich das getan habe. Aber macht das wohlhabende Leben auch das ultimative Glück aus? Oder irren wir an dieser Stelle mit unserer Einschätzung?
Meine Kindheit erweckt in mir nicht die gewünschten Glücksgefühle, von denen viele berichten, wenn sie sagen, dass sie sehr behütet und liebevoll erzogen wurden und aufgewachsen sind. Bei uns war das nach meiner Einschätzung nicht so reibungslos. Wie hätte es auch anders sein können? Für Zuwendung und Zärtlichkeit war sehr wenig Raum und im Alltag vor lauter Schufterei oft gar kein Platz. Aber das Gefühl, beschützt zu sein, ein Zuhause zu haben, war sehr wohl da. Auch die Förderung einer besseren Bildung war kein Thema, das meinen Eltern Kopfzerbrechen machte. Wichtig war gerade mal eine solide Ausbildung, das reichte für ein einfaches Mädchen. Ich will damit aber nicht sagen, dass ich mich ungeliebt fühlte. Es gab nichts, das ich vermisste, weil ich nichts anderes kannte und weil es zu dem Zeitpunkt gut war, wie es war.
Die Gedanken ließen mich auf jeden Fall nicht mehr los, und ich brauchte für mich und mein zukünftiges Wohlergehen die richtigen Antworten auf die Fragen, die sich immer stärker in meinen Kopf bohrten. Über diese Tatsache und die daraus entstandenen neuen Fragen grübelte ich ständig. Doch über die Herangehensweise und die Umsetzung dachte ich nur gelegentlich nach, dabei wäre dies mindestens genauso wichtig gewesen.
Irgendwann in diesem Prozess musste ich entscheiden, wie ich mein Ziel, zu erfahren, wer ich bin, erreichen wollte. Ja, ich hatte endlich begriffen, dass ich mich sehr um die Vergangenheit bemühen musste, obwohl es nicht so leicht war, wie ich einige Tage nach dieser endgültigen Erkenntnis feststellen musste. Ich legte mich trotzdem fest, es unbedingt herausfinden zu wollen. Nur wusste ich noch nicht, wie ich es anstellen sollte.
Und nach diesen mühselig und langwierig gewachsenen Einsichten sitze ich endlich an meinem Schreibtisch und drehe den Stift zwischen den Fingern. Nach langem Überlegen habe ich mir endlich vorgenommen, mein Ziel erreichen zu wollen, indem ich meine Geschichte aufschreibe, meine eigene, von mir eher als langweilig empfundene Lebensgeschichte – und die meiner Familie und Vorfahren. Ich muss lächeln, denn letzteres ist die Herausforderung überhaupt, und bei dem Gedanken bekomme ich Herzklopfen. Ich habe mir eigens hierfür mehrere Schreibblöcke, Bleistifte und einen richtig guten Füller besorgt, und nun kann ich beginnen.
Doch ich lege den Stift immer öfter beiseite und gehe stattdessen an einem dieser Tage entschlossen an den Computer. Damit geht es vielleicht besser, denke ich für einen mutigen Moment, stelle aber nach einigen Stunden fest, dass dies auch nicht der Fall ist. Dabei schien es mir so einfach. Ich würde doch nur in Gedanken zurückwandern müssen in die längst vergangene Zeit. Es gibt so vieles, an das ich mich erinnern kann. Klare Bilder, Szenen aus der Schule, mit Freunden, mit den Eltern, den Großmüttern. Ich sehe das Haus, die Nachbarn, die Tanten und Onkel. Ich sehe die Landschaft, die Bäume und Felder, im Sommer und im Winter, die Straßen unseres Dorfes. Sogar als kleines Mädchen kann ich mich in vielen verschiedenen Situationen erkennen. Warum kann ich das aber nicht präzise zusammenfügen, in die richtige Reihenfolge bringen? Wann war das? Wie alt war ich, als ich vor meinem geistigen Auge die Treppen des Hauses emporstieg?
Nein, so einfach geht das nicht, stelle ich kopfschüttelnd fest. Lange blicke ich aus dem Fenster, sehe hinter den Häusern ein wenig vom Horizont, schaue hindurch und nehme alles nur schemenhaft wahr. Mir ist schwer ums Herz, mich überfällt Hilflosigkeit, weil das Erinnerungsvermögen so viele ungeahnte Schwächen hat. Nie hätte ich geglaubt, dass ich so vieles vergessen, so vieles nicht erfragt habe. Zahlreiche Dinge aus meiner Erinnerung kommen mir nicht mit der hundertprozentigen Klarheit ins Gedächtnis. Doch gerade dies würde ich dringend benötigen, um die Bilder in meinem Kopf in klare Worte umsetzen zu können.
Die typischen Geräusche einer Großstadt umspülen mich plötzlich laut und gellend und wirken auf einmal störend. Sie hemmen mich in meiner Konzentration und lenken mich ab. Das ist das Hier und Heute, das sich nicht einfach abstellen lässt. Ich muss aber damit klarkommen und darf mich nicht ablenken lassen.
Im Geiste muss ich also zurückgehen, Altes wiederfinden, und wenn ich mich konzentriere, fällt mir auch sofort einiges wieder ein. Ich sehe mich auf der Schulbank sitzen, die Lehrerin steht am Pult und redet. Ich habe eine kleine Tafel und ein Stück Kreide vor mir liegen. Meinen Schwamm, der mit einer Schnur an der Tafel befestigt ist, habe ich nass gemacht. Zum Reinigen der großen Wandtafel befindet sich gleich daneben eine Schüssel mit Wasser. Ich sitze in den hinteren Reihen auf einer der Holzbänke, die direkt an die schrägen Pulte angeschraubt sind. Oben befindet sich eigens eine Rille, um die Feder ablegen zu können. Rechts außen ist ein Tintenfass eingelassen. Die Pulte sind schon ganz schön zerschrammt. Da haben doch ein paar ältere Schüler ihre Initialen und anderen Blödsinn eingeritzt.
Doch plötzlich ist alles, was ich soeben gesehen habe, schon wieder zu Ende. Das war es schon? Wann war das nur? Wer saß neben mir? Wie war ich gekleidet?
Schnell ziehen sie durch, die Bilder, viel zu schnell, dabei finde ich zahlreiche Lücken, die ich nicht zu füllen vermag. Was ist an diesem oder jenem Tag passiert? Wann haben wir wo und wie gewohnt? Wer hat wann und wo gearbeitet? Wie ist dieses und jenes verlaufen und warum?
Niemand in unserer Familie, einer Arbeiterfamilie, hat jemals Notizen angefertigt. Wozu hätte man dies auch tun sollen? Man hatte schließlich andere Sorgen. Und nun sitze ich hier und finde den berühmten Faden nicht.
So fasse ich nach reiflicher Überlegung einen weiteren wichtigen Entschluss: Ich werde abtauchen und Mosaikstein für Mosaikstein zusammensuchen, die kirchlichen Einträge sichten, die Erinnerungen zusammentragen und Fotos ansehen müssen.
Noch weiß ich nicht, wie lange dies dauern wird, aber ich weiß, dass ich es tun muss. Und eines Tages, wenn ich alles gefunden und mich erinnert habe, werde ich weitermachen, mit meinem Bleistift oder an meinem Computer.
Ich danke schon jetzt meiner kleinen Familie, die das wird ertragen müssen. Manchmal werde ich schlechte Laune haben und ab und zu auch mutlos sein. Ganz sicher werde ich an vielen Stellen den Faden verlieren, herumirren und natürlich manches Mal von vorne beginnen müssen, und ich werde des Öfteren glauben, dass ich es nicht schaffen werde.
Meine Erinnerung wird sicherlich keine sehr gute und auch keine allzu verlässliche Fundgrube sein, weil ich bestimmt hin und wieder das, was ich erlebt oder von anderen gehört habe, verwechseln und durcheinanderbringen werde. Doch es ist und bleibt das, was ich erfahren habe und was ich in mir trage.
Barbara heute
Die matte Wintersonne steht kaum eine Handbreit über den Dächern und blinzelt aus einem hell verhangenen Himmel auf das blendende Weiß, das sich über Nacht ausgebreitet hat, und die Schneeflocken tänzeln durch die Luft, um sich dann langsam niederzulegen. Es ist ein wunderschöner Wintertag, und der kalte Wind pfeift durch die Ritzen der Fenster des kleinen ehemaligen Winzerhauses. Es ist Mitte Februar im Jahr 2006, und hier drinnen ist es himmlisch warm, der alte Bollerofen spuckt knisternd seine Wärme aus und sorgt für Gemütlichkeit in der großzügigen Wohnküche. Ich, Barbara, sitze am Küchentisch, blicke still aus dem Fenster, habe einen Becher in der Hand, aus dem ich in kleinen Schlückchen meinen Kaffee genieße, und betrachte die lustig hin und her hüpfenden Schneeflocken. Ich stehe auf, öffne das Fenster, lasse eine Weile die kalte, klare Luft hereinströmen und atme sie tief ein. Was gibt es Schöneres, als den Tag ohne Stress, beschaulich, friedlich und mit sich selbst im Reinen beginnen zu dürfen?
Hierher, in dieses kleine Dorf an der Mosel, habe ich mich zusammen mit meinem Mann Thomas vor ziemlich genau einem Jahr teilweise zurückgezogen. Das schmale, enge Tal, in dessen Mitte sich der Fluss anmutig entlangschlängelt, strahlt sehr viel Ruhe und Geborgenheit aus. Mit einer Ausnahme natürlich: Wenn Hochwasser angesagt ist, verliert der Fluss seine Gelassenheit, und die zischende Gischt verwandelt sich in eine hässliche Fratze, die den Strom hinunterschnellt. Dabei steigt und steigt das Wasser, dringt rücksichtslos in die Straßen und Häuser ein und zerstört alles, was ihm im Wege steht. Ist es dann vorbei, strömt der Fluss wieder ruhig vor sich hin und tut so, als könne er kein Wässerchen trüben. Gerade weil das Tal so eng ist, ist alles sehr gewöhnungsbedürftig. Die Häuser sind dicht aneinandergereiht, weil schon vor Generationen platzsparend gebaut werden musste, mit Ausnahme der Neubaugebiete außerhalb des Ortes, die in jüngerer Zeit etwas anders angelegt und in die Hänge hineingeplant wurden. Eine weitere Ausnahme ist das eine oder andere Weingut, das inmitten eines Weinbergs mit einem großzügigen Herrenhaus und einigen Nebengebäuden in seiner ganzen Pracht strahlt. Die Steillage wird aber meist bis auf den letzten Meter für den Weinbau genutzt.
So musste ich mich schnell daran gewöhnen, dass die nächsten Häuser extrem nahe stehen und mehr oder weniger direkt an unseres angrenzen. Das anfangs merkwürdige Gefühl, dass die Nachbarn einem unmittelbar auf den Tisch blicken können, hat sich nach und nach verflüchtigt, zumal sich zu diesen eine wunderbare Freundschaft entwickelt hat.
Drei Jahre ist es inzwischen her, dass ich eine Bilanz ziehen wollte über mein Leben, das ich streckenweise als unbefriedigend angesehen, als nicht gut befunden hatte. Während meiner Recherche und den Versuchen, mein Erinnerungsvermögen zu stärken, hatte ich viel Zeit, die ich ausgiebig genutzt habe, und ich habe festgestellt, dass mich manche Begebenheit oft zum Erstaunen brachte, weil ich die Situation heute mit Abstand völlig anders einschätze als damals.
Das Vergangene übrigens sorgte mich nicht so sehr, denn es war gelebt, und daran konnte ich nicht mehr rütteln. Allerdings beschäftigte mich die Zukunft umso mehr. Was ist mit meiner Zukunft? Wie lange wird sie noch dauern? Kann ich noch etwas anfangen mit dem vielleicht letzten Rest meines Lebens? Aber weshalb die Formulierung „letzter Rest“? Ich kann ja auch noch viel Zeit vor mir haben. Wer sagt denn, dass ich nicht noch zwanzig oder gar mehr Jahre zur Verfügung habe? Da geht ja eventuell noch etwas! Kann ich mit Ende fünfzig noch einmal neu beginnen? Oder ist es zu spät, sogar viel zu spät? Ein mühevoller Prozess, den ich da bewältigen musste. Doch es hat sich, so glaube ich heute, für mich gelohnt.
Ja, so lange ist es her, dass sich diese Fragen, diese bohrenden Fragen nach meiner Herkunft in mir auftürmten. Das gelegentliche Gefühl, ein Leben lang extrem viel gearbeitet, aber nichts Besonderes erreicht zu haben, ist schon eine Sache für sich, ist nicht einfach und, wie ich finde, hin und wieder auch belastend.
Wie gut haben es die, die ihr Hobby zum Beruf machen konnten, glaubte ich. Da gibt es einen speziellen Einklang und eine ganz besondere Lust, das zu tun, was man tun möchte. Natürlich sind es verschwindend wenige Menschen, denen das vergönnt ist, das weiß ich auch, aber meine Arbeit war weit weg von dem, was meine Wünsche waren, so weit weg wie der Mond von der Erde. Ich träumte von einer guten Schule, von einer besonderen Ausbildung, und ich träumte davon, Bücher schreiben und Bilder malen zu können. Und was hatte das Leben für mich bereitgehalten? Eine arbeitsreiche Kindheit, die Volksschule, das einfache Landleben einer Arbeiterfamilie und rasch eine eigene Familie mit zwei Kindern. An eine Weiterbildung, gar eine Karriere war nicht mehr zu denken, solange die Kinder im Haus waren. Ich arbeitete dort, wo sich die Arbeitszeit mit meiner Familie in Einklang bringen ließ. Kurz vor dem Ende, nach fast vierzig Jahren, gesellten sich noch die Krankheit und die Pflege meiner Eltern dazu. Dann kam eine Phase der Müdigkeit, der Trauer und der Enttäuschung, der Frage, wie es zurück ins Berufsleben gehen soll, wie ich endlich das tun kann, was mir Spaß macht, was mir gefällt und was dazu auch ein wenig erfolgreich sein kann. Es dauerte noch ein paar Jahre bis zu einer nennenswerten Veränderung, bis dahin war ich eingebunden in Aufgaben, die den Zweck hatten, den Lebensunterhalt zu bestreiten.
Dann kam die Rente, und ich war endlich frei in der Entscheidung, womit ich mich beschäftigen wollte. So suchte ich einerseits nach einem neuen Anfang, und andererseits ließ mich die Vergangenheit nicht mehr los. Ich war zu dem Schluss gekommen, dass ich diesen Kraftakt, noch einmal neu anzufangen, mich noch einmal beruflich neu zu beweisen, vollziehen musste. Doch in dem Moment konnte ich diesen Weg nicht gehen – nicht, wenn ich nicht meinen Frieden mit der Vergangenheit schließen würde. Denn diese ewigen Zweifel, ob ich nicht gewisse Dinge hätte anders machen können, diese merkwürdigen Konstruktionen, die da ständig durch meinen Kopf geisterten, mussten zuvor eliminiert werden. Dabei muss man über seinen eigenen Schatten springen und zu sich selbst unerbittlich ehrlich sein. Es bereitete mit an einigen Stellen der Recherche starke körperliche Schmerzen, sehr ehrlich und selbstkritisch zu sein. Wie viele Jahre hatte ich mich eigentlich mit meinen inneren Ausreden eingerichtet? Wie lange waren alle anderen schuld gewesen – nur nicht ich? Wie viele Jahre habe ich mich hinter all diesen Ausreden versteckt, um der inneren Not nicht ins Auge sehen zu müssen, um die von außen hereinprasselnden Winde ertragen und damit leben zu können? Oh, ich hätte heulen können, und ich tat es manchmal auch. Aber es ist auch befreiend und erleichternd zugleich. Es öffnet neue Horizonte und Perspektiven.
Ich war als Autorin noch völlig unerfahren, es war bis dahin nichts als ein ewiger, verblasster Traum und eine Schublade voller kleinerer und mittellanger Texte, und ich glaubte auch nicht daran, dass mir als Autorin die Aufarbeitung gelingen könnte. Eine Geschichte mit biografischem Hintergrund ist schon eine andere Hausnummer als eine kleine, fiktive Story, das habe ich bei meinem ersten Versuch schnell erkannt. Ich habe es sofort wieder verworfen, es las sich nicht flüssig, war ungeordnet, unrealistisch, unprofessionell, ja, eigentlich gar nichts, wie ich glaubte. Ob etwas dramaturgisch gut und spannend oder nicht gut und langweilig ist, merkt man ja selbst, wenn man nicht ganz dem Glauben verfallen ist, der Meister aller Schriftsteller zu sein. Wie erkennt man aber, ob etwas schreibtechnisch gut ist oder nicht? Ich gab mich an der Stelle keinen Illusionen hin. Hinter dem Schreiben steckt eine ganze Menge Handwerk, das ich nicht beherrschte.
Also entschied ich mich, erst einmal die Zukunft zu suchen, bevor ich mich komplett mit der Vergangenheit auseinandersetzen wollte. Schließlich konnte ich ja bei meiner Recherche in die Vergangenheit in kleinen Schritten zurückgehen.
Natürlich musste ein neues, anderes Leben her. So wie es war, konnte es meines Erachtens nicht bleiben, zumindest nicht, wenn man wie ich glaubte, dass noch etwas nachgeholt werden musste. Und so verband ich in Gedanken das Nützliche mit dem Schönen und dem Sinnvollen.
Mir war klar, dass ich ohnehin das Schreiben erlernen musste, wenn ich meine Geschichte aufschreiben wollte. Warum sollte deshalb mein neues Leben nicht endlich mit dem Schreiben beginnen? Ich konnte ja mit kleinen Storys anfangen, mit diesen üben und dabei viel lernen. Sie sind übersichtlich, sagte ich mir, das würde bestimmt einfacher sein, als eine Zeitspanne von vielen Jahrzehnten akribisch und genau zu erfassen. Ich wollte das Leben meiner Vorfahren und auch mein eigenes Leben als eine spannende Geschichte erzählen. Und die zweifellos vorhandenen Lücken sollte meine Fantasie auffüllen. Ein autobiografischer Roman eben.
Das Knistern im Ofen holt mich in die morgendliche Realität zurück. Ich nehme wieder einen Schluck Kaffee, blicke zur Uhr, es ist erst sechs, noch früh am Tag, und ich habe keine Eile. Außerdem ist es still im Haus, mein Mann ist unterwegs und besorgt Brötchen, die ihm der Bäcker in dieser frühen Stunde durch die Hintertür reicht, denn während der Wintersaison ist es ruhig in unserer Gegend. Mein Blick geht über das Land, ich sehe die herrlichen Berge. Naja, das ist wohl etwas übertrieben, es sind nicht gerade Berge, wie wir sie von den Alpen kennen. Sagen wir, es sind große Hügel. Die vielen Reben, die heute ein weißes Kleid tragen und schlafen, scheinen in der Dämmerung wie Edelsteine zu funkeln. Die Straße ist sehr ruhig, niemand ist zu sehen – es wohnen sowieso nicht viele Menschen hier, gerade mal dreihundert – aber ich genieße diese herrliche Ruhe, bin weit weg, weg von der Großstadt, weg vom Autolärm, der Hektik und den umherströmenden Menschen, weg vom Kampf um das Leben, der bei vielen sogar ein Kampf um das Überleben ist. Ich bin im Augenblick weit weg von gesellschaftlichen Problemen und deren Niederungen, sehe nichts mehr von dem Streben, besser sein zu wollen als andere, spüre nichts von der Hektik der Tage.
Was mir hier allerdings fehlt, ist Kultur, die vielen Theater, Konzerte, Ausstellungen. Dafür lese ich Neuigkeiten über die Promis, die Politik, über Menschen, die mich sonst eigentlich überhaupt nicht interessieren. Aber sie gehören nun einmal in diese Welt, für manche auch zur Allgemeinbildung, zur Diskussion über dieses und jenes. Normalerweise bekommen wir das hautnah mit, wenn wir in Berlin sind. So ist das in der Hauptstadt, da tummelt sich alles, was Rang und Namen hat. Und ich liebe Berlin sehr. Um beide Vorlieben leben zu dürfen, haben wir uns entschieden, unsere Jahreszeiten aufzuteilen. Im Sommer die Mosel und im Winter die Stadt mit ihrem kulturellen Angebot. Nur weil das Buch geschrieben werden musste und ich keine Ablenkung haben wollte, ging es dieses Mal viel früher los als sonst, nämlich bereits im Januar. Bei näherer Betrachtung tut es gut, unendlich gut, all dem Drumherum entrinnen zu können, wenn man seine Ruhe braucht. Es ist auch eine ganz neue Erfahrung für mich, nicht ortsgebunden zu sein und selbst entscheiden zu können, wo ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein glaube.
Mittlerweile bin ich mein eigener Mittelpunkt und muss mich nicht mehr darum kümmern, dass es irgendjemandem gut geht, ich muss mich nicht mit den Problemen anderer beschäftigen, wenn ich das nicht möchte, und ich muss diese auch nicht bewerten und einschätzen. Wir haben den Schritt getan, so spät ein teilweise neues Leben zu beginnen, ohne das bisherige gänzlich aufzugeben, und es ist uns trotzdem verdammt schwergefallen, das kann ich so unverblümt sagen. Schließlich ist jede Veränderung nicht leicht und schon gar nicht eine weitere neue Herausforderung, die wir uns hätten ersparen können, würden wir uns auf die faule Rentnerhaut legen.
Aus einigen Fenstern des kleinen historischen Winzerhauses, das wir ziemlich heruntergekommen und daher billig angemietet haben, habe ich so etwas wie einen winzigen Fernblick zwischen den Gebäuden durch. Ich habe Glück, dass nicht ganz jeder Millimeter verbaut ist. Dieser Blick ist frei, nichts verstellt ihn, ich sehe Weinberge so weit das Auge reicht, bis an die Grenze zum blauen Himmel, und es ist wunderbar. Vor meinem Küchenfenster sehe ich auch den kleinen Innenhof, der von einigen Gebäuden umgeben ist. Da ist zunächst das winzige ehemalige Haupthaus, das wir selbst bewohnen. Vom Flur haben wir einen direkten Ausgang zur Straße und einen zweiten nach hinten zum Innenhof. Während der Saison wird er bestuhlt, mit zahlreichen Kübelpflanzen versehen und lädt die vielen Sommergäste zum Verweilen ein. Gegenüber dem Haupthaus befindet sich die alte Kelterei mit dem Zugang zu einem ersten Gewölbe, das sich auf der gleichen Ebene befindet. Von diesem führt dann weiter hinten eine Treppe nach unten in den Gewölbekeller, der natürlich als Weinkeller dient. Wir haben die alte Kelterei mit einfachen Mitteln renoviert, die Gewölbesteine gereinigt, den Raum mit alten Winzerutensilien und anderen passenden Dekorationen versehen sowie mit Tischen und Stühlen eingerichtet. Von März bis Oktober öffnen wir das Haupttor und bieten Touristen eine besonders gemütliche Möglichkeit zur Einkehr. Was gibt es Schöneres als eine Rast bei Kaffee und Kuchen, bei einem Glas Wein und einer Vesperplatte? Der Gedanke, dass mein Mann auch eine befriedigende Beschäftigung haben wollte und dass es nur gut sein konnte, die Rente für den Unterhalt unseres zweiten Standorts etwas aufzubessern, war letztendlich der Vater des Gedankens. So schaffen wir uns im Sommer mit wenigen Aushilfen den entsprechenden finanziellen Vorrat, der für das Stadtleben und die Kultursaison im Winter und eigentlich auch für das ganze Jahr wichtig ist. Nach vorne zur Straße erstreckt sich ein kleiner Vorgarten, der von einem Holzzaun umgeben ist, das Gartentor ist verschlossen, die Pflanzen sind im Moment noch unter der Schneedecke versteckt, und die Erde ist vom Frost durchzogen.
Ich schließe das Fenster, ziehe die Gardine vor und gehe zurück an den hölzernen Küchentisch, der in der Mitte des Raumes steht, setze mich wieder auf meinen Stuhl und sehe mich um. Neben dem alten Küchenherd, der noch ein Wasserschiff hat, befindet sich eine kleine Spüle, und auf der anderen Seite thront ein alter Küchenschrank aus Holz, wie ich ihn noch von meiner Mutter kenne. Der Unterschrank hat vier Türen und drei Schubladen, der Oberschrank links und rechts eine geschlossene Holztür und in der Mitte zwei Glastüren. Um den wuchtigen Tisch, auf dem ich eine rotweißkarierte Tischdecke ausgebreitet habe, stehen vier Stühle, die zum Sitzen einladen. Der Fußboden besteht aus alten,