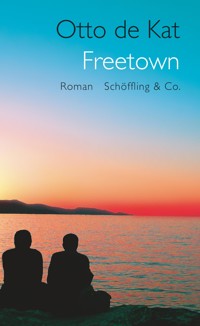19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schöffling & Co.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sommer 1909: Maxim, Bürgermeister der Nordseeinsel Texel, wird von seiner Vergangenheit verfolgt. Seine Zeit auf Sumatra als Offizier in der Königlichen Niederländisch Indischen Armee und die Gräuel, die er damals gesehen – und möglicherweise verursacht – hat, lassen ihn nicht los. Sein Freund W. A. wiederum verfasst unter dem sprechenden Pseudonym »Wekker« kritische Artikel über die Machenschaften der Kolonialherren in Niederländisch-Ostindien und erinnert sich noch genau, wie insbesondere Tjoet Nja Dinh, die legendäre Unabhängigkeitskämpferin, in die Falle gelockt wurde. Kann W. A. Maxim helfen, sich seiner Vergangenheit endlich zu stellen? Und wie ist es möglich, dass sich die beiden derart nach einem Ort sehnen, an dem sich so viel Schreckliches zugetragen hat? In seinem neuen Roman über Sehnsucht und Schuld beleuchtet Otto de Kat ein dunkles Kapitel der Kolonialgeschichte und stellt die Frage, ob man dem Gewicht der Vergangenheit jemals entkommen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
[Cover]
Titel
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Anmerkungen des Autors
Autor:innenporträt
Übersetzer:innenporträt
Kurzbeschreibung
Impressum
Widmung
Für Addie, in Freundschaft
1
Tjoet Nja Dinh war zehn Jahre alt und hatte ihren Hof noch kein einziges Mal verlassen, als sie Ibrahim Lamgna heiratete. Man hatte sie von klein auf dazu erzogen, die Erste unter den Frauen zu sein, so wie sie später auch die Erste unter den Männern sein sollte. Verwebt in uralte Überlieferungen ihrer Familie, verfügte sie über eine höchst ungewöhnliche eigene Stimme. Im Schatten des Schwertes liege das Paradies und im Trinken des Todesbechers das ewige Leben, so Dinh. Das hatte sie von ihrem Vater und ihrer Großmutter gelernt. Die beiden waren ihre Berater und prägten ihre Erziehung. Ihr Haus befand sich ganz in der Nähe der Moschee, und ihre Tage vergingen im Rhythmus des Singsangs betender Männer. Den Allgegenwärtigen nannten sie Ihn, und so empfand sie es auch. Vertrau nur ihm und keiner Menschenseele, hatte Ibrahim sie beschworen. Sie hörte auf ihn.
Fünfzehn Jahre lebten Ibrahim und sie in Lampadang, in Dinhs Dorf, wo sie ihren eigenen Pfahlbau besaß, geschützt von einer undurchdringlichen Mauer aus Dornbüschen. In Atjeh, dem sagenumwobenen Norden Sumatras. Fünfzehn Jahre ohne Krieg, bis die Kuffar kamen, die ungläubigen Niederländer und ihre Unterstützer, um die Zivilisation zu bringen. Zivilisation – sie wussten, was das bedeutete: Krieg. So geschah, was früher oder später geschehen musste: Ibrahim wurde bei einem Angriff auf ein Feldlager erschossen, und sein Gefolge schleppte die Leiche tagelang auf einer Trage nach Mon Tassik, hoch in den Bergen, wohin sich kein Niederländer vorwagte.
Dort beweinte ihn Dinh und begrub ihn.
Dann meldete sich Oemar, ihr Cousin, der berühmteste Mann der Westküste. »Dinh, wo bist du, heirate mich, Dinh.« Das wiederholte er so lange, bis sie schließlich Ja sagte: Ja, zu Oemar und vor allem Nein zu den Niederländern. Oemar hatte schon sechs Frauen und sie sollte die siebte, aber bei Weitem die Mächtigste sein. Mächtig und unnahbar in ihrer Glaubensrüstung, in ihrem Glauben an Allah, an Atjeh, über das ihre Vorfahren einst geherrscht hatten. In ihrem Glauben an den Kampf gegen die Eindringlinge, Weiße aus einem fernen Land, das so dreist war, sich einzubilden, Atjeh erobern zu können.
Seit mehr als fünfundzwanzig Jahren, ja, seit sie denken konnte, gab es diese Bedrohung, hemmungslose Gewalt, Tausende Tote und Verwundete in endlosen Schlachten. Mann gegen Mann, Mann gegen Frau, denn unzählige Frauen schlüpften in Männerkleidung und kämpften bis zum bitteren Ende. »Die Unversöhnlichen«, wie sie von den Niederländern genannt wurden. Wie konnten sie es wagen, woher nahmen sie die Frechheit, ihre Untertanen als »unversöhnlich« zu bezeichnen. Das war doch eine vollkommene Verkehrung der Verhältnisse, eine Lüge, so wie alles von ihnen verdreht wurde, verfügt, verspielt und verdorben. Unversöhnlich? Wie soll man sich denn mit dem Erschießen von Kindern, dem Vergewaltigen von Frauen und dem Enthaupten von Männern versöhnen können?
Manchmal, wenn wieder ein Dorf niedergebrannt und eine Moschee verwüstet worden war, verzweifelte sie, glaubte, Allah hätte sich von ihr abgewandt. Allah, der Einzige. Hatte er Atjeh etwa verlassen? Aber in solchen Momenten, wenn sie weder ein noch aus wusste und an allem zweifelte, hörte sie wieder die Stimme ihrer Großmutter, die ihr als Kind von Atjeh erzählt hatte. Von den Sultanen in ihrer Familie, die das Land regiert hatten, von Mahoedan Sati, Nanta Tjih, Nanta Setia, von Fürsten eines unsichtbaren Reichs, das noch überall existierte und eines Tages wiederauferstehen würde. Von Kota Radja, der Hauptstadt unweit der Küste, in der die Sultane von Atjeh schon seit Menschengedenken lebten und herrschten. Vom prächtigen Kota mit seinen Fürstengräbern, Moscheen, Märkten und seiner wachsenden Bevölkerung. Geraune von einer magischen Welt, in der jeder seinen Platz hatte und in der man im Schutz der Moschee lebte. Das Lied von einem Gottesreich, von einem Leben, das bis ins Detail ausgestaltet und geregelt war. Atjeh war eine Faust, eine Faust gegen die Ungläubigen, die Kuffar, die verfluchten Händler »mit ihren langen Schiffen, mit ihren Lügen mit den langen Beinen«.
Die Stimme ihrer Großmutter gab ihr Halt. Niemand war Allah so nah wie sie. Als sie starb, wollte auch Dinh nicht mehr leben. Aber das Atjeh ihrer Großmutter gab es schon damals nicht mehr, es war ein Mythos, ein aus Sehnsucht gespeistes Märchen, ein Wiegenlied. Atjeh war längst keine Einheit mehr, der Sultan ein bloßes Symbol ohne jede Macht. Das Land war in miteinander verfeindete Familien zerfallen, in endlose Fehden, in ein Chaos aus unterschiedlichen Interessen und Machtspielchen. Wer in Mekka gewesen war, hatte den größten Einfluss … und wurde reich. Verrat war nicht nur ein Wort, das auf die Ungläubigen zutraf, sie kannten es selbst zur Genüge. Verrat, Abtrünnigkeit, Spionage, Gewalt – all das war ihnen nicht fremd, Allah hin oder her.
Tjoet Nja Dinh versuchte sich da rauszuhalten. Sie war überparteilich, und dort, wo sie auftauchte, verschwand jede Rivalität. Sie besaß die seltene Gabe, Menschen Hoffnung zu schenken. Sie wurde zu Oemars Ratgeberin, er hörte auf sie, und sie gab die Richtung vor.
Damit begann ihre Odyssee, unablässig verfolgt von General Van der Heijden und seinen Truppen, die sich stolz Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger, KNIL, nannten – Königliche Niederländisch-Indische Armee. Eine aus dem Boden gestampfte Truppe, gegründet, um Niederländisch-Ostindien zu unterwerfen, Insel für Insel, Stadt für Stadt, Kampong für Kampong. Es folgten mehrere kleinere und größere Kriege, Strafexpeditionen, Disziplinarmaßnahmen, Plünderungen auf Java, Lombok, Borneo, Bali und so weiter.
Halb Atjeh wurde von Van der Heijden in Brand gesteckt, ein Dorf nach dem anderen verwüstet, Moscheen wurden zerstört, der General versetzte das ganze Land in Angst und Schrecken. Irgendwann ging der Krieg zu Ende, weil die Niederländer begannen, die Menschen zu bestechen – auch eine Art Kriegsführung. Guerillakämpfer bekamen Geld und Häuser, einstige Feinde wurden wieder Nachbarn, und für eine Weile schien Ruhe einzukehren. Vorübergehend keine mordenden Patrouillen, vorübergehend keine Verwüstungen. Die KNIL zog sich nach Kota Radja zurück, und Oemar, Dinh und seine anderen Frauen verließen ihr Versteck in den Bergen und lebten wieder im Gebiet ihrer Vorfahren. Aber das Haus auf den hohen Pfählen in Lampadang, in dem Dinh ihre Kindheit verbracht hatte, stand nicht mehr. Es war niedergebrannt und vollkommen zerstört worden.
Die Reisfelder dampften in der Sonne, die Kampongs erlebten in diesen wenigen Jahren erneut so etwas wie Frieden, der jedoch keiner war. Denn inzwischen formierte sich Widerstand. Oemar und Dinh ergänzten einander perfekt. Es dauerte nicht lange, und Oemar bewaffnete eine kleine Armee mit Gewehren und Munition, die er sich mit Lug und Trug von diesen dämlichen Holländern in ihrem sicheren Kota Radja beschafft hatte. Es war Dinh gewesen, die ihn dazu bewegt hatte, unbeirrbar in ihrem Glauben, unbeugsam in ihrem Hass und tief in den Mythos des Atjeh-Reiches eingebunden. Sie war diejenige, die keinen Millimeter zurückweichen wollte, die Oemar aufwiegelte. Sie einte diejenigen, die sich einst überworfen hatten, verschaffte sich Gehör bei denen, die einst nicht hatten hören wollen, rüttelte diejenigen wach, die noch schliefen, und sie war die treibende Kraft hinter Oemars bis dahin ungekannter Popularität. Sein Mythos reichte weit. In Amsterdam sangen die Straßenjungen »Aan een touw, aan een touw, Teukoe Oemar en zijn vrouw«, wollten ihn und seine Gemahlin hängen sehen.
Aber in Atjeh sang die Armee nicht. Sie hatte keine Zeit zum Singen, denn es hieß Alarm, Alarm.
Oemar wurde in einen Hinterhalt gelockt und mit einem Schuss und einem Hieb umgebracht. Dinh hatte alles mit ansehen müssen. Sie hatte seinen Leichnam befreit und an sich gepresst. Aber irgendwann wurde sie von ihren eigenen Leuten fortgerissen, sie konnte nicht bei ihm bleiben, durfte ihn nicht begraben und nicht an seinem Grab trauern, weinend rief sie nach Rache. Oemar, für den sie alles aufgegeben und den sie unterstützt hatte, als er den Niederländern den Krieg erklärte, Oemar war allgegenwärtig. Sie lief mit seinen Füßen, sprach mit seinem Mund, kämpfte mit seinem Klewang, betete mit seinen Gebeten, trat in seine Fußstapfen. Stets fragte sie sich, was er wohl gesagt oder getan hätte. »Wir haben Allah, doch sie haben niemanden«, hatte er sie beschworen.
»Tjoet Nja Dinh, Tjoet Nja Dinh!« Sie riefen es, sie sangen es, sie stampften mit den Füßen im Takt ihres Schlachtrufs. Tjoet Na Dinh führte den Widerstand gegen die compenie an, gegen diese hochmütigen Niederländer mit ihren Karabinern und ihrem Gerede von Zivilisation und Fortschritt. Tjoet Nja Dinh würde sie in ihr einstiges Land zurückführen, zurück zu ihren Tempeln und Kampongs, zu den Gesetzen des Propheten.
Die Niederländer hassten und fürchteten sie, sie wurden einfach nicht schlau aus ihr. Patrouillen machten Jagd auf sie, und im gesamten Archipel ertönte der Befehl: »Findet Dinh!«
Sie zog quer durch ihr Atjeh. An allen Ecken und Enden tauchte sie auf. Sie brachte Hoffnung und Rebellion, verfluchte ihre Gegner und deren Helfershelfer, die Amboneser, Sundaneser und Javaner. Sie führte ihre Truppen durch Urwald und Berge, plante Hinterhalt um Hinterhalt, tötete so viele Ungläubige, wie sie konnte und entkam unzählige Male.
»La ilaha illa ’llah!« – »Es gibt keinen Gott außer Gott!«
2
Der Strand von Texel war etwas breiter als der von Padang.
Maxim starrte schon eine ganze Weile vor sich hin, aufs Meer. Fast reglos, als hielte er Wache. Die Flut kam, kroch auf seine geputzten Schuhe zu, doch er merkte es nicht. W. A.’s Telegramm heute früh hatte ihn überrumpelt. Darin stand, er sei in Holland und werde morgen die Fähre nach Texel nehmen. Sein Freund W. A. aus Kota Radja, der Mann, der ihn ohne es zu wissen, mit seinen Artikeln um seinen Seelenfrieden gebracht und seine Zukunftspläne durcheinandergewirbelt hatte.
Weit in der Ferne ging seine Frau mit den Kindern spazieren, zog einen Bollerwagen hinter sich her. Er hatte ihr noch gar nichts von W. A’s Besuch erzählt.
In den Dünen hinter ihm ertönten Schüsse, die Jagd war eröffnet. Mehrere laute Schüsse hintereinander, ganz in der Nähe. Dann verstummten sie. Nur die Vögel, der Wind und das Meer waren noch zu hören. Die Seeschwalben über seinem Kopf, die nach Fischen tauchten, die Meeresluft, die Brandung, die Hitze – sie zwangen ihn zurück. Zurück nach Atjeh.
Lange konnte es nicht mehr dauern. Sie mussten ganz in der Nähe sein, obwohl da nichts als Stille war und ab und zu ein Vogelschrei. In den Gajo-Ländern war die Nacht tintenschwarz. Schattenlos, finster wie der Tod.
Er schaute sich um, beugte sich zu seinem Adjutanten und fragte ihn flüsternd, wann wohl die Sonne aufginge.
In drei Stunden.
Sie hatten nicht genug Träger, mussten es irgendwie schaffen, zwei Tote und acht Verwundete mitzunehmen. Seine Brigade war erschöpft, hatte mehr schlecht als recht ein Lager zwischen ein paar Bäumen und Sträuchern aufgeschlagen. Sie waren von allen Seiten umzingelt. Noch ein Tagesmarsch, und sie hätten das Gebiet der Garnison Djeuram erreicht. Worauf wartete der Feind? Wie ihm in diesem Moment klar wurde, genügte ein einziger Angriff, um ihnen den Rest zu geben, fast alle waren am Ende ihrer Kräfte. Gewehre lagen überall verstreut auf dem Boden, Männer saßen, lagen, lehnten aneinander. Ein einziger Angriff, und sie waren vernichtet.
Aus seiner Brusttasche zog er ein schwarz glänzendes Notizbuch, und ohne das Geringste sehen zu können, schrieb er seine letzten Worte quer über die Seiten: »Grüßt meine Mutter und meinen Bruder.« Ein Abschied mit Bleistift. Ein Gruß, der natürlich nie ankommen würde. Er hörte die Buchstaben geradezu, sah seine Mutter und seinen Bruder vor sich und steckte das Notizbuch zurück in seine Jacke, ein Waffenrock aus extra dickem Stoff, viel zu warm, auch nachts.
So wie sie da aufeinander hockten, sahen sie aus wie längst geschlagen, die hundert Mann, mit denen er das Tal betreten hatte. Eine fröhliche Expedition war das gewesen. Sie hatten überall zugeschlagen, waren sich nie zu schade gewesen, ein paar dieser Möchtegern-Diktatoren, die ihre Dörfer terrorisierten, in den Wald zu jagen. In den Wald, in dem sie nun selbst gefangen waren, umzingelt von einer unsichtbaren Übermacht. Das Leben auf wenige Minuten zusammengeschrumpft, auf eine halbe, höchstens eine Stunde. Bis zu den gefürchteten schiefen Tönen einer Militärtrompete.
Maxim und sein Adjutant schienen die einzigen zu sein, die noch wach waren, das Gewehr im Schoß, bereit, noch ein letztes Mal aufzustehen. Er lauschte. Jedes Geräusch konnte der Anfang sein, jeder Schrei der Angriff. Doch er hörte nur das Stöhnen der Verwundeten. Die waren genauso wach wie sie. Wie ihr Ende wohl aussah? Würde es sie in Form einer Machete, eines erbeuteten Gewehrs mit Bajonett oder einfach nur in Form einer Hand um ihre Kehlen ereilen, nachdem die Kulis geflohen waren?
Willem und er saßen ganz in der Nähe der am schwersten Verwundeten und bei den beiden, die es trotz der Pflege durch die Kulis nicht geschafft hatten. Wenn doch wenigstens noch die Sonne schiene, es ein winziges bisschen Licht gäbe, dann wären sie vielleicht gerettet. Dann könnten sie zusammensammeln, was nun überall verstreut war, sich schnell etwas zu essen machen und neuen Mut sammeln.
Willem de Koning, sein Adjutant, war näher gerutscht, lehnte sich fast schon an ihn. »Oranje-Willem«, wie er wegen seines Nachnamens und der Farbe seines Schnurrbarts genannt wurde. Er war ein Jahr jünger und kam wie er frisch aus Breda, war 1903 einberufen worden. Ein lieber Kerl, viel zu nett, um jetzt schon zu fallen. Vierundzwanzig Jahre alt und bereit, allzeit bereit.
Er wusste nicht mehr, warum er in diesem gottverlassenen Land war, in den Gajo-Ländern Atjehs und den ihnen unterstellten Gebieten, der schlimmste Ort auf Erden. In einem Anflug von Idealismus hatte er sich zur Königlichen Niederländisch-Indischen Armee gemeldet, um Leutnant einer Fliegenden Kolonne mit Langwaffen und Klewangs zu werden, bestehend aus Menschen, deren Hautfarbe genauso dunkel war wie der Boden, über den sie huschten. Athletisch sprangen sie über Hindernisse, über umgestürzte Bäume, mitten durch den Dschungel. Hin zu einem selbst erschaffenen Feind. Seine Soldaten kamen von Borneo und von den Molukken. Atjeh war nur ein fremder Laut für sie, unbekanntes Terrain. Wo das lag, wusste niemand. Willem und er wussten es und noch ein paar Europäer, die sich eine Uniform angezogen hatten, in der sie zweifellos fallen würden.
Er ließ sich nicht von der Stille einlullen, ihre Gegner kannten das Gelände zehnmal so gut. Seine einzige Hoffnung bestand darin, dass sie ihre genaue Position nicht kannten und auf den Morgen warteten, auf »die Stunde, in der der Elefant erwacht«. Oder waren sie vielleicht ebenfalls zu müde, um zuzuschlagen und es gab doch noch eine Chance zu entkommen? Er konnte es eigentlich kaum glauben, aber seit er Willem nach der Uhrzeit gefragt hatte, war schon eine Stunde vergangen. Dann noch eine. Nach der dritten würde es hell.
Ganz langsam stand er auf, lehnte sein Gewehr gegen einen Baum, drückte seinen Adjutanten, der mit aufgesprungen war, zu Boden und bedeutete ihm, an Ort und Stelle zu bleiben. Einige seiner Männer schliefen tief, sie ließen sich nicht wachrütteln. Andere schauten ihn an, ohne ihn zu erkennen, einen, der Haltung annehmen wollte, hielt er davon ab. Im Schutz der Sträucher lief er geduckt und relativ lautlos an seinen Männern vorbei, flüsterte ihnen zu, die Sonne gehe gleich auf, sie sollten sich auf die letzte Etappe vorbereiten. Wie eine Art Riesenigel würden sie weiterziehen, auf allen Seiten so gut wie möglich gedeckt, im Tempo einer Trage, die toten Kameraden und Verwundeten in ihrer Mitte, hinter einer Hecke aus Bajonetten auf einer Hecke aus Gewehren. Sie hatten das unzählige Male geübt, zuhause in der Garnison Djeuram gab es kaum etwas anderes zu tun.
Wenn Djeuram wach war, müssten sie seine Alarmnachricht empfangen haben. Wenn der junge Mann, den er damit beauftragt hatte, heil dort angekommen und den Unversöhnlichen entwischt war. Wenn, wenn. Doch auf einmal hatte er die vage Hoffnung, dass Hilfe unterwegs war. Die Stille hier im Tal, nichts rührte sich – da musste etwas im Busch sein. Der Feind, gab es den überhaupt noch?
Um ihn herum erwachten die Männer langsam wieder zum Leben. Ein Stummfilm in Zeitlupe, die ersten Schritte einer Armee aus Schlafwandlern oder der letzte Schritt einer Gruppe zum Tode Verurteilter. Noch war kein Lichtstreif über den Bäumen zu erkennen, noch war da die Angst. Hundert Mann, hundertmal Hoffnung und Verzweiflung, Erinnerungen an früher, an eine Frau, an Kinder, an den Tag, an dem sie sich verpflichtet, unbedingt Soldat hatten werden wollen oder an den Tag, als man sie dazu gezwungen hatte. Verflucht sei dieser Tag, verflucht sei Atjeh, verflucht die weit entfernten, arroganten Niederlande, wo sie nie gewesen waren und auch nie hinwollten. Borneo, Batjan, Ambon, Banda, dort war ihre Seele zu Hause, nicht in diesem Unland mit endlosen Ebenen. Den paar Wilden mit Röcken und Bärten, den schnitten sie schon die Kehle durch, das ging schon in Ordnung. Sie taten es gedankenlos, ohne jede Reue. Schuldgefühle waren ihnen fremd, so etwas gab es nicht auf ihren Inseln. Eine Erfindung der Christen, sie besaßen nicht mal ein Wort für Schuld. Wenn sie denn überleben wollten, mussten sie diesen weißen Offizieren gehorchen. Das begriffen sie nur zu gut. Sie standen auf, knöpften ihre Jacken zu, der Moment war gekommen, sie waren bereit. Wo steckte Oranje-Willem, wann würden sie losmarschieren? Die Angst wurde verdrängt, das Blut begann zu brodeln, die Nacht würde weichen. Das war natürlich wunderbar, bloß weg aus dieser Falle, aus der Umzingelung, auf nach Djeuram, wo ihre Frauen und Kinder waren, auf zum Feldlager, wo sie alles wieder vergessen konnten. Djeuram, auf nach Djeuram.
Schon etwas weniger vorsichtig kehrte er zur Kommandozentrale zurück, wo Willem wartete.
»Brigade abmarschbereit, Willem. Ich habe ihnen gesagt, dass wir die Igelstellung anwenden, es ist so weit.«
Dann sah er die Feuer. Im weiten Umkreis loderten sie auf, eines nach dem anderen, im ganzen Tal, eine Flammenkette. Also doch. Igel hin oder her, sie würden es nicht schaffen, sie waren knapp zu spät dran, die Stellung war kaum formiert.
Willem brüllte. Die Kulis sprangen zu den Männern auf den Tragen, Feldwebel und Gefreite, die langen M95-Gewehre in der Hand, brüllten am lautesten, Befehle hallten durchs ganze Lager. Jetzt waren alle in Bewegung, von einer Überrumpelung konnte keine Rede mehr sein. Da gab er den Marschbefehl: Folgt Adjutant de Koning, die Träger bestimmen das Tempo, geschossen wird nur auf Befehl des Leutnants, niemand tritt aus dem Glied, niemand.
Sie liefen los. Sie schlurften, strauchelten, fluchten, sie marschierten, so wie sie es geübt hatten. Ein Igel, ein seltsam schwankendes Schiff auf einem Meer aus Füßen mit Oranje-Willem als Kompass. Auf in den Kampf, in den sicheren Untergang.
Seine Brigade war zehn Stunden zuvor am späten Abend in einen Hinterhalt gelockt worden. Sie hatten bereits drei Tage mit Gewaltmärschen hinter sich, als sie beim Überqueren eines kleinen Flusses plötzlich von allen Seiten beschossen wurden: Es war keine Menschenseele zu sehen. Das Feuer wurde wieder eingestellt, sie hörten Schreie und sahen, wie sich in der Ferne mehrere Männer zurückzogen. Ein Angriff wie aus dem Lehrbuch, so als hätte ein Europäer das Kommando. In der Regel rannten sie auf die Gewehre zu, aber diesmal war es anders. Wie erfahrene Guerillakämpfer verschwanden sie, um sich in größerer Entfernung erneut zu formieren und sie anschließend gekonnt in die Zange zu nehmen.
Sofort hatte er seine Unteroffiziere einbestellt und einen Kurier nach Djeuram geschickt, um Verstärkung gebeten. Er hatte die riesige Übermacht gesehen und beschlossen, dieses nicht zu verteidigende Gelände am Fluss so schnell wie möglich zu verlassen. Er trieb seine Leute an, lief vorneweg, an den Flanken, am Ende der Kolonne, er feuerte sie an, brüllte und hob die Faust. Die Niederländisch-Indische Armee auf der Flucht, so sah es zumindest aus. Gehetzt von den Söhnen eines uralten Königreichs, des Sultanats Atjeh, von den Imamen der Moschee von Kota Radja, von den Anhängern des berüchtigten Teukoe Oemar, der zwar gefallen war, aber dessen Frau Tjoet Nja Dinh, die sagenumwobene Fürstin eines Guerillareichs, den Widerstand anführte und verstärkte. Sie war es, die da angriff, das konnte gar nicht anders sein. Niemand sonst war so schlau, so unvorhersehbar. Niemand verstand so viel von Waffen und Taktik.
Weil die Nacht so rasch hereingebrochen war, war ihr Versteck offensichtlich verborgen geblieben. Doch jetzt ging die Sonne auf, und das Licht wurde von ihren Bajonetten reflektiert. Sie waren schon von Weitem zu sehen, die ideale Zielscheibe. Dennoch ertönte kein Schuss, noch waren nur ihre Stiefel und das Stöhnen der Verwundeten zu hören.
Er schaute sich verständnislos um. Wo blieben sie bloß, wo war Dinh, die Frau, die keine einzige niederländische Patrouille hatte dingfest machen können und die schon seit Jahren überall auftauchte und zuschlug. Atjeh flüsterte ihren Namen und sie antwortete mit einem Schrei, der bis in die Berge reichte, bis zu den Dessas und Kampongs. Ihr Name war ein Losungswort, ein Tanz. Die Menschen fassten neuen Mut, wehrten sich, verließen ihre Häuser und schlossen sich ihr an.
Tjoet Nja Dinh – wie oft er schon an sie gedacht hatte! Überall, wo er stationiert gewesen war, in Djeuram, Meulaboh, Kota Radja, ja schon in Batavia, überall erzählte man von ihr, aber niemand kannte sie. Tochter, Frau, Mutter, so viel stand fest. Aber vor allem Feldherrin, Guerillaanführerin, Verteidigerin Allahs. Stets auf der Flucht, stets im Angriffsmodus.
Sie durften keine Sekunde nachlassen, es war ein Marsch, bei dem kein Blick zurück, kein Blick in die Zukunft erlaubt war. Diebe im Morgengrauen waren sie, der Feind konnte sie jeden Moment angreifen. Dinh würde ihnen zuvorkommen, er kannte ihre Angriffstaktik, sich rasch zurückziehen, sie umzingeln, die Angst verstärken, warten und nochmals warten, um dann endgültig abzurechnen.
Endlich hörte er Schüsse. Es war so weit, sie würden überrannt werden. Zu Hause schliefen seine Mutter und sein Bruder bestimmt noch, dort war es sechs Stunden früher. Seine Mutter dürfte müde sein und sein Bruder, das Sorgenkind, ging stets früh zu Bett. In seiner Todesstunde träumte er sich nach Holland, zurück in ihr gemeinsames Haus in Baarn, in seine alte Schule, zu Ko und Laurens, in Valks Laden.
Der Hornbläser hinter ihm legte plötzlich so richtig los. Mit einer wilden Geste versuchte er dem Idioten Einhalt zu gebieten. Aber der Mann blies weiter, andere begannen zu winken, man trat aus dem Glied, die Kolonne kam abrupt zum Stehen. Und ja, verdammt, da kam sie, Gott sei Dank, die Kavallerie, eine Schar Pferde in vollem Galopp, die Kavallerie Djeuram mit ihren Repetiergewehren, gegen die kein Atjeher etwas ausrichten konnte. Dinh hatte die Niederländer vermutlich kommen sehen und gewusst, dass sie sich zurückziehen musste. Gegen Kavallerie und schnelle Karabiner besaß sie nicht genug Feuerkraft. Die Feuer, die sie gelegt hatte, waren das Signal zur Flucht, nicht zum Angriff gewesen. Sie war genauso rasch verschwunden, wie sie gekommen war.
Oranje-Willem klopfte ihm auf die Schulter, und sie beglückwünschten einander.
* * *
Ein paar Monate nach ihrer wundersamen Rettung führten Oranje-Willem und er eine Routinekontrolle in einem Kampong durch, unweit ihres Feldlagers. Widerwillig hatte er damit begonnen. Die Einsätze fielen ihm seit dem Überfall immer schwerer. Über einen Elefantenpfad waren sie in das kleine Dorf einmarschiert, eine lange Kolonne, sorglosen Schrittes. Bald würden sie wieder kehrtmachen. Er war vorausgelaufen. Die ersten Bewohner, denen sie begegneten, machten einen freundlichen Eindruck, eine Frau gab ihm einen Korb mit Früchten, so als böte sie ihnen Frieden an. Alles war ruhig und friedlich, und das hätte ihn alarmieren müssen. Er sah den Gewehrlauf nicht, auch nicht, wie der ihm folgte. Der Schuss fiel, als er die Hütte bereits passiert hatte. Normalerweise wäre er in den Rücken getroffen worden. Aber der Schütze musste abgelenkt worden sein, oder aber er hatte noch nie geschossen, denn die Kugel streifte seine linke Augenhöhle. Eine Sekunde später rollte der Mann tot aus seiner Hütte, und im Nu besetzte die Patrouille das gesamte Kampong. Es schien sich um einen Einzeltäter zu handeln, nichts wies auf weiteren Widerstand hin.
Er war nach Kota Radja gebracht worden und hatte wochenlang in einem großen Haus in einem dunklen Zimmer gelegen, wo er von mehreren jungen Frauen versorgt worden war, Töchter niederländischer Beamter. Kein richtiges Krankenhaus, aber die Witwe eines Majors hatte ihr Haus verwundeten Offizieren zur Verfügung gestellt. In den tropischen Nächten dachte er ans Schlittschuhlaufen, und wenn der Regen aufs Dach prasselte, lief er durch den holländischen Herbst, einen strammen Verband über dem Auge, über dem Loch, wo einst sein Auge gewesen war. Die übertriebene Symbolik entging ihm nicht: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wer in Atjeh einfiel, kehrte nicht ungestraft zurück. Der eine ohne Arm, der andere ohne Bein oder ohne Hand beziehungsweise Ohr. Der ganze Krieg widerte ihn langsam aber sicher immer mehr an. Seine Verwundung kam da wie gerufen: Man würde ihn ehrenhaft entlassen, er durfte nach Hause.
Mit W. A., dem Mann im Nebenzimmer, der sich irgendwann regelmäßig zu ihm ans Bett setzte, konnte er gut darüber reden. Er hatte in einem anderen Distrikt gedient und war ein begnadeter Erzähler – der gruseligsten Geschichten, die er je gehört hatte.
»Maxim«, so hob er jedes Mal an. »Maxim, was wir da in Atjeh treiben, ist ein Verbrechen. Einfach nur ein Verbrechen, und zwar hoch zehn.« Das sagte er jedes Mal: »Ein Verbrechen hoch zehn.«
W. A. hatte sich noch nicht gesetzt, da legte er auch schon los, erzählte von Offizieren, die Maxim nur dem Namen nach kannte, von Schmidt, Dijkstra, Christoffel, Graafland, Van der Heijden. Und vor allem von Van Daalen.