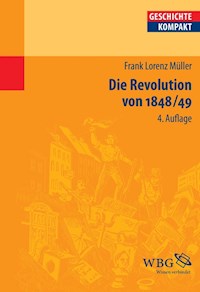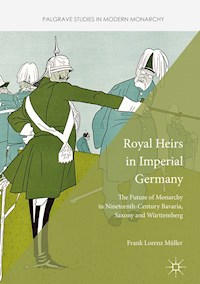25,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 25,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 25,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Habsburger, Hohenzollern, Bourbonen & Co.: Wie die großen Dynastien Europa prägten
Die Tage der Monarchie in Europa schienen gezählt, als der Henker an einem Januartag des Jahres 1793 der jubelnden Menge das abgetrennte Haupt von Ludwig XVI. entgegenstreckte. Trotz aller Revolution trat jedoch das Gegenteil ein: Kaiser, Könige und Fürsten sollten das 19. Jahrhundert prägen und ihr Amt vielerorts mit Glanz, Geschick und Erfolg ausüben. In seinem wunderbar erzählten Geschichtspanorama zeigt uns Frank Lorenz Müller, warum das so war. Im Zentrum stehen dabei die Persönlichkeiten und Schicksale der Thronfolger – denn sie waren es, die alle Erwartungen, Hoffnungen, Träume auf sich vereinten und somit im doppelten Sinne für das Überleben der Monarchie sorgten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 767
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Frank Lorenz Müller
DIETHRONFOLGER
Macht und Zukunft der Monarchieim 19. Jahrhundert
Siedler
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2019 by Siedler Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 MünchenUmschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, MünchenUmschlagabbildung: Rudolf, Kronprinz von Österreich, 1862, Foto: Ludwig Angerer, ÖNB/WienLektorat und Satz: Peter Palm, BerlinReproduktionen Aigner, BerlinISBN 978-3-641-16891-9V002www.siedler-verlag.de
This book is for Ceel.
Inhalt
Einleitung
KAPITEL 1»Unterpfand einer gesegneten Zukunft«? Thronerben im 19. Jahrhundert
KAPITEL 2Prinzen und ihre Familien Königliche Söhne und Ehemänner
KAPITEL 3»Gelernte Könige«? Neue Wege in der Prinzenerziehung
KAPITEL 4Auf dem Weg zur »sanften Macht«? Thronfolger in Politik, Medien und der Öffentlichkeit
KAPITEL 5 Vom »Tschingdada« zum Weltkrieg Thronfolger und die Militarisierung der Monarchie
Schlussbetrachtung
ANHANG
Dank
Anmerkungen
Quellen und Literatur
Regenten und Thronfolger
Personenregister
Einleitung
Der 21. Januar 1793, der Tag, an dem König Ludwig XVI. von Frankreich zum Schafott auf der heutigen Place de la Concorde gebracht wurde, war kalt und neblig. Mehr als 100000 Soldaten säumten die verschneiten Straßen der französischen Hauptstadt. Die Wagenkolonne mit dem Verurteilten brauchte beinahe zwei Stunden für die dreieinhalb Kilometer lange Strecke von Ludwigs Gefängnis im Tour de Temple. Als man die Hinrichtungsstätte erreicht hatte, stieg der entthronte Monarch aus der Kutsche, legte den Mantel ab und knöpfte den Kragen seines Hemdes auf. Da der Weg zur Guillotine rutschig war, stützte er sich zunächst auf den Arm seines Beichtvaters, des irischstämmigen Abbé Henry Edgeworth, erklomm die Stufen dann jedoch allein. Vom Schafott aus wandte sich der König, der vom Nationalkonvent wegen Landesverrats zum Tode verurteilt worden war, an die riesige Menschenmenge, beteuerte seine Unschuld und vergab seinen Feinden. Doch ein von General Antoine Santerre, dem Kommandanten der Nationalgarde, befohlener Trommelwirbel übertönte seine letzten Worte. Dann packten die Scharfrichter den Bourbonen und zwangen ihn unter das Fallbeil. Der kräftige Nacken des Verurteilten passte allerdings nicht richtig in die vorgesehene Aussparung im Richtblock, und so verlief die Hinrichtung unsauber und sehr blutig. Als der Henker das abgetrennte Haupt endlich hochhielt, brachen bei einigen der Umstehenden alle Dämme: Ein paar Gaffer kosteten von dem verspritzten Blut des Königs und stritten über seinen Geschmack, andere tauchten ihre Hände hinein, und so viele wollten Taschentücher oder Briefumschläge damit benetzen, dass der Scharfrichter schließlich einen Eimer voll Blut bereitstellte. Neun Monate später wurde an gleicher Stelle die Witwe des Königs, Marie Antoinette, enthauptet. Als das Beil fiel, ertönte auch bei dieser Gelegenheit der Ruf: »Es lebe die Republik!«1
Aus monarchischer Sicht hätte das lange 19. Jahrhundert, das sich von der Französischen Revolution bis zum Ende des Ersten Weltkriegs erstreckte, kaum apokalyptischer beginnen können. Für viele Zeitgenossen und Nachgeborene war die juristisch sanktionierte, öffentliche Tötung eines gesalbten Monarchen eine so empörende Untat, dass durch sie eine uralte Weltordnung für immer verloren schien. Einige verzweifelte Zeitgenossen wurden durch die Nachricht von Ludwigs Enthauptung in tiefe seelische Abgründe gestürzt, sodass es Berichten zufolge zu Selbstmorden und Fällen von plötzlicher Geisteskrankheit kam. Noch im 20. Jahrhundert bedauerte der französische Philosoph und Schriftsteller Albert Camus die Hinrichtung des Königs, denn sie erschien ihm, so Susan Dunn, als »die irreversible Zerstörung einer Welt, die sich für ein Jahrtausend an eine heilige Ordnung gehalten hatte«. Der 21. Januar 1793 bedeutete für Camus den dauerhaften Verlust eines moralischen, von einem transzendenten Gott sanktionierten Kodex.2
Angesichts dieses blutigen Auftakts zum langen 19. Jahrhundert hätte wohl kein Mitglied des eng miteinander verwobenen Netzwerks europäischer Herrscherfamilien sich an jenem düsteren Wintertag träumen lassen, welch farbenfrohe monarchische Spektakel 120 Jahre später in Berlin und Braunschweig veranstaltet werden sollten. Im Frühsommer 1913 gab sich nämlich in der deutschen Hauptstadt das dynastische Europa ein prachtvolles Stelldichein – nunmehr vor den Linsen von Filmkameras, die den festlichen Augenblick für alle Zeiten in bewegten Bildern festhielten. Man war gekommen, um der Hochzeit der Prinzessin Viktoria Luise, der Tochter des deutschen Kaisers, mit dem Welfenprinzen Ernst August von Cumberland beizuwohnen. Unter den mehr als tausend Gästen befanden sich die Spitzen der europäischen Monarchien: Zar Nikolaus II. war ebenso gerne beim deutschen Kaiser Wilhelm II., seinem angeheirateten Cousin, zu Gast wie König Georg V. von Großbritannien – auch er ein Vetter des Hohenzollern. Beide ließen es sich nicht nehmen, die junge Braut bei der Polonaise zu führen. Die Feier war mit Bedacht auf den 24. Mai, den Geburtstag der 1901 verstorbenen britischen Königin Viktoria, gelegt worden, eine Ahnin vieler der anwesenden hohen Gäste. Die Hochzeit war hochgradig politisch: Sie diente der Beilegung des seit der preußischen Annexion von Hannover im Jahr 1866 herrschenden Konflikts zwischen den Dynastien der Welfen und der Hohenzollern. Trotz dieses Hintergrunds wurde die Verbindung erfolgreich als Herzensangelegenheit präsentiert, und so säumten Tausende von begeisterten Berlinern die Straßen. Sehr zum Ärger der sozialistischen Presse, die solchen »Hurrapöbel« mit galligen Worten schmähte, nahm die Bevölkerung der Stadt während der mehrtägigen Feierlichkeiten lebhaften Anteil am Glück ihres »Prinzeßchens«.3
Die Berliner Hochzeit fiel in ein üppig ausgestattetes monarchisches Jubiläumsjahr, denn 1913 jährte sich nicht nur die siegreiche Schlacht von Leipzig zum hundertsten Mal, es war auch ein Vierteljahrhundert vergangen, seit Wilhelm II. den deutschen Kaiserthron bestiegen hatte. Beides wurde pompös gefeiert. Im November 1913 zog das frisch vermählte Paar dann unter dem Jubel der Bevölkerung in Braunschweig ein, wo Ernst August den Thron des Herzogtums bestieg. Damit kehrten die Welfen mehr als vier Jahrzehnte nach dem Ende des Königreichs Hannover als regierende Fürsten ins Deutsche Reich zurück. »Du alter Stamm / Sei stets erneut / In edler Fürsten Reihe, / Wie alle Zeit / Dein Volk Dir weiht / Die alte deutsche Treue«, war auf einer Festpostkarte zu lesen, die eigens für den großen Tag gedruckt worden war. »Auf den mit Blumen und blaugelben Landesfarben geschmückten Bahnhöfen begrüßte uns die Bevölkerung«, erinnerte sich Herzogin Viktoria Luise später. »Nicht nur die Einwohnerschaft der Stadt war hieran beteiligt. Aus der näheren und weiteren Umgebung waren weit über 100000 Menschen gekommen. […] Wer den Jubel gehört hat, bekam einen Begriff von der Macht der Tradition in den Herzen der Menschen.«4
Auch 120 Jahre nachdem der französische Revolutionär Maximilien de Robespierre im Nationalkonvent ausgerufen hatte, »Ludwig muss sterben, weil das Vaterland leben muss«, konnten sich die europäischen Monarchen also noch immer im warmen Licht öffentlicher Zustimmung sonnen, große Politik als Familienangelegenheit inszenieren und von der Macht dynastischer Loyalität in den Herzen der Menschen zehren. Durch das 19. Jahrhundert zog sich eine breite monarchische Ader, die jene Ära auf vielfältige Weise prägte. Um dieses Phänomen geht es im vorliegenden Buch.
Das Überleben der europäischen Monarchien im 19. Jahrhundert ist umso erstaunlicher, wenn man den Blick darauf richtet, dass dieses Jahrhundert zumeist als eine Zeit beschleunigter, tiefgreifender, oftmals revolutionärer Veränderungen verstanden wird. Diese Interpretation spiegelt sich auch in den Titeln der historischen Meistererzählungen zu diesem Säkulum wider. Eric Hobsbawms klassische Trilogie charakterisiert es als eine Abfolge von drei Epochen: Auf die der Revolution folgt die des Kapitals und schließlich die des Imperiums; in den Bänden der großen Propyläen-Geschichte Europas machten Eberhard Weis und Theodor Schieder erst den »Durchbruch des Bürgertums« und dann die Errichtung eines »Staatensystems als Vormacht der Welt« als die Kennzeichen des Jahrhunderts aus, und nach Jürgen Osterhammels magnum opus erlebte das Säkulum nichts Geringeres als die »Verwandlung der Welt«. In der Tat veränderten sich die Lebensumstände der Menschen in Europa im Verlauf des 19. Jahrhunderts gewaltig: Die sich beschleunigende Industrialisierung erreichte immer mehr Regionen des Kontinents; der Anstieg der Bevölkerungszahl und die damit verbundenen Wanderungsbewegungen vom flachen Land in die Städte und fort aus Europa nach Übersee waren enorm; die Bereiche Kommunikation und Mobilität wurden von einem rapiden wissenschaftlich-technischen Fortschritt erfasst; die Alphabetisierung schritt rasch voran, und daraus erwuchs eine breitere Öffentlichkeit; immer größere Bevölkerungsgruppen profitierten davon, dass Verfassungen eingeführt und das Wahlrecht schrittweise ausgeweitet wurde; mit dem imperialen Ausgreifen einiger europäischer Mächte auf den Rest der Welt ergaben sich neue Horizonte.5
Trotz aller Veränderungen blieb Europa während dieser Epoche ein zutiefst monarchisch geprägter Kontinent. Jeder Staat, der sich im 19. Jahrhundert in Europa neu etablierte, hat den Schritt in die Unabhängigkeit unter der Herrschaft eines gekrönten Hauptes getan: von Griechenland (1821) und Belgien (1830) bis Bulgarien (1878) und Norwegen (1905). Auch als die Staaten des Erdteils 1914 in den Krieg zogen, war er noch immer ganz überwiegend monarchisch. Frankreich, die Schweiz, Portugal und das kleine San Marino stellten die republikanischen Ausnahmen dar, die die monarchische Regel bestätigten.6 Zwar gab es in einigen Staaten antimonarchische Bewegungen, und einzelne Herrscher waren einer scharfen, mitunter ätzenden öffentlichen Kritik ausgesetzt. Zudem befanden sich unter den zahlreichen Opfern der Welle nihilistischer Attentate um die Jahrhundertwende auch einige gekrönte Häupter – etwa Zar Alexander II., Kaiserin Elisabeth von Österreich oder König Umberto I. von Italien. Dennoch kann man nicht von einem ernst zu nehmenden antimonarchischen Trend sprechen. Vielmehr erfreuten sich die monarchischen Regime – in den verschiedenen Formen, die sie im Verlauf der Jahrzehnte seit 1793 angenommen hatten – noch immer einer großen Akzeptanz. Mitunter waren sie sogar recht beliebt in der neuen Zeit der Radiogeräte, Motorflugzeuge, Röntgenapparate und Charlie-Chaplin-Filme. Die »Macht der Tradition in den Herzen der Menschen« war nicht verpufft.
Gerade im Kontrast zwischen der tiefgreifenden Verwandlung Europas und der kaum zu erwartenden Beharrlichkeit der monarchischen Staatsform liegt der Reiz in der Beschäftigung mit der monarchischen Dimension des Zeitalters. In Arthur Conan Doyles Kurzgeschichte Silver Blaze musste Meisterdetektiv Sherlock Holmes einen begriffsstutzigen Polizisten einmal auf den »sonderbaren Umstand« hinweisen, dass der Wachhund in der besagten Nacht eben nicht angeschlagen hatte. Darin lag der Schlüssel zur Überführung des Verbrechers. Diese Ermahnung – auf das zu achten, was gerade nicht passiert ist, obwohl man es hätte erwarten sollen – soll auch hier den Anstoß geben: Trotz der schockierenden Symbolik des 21. Januar 1793 und im Angesicht monumentaler politischer, sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Veränderungen kam es in Europa im 19. Jahrhundert eben nicht zu einem monarchischen Massensterben. Auf das, was der amerikanische Historiker Robert Roswell Palmer das »Zeitalter der demokratischen Revolution« genannt hat, folgte keine republikanische Epoche.7 Auch die nächste große Revolutionswelle, die den Kontinent in den Jahren 1848/49 erfasste, dünnte die Riege der Monarchen kaum aus. Das Thema dieses Buches ist also jener »sonderbare Umstand«, dass die Monarchien Europas im Verlauf des langen 19. Jahrhunderts, das sich an die Französische Revolution anschloss, nicht verschwanden. Im Zentrum steht dabei das erstaunliche Beharrungs-, Umgestaltungs- und Überlebensphänomen, ohne das die Feierlichkeiten des Jahres 1913 nicht möglich gewesen wären.
In dem hier vorliegenden Buch wird das monarchische 19. Jahrhundert porträtiert, analysiert und danach gefragt, was Europas royale Spätblüte ermöglichte und wie sie sich entfalten konnte. Auf welche Weise gelang es den Dynastien und ihren Befürwortern, eine Staatsform zu bewahren, in der das Staatsoberhaupt sein auf Lebenszeit verliehenes Amt durch regulären Erbgang erwarb? Denn dies war gewiss keine Selbstverständlichkeit inmitten des rasanten Wandels, dem so viele Elemente des Ancien Régime zum Opfer fielen, und angesichts der Herausforderungen eines nachrevolutionären Zeitalters, das auf eine größere Teilhabe des Volkes an der Macht, den Abbau von Privilegien und weitreichende Freiheitsrechte pochte. Wie also sah der von den fürstlichen Systemen angenommene und umgesetzte Wandel aus, durch den der Monarchie, wie Dieter Langewiesche es formuliert hat, die »Selbstbehauptung im 19. Jahrhundert« glückte?8
Lange haben Historiker die monarchische Dimension dieses Zeitalters stiefmütterlich behandelt. Das Thema war ihnen zu nostalgisch, zu apologetisch oder zu reaktionär, und wenn sie sich ihm dennoch zuwandten, taten sie es in analytisch unzureichender Weise. Noch 1989 klagte der britische Historiker David Cannadine, einer der Väter der modernen Monarchiegeschichte, dass auf diesem Gebiet »zuviel Chronik und zu wenig Geschichte, ein Übermaß an Mythen und ein Mangel an wissenschaftlicher Skepsis« angeboten werde. Das hat sich im Verlauf der letzten Jahre entscheidend geändert. Inzwischen geben hervorragende Studien Auskunft über die Entwicklung der europäischen Monarchie im 19. Jahrhundert. Im Zentrum des wissenschaftlichen Interesses stehen dabei einerseits das Thema königlicher Öffentlichkeitsarbeit – die Analyse von Medien, Selbstdarstellung und Kommunikation – und andererseits verfassungsgeschichtliche Fragen nach der Entwicklung und Leistungsfähigkeit des konstitutionell-monarchischen Systems. Daneben wird das monarchische Jahrhundert in zahlreichen neuen Herrscherbiographien beleuchtet. Man denke nur an biographische »Stars« wie Königin Viktoria von Großbritannien, König Ludwig II. von Bayern, Erzherzog Franz Ferdinand von Österreich oder den bombastisch-irrlichternden deutschen Kaiser Wilhelm II., die alle Gegenstand zahlreicher Biographien sind.9
In dieser Untersuchung wird eine neue Perspektive gewählt mit dem Ziel, ein besseres Verständnis der Wandlungs- und Überlebensfähigkeit der europäischen Monarchien zu gewinnen. Im Zentrum sollen dabei jene stehen, die für jedes erbmonarchische System von existenzieller Bedeutung sind, weil von ihnen die Zukunft der Dynastie abhängt: die Thronfolger. Es geht um Männer und Frauen, denen bereits zum Zeitpunkt ihrer Geburt große Bedeutung beigemessen und Aufmerksamkeit geschenkt wurde.
Am 21. August 1858 wurde in der Nähe von Wien eines dieser Kinder geboren, das vom ersten Atemzug im Mittelpunkt des Interesses stand. »Des Kaisers Stolz. – Die Hoffnung seiner Völker«: Unter diesem Titel erschien im Spätsommer 1858 ein prachtvolles »Erinnerungsblatt« an »Oesterreichs Freudentag«. Mit allen Insignien von Macht und Herrlichkeit ist hier die Taufe des Kronprinzen Rudolf (1858–1889) durch Kardinal Josef Rauscher ins Bild gesetzt, die am 23. August 1858 auf Schloss Laxenburg südlich von Wien stattfand.
Im Zentrum der Darstellung steht der zwei Tage alte Knabe, den der Kaiser Franz Joseph über das Taufbecken hält, während der Kardinal das Sakrament der Taufe spendet. Stelen mit den Büsten der großen Ahnen des Hauses Habsburg, Rudolf I. (1218–1291) und Maria Theresia (1717–1780), rahmen die Szene ein. Zudem sind das Kind, der Kaiser und der Kardinal von den Heiligenpatronen der österreichischen Kronländer, zahlreichen anderen Würdenträgern und einem milde dreinblickenden Löwen umringt. Auf einem Kissen zu ihren Füßen werden dem Betrachter die drei Kronen präsentiert, die das Kind dereinst tragen wird: die Kaiserkrone von Österreich sowie die Königskronen von Ungarn und Böhmen. Anlässlich der Geburt des Thronfolgers wurde eine Vielzahl ähnlicher Bilder geschaffen. Die Lithographie »Habsburgs jüngste Blüte« von Eduard Kaiser zeigt den Neugeborenen in einer Krippe, die mit einer Personifikation Österreichs geschmückt ist. Die kolorierte Kreidelithographie »Die Allerhöchste kaiserliche Familie mit dem durchl: / Kronprinzen Rudolf Carl Josef« zeigt das Bettchen des Thronfolgers unter einem mächtigen Bildnis Rudolfs I. und einem Posaune blasenden Engel, der auf das Kind weist. Joseph Kohns »Kron-Juwel für die Habsburgische-Dynastie«, ein »Fest-Album bei Gelegenheit der beglückenden Geburt Sr. k.k. Hoheit des Allerdurchlauchtigsten Kronprinzen Rudolf«, das 1858 in Lemberg erschien, bot seinen Lesern gar 35 Seiten kaisertreuer Erbauung.10
Die barock anmutende Üppigkeit dieser Propagandagraphik und der über sie verbreiteten Jubelprosa weist darauf hin, dass die Sicherung der Thronfolge – der Übergang monarchischer Herrschaft von einem Individuum auf seinen Nachfolger, zumeist von einer Generation auf die nächste – für dynastische Systeme nach wie vor eine große Herausforderung darstellte. Weil das Prinzip der Vererbung der Kronen ein Kernelement der europäischen Königsherrschaft blieb, stellten Thronfolger eine unerlässliche Systemkomponente dar. Zudem boten sie den Monarchien, deren Teil und Zukunft sie waren, eine einzigartige politische Ressource, die sich im 19. Jahrhundert als besonders nützlich erweisen sollte: Mit ihnen existierte die künftige Herrschergeneration nämlich auf eine sichtbare, direkt vermittelbare und formbare Weise, und das bereits Jahre und Jahrzehnte vor der Machtübernahme. Thronfolger eröffneten in monarchischen Systemen die Möglichkeit, die Zukunft der eigenen Dynastie durch Nachkommen aus Fleisch und Blut vorzubereiten, anzukündigen und diese so zu formen, dass sie den Bedürfnissen und Vorlieben der relevanten Bevölkerungsteile entsprachen.
»Des Kaisers Stolz. – Die Hoffnung seiner Völker«: Ein zeitgenössischer Druck stellt die Taufe des 1858 geborenen österreichischen Kronprinzen Rudolf als einen entrückten, von Heiligen und Vorfahren umringten Akt dar, der die Jahrhunderte überstrahlt.
»Des Kaisers Stolz. – Die Hoffnung seiner Völker«, 1858, Lithographie nach Johann Schmickl, ÖNB Bildarchiv und Grafiksammlung, Sign. Pk 3001, 270
Thronfolger verkörperten einerseits die Botschaft von der fundamentalen Kontinuität monarchischer Herrschaft – ebenjener beruhigenden und Ehrfurcht gebietenden Stetigkeit der Tradition, die durch den Blick des Stammvaters Rudolf I. auf seinen 650 Jahre später geborenen gleichnamigen Nachfahren betont wurde. Andererseits verwiesen sie auf die naturgesetzmäßige Unvermeidbarkeit des Wandels an der Spitze des Systems. Denn die Männer (und wenigen Frauen), denen es vorherbestimmt war, dereinst eine Krone zu tragen, wurden zwar durch ihre Herkunft und das dynastische wie höfische Umfeld geprägt, waren aber dennoch mehr als das bloße Produkt traditioneller Einflüsse. Die künftigen Herrscher mussten auch in der Lage sein, auf politische, mediale, kulturelle und verfassungsrechtliche Impulse ihrer Gegenwart zu reagieren. Zudem dienten sie – umso mehr, je stärker sie medial präsent waren – als Projektionsflächen, auf denen das Volk seine Hoffnungen abbilden konnte. Gerade in Zeiten rapider Veränderung verband sich dessen Wunsch nach einer besseren Zukunft oft mit dem Bedürfnis nach vertrauter Kontinuität. Thronfolger versprachen beides.
Die Rolle der künftigen Herrscher war eben nicht nur von alten Konventionen geprägt, sondern auch von neuen Faktoren wie der Einführung von Verfassungen und den Forderungen einer ständig wachsenden Öffentlichkeit nach mehr Teilhabe. Daher mussten Thronfolger ihr Leben zunehmend in der Öffentlichkeit führen, wo es für das Publikum sichtbar war und die staatlichen und gesellschaftlichen Kompetenzen des kommenden Herrschers begutachtet werden konnten. Ob der Thronerbe als tüchtig oder nutzlos galt, als tugendhaft oder verkommen, als sorgfältig vorbereitet oder überfordert, als engagiert oder lethargisch, ob er als lüsterner Schürzenjäger verschrien war oder als liebender Ehemann und Vater verehrt wurde: All das war von großer Bedeutung für das Zukunftsversprechen der herrschenden Dynastie. Es lohnt sich daher, die Erfahrungen, Darstellungen, Rollen und Funktionen der künftigen Monarchen während der Jahre zu erforschen, in denen sie sich im Licht der Öffentlichkeit auf ihr Herrscheramt vorbereiteten. Sie taten dies auf vielfältige Weise: als zarte Babys, als fleißige Schüler, als treu sorgende Eltern, als Weltreisende, als Parlamentarier, als Hüter der Verfassung, als schneidige Soldaten oder als Förderer von Kultur und Wissenschaft.
Zugleich eröffnet der Blick auf die Thronfolger eine Perspektive auf das monarchische Jahrhundert insgesamt. In ihren Biographien bildete sich das ab, was unverändert blieb, und ebenso das, was sich wandelte; die Anpassung der Königshäuser an vermeintlich bürgerliche Formen des Lebens der vielen wird genauso ersichtlich wie das Bemühen, den Zauber zu bewahren und im Kern etwas zutiefst Anderes und Seltenes zu sein. Im Zentrum dieser Betrachtung stehen dabei jene Monarchien Europas, deren Gesellschaften sich sozial, politisch, medial, kulturell und wirtschaftlich rapide modernisierten. Auf die sich daraus ergebenden Herausforderungen reagierten die Monarchien von Spanien bis Schweden, von den Niederlanden bis Griechenland, indem sie früher oder später zu einer Form von konstitutioneller Herrschaft übergingen. Dies ist als das wichtigste gemeinsame Charakteristikum zu nennen, denn damit setzte sich der »monarchische Konstitutionalismus«, so der Verfassungshistoriker Martin Kirsch, als »europäischer Verfassungstyp« auf dem Kontinent durch.11 Unter den größeren Staaten Europas scherten nur die zwei von den Auswirkungen der postrevolutionären Modernisierung zunächst weniger stark betroffene Monarchien am östlichen Rand Europas aus: Russland und das Osmanische Reich. Die Romanows konnten ihre autokratische Herrschaftsform weitestgehend unvermindert bis 1905 und in wichtigen Belangen sogar darüber hinaus bewahren. Auch den türkischen Sultanen gelang es nach der Aufhebung der kurzlebigen Verfassung von 1876 bis 1878, den Eintritt ins konstitutionelle Zeitalter bis zur jungtürkischen Revolution von 1908 hinauszuzögern. Diese beiden Sonderfälle werden hier ausgespart.
Obwohl in diesem Buch der Versuch unternommen wird, ein europäisches Panorama zu bieten, wird nicht der Anspruch erhoben, enzyklopädisch zu sein. Zu groß ist die Anzahl der Monarchien und ihrer Thronfolger in diesem Zeitraum, als dass jedes einzelne Herrscherhaus und jeder Thronanwärter erwähnt, geschweige denn ausführlich behandelt werden könnte.12 Stattdessen werden zur Erläuterung der zentralen Themen beispielhaft Dynastien, Einzelpersonen, Entwicklungen und Ereignisse aus mehr als einem Dutzend europäischer Monarchien herangezogen. Im Zentrum der Betrachtung stehen die monarchischen Systeme in Großbritannien, den deutschen Ländern, Österreich und Italien. Aber auch die Monarchien in Spanien, Griechenland, Frankreich, den Niederlanden, Belgien und Skandinavien bleiben nicht unberücksichtigt. Dabei wird die farbenfrohe Eindringlichkeit der Biographien der behandelten Thronfolger mit dem Blick auf breitere Zusammenhänge und Entwicklungen verbunden. Auch wenn die künftigen Herrscher wichtige und aufschlussreiche Systemkomponenten waren, sollen ihre individuellen menschlichen Schicksale doch nicht gänzlich hinter ihre Funktionen zurücktreten.
Ob und wie einzelne Thronfolger die schwierigen Aufgaben, die ihnen in die Wiege gelegt waren, erfolgreich erfüllen konnten und wollten, hing von zahlreichen Faktoren ab. Zufälle waren hier ebenso von Bedeutung wie individuelle Neigungen oder unterschiedliche Grade von Begabung. Weil die Vielfalt menschlicher Persönlichkeiten hier ins Spiel kam, kann man keine gleichförmigen Gesetzmäßigkeiten erwarten. Zudem gab es für die monarchischen Akteure, die im 19. Jahrhundert auf die Bühne traten, kein allgemeingültiges Skript. Immer wieder durchbrachen – und bestätigten – Ausnahmen die Regeln einer breiten Entwicklung. Dennoch ist es wichtig, zunächst die Grundzüge der Welt zu skizzieren, in der die meisten Thronfolger in den konstitutionellen Monarchien Europas im Verlauf des 19. Jahrhunderts ihre Rolle finden und ausfüllen mussten.
KAPITEL 1»Unterpfand einer gesegneten Zukunft«? Thronerben im 19. Jahrhundert
Ein Artikel, der am 14. Juli 1891 im Herald Democrat erschien, warf ein ungewöhnliches Licht auf die Umstände, die das Leben eines europäischen Thronfolgers bestimmten. Heloise, eine zehnjährige Amerikanerin auf Europareise, gab darin den Lesern des Provinzblattes aus der Bergarbeiterstadt Leadville in Colorado eine ausführliche Beschreibung der Eröffnung des Parlaments in Rom. Dies sei eine »sehr elegante Angelegenheit« gewesen, die der jungen Reisenden geradezu fantastisch vorkam. König Umberto I. (1844–1900) und Königin Margherita (1851–1926) waren in der Staatskarosse, gezogen von sechs Pferden im festlichen Prunkgeschirr, vor dem Parlamentsgebäude vorgefahren. Lakaien in seidenen Strümpfen und mit gepuderten Perücken begleiteten das Paar. Unter den Hochrufen des Volkes zog der König, in eine prachtvolle Galauniform gekleidet und mit einem reich verzierten Messinghelm auf dem Haupt, in den Parlamentssaal ein und hielt dort eine Rede. Anschließend nahm er jedem einzelnen Abgeordneten den Treueeid ab. In diesem Jahr leistete auch sein Sohn, der einundzwanzigjährige Viktor Emanuel, Prinz von Neapel (1869–1947), das Gelöbnis, »was alle für sehr interessant zu halten schienen«.1
Diese aus einer gewollt kindlich wirkenden Perspektive geschriebene Vignette ließ viele der Aspekte anklingen, die das Leben und Wirken von europäischen Thronfolgern im 19. Jahrhundert bestimmten: Der Anlass für die Zeremonie war die Eröffnung des gewählten, von der Verfassung garantierten Parlaments durch den König; nach der Verfassung wurde der Kronprinz mit Vollendung des einundzwanzigsten Lebensjahres Mitglied des Senats, der ersten Kammer des Parlaments, und leistete den Treueeid, der ihn an König und Verfassung band. Er tat dies vor einer interessierten Öffentlichkeit, die von Rom bis nach Colorado reichte, umgeben von seiner sorgfältig in Szene gesetzten Familie in einer Zeremonie voller helmbuschgeschmücktem und seidenbestrumpftem höfischen Pomp, der 1891 nicht nur zehnjährigen amerikanischen Mädchen märchenhaft und altertümlich erschienen sein dürfte.
Was in dieser Zeremonie versinnbildlicht wurde, war eine Politik, die Wandlung und Beharrung miteinander verknüpfte und damit den europäischen Monarchien das Überleben im postrevolutionären Zeitalter ermöglichte. Für die Königshäuser stellte der Übergang ins konstitutionelle Zeitalter die vermutlich tiefste Zäsur zwischen der vorrevolutionären Epoche und dem 19. Jahrhundert dar. Er bestimmte auch die festliche Szene in Rom. Denn auch wenn die nach dem Sieg über Napoleon bald überall auf dem Kontinent promulgierten Verfassungstexte weiterhin die monarchische Herrschaft von Gottes Gnaden und den königlichen Vollbesitz aller staatlichen Gewalt vorsahen, veränderte sich mit der Einführung von Staatsgrundgesetzen doch alles: Der von Gott begnadete und nach eigenem Anspruch unbeschränkte Herrscher wurde zu einem rechenschaftspflichtigen staatlichen Organ mit definiertem Zuständigkeitsbereich. Die einstmals strahlende Majestät nahm einen nüchterneren Amtscharakter an; die zuvor als gottgewollt akzeptierte monarchische Herrschaft musste fortan durch politischen Erfolg und effektive Regierungsarbeit überzeugen.
Wollten sie ihre Identität – die Kultur, für die sie standen, und das Herrschaftssystem, das sie verkörperten – nicht gänzlich aufgeben, mussten die königlichen Familien versuchen, die überlieferten Traditionen und Kontinuitäten zu bewahren. Möglichst viel von dem, was Europas Monarchen nach eigenem Selbstverständnis und in den Augen ihrer Untertanen von alters her besonders und staunenswert gemacht hatte, sollte überdauern und musste im öffentlichen Auftritt, bei Hof und innerhalb des dynastischen Familienverbunds weiterhin gepflegt werden. Das berühmte Aperçu in dem Roman Der Gattopardo von Giuseppe Tomasi di Lampedusa galt also, wie immer man es wendete: Alles musste sich ändern, damit alles gleich bleiben konnte; alles musste gleich bleiben, damit sich die Dinge wandeln konnten.2
Die Erwartungen und Verpflichtungen, die sich für Europas Thronfolger aus den Herausforderungen einer Zeit ergaben, in der die Forderungen der Französischen Revolution nach Freiheit und Demokratie nachhallten, waren neu und dynamisch und ließen sich nicht so leicht mit den zähen Kontinuitäten vereinbaren, die weiterhin Bestand hatten – am Hof und innerhalb der Familie. Das galt zunächst einmal für den institutionellen Rahmen, in dem Monarchen und ihre Familien existierten, agierten und regierten. Durch strikte Regelwerke war festgelegt, was für die Mitglieder der Königshäuser legal und legitim, was erwünscht und was verpönt war. Dem hatten sich selbst die Monarchen an der Spitze der staatlichen Institutionen zu unterwerfen, ganz gleich wie stark die Gestaltungs- und Führungsmöglichkeiten ausgeprägt waren, über die sie verfügten. Für rangniedrige dynastische Figuren – in besonderem Maße für Thronfolger – mag die Tatsache, dass sich ihr Leben innerhalb dieser sich ständig verschiebenden, wandelnden oder rigide beharrenden Institutionen abzuspielen hatte, eine ganz besondere Herausforderung gewesen sein – privat und öffentlich, persönlich wie politisch.
Das Lebensglück und der Erfolg eines künftigen Monarchen im Europa des 19. Jahrhunderts hing wesentlich ab von seiner Fähigkeit, diesen schwierigen und zum Teil im Zickzack verlaufenden Parcours zu bewältigen. Wie er sich schlug, hatte Einfluss darauf, wie sicher das monarchische System in Zukunft sein würde. Wenn es gelang, ein ansprechendes Bild von dem künftigen Herrscher zu verbreiten, konnte der Thronfolger vor den Augen der Öffentlichkeit zu dem werden, was die Norddeutsche Allgemeine Zeitung im Oktober 1881 im deutschen Kronprinzen Friedrich Wilhelm sah: »das Unterpfand einer gesegneten Zukunft«. Das Bild, das die Öffentlichkeit vom Kronprinzen gewann, war damit von zentraler Bedeutung für das Überleben der Monarchie im 19. Jahrhundert.3
Es galt also, den Thronfolger möglichst wirkungsvoll in die Institution Monarchie einzubinden. Das betraf zuallererst die Bemühungen der Kronen, mit dem Versprechen politischer und gesellschaftlicher Nützlichkeit einen Weg zur Überwindung der »Legitimationskrise der europäischen Monarchie« zu eröffnen. Hier kam dem Thronfolger als künftigem Monarchen naturgemäß große Bedeutung zu.4 Eng damit verbunden war die Entwicklung des Verfassungsstaates, in dem das Verhältnis zwischen den Rechten der Krone und ihres Trägers einerseits und denen der Untertanen andererseits gegeneinander abgegrenzt und auf eine austarierte rechtliche Basis gestellt werden musste. Es galt aber auch, Thronfolger im Rahmen der öffentlich sichtbaren, zunehmend an bürgerlichen Maßstäben gemessenen Institution der königlichen Familie zu präsentieren. Diese Verbände waren von dem strengen, oftmals in Hausgesetzen kodifizierten Entscheidungsmonopol des Familienoberhaupts geprägt, das tief in das private Leben jedes Familienmitglieds eingriff. Und nicht zuletzt hatte der Thronfolger seine Rolle am Hof zu spielen, in jener sorgfältig strukturierten unmittelbaren persönlichen und architektonischen Umgebung des Herrschers, die diesem ein machtvolles Mittel zur Kommunikation monarchischer Herrschaft und zur Disziplinierung verschiedener Personengruppen bot. Diese Strukturen prägten die Welt, in der sich Europas Thronfolger zurechtfinden mussten. Unter diesen Vorzeichen gestaltete sich die Zukunft der monarchischen Systeme.
»Monarchen brauchen Mehrheiten« Wege aus der Legitimationskrise
Als Herzogin Viktoria Luise im Herbst 1913 feierlich in Braunschweig einzog, glaubte sie bei der loyalen Bevölkerung eine durch die Tradition gefestigte Herzensneigung zu erkennen, die ihr und ihrem Gemahl entgegenschlug. Solche Gemütsregungen allein hätten jedoch kaum ausgereicht, die Monarchie im Verlauf des 19. Jahrhunderts abzustützen. Vielmehr hatte eine ausreichend große Zahl von Zeitgenossen davon überzeugt werden müssen, dass die Monarchie als Herrschaftsform geeignet war, Politik und Kultur des Kontinents entscheidend zu prägen und brauchbare Lösungen für Probleme anzubieten. »Die Monarchie steht heutzutage in den meisten Ländern stärker da als vor 50 Jahren«, resümierte der liberale niederländische Parteiführer Willem Hendrik de Beaufort im Jahr 1900. »Meinte oder befürchtete man zuvor, dass die konstitutionell-parlamentarische Monarchie nur eine Übergangsform für die Republik sein könnte, so kann man gegenwärtig sagen, dass die konstitutionelle Monarchie ihren festen Platz hat. Die Demokratie, bis auf einige Sozialisten, will das auch nicht ändern.«5 Wenn die grundsätzlich antimonarchische sozialdemokratische Bewegung auch deutlich zahlreicher war, als de Beaufort es hier suggerierte, traf seine zuversichtliche Einschätzung des Zustands der Monarchie doch weitgehend zu. Dieses Ergebnis war nicht ohne Anstrengungen erzielt worden. Um die Herausforderungen der Zeit, die mit der Französischen Revolution angebrochen war, zu überstehen, hatten sich Europas gekrönte Häupter im 19. Jahrhundert weitreichenden Veränderungen unterworfen.
Der Wandel war den Monarchien trotz – oder auch wegen – der Schwierigkeiten geglückt, die sich aus den Ereignissen nach 1789 ergaben. Mit dem Sturm auf die Bastille hatten sich Forderungen des Volkes nach größerer Teilhabe an der politischen Macht Bahn gebrochen. 1848/49 wurden diese Forderungen erneut erhoben. Sie rüttelten an den Grundfesten des monarchischen Modells, das durch eine weitere wichtige Entwicklung zusätzlich geschwächt wurde: Der Glaube der Menschen an den göttlichen Ursprung königlicher Macht schwand. Bereits die Rationalität der Aufklärung hatte der gottgewollten Königsherrschaft erste Kratzer zugefügt, und im aufgeklärten Absolutismus hatte die Erwartung monarchischer Leistungsfähigkeit zur weiteren Entzauberung der Monarchen beigetragen. Dass ein Fürst nur dann Legitimität beanspruchen konnte, wenn er sein Handwerk beherrschte, hatte bereits König Friedrich II. von Preußen in seinem »Politischen Testament« von 1752 formuliert, wo er konstatierte, dass der König als der »erste Diener und Amtmann seines Staates« fungieren müsse. Denn mit dem Eintritt der Monarchien in das Zeitalter der Verfassungen gelangte die religiös-magische Form von Herrschaftslegitimierung an ihr Ende. Die Einbindung in den Verfassungsstaat entweihte die Kronen und machte sie letztlich zu profanen staatlichen Organen.
Hier und da mochten Bevölkerungsteile und vereinzelt auch Monarchen und ihre engsten Berater weiter dem romantischen Gedanken von göttlich begnadeter Königsherrschaft nachhängen – etwa in der westfranzösischen Vendée oder im bayerischen Oberland, bei Friedrich Wilhelm IV. von Preußen oder dem Bayernkönig Ludwig II. Zudem beharrten die Kronen fast überall auf der trotzig-nostalgischen Formel von der Gnade Gottes. Doch änderte all dies nichts daran, dass es dem monarchischen Prinzip im 19. Jahrhundert an einer generell akzeptierten geistigen Rechtfertigung mangelte. Zwar konnten die Fürsten weiterhin auf die allgemeine christliche Verpflichtung pochen, nach der ihre Untertanen legitimer säkularer Herrschaft Gehorsam zu zollen hatten, doch das bot weit weniger Schutz als der Glaube, der Monarch persönlich befinde sich im Stand göttlicher Gnade. »Nicht nur die Intelligenz empfand diese Begriffe als überholt«, hat Heinz Gollwitzer lakonisch resümiert, »die Bevölkerung insgesamt glaubte nicht mehr so recht daran.«6
Da sich traditionelle und einst als axiomatisch geltende Bindungen zwischen Herrschern und Beherrschten abschwächten, bedurfte die Monarchie anderer Formen der Legitimierung. Das Recht der Monarchen, bei der Ausübung der Macht im modernen Staat eine wichtige Rolle zu spielen, musste völlig neu begründet werden, und das galt zwangsläufig auch für die staatlichen Zivillisten zum Unterhalt des Hofstaats. Allein mit dem Appell an die Herzen der Menschen war es nicht mehr getan, vielmehr galt es, die monarchische Herrschaft mit effektiver Regierungsarbeit und staatlicher Führung zu verbinden. Allerdings konnte diese Herrschaft nicht unbeschränkt sein, sondern musste sich der Kontrolle durch gewählte Parlamente sowie durch eine wachsende und zunehmend selbstbewusste Öffentlichkeit stellen.7 Bemühungen in diese Richtung begannen bereits unmittelbar nachdem die europäischen Monarchen mit ihrem Sieg über Napoleon den Nachlassverwalter der Französischen Revolution niedergerungen hatten, der als Vorbild wie Schreckbild die Entwicklungen der Monarchie entscheidend beeinflusste.
Im Verlauf des 19. Jahrhunderts sollten zahlreiche europäische Monarchien breite Zustimmung erlangen, indem sie sich mit politischen Tendenzen eines Großteils der politisch engagierten Zeitgenossen in Einklang brachten. Die Logik dieser Entwicklung brachte der deutsche Publizist und Politiker Friedrich Naumann 1912 auf die knappe Formel »Monarchen brauchen Mehrheiten«.8 Nicht nur chronologisch steht bei der Suche nach Mehrheiten die Verfassungsentwicklung an erster Stelle. Schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts war »Konstitution« ein wirkmächtiges »Zauberwort«, auf dessen Magie viele Kronen nicht verzichten zu können glaubten. 1814 präsentierte sich der nach Frankreich zurückgekehrte Bourbonenkönig Ludwig XVIII., der jüngere Bruder des 1793 enthaupteten Ludwig XVI., der französischen Nation daher nicht nur als rechtmäßiger Monarch von Gottes Gnaden, sondern auch als »Vollender der Revolution«. Als solcher legitimierte er wichtige Errungenschaften der Nation seit 1789, unter anderem eine Verfassung, die ein gewähltes Parlament vorsah und entscheidende Bürgerrechte festschrieb. Nach Dieter Langewiesche erkannten Zeitgenossen darin einen »Pakt des Monarchen mit der Reform«, eine »Revolution im guten Sinn«, mithin eine »Verheißung an die Nation, ihr die Reformen zu geben, welche die Zeit verlangt, ohne die Ordnung zu gefährden«.9
Neben der Konstitutionalisierung gab es noch weitere Bereiche von Bedeutung, in denen Monarchen sich um die Etablierung einer Spitzenposition bemühten: nationale Identität, imperiale Macht, militärische Stärke und gesellschaftliche Tugendhaftigkeit.
Es gelang den europäischen Fürsten schon frühzeitig, den Widerspruch zwischen der aufstrebenden Ideologie des Nationalismus und dem dynastischen Prinzip in ihrem Sinne zu entschärfen. Die Monarchien des Ancien Régime waren durch Erbgang, Eroberung, Tausch oder Kauf entstanden und beruhten auf den rechtlichen Normen dieser Vorgänge. Den Ergebnissen solcher Erwerbsmethoden – oftmals zerstreute, heterogene, lose integrierte Gebilde – stand mit der Nation ein politisch-kulturelles Konzept gegenüber, das Gemeinsamkeit, Zusammengehörigkeit sowie Einheitlichkeit in Sprache, Kultur, Religion und Politik forderte. Der zunehmend alle anderen Bezugsgrößen in den Schatten stellenden Nation wurden spezifische Rechte und Interessen zugesprochen, und so entwickelte sich die Verteidigung der nationalen Interessen allmählich zur entscheidenden Aufgabe jeder Form von legitimer Regierung. Das zwang die Monarchien zum Umdenken. »Statt dynastischer verfolgten sie nun nationale Ziele«, resümiert Volker Sellin, und bewiesen dabei beachtliches Talent. Je mehr sich der Nationalismus im Verlauf des 19. Jahrhunderts als »selbständige politische Kraft« etablierte, »gegen die auf die Dauer alle anderen Legimitationsangebote chancenlos waren«, so Hagen Schulze, desto mehr waren die Monarchen bereit, sich Nationalflaggen um die Schultern zu legen und sich als erste Vertreter ihrer Nationen zu gerieren. In vorderster Reihe stand dabei der britische König Georg III. (1738–1820), der sich schon frühzeitig bemühte, das Königshaus mit den Leistungen der Nation zu identifizieren. Am Ende seiner jahrzehntelangen Regierung, die im siegreichen Kampf gegen das napoleonische Frankreich gipfelte und somit die Freiheit und Sonderstellung Großbritanniens verteidigte, erfuhr der Monarch eine nationale Vergöttlichung. Mit der festlichen Begehung seines fünfzigsten Thronjubiläums im Jahr 1809 und der Trauer über seinen Tod elf Jahre später feierte die Nation ihre Freiheit und den Triumph über das, was sie als den militärischen Despotismus des französischen Kaisers begriff. Als tadelloser Hausvater an der Spitze einer vielköpfigen Familie und im Zentrum sorgfältig inszenierter Prachtentfaltung wurde »our Geordie« zum Bezugspunkt der Nation. »Wie sollen wir unseren Patriotismus zeigen?«, fragte der Pfarrer Henry Gauntlett seine Gemeinde im Oktober 1809. »Gewiss, meine Freunde, die wichtigste Art zu zeigen, dass er existiert, ist es, für den König zu beten.«10
Auch die Monarchien auf dem europäischen Festland griffen beherzt nach den Rockschößen des Nationalismus, der ja auch den Thron ihres großen Widersachers, des Kaisers Napoleon, machtvoll gestützt hatte. Der Grund dafür liegt auf der Hand: »Wenn ein Monarch sich auf den Boden des nationalen Gedankens stellte«, so Volker Sellin, »verwandelte er die Anhänger der Nationalbewegung in Parteigänger der Monarchie.« Nach dem Minister Élie Decazes war es das Ziel des 1814 nach Frankreich zurückgekehrten Bourbonenkönigs Ludwig XVIII., »die Nation zu royalisieren und den Royalismus zu nationalisieren«. Diese Idee zündete auf beiden Seiten des Rheins. Als 1840 aufgrund französischer Ambitionen auf die Wiedergewinnung der Rheingrenze in Deutschland der Nationalismus aufloderte und sich in der sogenannten Rheinliedbewegung entlud, wollten auch die gekrönten Häupter nicht abseits stehen. Nikolaus Becker, der damals mit dem patriotischen Gedicht »Sie sollen ihn nicht haben,/den freien, deutschen Rhein« zum Mann der Stunde wurde, fand auch auf königlicher Seite außerordentliche Anerkennung: Friedrich Wilhelm IV. von Preußen (1797–1861) verlieh dem rheinischen Verseschmied eine lebenslange Ehrenpension. Der Bayernkönig Ludwig I. (1786–1868) überreichte ihm einen kostbaren Pokal, woraufhin der Geehrte den Wittelsbacher in einem Dankschreiben als »starken Beschützer deutscher Gesinnung« rühmte. Als 1861 in Italien und zehn Jahre später in Deutschland die Gründung geeinter Nationalstaaten gelang, wurde dies vor allem als Leistung der führenden Dynastien gefeiert. König Viktor Emanuel II. (1820–1878) aus dem Hause Savoyen wurde zum »Vater des Vaterlands«, während man den betagten Hohenzollernkaiser Wilhelm I. (1797–1888) in Anlehnung an den sagenumwobenen Stauferkaiser mit dem Ehrentitel »Barbablanca« als den Wiedererwecker deutscher Herrlichkeit feierte.11
In ganz Europa verbanden sich Dynastie und Nation miteinander. Im Rahmen aufwendig inszenierter nationaler Feiern präsentierten sich Monarchen als symbolischer Mittelpunkt der Nation. So wurde etwa im Juni 1867 der österreichische Kaiser Franz Joseph (1830–1916) in einer mehrtägigen, überaus prunkvollen Zeremonie zum ungarischen König gekrönt. Dafür wurde ein Krönungshügel aufgeschüttet, zu dem Bauern aus allen Provinzen Ungarns je einen Kubikfuß Erde beitrugen. Nachdem Franz Joseph gesalbt sowie mit der Stephanskrone gekrönt worden war und geschworen hatte, die Verfassung zu wahren, ritt er auf den Hügel und zückte das Schwert Stephans des Heiligen. »Hoch blitzte es auf in seiner erhobenen Faust und der gesalbte Arm führte mit männlicher Kraft die vier Hiebe in die vier Gegenden der Welt«, berichtete der Pester Lloyd aus der ungarischen Hauptstadt, »und nun kannte die Begeisterung des Volkes keine Grenzen mehr. Ununterbrochen dröhnten die stürmischen Eljen[=Jubel-]rufe dem geliebten Monarchen zu.« Die Stimmung war ähnlich, als die englische Königin Viktoria 1887 feierlich ihr goldenes Thronjubiläum beging: »Nicht nur London allein, sondern ganz England hat sich eine Zeitlang in einen riesigen Hofstaat verwandelt«, resümierte die Londoner Times nach Abschluss der Festlichkeiten, »an dem die Nation und das Empire ihrem Souverän Gefolgschaft schworen.«12
Das Beispiel der britischen Königin, der Nation und Empire huldigten, offenbart, dass die europäischen Monarchien sich im 19. Jahrhundert nicht nur durch Konstitutionalisierung und Nationalismus legitimierten, sondern auch durch ihren Beitrag zu den imperialen Ambitionen ihrer Staaten und Gesellschaften. Unter den Würdenträgern, die 1887 die Westminster Abbey füllten, um die Frau zu ehren, die seit 1877 auch den Titel »Kaiserin von Indien« trug, entdeckte der Berichterstatter der Times »asiatische Fürsten, die vor lauter Juwelen schimmerten, Formen und Gesichter, die ebenso schön wie königlich und edel waren«. Die »imperialisierte Monarchie«, beobachtet David Cannadine, »verschmolz mit dem monarchisierten Weltreich«. Der britische Premier Benjamin Disraeli, der Architekt der Erhebung Viktorias zur Kaiserin von Indien, hatte die Verbindung von nationalem Stolz, Empire und Monarchie bereits in seiner großen Kristallpalastrede von 1872 zum Programm erhoben: Das englische Volk »und besonders seine arbeitenden Schichten« seien stolz darauf, »zu einem Imperium zu gehören«. Die Menschen seien überzeugt, »dass die Größe und das Weltreich Englands den altehrwürdigen Institutionen des Landes zuzuschreiben sind«. Zu Ehren der »Mutter des Empire« nahmen 1887 indische Prinzen und die Königin von Hawaii an der Jubiläumsprozession teil. Sie verkörperten jene imperiale Beziehung, durch die Untertanen in Übersee mit ihrer Königin-Kaiserin verbunden wurden. Zugleich bestärkte das Spektakel die britischen Schaulustigen im Mutterland in ihrem Stolz auf das gewaltige überseeische Kolonialreich, über dem der Union Jack wehte und das – unter anderem – sechs nach Viktoria benannte Seen, zwei Viktoria-Kaps, die Viktoria-Wasserfälle am Sambesi, den Viktoria-Nil in Uganda und die australische Viktoria-Kolonie umspannte.13
Ähnlich exponiert repräsentierte Kaiser Wilhelm II. (1859–1941) die deutsche Sehnsucht nach Weltpolitik, kolonialer Macht und einem Platz an der Sonne. Mit seiner lautstark inszenierten Flottenbegeisterung, seiner ruhelos-energischen Omnipräsenz und dem selbstbewussten Pochen auf Deutschlands globale Interessen bot der letzte Hohenzollernkaiser – wie Rüdiger vom Bruch es formulierte – eine »einzigartige Mischung, eine preußisch akzentuierte Sakralisierung des jungen Nationalstaats mit Weltmachtambitionen«. Damit entsprach der Monarch einem zeitgenössischen Bedürfnis, das besonders markant in der vielfach zitierten Antrittsvorlesung Max Webers zum Ausdruck kam. Hier wurde 1895 die Forderung erhoben, dass die nationale Einigung Deutschlands den »Ausgangspunkt einer deutschen Weltmachtpolitik« bilden müsse. Fünf Jahre später brachte Friedrich Naumann diesen Anspruch direkt mit dem deutschen Kaiser in Verbindung. »In diesem Punkt ist unser Kaiser ganz modern und macht sich zum Führer einer unausweichbaren Lebensforderung der Gesamtnation. Wer ihn in dieser Frage verläßt, der hat keinen Blick für die kommende Zeit«, heißt es in der Abhandlung Demokratie und Kaisertum. »Auf keinem Gebiete liegt das Wollen des Kaisers so klar, so absolut geschichtlich notwendig vor seiner ganzen Nation wie auf diesem. Mit seinem Flottengedanken setzt er sich durch, damit wird er der Erzieher der Nation.« Dass Wilhelm II. mit seinem Eintreten für einen forschen deutschen Imperialismus den Geschmack der Zeit traf – ja vielleicht gar ein Produkt dieses Geschmacks war –, haben bereits scharfsichtige Zeitgenossen bemerkt. Walther Rathenau stellte 1919 im Rückblick fest: »Dies Volk in dieser Zeit, bewußt und unbewußt, hat ihn so gewollt, nicht anders gewollt, hat sich selbst in ihm so gewollt, nicht anders gewollt.«14
Eine solch wohlwollende Haltung gegenüber dem Monarchen zeigte sich nicht nur bei den Großmächten, die ihre imperialen Ambitionen machtvoll verfolgten, sondern färbte auch die Wahrnehmung der Monarchien in den kleineren europäischen Staaten. Im Sommer 1900 etwa kehrte Prinz Waldemar (1858–1939), Marineoffizier und Sohn des dänischen Königs Christian IX. (1818–1906), von einer langen, von der Presse ausführlich geschilderten Weltreise an Bord der Korvette Walküre nach Kopenhagen zurück. Dort wurde er von Tausenden enthusiastisch willkommen geheißen. Einer seiner Begleiter, der bekannte Journalist Henrik Cavling, hatte schon bei der Abfahrt erklärt, dass das Unternehmen des Prinzen »einem kleinen, friedlichen Land gewisse Vorteile« einbringen würde. »Europäische Gouverneure und eingeborene Fürsten« würden Waldemar mit »orientalischen Festlichkeiten« ehren und damit den »zivilen Interessen« dienen. Im Juli 1900 kommentierte Cavling den großartigen Empfang, den die dänische Hauptstadt dem Prinzen bereitete, in der Zeitung Politiken: »Kein Kaiser hat bei seiner Ankunft jemals mehr Menschen auf die Promenade von Tobolden gelockt«, denn die Menschen hätten begriffen, dass Prinz Waldemar »dem Land den größtmöglichen Nutzen gebracht hat, den man von einem Königshaus gewinnen könnte und sollte, indem er es in fernen Ländern repräsentiert hat«.15
Auch der spanische König Alfons XIII. (1886–1841) profierte von imperialen Themen, gestaltete seine Rolle jedoch betont weniger zivil, als dies in Dänemark geschehen war. Nachdem er von Anfang an großes Interesse an den Entwicklungen in Marokko gezeigt hatte, reiste Alfons 1909 – als erster spanischer Herrscher seit dem 16. Jahrhundert – nach Nordafrika. In der Uniform des Capitan General inspizierter er vor Ort spanische Truppen, die im Kampf gegen den Berberstamm der Rifkabylen standen, und setzte sich fortan besonders für Offiziere ein, die dafür kämpften, das spanische Herrschaftsgebiet in Nordafrika zu erweitern. Nach seiner Rückkehr wurde auch er von seinem Volk bejubelt und gefeiert. Der Präsident des spanischen Senats verglich Alfons mit dem legendären Kaiser Karl V. (1500–1558), in dessen Reich die Sonne niemals untergegangen war, und ehrte ihn mit dem Titel »Don Alfonso el Africano«.16
König Viktor Emanuel III. von Italien, der im Herbst 1911 die Eroberung der damals türkischen Provinz Libyen befahl, stieß ebenfalls auf begeisterte Zustimmung beim Volk. Nachdem eine von nationalistischen Gruppen inszenierte Propagandakampagne das Bild eines Libyens gezeichnet hatte, in dem Milch und Honig flossen und dessen arabische Bevölkerung die Italiener dankbar als Befreier begrüßte, erklärte der im Grunde eher vorsichtige und skeptische König dem Osmanischen Reich am 29. September 1911 den Krieg. Auch der Monarch war am Ende überzeugt, so berichtete Gioacchino Volpe, es nicht zulassen zu können, dass Italien im Mittelmeer gänzlich von anderen Mächten eingeschlossen wurde. Zudem sei er froh gewesen, eine Gelegenheit ergreifen zu können, um die Moral der Armee zu heben. Der Öffentlichkeit wurde ein schneller Sieg versprochen, der nur wenige Opfer fordern würde. Der Jubel war groß. Um einer etwaigen französischen Annexion von Tripolis zuvorzukommen, hatten die von der Regierung geleitete Presse sowie nationalistische und katholische Blätter für ein beherztes Eingreifen geworben. Selbst liberale und sogar einige sozialistische Politiker stimmten in den imperialistischen Enthusiasmus ein. »Gerade einmal fünfzig Jahre nachdem es wieder zum Leben erwacht ist«, erklärte der Dichter Giovanni Pascoli nach dem Einmarsch italienischer Truppen in Libyen in einer weit verbreiteten Rede, »hat Italien, der große Märtyrer unter den Nationen, seine Pflicht getan und zum Fortschritt und zur Zivilisation der Völker beigetragen und sein Recht behauptet, nicht hinter seinen eigenen Küsten eingepfercht und erstickt zu werden.« Militärisch konnte Italien einen Erfolg verbuchen: Im Oktober 1912 schloss das Osmanische Reich Frieden und zog seine Truppen aus Libyen ab, das damit faktisch an Italien fiel.17
Die Kämpfe in Nordafrika waren hart und von Grausamkeiten auf beiden Seiten gekennzeichnet. Dennoch wendeten sich zahlreiche italienische Intellektuelle aufgrund dieser Erfahrung einer Erscheinung zu, die den Monarchen nützten: dem Militarismus. »Ich bin zu der festen Überzeugung gelangt, dass Italien erst dann sagen kann, dass es anderthalb Jahrtausende schamvoller Geschichte gerächt hat und der Zukunft mit Zuversicht entgegensehen kann, wenn es einen männlichen Sieg seines Volkes über einen Feind errungen hat – egal welchen«, schrieb der Historiker Giustino Fortunato im November 1912. »Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich eine Vorstellung von der Heiligkeit des Krieges.«18 Von solchen Gefühlen sollten die Monarchien in erheblichem Maß profitieren, denn Europas Königshäuser trafen im 19. Jahrhundert auch durch ihre Verkörperung und Darstellung militärischer Kraft den Nerv der Zeit. Es gelang den gekrönten Häuptern, die archaische Rolle des Herrschers als Krieger und Feldherr den Anforderungen eines Zeitalters anzupassen, das von Verfassungen, Massenheeren, komplexer Militärtechnik und einer wachsenden medialen Öffentlichkeit geprägt war.
Der Siegeszug des Nationalismus im 19. Jahrhundert führte dazu, dass Gesellschaften und Staaten ihre oftmals aggressiven außenpolitischen Interessen auch durch kriegerische Mittel – oder zumindest deren Androhung – durchzusetzen suchten. Bald zeigte sich jenes Phänomen, das Johannes Paulmann als die allgemeine »Aufwertung des Militärischen« bezeichnet hat. Dank ihrer traditionellen Rolle an der Spitze der Armee und ihrer engen Verbindung zur bewaffneten Macht fiel es den Monarchen leicht, diese Aufwertung in eine Bestätigung der eigenen Rolle umzumünzen, da sie selbst ja die öffentlich sichtbare Verkörperung der nationalen militärischen Macht waren.19 So wie Viktor Emanuel III., dessen Konterfei auf den 1912 gedruckten Jubelpostkarten über einem Siegesengel schwebte, obwohl er kaum aktiv in die Leitung des italienischen Feldzugs in Libyen eingegriffen hatte, präsentierten sich im 19. Jahrhundert viele Monarchen ihren Völkern: als die verfassungsmäßigen Väter der Nation, die zu Hause wie in Übersee siegreich für die Interessen des Vaterlandes eintraten – fast immer in Uniform und wenn nötig an der Spitze ihrer Heere.
Der Erfolg, den die Monarchen mit dieser Rolle erzielten, ergab sich nicht zuletzt aus der Tatsache, dass sie das – mehr oder minder helle – Licht ihrer politischen Leistungen keineswegs unter den Scheffel stellten. Vielmehr erwiesen sie sich als gewiefte Werbestrategen in eigener Sache und bedienten sich geschickt der Medien. Das waren zunächst Münzen, Proklamationen, zeremonieller Pomp, Denkmäler, Gemälde und Stiche, später auch die Presse, Photographien, das Bad in der Menge und sogar bewegte Bilder. Überdies waren sie nun auch bereit zu reisen und sich – umtost von Jubelrufen und patriotischen Klängen – dem untertänigen Publikum fernab des Hofes zu präsentieren. Sie hatten sich also zunehmend auf die Anforderungen des aufziehenden politischen Massenmarktes einzulassen und mit ihnen zurechtzukommen. Bella figura zu machen und unterschiedliche Öffentlichkeiten auf vielfache Arten zu umgarnen gehörte zu den Mitteln, mit denen sich die Kronen im Verlauf des Jahrhunderts behaupteten. Sobald das, was die Monarchen taten, als ein Handwerk verstanden wurde, musste es eben auch klappern – und nach Möglichkeit so laut und klangvoll wie möglich.
Zum Klappern gehörte, dass sich Fürsten nicht nur in strikt politischen und militärischen Bereichen als führend präsentierten, sondern ihren Gesellschaften auch in kulturellen, philanthropischen und moralischen Angelegenheiten ein Vorbild waren. Aufbauend auf zum Teil jahrtausendealten Handlungs- und Darstellungsmustern der Könige als Retter der Armen, Beschützer der Religion und Förderer der Künste, entwickelten die Monarchien im 19. Jahrhundert ein betörendes Narrativ. Es kündete von der allumfassenden Tugendhaftigkeit der Einrichtung und zielte sorgfältig auf die Vorlieben der Zeitgenossen. So wurde nichts, was die französische Kaiserin Eugénie tat, in der zeitgenössischen Presse so sehr gefeiert wie die sorgfältig inszenierten Besuche der Gemahlin Napoleons III. in den Choleraspitälern von Paris und Amiens in den Jahren 1865 und 1866. Schon bald kursierten Anekdoten, die das Handeln der Kaiserin in ein mildtätiges Licht tauchten: In Paris habe sie sich darüber gefreut, von einem Patienten als »Schwester« angesprochen worden zu sein; in Amiens habe sie zwei Cholerawaisen adoptiert; und als ein hoher Offizier ihr von solch gefährlichen Besuchen abgeraten habe, sei Eugénie ihm ins Wort gefallen: »Herr Marschall, dies ist unsere Art, in die Schlacht zu ziehen.«20
Nicht immer bedurfte es solchen Mutes, um Herrschertugend zu demonstrieren. »Ich müßte nicht ein Spross des kunstsinnigen Hauses Wittelsbach sein, das überall oder nahezu überall, wo es geherrscht hat […] Spuren seiner Kunstthätigkeit hinterlassen hat«, erklärte etwa der bayerische Thronfolger Prinz Ludwig (1845–1921) im April 1890 im Parlament, »ich müßte nicht der Enkel sein des unvergeßlichen Königs Ludwig I., des Wiedererweckers der deutschen Kunst; ich müßte nicht der Sohn sein des eifrigen Freundes und Förderers der Kunst und der Künstler, Sr. Königlichen Hoheit des Prinzregenten, wenn ich nicht mit Freuden Alles begrüßen würde, was dazu bestimmt ist, die Kunst zu fördern.«21 So wie der Spross der Wittelsbacherdynastie rühmten sich im 19. Jahrhundert fast alle Mitglieder der Herrscherhäuser der ehrwürdigen und bis in die Gegenwart reichenden kulturellen, wohltätigen und tugendhaften Traditionen ihrer Familien. Sie bemühten sich, ihren Platz an der Spitze von Nationen, Staaten und zunehmend bürgerlich geprägten Gesellschaften auch dadurch zu rechtfertigen, dass sie sich als Sterne am bürgerlichen Wertehimmel inszenierten, die alles überstrahlten.
Die Wege aus der Legitimationskrise, in der sich die Monarchien nach der Französischen Revolution und angesichts des schwindenden Glaubens an das Gottesgnadentum befanden, waren also durchaus nicht unbeschwerlich. Die Notwendigkeit, Mehrheiten hinter sich zu bringen, stellte die Fürsten und ihre Nachfolger vor beträchtliche Herausforderungen und führte sie auf teilweise unbekanntes Terrain. Dass Prinz Ludwig von Bayern – der künftige König Ludwig III. – sein Loblied auf das kulturelle Schaffen seines Hauses in einer Parlamentskammer angestimmt hat, und zwar als deren Mitglied, ist kein Zufall, sondern verweist auf eine entscheidende Hürde für das monarchische Überleben im 19. Jahrhundert: auf den Übergang zum Verfassungsstaat.
Für »die Souveräne gibt es keinen anderen Weg mehr« Die Konstitutionalisierung der Monarchie
Schon bald nach Ausbruch des Deutsch-Französischen Krieges von 1870/71 zeichnete sich ab, dass das Ergebnis des blutigen Konflikts ein von Preußen geführter deutscher Verfassungs- und Nationalstaat sein würde. Der preußische Kronprinz Friedrich Wilhelm (1831–1888) machte sich daher – nicht ohne Selbstvertrauen – mit der Rolle vertraut, die ihm nun vorherbestimmt schien. Den Anforderungen der neuen Zeit werde er entsprechen, notierte er im März 1871, denn er glaubte der erste Fürst zu sein, »der den verfassungsmäßigen Einrichtungen ohne allen Rückhalt ehrlich zugetan« vor sein Volk treten werde.22 Mit dieser Selbsteinschätzung dokumentierte der künftige deutsche Kaiser Friedrich III. seinen Willen, sich als Thronfolger und Monarch konstruktiv in jenen in Preußen noch recht neuen institutionellen Rahmen einzufügen, der die europäischen Monarchien nach Napoleon am stärksten verändert hat: in den der Konstitutionalisierung.
Der Beginn des monarchischen Konstitutionalismus, der sich im Verlauf des 19. Jahrhunderts in fast ganz Europa als Verfassungstyp durchsetzte, lässt sich auf das Verfassungsdekret König Ludwigs XVIII. (1755–1824) von Frankreich datieren. Der Bourbone, der 1814 nach der Niederwerfung Napoleons aus dem englischen Exil in die Heimat zurückkehrte, verwarf zwar eine vom französischen Senat vor seiner Ankunft formulierte Verfassung, gewährte aber sehr rasch die sogenannte Chartre. In diesem Dekret wurden weiterhin das Königtum von Gottes Gnaden verkündet und die Souveränität allein dem Monarchen zugesprochen. Doch der Text griff entscheidende politische Forderungen und Errungenschaften aus der Revolutionszeit und der napoleonischen Epoche auf, die konstruktiv in die Gestaltung monarchischer Herrschaft im 19. Jahrhundert eingebunden wurden. »Wir glauben auch«, erklärte Ludwig etwa in der Präambel, »die neuen Verhältnisse würdigen zu müssen, welche diese Fortschritte in der bürgerlichen Gesellschaft hervorgebracht haben, die dem menschlichen Geiste seit einem halben Jahrhundert dadurch gegebene Richtung und die tief greifenden Veränderungen, welche daraus hervorgegangen sind.«23
Mit der Chartre begann ein Prozess, der im Laufe des 19. Jahrhunderts früher oder später in fast allen europäischen Staaten umgesetzt wurde: der Übergang von ehemals absoluter Fürstenherrschaft zu einem System der konstitutionellen Monarchie. Auf diese Weise wurde die Macht des Herrschers durch kodifiziertes Recht begrenzt und an die Mitwirkung anderer staatlicher Organe – insbesondere gewählter Volksvertretungen – gebunden. Zudem garantierten Verfassungen zentrale Menschen- und Bürgerrechte. Mitunter reagierten die Monarchien auf die Forderungen nach konstitutionellem Fortschritt und Verfassungsreformen nicht schnell genug, und die Reformmaßnahmen erfolgten erst, wenn sich revolutionärer Druck aufgebaut oder bereits entladen hatte. So erzwang etwa die Pariser Julirevolution des Jahres 1830 das Ende der Bourbonenherrschaft und den Übergang zur »Julimonarchie« des Königs Ludwig Philipp (1753–1850), die eine Verfassungsrevision und ein erweitertes Wahlrecht mit sich brachte. Während der Nachwehen dieses Ereignisses wurden in Braunschweig, Sachsen und Hannover Verfassungen eingeführt; wenig später gelang in Großbritannien eine tiefgreifende Reform und Erweiterung des Wahlrechts. Die europaweiten Revolutionen von 1848/49 führten lediglich in Frankreich, Venedig, in der Pfalz und im Großherzogtum Baden zur Errichtung kurzlebiger Republiken, bewirkten aber einen weiteren, vielerorts nachhaltigen Konstitutionalisierungsschub. Die Monarchien in Preußen, Piemont-Sardinien und zeitweilig auch in Österreich traten damals ins Verfassungszeitalter ein.
Mal früher, mal später, mal mehr und mal weniger getrieben vom Druck der öffentlichen Meinung gelang es im Verlauf des Jahrhunderts, die monarchischen Staaten des Kontinents durch wiederholte Umgestaltungen fürstlicher Herrschaft verfassungsrechtlich zu modernisieren – und zwar auf weitgehend friedliche und geordnete Weise. Vielerorts präsentierten sich Monarchen als die Väter der Verfassung und hehre Garanten der darin verbrieften Rechte. So ließen die »dankbaren Stände« ein Jahr nach dem Verfassungsdekret vom 26. Mai 1818 zu Ehren des bayerischen Königs Maximilian I. Joseph (1756–1825) eine Münze schlagen, um an die Charta Magna Bavariae zu erinnern, die er gewährt hatte. Im Königreich wurden zahlreiche Denkmäler errichtet, um die Erinnerung an die königliche Tat lebendig zu halten. Darüber hinaus sorgten Maximilians Nachfolger – die Könige Ludwig I. und Ludwig II. (1845–1886) – durch eine versierte dynastische Öffentlichkeitsarbeit dafür, dass die Wohltat nicht in Vergessenheit geriet. Das zahlte sich auf vielfache Weise aus. So blickte Otto von Stromer, der Bürgermeister von Nürnberg, im März 1891 anlässlich einer Feier zum siebzigsten Geburtstag des bayerischen Prinzregenten Luitpold (1821–1912) dankbar auf die Leistungen des bayerischen Königshauses zurück: »Haben wir nicht Sr. Majestät König Maximilian I. unsere Verfassung zu danken, die noch heute maßgebend ist, die vortrefflich ausgearbeitet und im Hauptzweck das bietet, was das bayerische Volk will?«, fragte er in Gegenwart des bayerischen Thronfolgers. Nach Stromers Rede, so berichteten die Münchner Neuesten Nachrichten, erhob sich jubelnder Beifall.24
»Dem Geber der Verfassung Baiern’s dankbare Staende«: So wie König Maximilian I. Joseph von Bayern ließen sich Monarchen in ganz Europa von ihren Völkern als großmütige Väter der Verfassungen und der darin garantierten Freiheiten feiern.
Joseph Losch, »Dankmedaille zum Jahrestag der bayerischen Verfassung von 1818«, 1819. Vorder- und Rückseite. Foto: Berlin-George/Wikimedia Commons, CC-BY-SA-4.0
Auf der Basis von dergestalt gefeierten monarchischen Verfassungsdekreten wurde im frühen 19. Jahrhundert vielerorts eine Versöhnung von Krone und Nation angestrebt: Reformanliegen fanden Berücksichtigung, womit man auch dem Bedürfnis nach Ruhe und Ordnung Rechnung trug, das nach Jahrzehnten der Kriegführung vorherrschte. Hier befand sich der Ursprung jener klassischen Formel vom »Monarchischen Prinzip«, die im Laufe des Jahrhunderts zu einem zentralen politischen Kampfbegriff werden sollte. Danach lag die Gesamtheit der staatlichen Macht in der heiligen und unverletzlichen Person des Monarchen, der sich – nach Maßgabe des jeweils gültigen Verfassungskompromisses – verpflichtete, diese nur im Zusammenwirken mit anderen Verfassungsorganen auszuüben. Zwar blieben im System des Konstitutionalismus die Machtmittel der Kronen in einigen Bereichen – etwa beim Kommando über die Streitkräfte oder in der Außenpolitik – weiterhin beachtlich, doch die prinzipielle Einschränkung monarchischer Gewalt war unübersehbar und sollte im Laufe der Zeit fortschreiten.25
Für den König von Frankreich bedeutete die Ausübung der exekutiven Gewalt nach dem Übergang zum Verfassungsstaat im Jahr 1814 die Mitwirkung verantwortlicher Minister, während die Gesetzgebung und die Bewilligung öffentlicher Gelder der Zustimmung des gewählten Parlaments bedurften. Zudem wurden – auch dies war ein wichtiges Erbe der Aufklärung und der Revolutionszeit – in der Chartre und den ihr folgenden europäischen Verfassungstexten die individuellen Rechte der Untertanen verbrieft. In der Deutung des Historikers Volker Sellin begann mit diesem Verfassungsdekret ein dynamischer Prozess, der die Monarchien Europas während des darauffolgenden Säkulums prägen sollte. Sellin spricht von einem »Jahrhundert der Restaurationen«, in dem monarchische Herrschaft immer wieder von oben stabilisiert und neu legitimiert wurde. Dies geschah durch Verfassungsreformen, die sich an den Forderungen der Zeit orientierten. Restauration wird hier also nicht als der rückwärtsgewandte Versuch definiert, die Uhr mehr oder minder gewaltsam bis zu einem status quo ante zurückzudrehen. Vielmehr zielten die wiederholten Restaurationen darauf, die Macht zwar formal beim Monarchen zu belassen, das Recht auf politische Partizipation aber auf immer breitere Bevölkerungsschichten auszudehnen. Dies geschah »durch die Behauptung der monarchischen Souveränität und die Verbeugung vor der Revolution«. So wurden verfassungsrechtliche Lösungen geschaffen, die weniger dramatische Verwerfungen verursachten als revolutionäre Veränderungen und die obendrein länger Bestand hatten.26
Die insgesamt beständige, wenn auch oftmals nur widerwillig eingeräumte Konzessionsbereitschaft der Monarchen hatte zur Folge, so Sellin, dass sich das monarchische und demokratische Prinzip langfristig aufeinander zubewegten. Restaurationsbemühungen dieser Art sollten nämlich keine einmaligen Vorgänge bleiben, sondern Schritte einer kontinuierlichen Reformpolitik darstellen. Und selbst da, wo die einmal kodifizierten Verfassungstexte über Jahrzehnte weitestgehend unverändert blieben – etwa bei den von der Chartre inspirierten Verfassungen in Bayern und Württemberg oder dem piemontesisch-italienischen Statuto Albertino von 1848 –, ist eine stetige Veränderung der Verfassungswirklichkeit unter dem Druck der sich wandelnden Zeitläufte nicht zu übersehen: Die im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert regierenden Könige Ludwig III. von Bayern (1845–1921), Wilhelm II. von Württemberg (1848–1921) oder Viktor Emanuel III. von Italien waren trotz unveränderter verfassungsrechtlicher Grundlage von einem ganz anderen Selbstverständnis der eigenen Rolle erfüllt als ihre bedeutend selbstherrlicheren Vorgänger Ludwig I. (1786–1868), Wilhelm I. (1781–1864) oder Viktor Emanuel II. (1820–1878) zwei Generationen zuvor. Zwar wurde diese gesamteuropäische Regel einer fortschreitenden expliziten oder auch nur stillen Konstitutionalisierung der Monarchie durch einige prominente Ausnahmen bestätigt – man denke etwa an den »Märchenkönig« Ludwig II. von Bayern, den als »König Gorilla« verspotteten Wilhelm III. der Niederlande (1817–1890) oder Kaiser Wilhelm II., der bereits wenige Jahre nach seiner Thronbesteigung in einem Pamphlet mit Caligula verglichen wurde, was für viel öffentliche Aufregung sorgte. Das offenbart jedoch, dass diese neo-absolutistischen oder rückschrittlich orientierten Herrscherpersönlichkeiten schon von den Zeitgenossen als skandalös, bedrohlich oder geisteskrank, jedenfalls als nicht zeitgemäß wahrgenommen wurden.27
Es gelang diesen schwarzen Schafen offensichtlich nicht, dem nachzukommen, was sich im Laufe des Jahrhunderts zunehmend als zentrale öffentliche Anforderung an einen europäischen Monarchen herausgeschält hatte: ein guter konstitutioneller Herrscher zu sein. Welche Erwartungen das waren, lässt sich dem Nachruf entnehmen, mit dem der Staats-Anzeiger für Württemberg den im Oktober 1891 verstorbenen König Karl I. ehrte. Zu dessen »edlen Herrschertugenden« habe sein konstitutioneller Sinn gehört: »Treu hielt der König an der Verfassung, diesem festen Band, das Fürst und Volk Württembergs stets einigte«, fest, lobte das amtliche Blatt. Noch besser war es, wenn die Haltung des Herrschers gegenüber dem Parlament freundlich war: »Mit der Volksvertretung verknüpfte den König in der ganzen Zeit Seiner Regierung ein schönes Verhältnis ungetrübter Eintracht.« Den neun Jahre später durch ein Attentat ums Leben gekommenen italienischen König Umberto feierte die L’Illustrazione Italiana in ähnlicher Weise als »modellhaften konstitutionellen König«. Die »tiefste und absolute Hingabe an die Institutionen des Vaterlandes nahm von ihm seinen Ausgang«, und die Essenz moderner Verfassungen sei geradezu »in seine Seele eingegraben« gewesen. Im darauffolgenden Jahr verfasste der katalanische Architekt José Grases Riera ein Memorandum zur Errichtung eines Denkmals für den 1885 jung verstorbenen spanischen König Alfons XII. Der Herrscher, mit dessen Regierung sich die Hoffnung auf Frieden, Ordnung und Freiheit verbunden hatte, dieser kultivierte, tolerante, liberale, zeitgemäße, ja demokratische Mann verkörperte, so Grases Riera, das Vaterland, und zwar als ein »konstitutioneller König der modernen Zeit«. Die durch dieses Ideal vorgegebene Richtschnur band den Thronfolgern zunehmend die Hände.28
Dass die Idee eines vorbildlichen konstitutionellen Herrschers – womit noch nichts über die Realität der Verfassungs- oder Parlamentsfreundlichkeit dieses oder jenes Monarchen gesagt ist – so gefeiert wurde, ist kein Zufall. Vielmehr ergab sich dies beinahe zwangsläufig aus der Tatsache, dass der monarchische Konstitutionalismus – also die Herrschaft eines Einzelnen, dessen Macht durch (zumeist kodifiziertes) Recht eingeschränkt ist – im 19. Jahrhundert zu einem erfolgreichen »europäischen Verfassungstyp« wurde. Dem frühen Sonderfall Großbritannien, wo die fortschreitende verfassungsrechtliche Einhegung königlicher Gewalt seit der »Glorreichen Revolution« von 1688 nicht durch ein zentrales Dokument umfassend und systematisch kodifiziert wurde, folgten im 19. Jahrhundert nach und nach fast alle europäischen Monarchien.