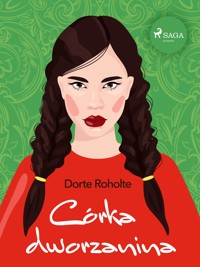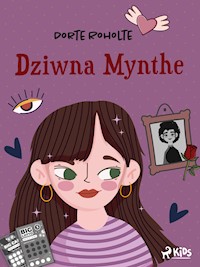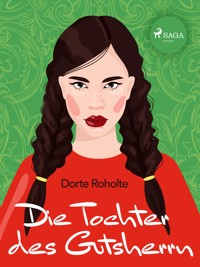
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Die Halbwaise Boel wächst auf dem abgelegenen Gutshof ihres gefühlskalten Vaters auf. Als sie älter wird, erkennt sie, dass viele Dinge nicht so sind, wie sie immer angenommen hatte, und sie nicht die ist, die sie zu sein geglaubt hatte."Lass mich los", zische ich und versuche mich zu befreien, aber vergeblich. Nie hätte ich gedacht, dass ein altes Weib über solche Kräfte verfügt [....] "Du gehörst nicht hierher", fährt sie fort und starrt mich aus weit aufgerissenen Augen an. "Du gehörst nirgendwo hin. Du bist nicht die, nach der du aussiehst. Das ist dein Schicksal. Du bist nie die gewesen, die du wirklich bist!"-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 143
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dorte Roholte
Die Tochter des Gutsherrn
Übersetzt von Patrick Zöller
Patrick Zöller
Saga Kids
Die Tochter des Gutsherrn
Übersetzt von Patrick Zöller
Titel der Originalausgabe: Herremandens datter (Bind 1)
Originalsprache: Dänisch
Coverimage/Illustration: Shutterstock
Copyright ©2015, 2023 Dorte Roholte und SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788728258637
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung des Verlags gestattet.
www.sagaegmont.com
Saga ist Teil der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt.
1.
Eine glänzende schwarze Fliege stürzt sich wieder und wieder gegen die Scheibe des Turmfensters. Sicher bereut sie es, dass sie sich in meine Kammer verirrt hat. Verzweifelt sucht sie nach einem Ausweg, und findet sie ihn, bleibe ich allein zurück. Ich lege die Stickerei in den Schoß und starre hinaus in die Sonne.
Draußen herrscht hochsommerliche Hitze, aber hier drinnen, hinter den dicken steinernen Mauern, ist es kühl. Trotzdem sind mein Nähzeug und meine Hände schweißnass, denn Vater verlangt, dass ich jeden Tag wenigstens drei Stunden nähe. Offenbar verbessert es seine Aussichten, einen passenden Ehemann für mich zu finden, wenn ich nähen und sticken kann.
Der Gedanke an eine Ehe macht mir Angst und Näharbeiten langweilen mich schrecklich. Außerdem kann ich es auch nicht besonders gut. Ständig steche ich mich mit der Nadel und muss leuchtend rote Perlen aus Blut von den Fingern lecken.
Die alte Magna schimpft mich immer aus, wenn ich mich steche. „Ach, Boel, du ruinierst noch den ganzen Stoff!“, schnaubt sie dann, aber jetzt liegt sie in ihrer Kammer nebenan und ruht sich aus. Seit Kurzem wird sie sehr schnell müde. Ich kann ihr Schnarchen hören, ganz schwach nur, und es ist beruhigend und irritierend zugleich.
An richtig langen Tagen vermisse ich sogar Magister Frantz. Er hat mir Lesen, Schreiben und Rechnen beigebracht und mich in Deutsch und Französisch unterrichtet. Aber nun ist er abgereist. Papa meinte, ich müsse nicht noch mehr lernen.
Die Fliege summt wütend und hämmert noch einmal gegen das Glas. Könnte ich das Fenster öffnen, würde ich sie nach draußen lassen. Aber es ist zugenagelt. Mein Blick wandert zu dem großen Gobelin rechts neben dem Fenster. Meine Mutter hat ihn angefertigt. Es muss viele, viele Stunden gedauert haben. Er zeigt eine Jagdszene. Prächtig ausstaffierte Reiter auf edlen Pferden sind zu sehen, gefolgt von zwei einfach gekleideten Reitern. Jeder von ihnen führt einen Falken mit sich auf dem linken Arm. Die Falken haben eine kleine Haube auf dem Kopf, sodass sie nichts sehen können, und sitzen stolz und ruhig auf den langen, dicken Lederhandschuhen. Zum Schluss kommen die Jäger und die Hundeführer, die nebeneinander gehen.
Der Gobelin ist das einzige greifbare Andenken an meine Mutter, das ich habe. Bis vor fünf oder sechs Jahren hing außerdem ein Porträtgemälde von ihr im Rittersaal. Aber Papa ließ es abnehmen. Ich sehe meinen Vater fast nie, aber wenn ich ihn sehe, dann ist er meistens kalt und wie abwesend. Ob meine Mutter warmherziger und freundlicher war? Ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich kaum noch an sie erinnern. Sie starb, als ich drei Jahre alt war. Zum Glück hatte ich Magna. Sie stillte mich, als ich ein Säugling war, und hat seitdem immer auf mich aufgepasst. Als meine Mutter starb, tröstete sie mich. Sie wischte mir die Tränen weg und spielte mit mir im Rosengarten. Manchmal nahm sie mich mit auf die andere Seite der Zugbrücke und des Wassergrabens. Sie sagt, mein Vater habe über die Maßen getrauert, als meine Mutter tot war. Vielleicht trauert er immer noch, denn er trägt stets schwarze Kleidung. Die Leute im Dorf halten Erik von Falkenholt für einen harten und strengen Mann. Und für fromm. Jeden fünften Tag feiert Pastor Munk eine Andacht in unserer kleinen Kapelle, und dann kniet Papa stundenlang da und betet mit geschlossenen Augen und gefalteten Händen.
Ich weiß nicht, wofür er betet. Aber er erwartet, dass ich bei der Andacht bin und ebenso lange bete wie er. Drei Mal hat er mich geschlagen, weil er meinte, ich sei nicht andächtig genug.
Ein Geräusch übertönt Magnas Schnarchen. Pferdehufe klappern nervös auf dem Kopfsteinpflaster. Ich lege das Stickzeug beiseite und drücke das Gesicht an die Scheibe. Es ist der Stallbursche, der den Schimmel für meinen Vater bereithält. Unruhig trippelt der Hengst vor und zurück. Auf der Treppe erscheint mein Vater. Er trägt Reitstiefel und einen breitkrempigen Hut, schwingt sich in den Sattel und reitet im Schritt über den Hof hinüber zur Zugbrücke, ohne zu meinem Fenster heraufzusehen. Einen Moment später ist er verschwunden.
Ich wende mich dem Gobelin zu und lasse meine Finger über den feinen Stich gleiten. Es ist wie ein Gemälde, das mit Nadel und Faden ausgeführt wurde. Eine eigenartige Sehnsucht stellt sich ein. Ob alles anders wäre, wenn meine Mutter noch lebte?
Ich seufze, schleiche zur Tür und drücke vorsichtig mit der Schulter dagegen. Die Angeln knarren. Ich schlüpfe nach draußen und werfe einen Blick in Magnas Kammer. Leise schmatzend dreht sie sich im Schlaf um. Ich halte den Atem an, denn die Luft, die zu mir dringt, ist schwer und stickig. Magna hat schon seit Längerem eine Verletzung am Fuß, die sich immer wieder entzündet und einfach nicht heilen will. Es stinkt widerlich, wenn sie wie jetzt ihre Schuhe ausgezogen hat.
Ich hebe meine grobe Schürze an und laufe so schnell ich kann die Treppe hinunter. Beinahe stürze ich über das Zimmermädchen, das am Fuß der Treppe kniet und die Bodendielen schrubbt. Es ist meine Schuld, dass sie gegen den Eimer stößt und das Wasser überschwappt. Dennoch entschuldigt sie sich bei mir.
„Verzeihung, Jungfer Boel“, sagt sie und sieht nur ganz kurz zu mir auf, bevor sie sich daran macht, aufzuwischen. Trotzdem bemerke ich ihre aufgedunsenen und von Tränen rot gefärbten Augen. Außerdem läuft ihr die Nase.
„Warum weinst du?“, frage ich, obwohl es sich für mich nicht gehört, mit der Dienerschaft zu sprechen. Meinem Vater würde es nicht gefallen. Aber er ist nicht hier, und das Zimmermädchen ist vielleicht gerade neun, zehn Jahre alt.
„Es ist nichts.“
„Du lügst“, sage ich.
Sie schnieft laut und das kleine Gesicht ringt um Fassung.
„Mama ist letzte Nacht gestorben. Und meine kleine Schwester, die sie gerade zur Welt brachte“, schluchzt sie. „Mein Bruder war heute Morgen da und hat es mir erzählt. Ich wollte nach Hause, aber die Köchin hat es mir verboten.“
„Ach“, murmele ich. Die Mutter des Zimmermädchens ist im Kindbett gestorben. Ein vager Gedanke leuchtet schwach in meinem Hinterkopf auf.
Ich nehme ein Taschentuch aus dem Ärmel und reiche es dem Zimmermädchen. „Hier, für die Tränen. Du kannst es gerne behalten.“
Ehrfürchtig nimmt sie es entgegen. Von einem Moment auf den anderen versiegt der Strom aus Tränen und Rotz.
„Wirklich?“, flüstert sie mit kugelrunden Augen.
„Ja, wenn ich es dir sage“, antworte ich und mache zwei Schritte von ihr weg. Mir wird klar, dass sie noch nie etwas so Schönes und Feines besessen hat wie mein Spitzentaschentuch.
„Jungfer Boel“, sagt sie entschlossen, „Verzeihung, aber darf ich es meiner Mutter mit ins Grab geben?“
„Du kannst damit machen, was du willst.“
Ich wirbele herum und haste durch den Rittersaal zum Privatgemach meines Vaters. Bevor ich die Türklinke nach unten drücke, werfe ich einen Blick über die Schulter. Hoffentlich sieht der Verwalter mich nicht. Er ist Papas rechte Hand, und manchmal scheint er überall zur gleichen Zeit zu sein. Aber im Rittersaal ist niemand außer dem Zimmermädchen, das intensiv das Taschentuch studiert. Mein Puls beschleunigt, als ich das Zimmer betrete. Hier drinnen riecht es nach Büchern, Tabak und Leder. Auf Papas Bett liegt eine kostbare Decke aus Brokat. Es gibt zwei Fenster, die im Gegensatz zu meinem geöffnet werden können. Mitten im Zimmer steht sein großer Schreibtisch, auf dem sich Papiere, Dokumente und Briefe stapeln. Mitten auf der glänzenden Tischplatte steht der Schrein.
Ich schleiche hin und öffne ihn. Er ist nicht verschlossen. Bestimmt kann Papa sich gar nicht vorstellen, dass jemand hereinkommt und es wagt, ihn zu öffnen. Es befindet sich auch nichts darin, nur der Brief. Mit angehaltenem Atem falte ich ihn auseinander. Mit den Jahren ist das Papier vergilbt, die Ränder sind eingerissen und die Faltkanten abgegriffen. Aber die Schrift meiner Mutter kann ich immer noch lesen, auch wenn die Tinte allmählich verblasst:
Mein lieber Gemahl,
unser Erbe ist also zur Welt gekommen. Leider ist es ein Mädchen, im Gegensatz zu dem, was uns versprochen wurde. Doch sie scheint gesund und lebensmutig zu sein. Ihr Haar ist dunkel und sehr dicht. Aber so ist es oft bei Säuglingen, und später verliert sich die dunkle Färbung. Ich weise den Boten an, diesen Brief eilig zu überbringen und kehre so bald wie möglich nach Falkenholt zurück.
Eure ergebenste Gattin Laurine.
Leider ist es ein Mädchen. Mein Blick bleibt an den Worten hängen. Ich bin das einzige Falkenholt-Kind. Natürlich sollte ich ein Junge sein. Aber heißt es, dass meine Mutter mich trotzdem mochte, wenn sie schreibt, ich sei gesund und lebensmutig? Denn das sind doch wohl gute Eigenschaften?
Ich denke über meine Haarfarbe nach. Die Haare meines Vaters waren früher rot, jedenfalls auf dem Porträt, das im Rittersaal hängt. Jetzt sind sie grau. Welche Haarfarbe meine Mutter wohl hatte? Ich schließe die Augen und versuche, mich an das Porträt von ihr zu erinnern, das einmal neben dem meines Vaters hing. Es gelingt mir nicht. Aber ihr Haar muss dunkel gewesen sein. Denn meine Haare sind immer noch dunkel. Meine Augen sind irgendetwas zwischen braun und grün. Papas Augen sind grau, also muss ich die Augen wohl auch von meiner Mutter geerbt haben.
Ein Geräusch unterbricht meinen Gedankengang, Metall, das aneinander klirrt. Rasch falte ich den Brief zusammen, lege ihn zurück in den Schrein und schließe den Deckel. Dann atme ich tief durch und verlasse eilig das Zimmer meines Vaters.
Aber das klirrende Geräusch kommt weder von den Sporen meines Vaters noch von denen des Verwalters, sondern vom Schlüsselbund der Köchin, den sie stets am Gürtel trägt. Die großen, schweren Schlüssel gehören zu den Türen der Speisekammern, wo sämtliche Vorräte des Gutshofs lagern, gesalzenes und getrocknetes Fleisch, Mehl und Fett und Krüge voller eingelegtem Obst und Gemüse. Andere Schlüssel führen in den dunklen, feuchten Keller hinter der Küche, zu dem es auch einen Zugang von draußen gibt. Erhobenen Hauptes trete ich aus der Kammer meines Vaters.
Die Schürze der Köchin spannt wie die Pelle einer gekochten Wurst. Auf ihren roten Wangen glänzt Bratenfett. Als sie mich bemerkt, verneigt sie sich und blickt zu Boden.
„Jungfer Boel“, setzt sie atemlos an und zieht dabei mein schönes Taschentuch aus einer der Falten ihrer Schürze und hält es mir hin. „Das Zimmermädchen muss es gestohlen haben. Das wird sie bereuen, seien Sie gewiss!“
„Du irrst dich“, halte ich kalt dagegen. „Und wenn hier jemand etwas bereut, dann ganz sicher nicht das Zimmermädchen. Das Taschentuch habe ich ihr geschenkt, zum Trost, und sie will es ihrer verstorbenen Mutter mit ins Grab geben.“
Mit offenem Mund glotzt die Köchin mich an.
„Gib es ihr zurück.“
„Ja … ja.“
Einen Augenblick lang steht die Köchin wie versteinert da, dann macht sie auf dem Absatz kehrt und läuft mit kleinen kurzen Schritten ungelenk zu der Tür, die hinunter in die Küche führt.
Ich stürme die Wendeltreppe nach oben und finde, dass ich gut aus der Sache herausgekommen bin. Ich will Magna wecken, denn ich muss sie etwas fragen. Endlich habe ich den Gedanken zu fassen bekommen, der mir flüchtig im Kopf herumschwirrt.
Aber ich muss Magna gar nicht wecken, denn sie ruft bereits nach mir. Ich gehe wieder ein paar Schritte nach unten und sehe sie, wie sie humpelnd aus dem Nähzimmer kommt, das im Stockwerk über dem Rittersaal liegt und wo sich die Frauen versammeln würden, sollten wir jemals Gäste auf Falkenholt haben, was sowieso nie der Fall ist.
„Boel! Ich habe nach dir gesucht“, sagt sie völlig außer Atem.
Ich verrate nicht, wo ich gewesen bin, sondern laufe auf sie zu und ziehe sie mit mir ins Nähzimmer. Wir setzen uns auf die Holzbank in dem kleinen Erker, die mit weichen Sitzkissen ausgestattet ist. Von hier hat man einen schönen Blick über den Wald, hinter dem sich ein Stück entfernt die Weiden und das Dorf verbergen.
„Magna“, sage ich und nehme ihre Hand. Sie ist kühl und weich, fast ein wenig schwammig, weil Magna mit zu viel Wasser im Körper zu kämpfen hat. „Magna, ist meine Mutter im Kindbett gestorben? So wie die Mutter des Zimmermädchens?“
Magnas Augen leuchten hellblau. Sie erwidert meinen Blick, ohne auch nur zu blinzeln.
„Nein“, entgegnet sie. „Deine arme Mutter ist an der Schwindsucht gestorben.“
Ich bin nicht sicher, ob sie lügt.
„Ach, ich musste heute so oft an sie denken“, murmele ich und fühle mich plötzlich ganz niedergeschlagen.
Magna sieht es, sie kennt mich sehr gut.
„Lass uns über etwas Anderes sprechen, etwas Schönes“, sagt sie und lächelt auf ihre sanfte, müde Art. „Als ich nach dir suchte, habe ich den Verwalter getroffen. Er hat mir erzählt, dass es bald ein großes Volksfest geben wird, auf den Weiden beim Dorf. Es ist wohl fünfzehn Jahre her, seit wir zuletzt ein Volksfest gefeiert haben, wenn ich mich nicht irre.“
Dann verstummt sie. Ihr Blick ruht immer noch auf mir, und ich sehe, wie sich der Ausdruck in ihren Augen verändert.
„Nein, es müssen bald sechzehn Jahre vergangen sein“, sagt sie dann.
2.
„Volksfest?“, wiederhole ich und sehe meine alte Amme an. „Erzähl mir mehr davon.“ Ich weiß nicht genau, was ein Volksfest ist. Es gibt so viele Dinge, über die ich nichts weiß, weil ich an diesem abgelegenen und einsamen Ort aufgewachsen bin. Aber ich kenne die großen, grünen Weiden, die zwischen dem Wald und dem Dorf liegen. Und ich bin ein paar Mal in der Kutsche durchs Dorf gefahren. Jedes Mal sind mir vor Neugierde fast die Augen aus dem Kopf gefallen, und jedes Mal hat mein Vater mich deswegen gemaßregelt. Beim letzten Mal wurde er so böse, dass er mir mit seinem Stock vors Schienbein geschlagen hat. Er sagte, für eine junge Dame gehöre es sich nicht, so zu glotzen, und erst recht nicht für die Tochter des Gutsherrn. Mir standen Tränen in den Augen; nicht nur, weil mein Schienbein so wehtat.
„Auf einem Volksfest tummeln sich viele Menschen, und es gehört auch ein Markt dazu“, beginnt Magna, und ihr matter Blick scheint in die Ferne zu schweifen. „Alles Mögliche wird feilgeboten, von Seide bis hin zu Gewürzen aller Art in bunten Farben. Es wird Musik gespielt, die einem die Füße verhext, wenn man ihr zuhört, sodass man nicht anders kann und tanzen muss. Die Männer trinken und manchmal prügeln sie sich, meistens aber erst, nachdem es dunkel geworden ist. Für einen Schilling kann man die wunderlichsten Dinge sehen, einen tanzenden Bären oder einen Affen, der kleine Kunststückchen aufführt. Taschenspieler und Zauberer schwirren überall umher, wie Bienen um den süßen Honig. Aber gute Leute müssen sich vorsehen, sonst riskieren sie, hinters Licht geführt und betrogen zu werden. Vor vielen, vielen Jahren, als deine Mutter jung und schwanger und mit ihrem ersten Mann verheiratet war, bin ich mit ihr zum Fest gegangen, und dort …“
Magna verstummt abrupt. Ihre bleichen Wangen nehmen einen rötlichen Schimmer an, was nur selten vorkommt. Sie schaut mich an.
Gespannt habe ich ihr zugehört, jetzt würde ich sie am liebsten schütteln, damit sie mehr erzählt. Ich weiß jetzt schon, dass ich unbedingt zum Volksfest will. Aber ich weiß auch, warum Magna plötzlich nichts mehr sagt: Wegen meiner Mutter!
„Magna“, sage ich und beuge mich zu ihr hin, stütze die Ellbogen auf die Knie und spreize die Beine ein wenig. Würde mein Vater mich so sehen, er würde weiß werden vor Wut und mich ausschimpfen, wie ich auf so liederliche Art und Weise hier sitzen könne. Ich weiß nicht, was nicht stimmt mit mir, aber so zu sitzen fühlt sich für mich ganz natürlich an. Ständig muss ich mich daran erinnern, dass es sich nicht schickt. Aber jetzt gerade verdränge ich den Gedanken.
„Magna, hatte meine Mutter schon einen anderen Mann, bevor mein Vater kam?“
Davon habe ich bisher nicht das Geringste gewusst. Und ich sehe es Magna an, dass sie weiß, sie hat sich verplappert. Die Röte ist aus ihrem Gesicht verschwunden, sie ist weiß wie eine Wand. Ihr Blick huscht zur Tür, als befürchte sie, eine ganz bestimmte Person könnte eintreten. Sicher denkt sie dabei an meinen Vater.
„Papa macht einen Ausritt“, sage ich schnell und stehe auf. „Soll ich die Tür verriegeln?“
Die Tür zum Nähzimmer ist eine der wenigen, die verriegelt werden können. Früher machte man das so, hat Magna mal zu mir gesagt. Dann waren die Frauen in Sicherheit, wenn die Männer sich betranken und den Verstand verloren. Damals konnte ich mir nur schwer vorstellen, dass es auf Falkenholt dazu kommen könnte, und das ist heute immer noch so.
„Nein, nein“, seufzt Magna. „Ach, Boel. Ich hätte das nicht sagen sollen. Kannst du es nicht wieder vergessen?“