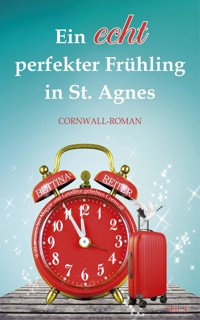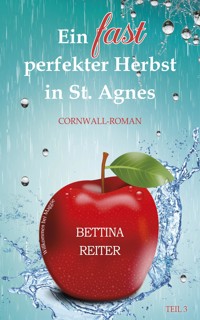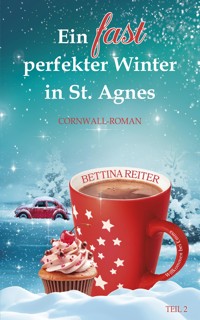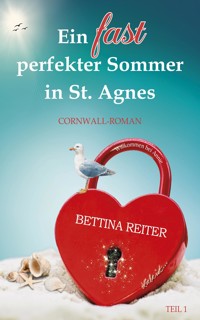Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein ganzes Leben zwischen ihnen … Der bewegende Familiengeheimnisroman »Die Töchter Irlands« von Bettina Reiter jetzt als eBook bei dotbooks. Anfang des 20. Jahrhunderts: Stürmisch branden die Wellen an die irischen Klippen, die Luft schmeckt nach Salz und Freiheit … Inmitten dieser Idylle wächst Catherine mit ihren Geschwistern auf der Farm Wild Swan auf. Dieser Flecken Erde bedeutet Cat alles – bis ihre kleine Welt unwiderruflich auseinanderbricht, denn Aufstände erschüttern das Land und der Farm droht der Ruin. Nicht zuletzt aufgrund der intriganten und kaltherzigen Matriarchin Esther Wolfe Mitchel: Ihr gehört eine Whiskey-Dynastie und schon lange scheint ihr Wild Swan ein Dorn im Auge zu sein. Doch warum hegt diese Frau einen solchen Hass auf Cats Familie? Und welche Rolle spielt ihr Sohn David bei all dem? Cat spürt, dass es ein besonderes Band zwischen ihnen gibt – aber darf sie ihrem Feind wirklich trauen? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Die bewegende Frauensaga »Die Töchter Irlands« von Bettina Reiter über die schicksalshafte Verbindung zweier Familien umfasst die beiden »Rebellinnen von Irland«-Romane und wird Fans von Deirdre Purcell begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 826
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Anfang des 20. Jahrhunderts: Stürmisch branden die Wellen an die irischen Klippen, die Luft schmeckt nach Salz und Freiheit … Inmitten dieser Idylle wächst Catherine mit ihren Geschwistern auf der Farm Wild Swan auf. Dieser Flecken Erde bedeutet Cat alles – bis ihre kleine Welt unwiderruflich auseinanderbricht, denn Aufstände erschüttern das Land und der Farm droht der Ruin. Nicht zuletzt aufgrund der intriganten und kaltherzigen Matriarchin Esther Wolfe Mitchel: Ihr gehört eine Whiskey-Dynastie und schon lange scheint ihr Wild Swan ein Dorn im Auge zu sein. Doch warum hegt diese Frau einen solchen Hass auf Cats Familie? Und welche Rolle spielt ihr Sohn David bei all dem? Cat spürt, dass es ein besonderes Band zwischen ihnen gibt – aber darf sie ihrem Feind wirklich trauen?
Über die Autorin:
Bettina Reiter wurde 1972 geboren und arbeitet im sozialen Bereich. Neben dem Schreiben malt und fotografiert sie leidenschaftlich gerne. Sie ist Mutter von zwei Kindern und lebt mit ihrer Familie in Tirol.
Die Website der Autorin: www.bettina-reiter-autorin.com/
Bei dotbooks veröffentlichte Bettina Reiter auch ihre »White Manor«-Saga mit den Romanen »Die Töchter von White Manor – Schicksalsjahre« und »Die Töchter von White Manor – Sturmwellen«.
***
Überarbeitete eBook-Neuausgabe August 2023
Die deutsche Originalausgabe erschien bereits 2016 unter dem Titel »Der Wind inmitten wilder Schwäne« bei hey! publishing
Copyright © der Originalausgabe 2016 bei hey! publishing, München
Copyright © der überarbeiteten Neuausgabe in zwei Bänden 2022 dotbooks GmbH, München, und als Doppelband 2023 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Bildmotiven von shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-98690-796-9
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Töchter Irlands« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Bettina Reiter
Die Töchter Irlands
Die Wild-Swan-Saga
dotbooks.
Die Rebellinnen:Sturm über Irland
Ich widme dieses Buch meiner Großmutter,
deren Stärke ich immer bewundert habe
und deren Liebe zur Poesie auch mein Leben geprägt hat.
… But one man loved the pilgrim soul in you,
and loved the sorrows of your changing face …
William Butler Yeatsi
Auszug aus seinem Gedicht When You Are Old, das er seiner großen Liebe Maud Gonne MacBride widmete
Prolog
Kingstown, Juni 1890
Voller Dankbarkeit blickte Tatty auf die Irische See, auf ihre Muir Éireann. Von der Veranda ihres Cottage aus hatte sie einen wunderbaren Blick und hätte nicht zu sagen vermocht, wie oft sie den Sonnenuntergang gesehen hatte – dennoch war jeder etwas Besonderes. Heute lag ein sattes Orange über den wilden Klippen und glitzerte über die Muir Éireann, die ruhig da lag, als würde sie – ebenso wie Tatty – einen Moment lang ehrfürchtig den Atem anhalten.
»Du siehst wunderschön aus«, hörte Tatty die geliebte Stimme und wandte sich Laurence lächelnd zu. Wie üblich saßen sie nebeneinander in den gemütlichen Rattan-Stühlen und hielten sich an den Händen. Ein warmes Gefühl durchströmte sie. »Seit zwei Jahren liebe ich dich nun schon«, fuhr Laurence mit rauer Stimme fort, »und werde es bis ans Ende meiner Tage tun.«
Gespielt böse schaute Tatty ihn an. »Der Tod hat keinen Platz in meinem Leben. Das solltest du inzwischen wissen.«
Er lachte, ehe er zärtlich ihre Hand küsste. »Du bist eine ganz besondere Frau.« Seufzend ließ er seinen Blick über ihr Land schweifen. »Genau wie Wild Swan. Ein Flecken Erde, den ich inzwischen genauso verehre wie du es tust. Nie zuvor habe ich mich so lebendig gefühlt wie hier … wie in deiner Nähe. Im Grunde muss ich Clarice dankbar sein, dass sie so erpicht darauf gewesen ist, Wild Swan zu kaufen.«
Ein kleiner Stachel der Eifersucht bohrte sich in Tattys Herz. »Kingstown ist nicht weit entfernt von Dublin. Irgendwann kommt deine Frau hinter unsere Affäre. Es ist ohnehin ein Wunder, dass wir nicht längst aufgeflogen sind.«
»Affäre.« Sein Gesicht zog sich zusammen. »Das klingt so abwertend. Du bist weit mehr als das. Ich hoffe, das weißt du.«
Ja, das tat sie. Laurence hatte ihr nie das Gefühl gegeben, lediglich eine billige Geliebte zu sein. Er nahm Anteil an ihrem Leben und war da, wenn sie ihn brauchte. Nebenbei war er unglaublich attraktiv mit seinem aschblonden vollen Haar, das ihm ständig in die Stirn fiel, den strahlenden, rauchblauen Augen, dem markanten Gesicht und dem kräftigen Körperbau. »Unsere erste Begegnung werde ich nie vergessen«, schwelgte Tatty in ihrer Erinnerung. »Anfangs dachte ich, du wärst ein aufgeblasener Wichtigtuer. Davon abgesehen hast du ziemlich verkleidet ausgesehen in deinem Anzug. Von deinem Kaufangebot für mein Gut will ich gar nicht erst anfangen.«
»Du hast mich ausgelacht«, beschwerte sich Laurence mit gutmütigem Blick. Tatty dachte sofort an jenen schicksalshaften schwülen Sommertag zurück. Wie versteinert hatte er vor ihr gestanden und erbost um eine Erklärung für ihre Heiterkeit gebeten, nachdem sie sein Kaufangebot ausgeschlagen hatte. »Deine Antwort war, dass ich meine Schuhe ausziehen, die Hose bis zu den Knien aufrollen und mit dir über Wild Swan spazieren soll.« In seinen Augenwinkeln glitzerten plötzlich Tränen. »Ich habe es getan. Mein Gott, ausgerechnet ich habe es getan. Weil dich ein Zauber umgibt, dem man sich nicht entziehen kann. In der nächsten Sekunde habe ich zum ersten Mal gespürt, was Freiheit heißt. Die Freiheit, einfach etwas zu tun. Ohne Rücksicht darauf, was andere denken könnten. So viele Jahre habe ich mich wie eingesperrt gefühlt. Die Brennerei war mein Lebensinhalt und natürlich bedeutet sie mir viel. Doch ich hatte keinen Blick für andere Dinge. Erst durch dich habe ich mich selbst gefunden, wofür ich dir unendlich dankbar bin.«
Sie küssten sich zärtlich. »Was du mir jedes Mal aufs Neue zeigst«, sagte Tatty dann dicht vor seinen Lippen. »Trotzdem musste ich dein Kaufangebot ablehnen.«
»Und das bei der Summe!« Laurence grinste. »Wild Swan ist nicht zu verkaufen!«, ahmte er sie nach, »denn, wenn ein Schwan liebt, tut er es ein Leben lang. Auf dieselbe Weise liebe ich mein Land.«
»So ist es, und daran wird sich nie etwas ändern.« Tatty lehnte ihren Kopf an Laurences Schulter, umschloss seine Hand mit ihren beiden Händen, und zog sie nahe an ihr Herz. Nie hätte sie gedacht, dass sie sich nach dem Tod ihres Mannes noch einmal verlieben würde, schon gar nicht in einen der reichsten Männer Irlands. Weder von seinem Wohlstand noch von seiner Frau hatte sie anfangs etwas gewusst. Laurence war in zweiter Ehe verheiratet. Seine erste Frau hatte die Geburt seines Sohnes Johann nicht überlebt. Hals über Kopf hatte Laurence Jahre später seine Schreibkraft Clarice geheiratet, die ihre Tochter Esther mit in die Ehe brachte. Nun schlug er sich mit zwei raffgierigen Frauen herum.
»Ich kann nicht verstehen, wie sich Johann auf Esther einlassen konnte.« Laurence seufzte tief. Seit drei Jahren waren sein Sohn und die Stieftochter ein Paar. »Als würde er die Augen davor verschließen, was ich mit ihrer Mutter durchmache. Clarice ist kalt und berechnend. Sicher, sie hat Sinn für das Geschäftliche, nur kriegt sie den Hals nicht voll und lebt auf großem Fuß. Dass sie dein Land als Standort für eine weitere Brennerei haben möchte, mag naheliegen, aber ein Nein kommt für sie nicht infrage. Wenn Clarice etwas will, dann bekommt sie es auch. Ihre Tochter ist aus demselben Holz geschnitzt.«
»Da lobe ich mir meinen Sohn Chester«, bekannte Tatty. »Der Junge macht mir viel Freude, obwohl er momentan nur seine Florence im Kopf hat und fast jede Nacht bei ihr ist. Umso neugieriger bin ich auf das Mädchen. Er will sie mir übernächste Woche vorstellen. Ich schätze, er meint es ernst.«
»Auch wir sollten endlich Nägel mit Köpfen machen.« Laurence beugte sich vor und nahm das Glas Rotwein vom Tisch, in dessen Mitte ein Topf mit blühenden roten Geranien stand. »In den nächsten Tagen werde ich mit Johann über uns sprechen. Ich bin sicher, dass mich mein Junge verstehen wird und sich dein Sohn ebenso mit uns freut.«
Bisher hatte sie Chester nichts von Laurence erzählt, weil sie sich einig gewesen waren, ihre Liebe vorerst für sich zu behalten. »Esther und Clarice werden dir die Hölle heiß machen.«
»Und wenn schon. Ich bin ein mächtiger Mann und lasse mich von niemandem gängeln. Deswegen werde ich einige Dinge regeln, unter anderem mein Testament. Man weiß ja nie.« Er trank einen Schluck.
»Mich lässt du bitte außen vor.«
»Tatty«, begann er mit weicher Stimme und stellte das Glas zurück, »neben meinem Sohn und meinem Enkel David bist du der wichtigste Mensch in meinem Leben. Ich möchte, dass es dir und Chester gut geht. Mich kostet es höchstens ein müdes Lächeln, wenn ich dir mit einer Zahlung unter die Arme greife.«
»Das will ich nicht.« Sie ließ seine Hand los, erhob sich und lehnte sich an die Verandabrüstung. »Wir schaffen es allein.«
»Wie denn?« Laurence trat hinter sie. »Über kurz oder lang werden deine finanziellen Mittel aufgebraucht sein. In dem Fall stellt sich nicht mehr die Frage, ob du Wild Swan verkaufen willst oder nicht.« Sanft drehte er Tatty zu sich um. »Lass mich euch helfen.«
»Das hast du bereits einige Male getan. Diese Durststrecke müssen wir allein bewältigen.«
»Warum machst du es dir so schwer, wenn es einfacher geht?«
»Weil ich meinen Stolz habe.«
»Den du dir nicht leisten kannst. Es sei denn, du willst Wild Swan verlieren.«
»Natürlich nicht!«, entgegnete Tatty schroffer als sie wollte.
»Siehst du. Außerdem werden wir ohnehin in absehbarer Zeit heiraten. Dann gehört dir ein Zehntel der Brennerei und mir ganz Wild Swan.« Grinsend zwinkerte er ihr zu.
»Das hättest du wohl gern.« Ihr gemeinsames Lachen hatte etwas Befreiendes, denn die Last der Schulden drückte mit jedem Tag mehr. Auch etwas anderes, das aber um vieles schwerer wog. Doch wenn Laurence sie in die Arme nahm – so wie jetzt – trat alles andere in den Hintergrund.
Unendlich zärtlich küssten sie sich.
»Du gibst wohl nie auf, was?«, neckte Tatty ihn, als sie sich voneinander gelöst hatten. Laurence schüttelte den Kopf. »Na gut, ich werde darüber nachdenken.« Damit schien er fürs erste zufrieden zu sein und als sie sich an ihn schmiegte, fiel ihr Blick auf das Bild, das er ihr heute geschenkt hatte. Es lehnte am Blumentopf. Laurence war ein leidenschaftlicher Fotograf und hatte sie vor zwei Wochen abgelichtet. Wie glücklich sie in ihrem weißen Kleid wirkte, das er so sehr an ihr mochte.
»Warte kurz.« Tatty schlüpfte aus ihren Schuhen und eilte ins Esszimmer. Dort kurbelte sie das Grammophon an, bevor sie das Fenster sperrangelweit öffnete und als sie wieder hinausging, ertönte ihr gemeinsames Lieblingslied: Molly Malone.
In der nächsten Sekunde tanzten sie auf der Veranda, die vom Abendlicht erfasst wurde. Dabei juchzte Tatty. Weil sie voller Lebensfreude war. Weil Laurences Lachen etwas Ansteckendes hatte, wie sein Übermut. In diesem Moment gab es nur sie beide auf der Welt. So wie am Bloomsday. An diesem besonderen Tag hatten sie sich kennengelernt. Jedes Jahr taten sie, als würden sie sich zufällig über den Weg laufen, um ihn gemeinsam zu verbringen. Wenn der Abend hereinbrach, tanzten sie im Hafenlokal, bis ihre Füße wund waren. Später – im Schutz der Dunkelheit – liebten sie sich am Sandymount Strand oder unten an der Bucht. Zwei Menschen, die sich selbst genügten, sich alles gaben und einander alles einforderten.
»Wirst du mich heiraten, wenn ich von Clarice geschieden bin?«, fragte er nahe ihrem Ohr. »Obwohl du deine Freiheit liebst?«
Tatty blickte ihm tief in die Augen. »Du bist meine Freiheit, Laurence.«
In dieser Nacht liebten sie sich auf beinahe schmerzvolle Weise. Nie zuvor hatten sie sich bewusster wahrgenommen. Nie zuvor hatte Tatty seine Berührungen intensiver gespürt, nie hatte sie ihn intensiver berührt. Als Laurence in der Morgendämmerung nach Hause fuhr, winkte sie ihm nach, bis sein Fahrzeug in der Kurve verschwunden war. Auch das hatte sie nie zuvor getan.
Den Abschiedsschmerz nahm sie mit sich, als sie barfuß durch das feuchte Gras schlenderte. Auf der Anhöhe blieb sie stehen und schaute zum Cottage hinunter. Zum Leuchtturm, der drüben auf einer Landzunge jede Nacht die Dunkelheit erhellte. Sie hörte das sanfte Rauschen der Wellen, die sich an den Felsen in der kleinen Bucht brachen. Dachte an die vielen Gewitterregen in den vergangenen fünfundvierzig Jahren ihres Lebens. An die unzähligen Sommertage, lau oder erfüllt mit flirrender Hitze. Oft hatte sie im Schatten der Bäume gesessen und auf den Bach geschaut, der sich durch ihren Besitz grub und manchmal wie ein blanker Spiegel leuchtete. Da waren die Berge mit ihren vergletscherten Spitzen, zerklüftete Felsen mit den unnachahmlichen Hochplateaus. Das wilde Gras, das sich in alle Richtungen neigte, als könne sich die hereinwehende Meeresbrise nicht entscheiden, wohin sie wollte. Steinmonumente prägten das Land, Boten vergangener Jahrhunderte, die so viel Zeit in sich trugen. Standhaft trotzten sie den Gegebenheiten, herrschten über die Hügel und thronten über den Tälern, auf denen Schafe weideten. Manchmal war die Sicht klar, manchmal verschwand alles hinter einer Nebelwand. So war Irland. Es empfing einen mit offenen Armen, zeigte seine Schönheit und Fülle, gleichzeitig blieb es mystisch und geheimnisvoll. Wie ihr geliebtes Wild Swan. Es war die schönste Heimat, die ihr das Leben schenken konnte. Aber die schlimmste, wenn man den Tod vor Augen hatte.
Tränen rollten über Tattys Wangen, als sie sich auf ihren, mit unzähligen Kerben übersäten, Lieblingsstein nahe der Waldlichtung setzte. Seine rotbraune Farbe stach aus dem üblichen Grau heraus und doch wirkte sogar der Stein in diesem Moment farblos. So farblos wie ihre Zukunft. Einige Wochen vielleicht, hatte ihr der Arzt vorgestern gesagt. Lapidar, als hätte sie eine Erkältung. Nach wie vor stand Tatty neben sich und wusste nur, dass etwas in ihrem Körper wucherte, das nicht dorthin gehörte.
Selbstquälerisch sah sie zum Himmel empor. »Warum tust du mir das an?« Tatty hörte selbst, wie zornig sie klang. Ja, verdammt, sie war zornig! »Weshalb ich? Was habe ich dir getan? Siehst du nicht, dass mein Paradies hier ist? Genau hier?« Sie schluchzte auf. Die Muir Éireann verschwamm vor ihren Augen. »Was wird aus meinem Sohn? Sag es mir.« Chester zu verlassen – das eigene Kind verlassen zu müssen – brach ihr das Herz. Nie würde sie seine Hochzeit erleben, ihre Enkelkinder im Arm halten dürfen oder mit Laurence offen ihre Liebe leben können. Nein, der Tod war in ihrem Denken nie vorgekommen. Dafür hatte sie das Leben zu sehr geliebt. Jeden neuen Tag, wie er sich auch jetzt am Horizont ankündigte. Doch heute war es anders. Sie wollte nicht, dass der Tag kam, die Nacht ging. Weil es ihr letzter Tag sein könnte, die letzte Nacht. Um keinen Preis wollte sie loslassen. Dennoch wusste sie, dass sie es tun musste. Weil sie wieder von Schmerzen geplagt wurde, als ob sie an das Unvermeidliche erinnert werden sollte.
Grob wischte sie sich mit dem Handrücken über die Augen, ehe sie sich das rotgrüne Tuch enger um die Schultern zog. »Einige Wochen!« Tatty ließ ihren Blick über Wild Swan schweifen, dann blickte sie erneut zum blassblauen Himmel hoch. »Wie kannst du das zulassen?« Schluchzend hielt sie die Hand an den Mund gepresst. Bis sie auf eine Gestalt aufmerksam wurde, die mit eiligen Schritten auf das Cottage zuging. Chester! Wie sollte sie ihrem Sohn das Ungeheuerliche beibringen? Mit welchen Worten, wenn sie selbst keine hatte? Und wann? Heute? Morgen? Oder war es besser zu schweigen und so zu tun, als wäre nichts? Nein, das wäre feige, und feige war sie nie gewesen. Nicht einmal der Tod würde sie dazu machen!
Entschlossen erhob sich Tatty. Das Tuch glitt von ihren Schultern und flatterte auf das Grasbett, ehe sie mit bleiernen Beinen auf ihren Sohn zuschritt, der beinahe das Cottage erreicht hatte. Als Chester auf sie aufmerksam wurde, blieb er stehen und lächelte ihr entgegen. Doch sein Lächeln erstarb. Vielleicht lag es an ihrem Blick, an den Tränenspuren oder an der Tatsache, dass Tatty ihn mit der ganzen Liebe betrachtete, die sie im Herzen trug. Oh ja, sie hatte ihren Sohn immer geliebt, doch nie mehr als in diesem Augenblick …
Kapitel 1
Kingstown, Juni 1910
Jeden Tag um dieselbe Zeit saß Catherines Vater nach dem Mittagessen in seinem Schaukelstuhl auf der Veranda und las die Zeitung. Danach faltete er sie sorgsam zusammen und blickte meistens gedankenverloren auf die Irische See. Sobald Catherine ihrer Mutter in der Küche geholfen hatte, lief sie zu ihm, damit sie diese Momente gemeinsam mit ihm erleben konnte. Momente, die nur ihr gehörten. Leider schafften es ihre dämlichen Brüder Thomas und George jedoch laufend, dass dieses Vergnügen nur von kurzer Dauer war. Auch heute war es nicht anders!
»Gehst du mit uns angeln, Vater?« Thomas faltete die Hände wie zum Gebet. Die dreckumrandeten Fingernägel schrien geradezu danach, geschnitten zu werden. Bis zum Nagelbett. Himmel, Catherine hätte ihn zum Mond schießen können. Besonders, da er ihr die Zunge herausstreckte, als der Vater zu George blickte, der aus dem Haus geschossen kam. Bewaffnet mit drei Fliegenruten in der prallen Hand. Die Brüder setzten wie üblich voraus, dass ihnen der Vater diesen Wunsch nicht abschlagen würde, womit sie richtig lagen. Ehe Catherine sich’s versah, schob der Vater sie von seinem Schoß, griff zur Brille auf dem Rattan-Tisch und setzte sie umständlich auf. Das silberne Gestell war verbogen, weil er sich einige Male daraufgesetzt hatte. Gottlob war das Glas nie zu Bruch gegangen, da eine Reparatur nicht billig war.
»Glaubt ihr, dass wir diesmal mehr Glück haben als letzte Woche?«, fragte der Vater augenzwinkernd und nahm die graue Anzugjacke von der abgeblätterten Sessellehne. Angeln gehörte zu seiner liebsten Beschäftigung, wozu er Sonntage wie heute nutzte.
Catherines Hand umspannte die Verandabrüstung. Sie blickte zu ihrem vierzigjährigen Vater hoch, während er die Jacke überstreifte. Liebenswürdigkeit umgab ihn. Wie einen Kamin, der Wärme verbreitete. Obwohl seine Gutmütigkeit auch Grenzen hatte. Ab und zu konnte man heiße Ohren bekommen, wenn er schimpfte. Im Gegensatz zur Mutter wurde er allerdings nur selten wütend und erhob niemals die Hand gegen seine Kinder. Meistens war er nachgiebig und verständnisvoll. Trotzdem forderte er einiges von ihnen ein. Jedes Kind erhielt mit zunehmendem Alter mehr Aufgaben.
»Nichts ist schlimmer, als unvorbereitet ins Leben geschubst zu werden«, war einer seiner Leitsätze. Meistens sagte er dies in Gegenwart ihrer Brüder, die ziemlich faul und träge waren. Ihre Figur war das beste Indiz dafür. Beide sausten pummelig durchs Leben, hatten braune Augen, fleischige Pausbacken, Sommersprossen auf den Knollennasen und feuerrotes schulterlanges Lockenhaar. Das hatten sie vom Vater geerbt, der es allerdings über die Sommermonate hinweg kurzgeschoren trug. Ansonsten war ihr Vater von großer Statur, worin Catherineihm ähnelte. Schon jetzt mit elf war sie größer als Thomas, obwohl er um ein Jahr älter war.
»Wartet hier, Jungs. Ich ziehe mich schnell um.« Der Vater wollte an den Brüdern vorbei, als er auf einmal innehielt. »Oder wie wäre es mit einer Runde Hurling?« Thomas und George maulten wie Esel, die partout nicht aus dem Stall wollten. »Beim Angeln fehlt euch die Bewegung. Ihr liegt ohnehin rum wie braches Fleisch.«
Catherine konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Der achtjährige George zeigte ihr die Faust. Thomas warf ihr einen grimmigen Blick zu und steckte die Hände in die Hosentaschen. Der Ausbeulung zufolge ballte auch er seine Hände.
»Hör auf, so dämlich zu grinsen, Schwester«, zischte Thomas ihr zu, als der Vater achselzuckend im Haus verschwunden war, »du Bohnenstange.«
Flugs packte Catherine ihn beim Kragen und zog ihn nahe zu sich. Er roch nach gebratenem Speck. »Hüte deine Zunge, Thomas Griffith. Ansonsten verabreiche ich dir erneut eine Tracht Prügel, dass dir Hören und Sehen vergeht.«
»Du bist nicht besser als Mutter!«
Catherines Zorn wuchs. »Im Gegensatz zu ihr habe ich wenigstens einen triftigen Grund, dir eine runterzuhauen.«
Thomas’ Augen weiteten sich. Er nahm die Hände aus den Taschen und hob sie beschwichtigend in die Höhe. »Schon gut.«
»Schon gut … was?«
»Äh, entschuldige.« Sie ließ ihren Bruder los, aber nicht aus den Augen. Mit finsterer Miene richtete er sich den ockerfarbenen Pullover, auf dem Flecken von mindestens zwei Wochen klebten. Man hätte ohne Mühe an ihnen ablesen können, was Thomas gegessen hatte. Mit der Sauberkeit hatte besonders er Probleme.
»Du hättest ein Junge werden sollen«, meldete sich Georgie mutig zu Wort, trat allerdings ein paar Schritte zurück. »Du ziehst dich nicht nur an wie einer, sondern haust auch zu wie unsereins.«
»Dass ich aussehe wie ein Junge, habe ich euch Blödmännern zu verdanken. Und was heißt: wie unsereins?«, höhnte Catherine und setzte sich in den Schaukelstuhl. »Selbst der Leprechaun ist stärker als ihr beiden zusammen, obwohl er ein Zwerg ist.«
Georgie verzog das Gesicht. »Rede nicht über ihn, sonst kann ich nicht schlafen.«
Thomas’ Ellenbogen traf ihn in die Rippen. »Glaubst du im Ernst, dass es den gibt, Bruder? Unsere blöde Schwester will dir nur Angst machen.«
»Du nimmst den Mund ziemlich voll, Thomas.« Catherines Schaukeln wurde heftiger. Ständig fühlte sie sich von ihren Brüdern provoziert. Seit jeher machten sie sich einen Spaß daraus, ihre Schwester Johanna und sie aufzuziehen. Aber Torf in den Schuhen, Ameisen im Bett oder Regenwürmer im Essen waren nichts gegen das, was sie sich vor zwei Wochen geleistet hatten: Mitten in der Nacht schnitten sie ihr das lange tizianrote Lockenhaar ab. Sie sah aus, als hätte sie ein Vogelnest auf dem Kopf, über das ein Orkan gefegt war. Ihre Mutter hatte versucht, dem Schlachtfeld Herr zu werden, gab schließlich auf und schleppte sie zum Friseur. Bei ihrem Anblick hatte Mister Doodley die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und ihr anschließend einen Bubikopf verpasst.
Bubikopf! Der Name sagte alles!
Dass der Vater ihren Brüdern ordentlich die Leviten gelesen hatte – auch, weil ihr Streich ein großes Loch in sein Portemonnaie fraß – war nur ein kleiner Trost gewesen. Zum ersten Mal hatte sich Catherine mit Fäusten gegen die Brüder gewehrt und der Erfolg für sich gesprochen. Nach wie vor prangte ein markanter blauer Fleck auf Thomas’ Wange. Georgie hatte einen seiner strahlend weißen Milchzähne verloren. Natürlich war sie dafür vom Vater getadelt worden, doch das war ihr egal gewesen. Erstens hatte es gutgetan, zweitens wussten ihre Brüder seitdem, dass sie lieber einen Mindestabstand zu ihr einhalten sollten. Die Nachbarskinder würden sich vor Lachen biegen, wenn sie von der Niederlage ihrer Brüder erfuhren.
»Äh, du wirst das nicht rumerzählen, oder?«, erkundigte sich Thomas, als hätte er ihre Gedanken gelesen. »Vor allem Robert nicht.«
Ein Name, der Catherine mit Vorfreude erfüllte. Selbst als ihr Vater und die Brüder das Cottage verlassen hatten, war sie noch in Gedanken bei Robert. Seit Jahren kamen er und seine Eltern jeden Sommer nach Kingstown. Die Familie wohnte ansonsten im County Cork. Ihr Pa und Roberts Vater waren gemeinsam zur Schule gegangen, ehe Jeffrey der Liebe wegen fortzog. Die enge Freundschaft hielt bis heute, obwohl es Roberts Vater zu Geld und Ansehen gebracht hatte. Er besaß sogar ein nagelneues Automobil, frisch aus Amerika importiert. Zumindest hatte Robert davon in seinem letzten Brief geschrieben.
In einer Woche würde er endlich kommen. Catherine konnte es kaum erwarten. Umso mehr schob sie die Erinnerung an die letzten Monate von sich, in denen sie Robert schrecklich vermisst hatte. Obwohl sie sich oft schrieben, konnte nichts seine Gegenwart ersetzen. Wenigstens lenkten sie seine Briefe kurzzeitig ab und verdrängten die Traurigkeit, denn sie fühlte sich mit jedem Tag einsamer. Doch war das ein Wunder?
***
Am späten Nachtmittag half Catherine ihrer Mutter bei der Hausarbeit. Sie bezogen die Betten neu und wuschen Wäsche am nahen Bach. Emma und Johanna halfen mit. Neidisch schaute Catherine auf die langen blonden Haare ihrer Schwestern, die bei jeder Bewegung mit der Sonne spielten, oder umgekehrt.
Jäh stimmte ihre Mutter ein Volkslied an, in das zumindest die Schwestern fröhlich einfielen. Down By The Salley Gardens erschallte es alsbald, wobei Catherine verstohlen ihre Mutter musterte. Sie lachte zunehmend seltener, schlich still und gebeugt durch das Haus. Eine strenge Protestantin mit deutschen Wurzeln, die ihnen viele Verbote erteilte. Zart und klein, dafür umso energischer, mit weizenblondem Haar und blauen Augen. Umarmungen oder Nähe schien sie in den letzten Jahren nicht mehr ertragen zu können. Bloß die vierjährige Emma durfte manchmal auf ihren Schoß. Wenngleich nur kurz.
Was hatte ihre Mutter so verändert? Früher war sie warmherzig gewesen, hatte ihnen Geschichten vorgelesen oder mit ihnen gespielt. Aber das änderte sich von einem Tag auf den anderen. Jegliche Wärme war aus ihren Augen gewichen und oft musterte sie den Vater mit einer unbeschreiblichen Kälte. Als würde sie ihm die Schuld für etwas geben, worunter sie litt. Womit sie grollte, was sie quälte. Mit demselben Blick wurden auch die Geschwister und Catherine bestraft. Ob es an den vier Freundinnen lag, die ihre Mutter regelmäßig besuchten oder zu sich einluden? Reiche Damen, die sich alles leisten konnten. Jedes Mal kehrte ihre Mutter verstimmt heim und schwärmte tagelang von den feudalen Häusern der Frauen. Nein, eigentlich hatte ihre Stimme etwas Vorwurfsvolles, besonders in Gegenwart des Vaters. Es tat weh, wenn er nach jedem ihrer Monologe mit hängenden Schultern den Raum verließ.
»Warum hast du nicht mitgesungen, Cat?«, unterbrach Johanna ihre Gedanken und wrang das nasse Laken aus.
»Du weißt, dass ich eine miserable Stimme habe, Hannie.« Catherine nahm das Laken entgegen und legte es in den geflochtenen Korb neben sich. »Außerdem mag ich das Lied nicht sonderlich.«
»Es entstammt einem Gedicht von William Butler Yeats!«, fuhr die Mutter sie an. »Ein Mann wie er verdient Respekt, junge Dame. Immerhin hat er es weit gebracht und führt ein Leben, von dem wir nur träumen können. Außerdem ist er ein enger Vertrauter meiner Freundinnen.«
»Entschuldige bitte, Mama.« Catherine hob schnell den Korb auf. Im Wissen, dass sie mit ihrer Aussage den Zorn der Mutter herausgefordert hatte. Aber wer konnte ahnen, dass die Frauen Gott und die Welt kannten, womit sie ganz schön tief in der Tinte saß! Niemand durfte die Freundinnen beleidigen – sei es auch nur im Entferntesten – ansonsten fuhr ihre Mutter die Krallen aus. Ein Einsatz, den sie ihrer Familie vorenthielt. »Ich werde die Wäsche aufhängen.« Es war besser, sich in Luft aufzulösen!
»Ach ja? Seit wann bestimmst du, wann unser Gespräch zu Ende ist?« Mit funkelnden Augen baute sich die Mutter vor ihr auf. Catherines Lippen zitterten, als sie die Hand ihrer Mutter fixierte. Eine Hand, die ihr oft genug auf schmerzhafte Weise klarmachte, dass sie ständig alles falsch machte. »Du bist eine undankbare kleine Kröte.« Der heftige Schlag traf Catherine trotz ihrer Ahnung unvermittelt. Sie taumelte zurück, der Korb entglitt ihr. Emma schrie auf und drängte sich an Hannie, als hätte sie soeben selbst eine Ohrfeige bekommen. »Wag es ja nicht zu weinen, Catherine!«, hallte die Stimme der Mutter unheilvoll über das Hochplateau. »Du weißt, wie sehr ich Menschen verabscheue, die sich nicht beherrschen können. Tränen widern mich an.« Wutschnaubend schritt sie davon. Catherine starrte ihr mit brennenden Augen hinterher und spürte das schmerzhafte Pulsieren auf ihrer linken Wange.
»Das habe ich nicht gewollt, Cat«, hörte sie Hannies dünne Stimme. »Und Mutter hat es bestimmt nicht so gemeint.«
»Doch, das hat sie.« Catherine sammelte die Laken ein und stopfte sie wütend in den Korb. Dann hob sie ihn auf und presste ihn an sich. So fest, dass er in ihr Fleisch drückte. Es schmerzte, aber nichts auf der Welt würde mehr wehtun als die Ohrfeige der Mutter. Ihr zorniger Blick. Die Ungerührtheit. Diese Abscheu. »Sie wird es immer wieder tun.« Hannie löste sich von Emma und kam mit mitleidigem Blick auf Catherine zu.
»Bitte, lass es!«, wies Cat ihre Schwester zurück, da sie im Begriff war, sie zu umarmen. Das würde sie in Tränen ausbrechen lassen. Allein Hannies Blick genügte, um beinahe die Beherrschung zu verlieren. Darum eilte Catherine zum Cottage hinunter und hängte die Wäsche auf. Danach zog sie sich in ihr Zimmer zurück, das sie mit ihren Schwestern teilte, und führte ein Zwiegespräch mit Gott.
Nein, sie dachte nicht im Traum daran, ihn um Hilfe zu bitten, sondern wandte sich mit geballter Wut gegen ihn. Wie konnte er zulassen, dass sich die Mutter auf diese Weise veränderte? Die eigene Mutter! Zwar ging es den Geschwistern nicht besser, doch sie bekam am meisten ab. Vielleicht deswegen, weil sie sich oft schützend vor alle stellte, ungeachtet dessen, was sich ihre Brüder manchmal leisteten. Inzwischen dachte die Mutter wohl, sie wäre ein willkommener Prellbock. Eines Tages würde sie jedoch kräftig genug sein, um sich gegen die Schläge zu wehren.
»Ach, Granny, ich wünschte, du wärst hier«, entfuhr es Catherine mit Tränen in den Augen. Sie kannte ihre Großmutter Tatty zwar nur aus den Erzählungen ihres Vaters, trotzdem war sie ihr näher als die eigene Mutter. Ihr Pa hatte Tatty als warmherzig und liebevoll beschrieben. Deswegen flüchtete sich Catherine in unzähligen Tagträumen oft in deren Arme. Um Trost zu suchen. Das Gefühl, geliebt zu werden. Oder sei es nur, um ihren Tränen freien Lauf zu lassen. Natürlich, ihre Mutter hatte eine schwere Kindheit gehabt, lebte als Waisenkind in einem deutschen Heim und wurde von einem kinderlosen irländischen Paar adoptiert. Nach einem Jahr war ihre Ziehmutter überraschend schwanger und ihrer überdrüssig geworden. Kurzerhand wurde sie in ein Heim für schwererziehbare Kinder nahe Dublin gesteckt. Nur einmal hatte die Mutter weinend davon erzählt, wie viel Angst sie gehabt hatte unter den vielen Kindern, die sich gegenseitig gebissen, geschlagen und sogar mit Messern verletzt hatten. Die Nonnen seien nicht weniger grausam gewesen. Aber ihre Mutter war es auch. Wenngleich auf andere Weise.
Auf einmal spürte Catherine einen Luftzug. Erschrocken wandte sie sich zur Tür und entspannte sich wieder, als sie ihren Vater erblickte.
»Hannie meinte, dass es dir nicht gutgeht«, sagte er leise und ließ sich neben ihr auf die Bettkante sinken. Auf seiner Stirn glänzten winzige Schweißperlen. Vorsichtig umfasste er Catherines Kinn und betrachtete ihr Gesicht. »Was ist das für ein Fleck an deiner Wange? Bist du wieder auf einen Baum geklettert?« In jeder Silbe schwang Hoffnung mit, obwohl er seiner Miene nach zu urteilen die Antwort kannte. »Mutter?«, fuhr er zögernd fort. Catherine nickte. »Hast du etwas angestellt?«
»Ich habe gesagt, dass mir das Lied Down By The Salley Gardens nicht gefällt.« Sein trauriger Blick schnitt Catherine ins Herz. Es wäre besser gewesen, den Mund zu halten!
»Das ist alles?«
»Ja, Pa. Das ist alles.«
Seine von blauen Adern gezeichnete Hand sank auf den Schoß. »So kann es nicht weitergehen. Ich muss ein ernstes Wort mit deiner Mutter reden.«
»Bitte nicht, sonst streitet ihr wieder.« Vor zwei Wochen hatte die Mutter sie mit einer Rute verdroschen. Ihr Pa war dazwischengegangen. Danach hatten sich die Eltern regelrecht angebrüllt.
»Na und?«, wurde er zornig. »Ich kann mich wehren. Ihr nicht. Eine Ohrfeige mag gerechtfertigt sein, sofern ihr euch etwas Grundlegendes zuschulden kommen lasst. Aber ein Lied, das man nicht mag …« Er schüttelte den Kopf. »Schlimme Kindheit hin oder her. Es kann nicht angehen, dass ihr unter Florences Vergangenheit leiden müsst.«
»Ich sollte jetzt besser hinuntergehen«, entgegnete Catherine, »und Mutter beim Kochen helfen.«
»Du weißt, dass du mit mir über alles reden kannst.«
»Die Ohrfeige habe ich verdient, Pa.«
Ihr Vater musterte sie stirnrunzelnd. Dann glätteten sich seine Züge. »Geh hinaus an die frische Luft. Hannie kann in der Küche helfen, die Jungs ebenso. Ich werde Florence sagen, dass ich es dir erlaubt habe.« Er streichelte über Catherines Wange. »Du bist groß geworden, so erwachsen. Ich frage mich, wo mein kleines Mädchen geblieben ist? Jenes, das früher so viel gelacht hat. Du bist erst elf Jahre alt und trägst eine beängstigende Ernsthaftigkeit mit dir herum. Etwas, wofür ich auch mir die Schuld gebe. Leider schaffe ich es nicht, eurer Mutter aus ihrer Lebenskrise herauszuhelfen.« Ein Ruck ging durch seinen Körper. »Womit ich dich nicht belasten will, und nun geh …«
Das ließ sich Catherine nicht zweimal sagen und floh regelrecht aus dem Cottage. Umgehend schlug sie den Weg zur Waldlichtung ein. Ihr Lieblingsstein leuchtete von weitem und sie atmete tief durch, als sie sich hingesetzt hatte. Mit den Handflächen glitt sie über die vielen Kerben und blickte zum Elternhaus hinunter.
Beschaulich stand das hellblau getünchte Cottage auf dem Hochplateau und bot einen wundervollen Ausblick auf die Irische See und die Stadt. Kingstown galt als nobler Vorort Dublins. Viele gut situierte Familien hatten sich hier niedergelassen, deren imposante Villen die Küste schmückten. Auch die malerischen Buchten zogen Menschen aus allen Herren Länder förmlich an. Das war nicht immer so gewesen, aber inzwischen wimmelte es den Sommer über vor Badegästen. Außerdem sicherte sich Kingstown – das früher Dún Laoghaire geheißen hatte – zunehmend einen guten Namen als Hafenstadt. Aber gerade aufgrund der florierenden Wirtschaft und des Zustroms äußerte sich der Vater besorgt. Geld locke Macht an und gegen viele andere Einwohner der Stadt seien sie bloß kleine Fische. Nie hätten sie sich einen Besitz wie Wild Swan leisten können, schon gar nicht in der jetzigen Zeit. Umso häufiger betonte der Vater, wie dankbar er ihrer Großmutter sei, dass sie das Anwesen erhalten hatte.
Seit zweihundert Jahren war es in Familienbesitz. Früher gehörten dreißig Hektar Land dazu. Inzwischen musste ihr Vater einiges verkaufen, um sie über Wasser zu halten. Vor etlichen Jahren gab er zudem seine Arbeit im nahgelegenen Salzwerk auf und nun bauten sie Gerste an. Zu Beginn ein waghalsiger Schritt. Vor allem die Mutter hatte ihm vorgeworfen, ein zu großes Risiko einzugehen. Sogar einfältig hatte sie ihn genannt, weil er auf das sichere Einkommen verzichtete. Nun schien die Saat ihres Vaters jedoch aufzugehen. Vor einem Jahr hatten sie die erste große Ernte eingefahren. Gleichzeitig schloss er lukrative Verträge mit zwei großen Whiskey-Brennereien ab – Trusts und Wolfe Mitchel. Gutes Geld, das sie zum ersten Mal seit langem ohne große Geldsorgen über die Wintermonate gebracht hatte, obwohl die Mutter nach wie vor nicht mit Häme sparte. Vor allem, als der Vater die Holztenne zum Mälzen der Gerste gebaut hatte.
Neben dem Elternhaus war im Laufe der Jahre eine kleine Werkstatt entstanden, in der ihr Vater Eichenfässer baute. Er wollte sie verkaufen und betonte ständig, dass nur ein gutes Holzfass, die richtige Lagerung und Reife, einen Whiskey zu einem richtigen Whiskey machten. In zwei Wochen hatte er deshalb ein Treffen mit der Familie Wolfe Mitchel. Deren Brennerei befand sich in Dublin und zählte zu den größten in ganz Irland. Catherine wünschte sich von Herzen, dass ihm der Erfolg treu blieb und war stolz auf ihren Pa. Ihre Granny wäre es ebenfalls …
Wehmütig schweifte Catherines Blick zum schlichten Holzkreuz, das unweit von ihr aus der Erde ragte. Von hier oben hatte man einen freien Blick auf die Muir Éireann. Ihr Vater war fest davon überzeugt, dass Tatty nirgends lieber ihre letzte Ruhe gefunden hätte. Es gab Momente, da beneidete Catherine ihre Großmutter. Nichts mehr hören, nichts mehr fühlen. Denn es gab nichts, das den Schlägen ihrer Mutter die Wucht hätte nehmen können. Den Blicken diese Härte. Wäre der Vater nicht gewesen, wäre sie längst fortgelaufen!
***
»Eine gute Idee bedeutet noch lange kein Geld«, erklärte die Mutter einige Tage später am Frühstückstisch. Catherine mied tunlichst jeden Blickkontakt zu ihr. Als sie nach ihrem Spaziergang zurückgekommen war, hatten sich die Eltern so heftig gestritten, dass sich alle in ihre Zimmer verkrochen. Einmal war ein klatschendes Geräusch zu hören gewesen. Der Abdruck im Gesicht des Vaters hatte Bände gesprochen. Trotz allem nahm er sich Zeit für ihr tägliches Gute-Nacht-Ritual und stellte die obligatorische Frage, ob sie sich in ihren Träumen treffen würden. Gemeinsam malten sie sich stets aus, was sie alles mitnehmen würden und erzählten sich am nächsten Morgen, was sie erlebt hatten. Lauter erfundene Geschichten. Dennoch tat der eine so, als wüsste er, worüber der andere sprach. »Aber ich werde dafür beten, Chester. Im Gegensatz zu dir habe ich nämlich Werte im Leben.«
Der Vater verzog kurz die Mundwinkel, bevor er sein Wort wie üblich nachsichtig an sie richtete: »Auch ich glaube an Gott, Florence, und bin ebenso Protestant. Bloß gehe ich deswegen nicht ständig in die Kirche. Außerdem bin ich ohnehin davon überzeugt, dass in jeder Religion ein Körnchen Wahrheit steckt. Würde man daraus die Bibel machen, gäbe es keine vortrefflichere.«
»Mit deiner saloppen Einstellung zu Gott bist du kein gutes Vorbild für die Kinder.«
»Und das ausgerechnet aus dem Mund einer Frau, die eine saloppe Einstellung zu Gewalt hat«, konterte er. Es musste ihn unendlich viel Geduld kosten, sie ständig mit Samthandschuhen anzufassen. Wie es aussah, stieß er jedoch allmählich an seine Grenzen.
»Das nennt man Erziehung! Aber davon hast du keine Ahnung, nachgiebig wie du bist.« Eine Weile blieb es still. Wohltuend still.
»Wann kommen eigentlich deine Freundinnen heute?«, wechselte der Vater das Thema, goss etwas Milch in seinen Schwarztee und stellte das Kännchen zurück. Catherine tauschte einen schnellen Blick mit Hannie, die mit den Augen rollte. Auch ihre Schwester schien zu ahnen, wessen Besuch bevorstand. »Wisst ihr noch, Kinder? Früher hatten wir nur Butter und Marmelade auf dem Tisch. Nun seht, welche Annehmlichkeiten mein Geschäft mit sich bringt.« Fast jeden dritten Tag gab es würzige Speckscheiben und Blut- oder Leberwurst. Gebratene Tomaten, gebackene Bohnen und Rührei beinahe täglich. Am liebsten hatte Catherine jedoch Scones mit Honig, aber ihre Mutter buk sie selten.
»Du kannst dir die Spitzen sparen, Chester«, erwiderte die Mutter.
»Weshalb fühlst du dich ständig angegriffen? Ich bin einfach nur stolz, euch etwas bieten zu können. Das ist alles.«
»Wie dem auch sei, ich nehme an, du bist den Tag über in der Werkstatt?« Mit gezwungenem Lächeln schälte die Mutter das hartgekochte Ei. Mehr nahm sie am Morgen nie zu sich.
»So ist es. Die Damen haben dich ganz für sich allein. Ich weiß ja, dass du während des Besuches niemanden um dich haben willst.
»Missgönnst du mir diese Treffen etwa?«
»Im Gegenteil. Genieß die Stunden mit deinen Freundinnen.« Der Vater nippte an seiner Tasse. Stets bog er dabei den kleinen Finger weg.
Missmutig nahm sich Catherine einen Sodatoast.
Annie Horniman, Countess Constance Markievicz, Lady Gregory und Maud Gonne MacBride waren eine Zumutung. Letztere mochte Catherine am wenigsten von allen. Wie einen kalten Teller Suppe wärmte diese sauertöpfische Frau ständig dieselbe Floskel auf: »Catherine! Was für ein schöner Name für ein so hässliches Kind!« Das hatte sie angeblich kurz nach ihrer Geburt ausgerufen. Erbost biss Catherine in den Sodatoast. Obwohl sie Maud nicht ernstnahm, fühlte sie sich verletzt. Hässlich inmitten ihrer Schwestern. Hannie war eine Schönheit, aber Emma glich mit ihrem gelockten Haar einem Engel. Fehlten nur der Heiligenschein und die Flügel.
Jedenfalls inspirierten beide Schwestern die Alten – so wurden sie unter den Geschwistern genannt, da sie immerhin schon zwischen vierzig und sechzig Jahre alt waren – stets zu einem entzückten Ausruf. Manchmal mussten sie sogar die Münder öffnen und ihre blendend weißen, geraden Zähne zeigen. Catherine hingegen hatte eine kleine Lücke zwischen den Schneidezähnen. Noch etwas, das ihr zusetzte. Da half es wenig, dass der Vater oft sagte, damit sei sie unverwechselbar.
»Kinder, seht zu, dass ihr fertig werdet«, forderte die Mutter. »Ihr solltet euch umziehen, bevor meine Freundinnen kommen.«
»Das gilt sicher nur für uns vier, oder?« Thomas beugte sich über seinen Teller, sodass er ihn fast mit der Nasenspitze berührte. Dabei schaufelte er die Bohnen regelrecht in sich hinein. Nicht, dass er sie besonders mochte, ihm gefiel das Furzen danach. Vom Gestank ganz zu schweigen. »Weil unsere Cat«, fügte er kauend hinzu, »schaut sowieso keine an.«
Am liebsten hätte ihm Catherine den Inhalt der Teekanne über den Kopf gegossen.
»Cat ist hübsch mit der neuen Frisur«, ergriff die Mutter ungewohnter Weise Partei für sie. »Ein Haarschnitt, wie ihn Coco Chanel hat. Europaweit ahmt man ihn nach. Deine Schwester geht eben mit der Mode.«
Thomas hob den knallroten Kopf. »Na ja, wem’s steht …«
Nein, ihn mit Tee zu übergießen, wäre eindeutig zu wenig. Catherine hätte ihn erwürgen können. »Du bist ja nur neidisch mit deiner Mädchenfrisur und hast mehr Locken als Emma.«
Ihre kleine Schwester begann zu kichern. Auch der Vater schmunzelte.
Thomas schob den leeren Teller von sich und öffnete die obersten Knöpfe seiner knielangen braunen Leinenhose. »Vater, darf ich zu Mister Doodley?«, erkundigte er sich.
»Dafür haben wir kein Geld«, sagte der Vater und sah Thomas missbilligend an. »Deine Mutter könnte jedoch dein Haar kürzen, wie ihr es bei Catherine getan habt.«
»Haben wir überhaupt einen Topf, der auf seinen Wasserkopf passt?«, mischte sich Hannie ein und grinste Catherine an.
»Halt die Klappe.« Thomas verschränkte die Arme vor der Brust. Sein Kinn glänzte fettig. »In deinen geblümten Kleidchen siehst du lächerlich aus. Du machst dich ja nicht einmal bei der Feldarbeit schmutzig.« Wie zum Hohn wischte er sich mit den Fingern über die Hose.
»Schluss jetzt, Kinder!« Die Mutter hieb ihre Faust auf den Tisch. Sofort war es mucksmäuschenstill. Als wäre nichts gewesen, erhob sie sich lächelnd und rückte den schmalen schwarzen Gürtel an der Taille zurecht, den sie zum dunkelblauen Hemdkleid trug. »Helft mir, das Geschirr in die Küche zu bringen. Mädchen, ihr übernehmt den Abwasch. George, du hilfst deinem Vater. Thomas, der vorlauten Zunge wegen bleibst du den ganzen Tag in deinem Zimmer. Es braucht ohnehin einen neuen Anstrich. Farbe steht in der Werkstatt. Und nun ab mit euch!«
***
Catherine tauchte ihre Hände in das seifige Wasser in der Blechschüssel. Die Mutter war nach oben gegangen, um sich umzuziehen. Hannie trocknete ab. Emma plapperte wie üblich die ganze Zeit über. Eigentlich waren es nur Laute und Wortfetzen. Sie hatte Schwierigkeiten zu sprechen. Dennoch verfügte sie über ein ziemlich großes Lungenvolumen. Doch ihre helle klare Stimme brachte wenigstens Farbe in den tristen Tag, denn Regentropfen trommelten wie Schüsse gegen die Fensterscheiben. Graue Wolken bedeckten den Himmel. Nicht der kleinste Fetzen Blau war zu sehen. Aus der Ferne hörte man das Blöken der Schafe. Es hatte etwas Leidvolles. Catherine fühlte mit ihnen, weil sie an den bevorstehenden Besuch dachte. Zwar blieben die Alten meistens nur bis in die Abendstunden, doch das war lange genug.
Als die Mutter herunterkam, wirkte sie wie eine vornehme Lady. Sie trug ein enges schwarzes Kleid, das knapp unter ihre Knie reichte. Hals und Handgelenk waren mit einer Perlenkette geschmückt. Das schulterlange Haar fiel in weichen Wellen herab. Die schwarzen Schuhe mit hohem Absatz waren auf Hochglanz poliert und ihre Augen funkelten.
Der Vater kam aus seiner kleinen Bibliothek und pfiff leise durch die Zähne. Wie ein junges Mädchen drehte sich die Mutter ein paar Mal im Kreis und sonnte sich in seiner Bewunderung. »Für mich machst du dich nie so hübsch«, stellte er fest, wobei er sein Lächeln nicht verlor. Ihre Mutter hingegen schon. Als hätte er etwas Beleidigendes gesagt, blickte sie ihn zornig an und eilte ins Esszimmer. Mit Nachdruck schloss sie die Fensterläden, um den Raum abzudunkeln.
Achselzuckend schaute der Vater zu Catherine, dabei rollte er die Hemdärmel hoch. »War das unangebracht?«, erkundigte er sich leise.
Emma schüttelte heftig den Kopf, umschlang seinen Fuß und schmiegte sich an ihn. Er lachte und hob sie hoch. »Du wirst auch einmal groß«, neckte er sie, »und zu einer Spezies gehören, die wir Männer selten verstehen.« Abermals nickte sie und gab ihm einen Kuss auf die stoppelige Wange. Seine Augen schimmerten wässrig, als er sie an sich drückte und zu Catherine und Hannie sah. »Versprecht mir, immer aufeinander aufzupassen, Mädchen«, bat er mit belegter Stimme.
Beinahe wäre Catherine der Teller entglitten, nach dem sie gerade gegriffen hatte. »Weshalb sagst du das, Pa? Fehlt dir etwas?«
»Keine Angst, Liebling. Manchmal überrollt mich eben die Liebe zu euch. Und wer kann heute wissen, was morgen ist? Aber ihr alle seid eine Griffith! Wie pflegte schon eure Großmutter zu sagen?«
»Dass Griffith-Frauen wie wilde Schwäne sind«, antworteten Catherine und Hannie wie aus einem Mund. Emma klatschte begeistert in die kleinen Hände.
»So ist es. Mögen die wilden Schwäne längst fort sein, vergesst nie, dass ihr einer von ihnen seid. Aber auch nie, wem euer Herz gehört. Nichts geht über die Familie. Lasst niemals zu, dass euch jemand auseinandertreibt.«
Catherine reinigte den Teller mit dem alten Lappen. »Niemals, Pa, großes Ehrenwort.« Sie reichte Hannie den Teller. Wasser tropfte auf den Holzboden.
Lächelnd nickte er. »Gut. Sagt eurer Mutter, dass ich Emma mit in die Werkstatt nehme. Georgie badet noch und kommt nach.« Im gleichen Augenblick ertönte Georgies schiefer Gesang aus dem Badezimmer im ersten Stock, das sich zwischen den Kinderzimmern befand. Im Gegensatz zu Thomas nahm es Georgie mit der Sauberkeit sehr genau und ließ sich Zeit dafür. Dasselbe galt, wenn er das Plumpsklo im hinteren Teil des Cottage aufsuchte. Wenn Georgie saß, dann saß er. Nicht selten waren sie gezwungen, sich andernorts Erleichterung zu verschaffen. »Es wird dauern, bis er in die Werkstatt kommt«, vermutete der Vater mit leisem Lachen. »Tut mir den Gefallen und treibt ihn nicht zur Eile an. Mit seinen zwei linken Händen ist er ohnehin keine allzu große Hilfe. Auf Thomas hingegen werft bitte ein Auge. Nicht, dass er ausbüxt.«
»Ach, Pa, wir sind doch nicht seine Kindermädchen.« Hannie hängte das Trockentuch auf den Haken unter dem regennassen Fenster. Daneben baumelten sieben Tassen an Henkeln – jede in einer anderen Farbe. Hannie gehörte die gelbe, Emma die blaue und Catherine die grüne.
»In diesem Fall schon. Eure Mutter soll ihren Besuch genießen können. Ich möchte nicht, dass sie sich wieder aufregt. Wir hatten genug Sorgen in den letzten Monaten.«
»Na gut, wir kümmern uns um Thomas.« Catherine knuffte Emma mit nassen Fingern in die rosige Wange. »Und du, Winzling, malst etwas Schönes für unser Zimmer.«
»Jaaa! Papier … Farben … Doodley.« Alle lachten. Emma hatte die Strohpuppe, die ihr der Vater im letzten Jahr gebastelt hatte, nach dem Friseur benannt. Die beiden waren unzertrennlich.
»Richtig! Mister Doodley. Wir holen ihn schnell, ehe wir in die Werkstatt gehen.« Ein letztes Lächeln des Vaters, dann verschwand er. Catherine beneidete sowohl ihn als auch die anderen um diese Möglichkeit. Am liebsten hätte sie Thomas beim Streichen oder dem Vater in der Werkstatt geholfen. Der anstehende Besuch hieß nämlich auch, dass sie sich in ein Kleid zwängen musste. Dabei hasste sie das. Lieber trug sie Hosen und Hemden wie ihre Brüder.
»Wir sollten uns sputen.« Hannie verstaute die letzten Teller im Holzschrank und zog Catherine dann an der Hand mit sich. »Die vier werden bald da sein.«
Einträchtig liefen sie in ihr Zimmer hinauf. Catherine setzte sich auf das Bett und spürte die kühle Luft im Rücken, die durch das gekippte Fenster hereinströmte. Zeitweilig blähten sich die roten Vorhänge auf. Hannies Bett stand an der gegenüberliegenden Wandseite, auf die ihr Vater eine hellrosa Tapete angebracht hatte. Zwischen ihren Betten harrte ein schwerer Kirschholzschreibtisch aus grauer Vorzeit. Emma schlief gleich neben der Tür. Der Vater hatte einige ihrer Zeichnungen liebevoll gerahmt und sie an der Wand aufgehängt.
»Du solltest den Wäscheberg auf deinem Bett wegräumen«, mahnte Hannie und schob mit dem Fuß den roten Teppich gerade, der schon bessere Zeiten gesehen hatte. Die Großmutter hatte ihn von einer ihrer Reisen aus Italien mitgebracht. »Wie du weißt, inspizieren die Freundinnen gern unsere Zimmer. Wir sollten Mutter lieber keinen Grund zum Tadel geben.« Flugs öffnete sie den Kleiderschrank, der am Fußende von Emmas Bett stand.
»Was schert es mich?«, gab sich Catherine mutiger, als sie war. Angesichts der Abwesenheit ihrer Mutter war es ein Leichtes, sich über sie hinwegzusetzen und verdammt, es tat gut! »Du ahnst nicht, wie oft ich mir wünsche, dass unsere Granny noch leben würde.« Lustlos wühlte Catherine im Kleiderberg.
»Das wäre schön.« Hannie zog ein Sommerkleid aus dem Schrank. Pastellfarbene Orchideen wüteten darauf, als hätte jemand zunehmend an Gedächtnisschwund gelitten und wollte die Blumen um jeden Preis in Erinnerung behalten. »Dann könnte sie uns all das erzählen, was wir noch nicht von Pa wissen.«
»Das wäre sicher jede Menge.« So viele Geschichten rankten sich um ihre Granny. Vom Vater wussten sie, wie glücklich die Ehe seiner Eltern gewesen war. Ihr Großvater hatte sich als Tabakhändler einen guten Namen gemacht und das Cottage liebevoll ausgebaut, sofern die beiden nicht gerade das Ausland erkundeten. Leider war der Krieg ausgebrochen und er an der Front gefallen. Nie wieder hatte die Großmutter geheiratet, jedoch die Geschäfte übernommen. Über kurz oder lang hatte sie allerdings aufgeben müssen, weil man als Frau an der Spitze eines Unternehmens wenig Akzeptanz bekam. Zumal sie vom Geschäftlichen kaum etwas verstand. Alles war verkauft worden, weit unter Wert, wie sich später herausstellte. Einzig das Cottage hatte ihre Großmutter behalten. Wie sie es schaffte, sowohl die Unruhen im Land als auch die große Hungersnot ohne Mann oder Einkommen zu überstehen, wusste nicht einmal der Vater. Anscheinend gab es einen ominösen Verehrer, der ihr finanziell unter die Arme gegriffen hatte. Doch weder war seine Identität bekannt noch gab es einen Beweis, der dieses Gerücht untermauert hätte.
Motorgeräusch näherte sich. Catherine warf einen raschen Blick aus dem Fenster. Ein rostbraunes Fahrzeug kämpfte sich über die holprige Straße herauf. Wasser spritzte zu allen Seiten, denn durch den Regenfall hatten sich tiefe Lachen gebildet. »Die Alten!«, murmelte Catherine. Hoffentlich wurden die Frauen ordentlich durchgeschüttelt und knallten mit den Köpfen hart gegen das Dach.
»Oh, nein, das ist zu früh!« Hannie schlüpfte hastig in ihr Kleid. Mit flinken Fingern schloss sie die Knöpfe. Sie reichten vom Rundhalsausschnitt bis zur Taille. »Außerdem bin ich nicht einmal gekämmt.«
»Sieh mich an und dann beklag dich noch einmal.«
»Komm schon, Cat. Du weißt, wie Mutter reagiert, wenn sie sich blamiert fühlt.«
»Von mir?«
»Nicht nur von dir. Wir alle sollen uns von der besten Seite zeigen.«
»Du könntest einen Kartoffelsack tragen und trotzdem wäre ich als Mutter stolz auf dich. Das sollte sie auch sein.«
»Meine Güte, Mutter kommt ohnehin kaum unter Leute. Lass sie ein bisschen mit uns angeben.« Hannie war die Realistin in der Familie, die Bedachte und Vernünftige. »Davon abgesehen sind die Frauen im Grunde ganz nett. Was hast du eigentlich gegen sie?«
»Ist deine Frage ernst gemeint?« Catherine stemmte die Hände in die Hüften. »Im Übrigen warst du bisher auch keine glühende Verehrerin der Alten und wenn ich mich recht entsinne, hast du vorhin am Frühstückstisch die Augen verdreht.«
»Mag sein, aber wir bekommen sie ohnehin kaum zu Gesicht.«
»Und was ist mit Mutter? Sie setzen ihr Flausen in den Kopf. Seitdem sie diese Hexen kennt, hat sie sich jedenfalls verändert.«
»Mutters Wandlung begann schon vorher.«
»Wie kannst du das behaupten? Du warst erst drei Jahre alt, als Mutter sie kennenlernte. Außerdem leidet Vater unter Mutters Unzufriedenheit, die mit jedem Treffen zunimmt. Es kann nur damit zusammenhängen, dass sie sich zu sehr von den Frauen blenden lässt. Wer weiß, was die ihr alles einreden. Hinzu kommen diese komischen Séancen. Es macht mir höllische Angst, wenn Lebende mit Toten reden.«
»Du hast ja recht, trotzdem kannst du den Frauen nicht die Schuld für alles geben.«
»Weshalb nicht? Ein anderer Grund für Mutters Verhalten fällt mir nicht ein. Tatsache ist, dass die Frauen keinen guten Einfluss auf sie haben, deshalb mag ich sie nicht. Dass du jedoch anderer Meinung bist, leuchtet mir ein. Immerhin schieben dir die Alten ein Kompliment nach dem anderen in den Hintern, von Emma ganz zu schweigen.«
»Bist du etwa eifersüchtig?«, fragte Hannie mit verblüffter Miene.
»Hast du einen Vogel?« Catherine tippte sich mit dem Zeigefinger an die Stirn. Insgeheim gestand sie sich jedoch ein, dass es ihr nicht passte, ständig bemäkelt zu werden. Sie wollte gebildet sein wie Hannie. Engelsgleich wie Emma. Selbst die Brüder schnitten bei den Alten um Längen besser ab als sie. »Sag mir lieber, was ich anziehen soll.«
Der letzte Knopf, schnell die weißen Socken bis zu den Knien hochgeschoben, dann kramte Hannie im Schrank. »Das dunkelblaue mit den Punkten.« Der Entgegnung folgte besagtes Kleid, das auf Catherines Kopf landete. Widerwillig zog sie es herunter und hielt es sich vor den Körper. Es reichte bis knapp über ihre aufgeschlagenen Knie. Scheinbar war sie gewachsen, dabei hatte ihr die Mutter das Kleid erst kürzlich gekauft. Nun würde sie mit der unchristlichen Länge erst recht für Aufregung unter den Damen sorgen. Vielleicht sogar einen Herzanfall bei der einen oder anderen Lady auslösen. In dem Fall wäre das Kleid gar nicht schlecht gewählt!
***
Wie erwartet wurden Hannie und Catherine eingehend gemustert. Catherine mit hochgezogenen Augenbrauen, kurz und bündig. Auf Hannie lagen die faltigen Augen länger, und ein wohlwollendes Lächeln stahl sich in die Gesichter der Alten.
»Entzückend!«, rief Annie Horniman aus. Ihres Zeichens eine reiche Tee-Erbin. Viele nannten sie The Hornibag. Ihr Großvater hatte eine Art Papier-Teebeutel erfunden, woher vermutlich die Bezeichnung stammte. »Und was für wunderhübsches Haar du hast, Hannie.« Da sprach wohl der Neid aus der dünnen Brust. Immerhin stand Annie das dunkle Kraushaar wirr vom Kopf ab, unzählige Holzketten hingen um ihren Hals und das Kleid glich einer weiten Soutane. Eine dicke Nase und weit auseinanderliegende Augen ließen ihr Gesicht ungleichmäßig erscheinen.
Der dürren Countess Constance Markievicz war wie üblich keine Regung abzulesen. Sie stand stramm da wie ein Zinnsoldat, hatte ein strenges Gesicht und wenn sie lächelte, zeigten sich große Lücken zwischen den Zähnen. Sie trug einen Dutt, und eine Seitenwelle verdeckte die linke Stirnhälfte. Ihr Kleidungsstil wurde mit jedem Jahr maskuliner. Der Hosenanzug ähnelte einer Männeruniform.
»In der Tat, Hannie wird immer hübscher«, ließ die achtundfünfzigjährige Lady Gregory verlauten und drängte sich an Constance vorbei. Meistens war ihr Blick abwesend, als würde sie die ganze Zeit nachdenken. Genauso betrachtete sie Hannie. »Wenn sie groß ist, werden sich die Männer förmlich um die Kleine reißen.« Lady Gregory trug ein hochgeschlossenes schwarzes Seidenkleid mit Puffärmeln und verspielter Spitze am Brustansatz. Diesmal hatte sie auf den obligatorischen Chiffonschleier verzichtet. Im Gegensatz zu Annie trug sie selten Schmuck, mit Ausnahme der feinen Silberkette, an der ein großer keltischer Kreuzanhänger baumelte. Was Lady Gregory jedoch mit dem Teebeutel gemeinsam hatte, war die aufgelöste Frisur. Vermutlich waren die Frauen im Kraftfahrzeug tatsächlich enorm durchgeschüttelt worden.
Und dann war da noch die vierundvierzigjährige Maud, deren abschätziger Blick wie ein aufgezogenes Uhrwerk über Catherines Gestalt glitt. »Kinder, wisst ihr noch, was ich damals bei Catherines Geburt gesagt habe?« Alle nickten einträchtig, inklusive der Mutter! »Das war nett ausgedrückt, wenn ich es recht bedenke. Gott, herrjeh, was ist mit deinem Haar geschehen, Catherine Griffith? Es war das einzig Kleidsame an dir. Nun siehst du aus wie ein Bursche in einem viel zu kurzen Gewand.« In Gedanken zog Catherine gewaltsam an Mauds fülligem dunkelgelocktem Haar, das ihr bis zu den Schultern reichte. Rammte ihr die Fingernägel in die großen Augen und zupfte mit Wonne jede einzelne der buschigen Brauen aus. Die leicht herabhängenden Mundwinkel hätte sie ihr gern bis an den zerknitterten Hals gezogen. Vermutlich war Maud mit sich selbst unglücklich. Kein Wunder, denn für eine Frau war sie viel zu groß geraten. »Dir fehlt eindeutig das Damenhafte. Nimm dir ein Beispiel an mir.« Maud deutete auf sich selbst, als müsse sie ihre haarsträubende Aussage unterstreichen. Scheinbar hatte die Gute keinen Spiegel. So halbnackt würde sie jedenfalls niemals herumlaufen! Mauds nachtblaues Kleid war nämlich ziemlich offenherzig und zeigte milchig blasse Haut an den Schultern. Am tiefen Dekolleté wurde der Stoff mit einer Brosche gerafft. Der schwarze Stein funkelte. Catherine funkelte zurück.
»Ihr habt sicher Hunger«, wandte sich die Mutter an ihre Freundinnen. »Kinder, geht nach oben und spielt. Wir möchten in den nächsten Stunden nicht gestört werden.« Kaum ausgesprochen, schob sie die Tür zum Esszimmer auf. Eine große Kerze mitten auf dem Palisandertisch war die einzige Lichtquelle. Karten mit bizarren Zeichen lagen ausgebreitet da. Ein merkwürdiger Duft drang aus dem Raum. Wie es aussah, wollten sie sofort mit einer Séance beginnen.
»Mir knurrt der Magen.« Constance rieb sich den Bauch und marschierte an der Mutter vorbei. Lady Gregory folgte ihr. »Wie schön du alles arrangiert hast.« Ihr Lob klang wie ein Bühnentext. Wobei Constance beizeiten tatsächlich in diversen Stücken mitwirkte, so wie jede der vier Damen einen engen Bezug zum Theater hatte.
»Es wäre gut, vorher die Zimmer auszuräuchern.« Annie spielte mit den Halsketten, was ein hölzernes Geräusch erzeugte. »Ich spüre negative Energie, Florence. Habt ihr Schwierigkeiten?«
Die Mutter schüttelte den Kopf. »Chesters Geschäft befindet sich im Aufwind.«
»Dennoch wirkst du unglücklich.«
»Weil mir nicht aus dem Kopf geht, was bei unserer letzten Séance ans Licht kam.«
»Du nimmst das eindeutig zu ernst«, erwiderte Annie, die sich sogar traute, in der Öffentlichkeit zu rauchen. Wie hatte der Vater sie letztens genannt? Exzentrisch und rebellisch. Zugegeben, der Teebeutel wies ein paar positive Züge auf. »Tote sprechen viel, wenn der Tag lang ist. Sie haben ja selten Gelegenheit dazu.«
Hannie machte einen tiefen Atemzug. »Sprecht … ihr tatsächlich mit Toten?«, flüsterte sie und griff nach Catherines Hand. Fast schmerzhaft drückte sie zu. »Mutter, ich …«
»Geht nach oben!« Die Mutter schob Maud und Annie in den Raum. Dann verschloss sie mit Nachdruck die Tür. Catherine brauchte Hannie nicht einmal anzusehen, um zu wissen, dass auch sie eine Gänsehaut hatte. Oder Hinkelsteine in den Beinen, denn sie bewegten sich keinen Zentimeter. Nach einer Minute jedoch so viel, um mit gespitzten Ohren und zitternd wie Espenlaub vor der sperrigen Holztür zu knien. Manchmal waren die Frauen kaum zu verstehen. Monotones Murmeln ertönte. Dann wiederum laute Rufe.
»Wer ist hier?« Das war Annie. »Rede mit uns, wir haben Fragen an dich. Besser gesagt, Florence hat einige auf dem Herzen. Jesus, ich brauche dringend eine Zigarette. Diese Energie ist kaum auszuhalten. Ebenso wie die Kälte. Es müssen einige Geister im Raum sein.«
Die Härchen auf Catherines Armen richteten sich auf. Hannie presste die Augen zusammen, als könnte sie sich dadurch besser konzentrieren oder unsichtbar machen. Vermutlich beides zusammen. Ihr selbst war ja auch angst und bange, dennoch konnte sie sich nach wie vor nicht von der Stelle bewegen.
»Wer bist du? Ich spüre dich ganz deutlich.« Die Mutter klang anders als sonst. Sanfter. Zugleich hatte ihre Stimme etwas Beängstigendes. »Ihr habt mir gesagt, dass ich zu Höherem geboren bin. Ist dem tatsächlich so?«
»Beim letzten Mal«, ertönte Mauds Stimme abgehakt, als lausche sie zwischendurch, »habe ich dir … gesagt, dass du kein Leben geführt hast, wie es dir beschieden gewesen wäre. Darum mach dich nicht kleiner, als du bist. Wertloser.«
»Ich bin ein Heimkind, der letzte Dreck.«
»Schluss mit dieser Selbsterniedrigung«, beschwor Maud sie. »Auch du darfst mehr vom Leben erwarten als das, womit du dich begnügst.«
»Meinst du Chester? Oh, ich möchte frei sein, ohne diese Fesseln …«
»Himmel, Florence, du solltest zu rauchen anfangen«, warf Annie ein, »das hilft manchmal. Chester ist doch kein übler Kerl. Und du, Maud, schaffst es noch die Beiden zu trennen, bloß weil du selbst Probleme mit Männern hast.«
»Was soll diese Unterstellung? Ich gebe nur das wieder, was ich aus dem Jenseits höre.«
»Sicher, Maud. Die Geister haben ja nichts Besseres zu tun, als sich mit einer alten Schachtel wie dir zu unterhalten.«
»Wenn du nicht daran glaubst, weshalb machst du dann mit?«
»Wer sagt denn, dass ich nicht daran glaube?«, zischte Annie. »Allerdings bezweifle ich, dass ausgerechnet du Stimmen hören kannst bei all dem Unsinn, den du von dir gibst.«
»Sei still, Annie! Bitte, sei still.« Das fast verzweifelte Flehen der Mutter fuhr Catherine durch und durch. »Lass Maud aussprechen. Ich habe das Gefühl, dass ich endlich einen Ausweg aus diesem ärmlichen Leben finde.«
»Hast du das gehört?«, wisperte Catherine und spürte Hitze in ihren Wangen. »Glaubst du mir jetzt, dass die Alten schuld sind an Mutters Veränderung? Allen voran Maud?«
Langsam hob Hannie die Lider. Ihre langen Wimpern waren hell. Punkte tanzten in ihrer Iris. Sie griff sich an den Hals. »Oder es sind tatsächlich böse Geister im Spiel.«