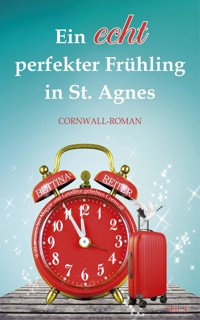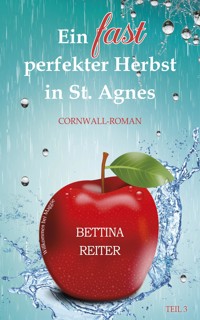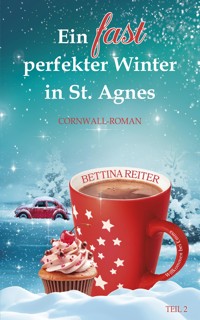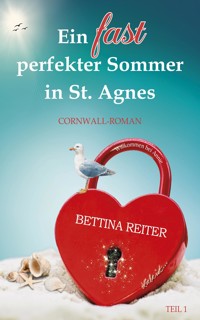Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Töchter von White Manor
- Sprache: Deutsch
Zwei Frauen, verbunden durch das Schicksal: Die Familiensaga »Die Töchter von White Manor – Sturmwellen« von Bettina Reiter als eBook bei dotbooks. Eine Familiensaga, die vom englischen Kent ins Venedig des Nordens führt … Mitte des 17. Jahrhunderts in Amsterdam: Mary-Ann wird von den Schatten ihrer Vergangenheit verfolgt – obwohl sie einen Ozean zwischen sich und dem dunklen Vermächtnis von White Manor wähnt, scheint ihr Glück so zerbrechlich wie Glas. Ihr Herz gehört John van Hoven, der bereit ist, alles für sie aufzugeben. Aber es ist eine Liebe wie die Stille vor dem Sturm, denn niemand weiß, ob Mary-Anns grausamer Ehemann noch am Leben ist. Nach Rache sinnt auch Johns ehemalige Verlobte Eleonore: Sie will Vergeltung für die erlittene Schmach und spinnt ein perfides Netz aus Lügen und Intrigen, in dem sich auch Mary-Anns einstige Zofe Victoria bald zu verlieren droht. Werden die beiden Frauen dem langen Schatten von White Manor jemals entkommen können? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der bewegende Schicksalsroman »Die Töchter von White Manor – Sturmwellen« von Bettina Reiter ist der zweite Band ihrer Upstairs-Downstairs-Saga, die Fans von »Downton Abbey« und »Poldark« begeistern wird. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 663
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Eine Familiensaga, die vom englischen Kent ins Venedig des Nordens führt … Mitte des 17. Jahrhunderts in Amsterdam: Mary-Ann wird von den Schatten ihrer Vergangenheit verfolgt – obwohl sie einen Ozean zwischen sich und dem dunklen Vermächtnis von White Manor wähnt, scheint ihr Glück so zerbrechlich wie Glas. Ihr Herz gehört John van Hoven, der bereit ist, alles für sie aufzugeben. Aber es ist eine Liebe wie die Stille vor dem Sturm, denn niemand weiß, ob Mary-Anns grausamer Ehemann noch am Leben ist. Nach Rache sinnt auch Johns ehemalige Verlobte Eleonore: Sie will Vergeltung für die erlittene Schmach und spinnt ein perfides Netz aus Lügen und Intrigen, in dem sich auch Mary-Anns einstige Zofe Victoria bald zu verlieren droht. Werden die beiden Frauen dem langen Schatten von White Manor jemals entkommen können?
Über die Autorin:
Bettina Reiter wurde 1972 geboren und arbeitet im sozialen Bereich. Neben dem Schreiben malt und fotografiert sie leidenschaftlich gerne. Sie ist Mutter von zwei Kindern und lebt mit ihrer Familie in Tirol.
Die Website der Autorin: www.bettina-reiter-autorin.com/
Bei dotbooks veröffentlichte Bettina Reiter ihre »White Manor«-Saga mit den Bänden »Schicksalsjahre« und »Sturmwellen«.
***
Überarbeitete eBook-Neuausgabe Januar 2022
Dieses Buch erschien bereits 2018 unter dem Titel »Erben der Sühne« im Selfpublishing, es wurde für die Neuausgabe überarbeitet.
Copyright © der Originalausgabe 2018 Bettina Reiter
Copyright © der überarbeiteten Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/faestock, Idea Studio, Vasya Kobelev, Ratana21
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-96655-589-0
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Liebe Leserin, lieber Leser, in diesem eBook begegnen Sie möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. Diese Fiktion spiegelt nicht unbedingt die Überzeugungen des Verlags wider.
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »White Manor 2« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Bettina Reiter
Die Töchter von White Manor – Sturmwellen
Roman
dotbooks.
Für meinen Papa
Danke für deinen letzten Rat,
für deinen Stolz und für deine Liebe
Kapitel 1
Amsterdam, Jänner 1651
Auf der Oberfläche der Herengracht spiegelten sich die feudalen Patrizierhäuser wider. Vereinzelt trieben Schneeflocken vom Himmel herab. Es war ein milder Winter, der durch viel Sonnenschein bestach. Auch jetzt brach die rotgoldene Abendsonne hinter der Wolkenfront hervor und zog wie ein warmer Strom über die Häuser und den Kanal herauf. Einige Boote glitten lautlos über das Wasser, teilten es in sanfte Wellen und verzerrten die Fassaden. Die Bootsmänner lachten oder riefen sich etwas zu. Manche steuerten die Gehwege an – die den Kanal begrenzten –, um Kisten auszuladen. Sie wurden von Frauen und Kindern erwartet, die aufgeregt nach ihren Männern und Vätern riefen. Umgehend eilten diese mit Bediensteten herbei, kontrollierten die Waren und gemeinsam hievte man die Güter mittels Flaschenzüge in die Häuser. Manchmal wurde laut gestritten, so wie jetzt. Ein reicher jüdischer Kaufmann deutete wütend auf einige Kisten. Er war als ziemlich streitlustig bekannt, aber das konnte Eleonore egal sein. Sie hatte ihre eigenen Probleme.
Seufzend wandte sie sich um und starrte auf ihr Hochzeitskleid, das seit Wochen über dem Stuhl lag. Als ihr dieser Traum aus Rohseide und zahllosen Perlen vom besten Schneider Amsterdams geliefert wurde, war sie ganz aufgeregt gewesen. Nur wenige Minuten später hatte sie es angezogen, war zum großen Wandspiegel geeilt und hatte sich übermütig hin und hergedreht. Mit dem Glücksgefühl in sich, dass ihr ausgerechnet ein Mann wie John van Hoven einen Heiratsantrag gemacht hatte. Umso schwerer war ihr der Abschied gefallen, bevor er nach England reiste.
Auf einmal brannten Tränen in ihren Augen.
Wie so oft in letzter Zeit kroch die Furcht in ihr hoch, dass dieses Glück nicht stärker war als filigranes Glas. Eine falsche Bewegung, und es würde in ihren Händen zerspringen. John war geistig oft abwesend gewesen, schien in Gedanken Kontinente entfernt. Manchmal hatte sie ihn gefragt, ob ihn etwas quälen würde, doch er hatte nur missmutig abgewunken. Selbst aus Olivia war nichts herauszubringen gewesen, obwohl sie eine gesprächige Frau war. Irgendwann hatte Eleonore damit aufgehört, nach Antworten zu suchen, weil diese Angst immer mehr Besitz von ihr ergriff. Viele schlaflose Nächte und nachdenkliche Tage lagen hinter ihr, in denen sie sich eine Frage gestellt hatte: Gab es eine andere Frau in Johns Leben?
Ein schrecklicher Gedanke, der wie ein gefräßiges Tier an ihr nagte und sie regelrecht mit Hass erfüllte. Deswegen versuchte sie sich selbst zu schützen, indem sie andere Erklärungen für Johns Wesensänderung in Betracht zog. Womöglich war er besorgt um sein Familienimperium? Nicht selten griff ein Mann deswegen zur Flasche und betrank sich sinnlos. Besonders kurz vor seiner Abreise war er selten einen Tag nüchtern gewesen. An ihren Abschied würde er sich vielleicht nicht einmal erinnern.
Am Schreierstoren hatte Eleonore vor ihm gestanden und gehofft, er würde sie in die Arme nehmen und zum Abschied küssen. So, wie er sie noch nie geküsst hatte. Sein Wanken hatte jedoch befürchten lassen, dass er eher ins Wasser fallen würde. Dass er litt – unsagbar litt –, hatte ihr Herz trotz allem noch mehr für ihn brennen lassen. Gleichzeitig hatte es sich angefühlt, als würde sich ein Eisenring darum spannen, der sich mit jedem Atemzug enger zog. Weil ihr in diesem Augenblick klargeworden war, dass alles mit England zu tun hatte. Alles!
Etwas, das sie zwar in der nächsten Sekunde weit von sich gewiesen hatte, doch diese unsichtbare Frau drängte sich mit jedem Tag mehr und mehr auf. Aber wer liebte, verzieh vieles. Wer aus tiefstem Herzen liebte, verdrängte alles. Und wer so liebte, dass er sein eigenes Leben für den Anderen opfern würde, war zu allem bereit.
Erneut trat Eleonore ans Fenster und blickte zur Goldenen Bucht hinauf. Dort befand sich Johns Stadthaus, das Huis aan de Bocht. Verwaist und leer, keine Lichter, verlassen. Genauso fühlte sie sich: Verlassen. Dabei hatte sie alles, was man sich nur wünschen konnte. Ihr Vater war Ratspensionär von Holland und zählte zu den einflussreichsten Persönlichkeiten des Landes. Viele Besitztümer gehörten ihnen. Diesen Stadtpalast nahe der Goldenen Bucht liebte sie besonders. Ihr Vater hatte ein großzügiges Appartement für sie eingerichtet. Sie mochte die Höhe, liebte die Weite und genoss die Stille, die hier vorherrschte. So wie in ihrer Schlafkammer, die auch John manchmal aufgesucht hatte. Leider nur für einen Kuss lang. Er war zu sehr Gentleman gewesen, um die Situation auszunutzen. Selbst wenn er getrunken hatte.
Plötzlich öffnete sich die Tür hinter ihr.
Eleonore wandte sich nicht um, weil sie wusste, dass es ihr Vater war. Es musste drei Uhr sein. Er kam jeden Tag zur selben Stunde, um nach dem Rechten zu sehen. »Mir geht es gut, Vater. Du musst dir keine Sorgen machen«, sagte Eleonore in die Stille hinein. Nur sein schnelles Atmen war zu hören und das Schließen der Tür. »Warum hetzt du immer so herauf? Das tut dir nicht gut.« Lächelnd, obwohl ihr nicht danach zumute war, drehte sie sich um. »Du weißt ja, Eile mit Weile. Das predigst du uns schließlich auch ständig vor.«
»Was mich umsichtig handeln lässt.« Er nahm den Dreispitz vom Kopf und legte ihn auf den achteckigen Kirschholztisch. »Eile ist ein schlechter Ratgeber. Manchmal muss man stehenbleiben und einen anderen Weg einschlagen.«
Eleonore musterte sein schmales längliches Gesicht und trat zögernd auf ihn zu. »Du bist blass, Papa. Ist etwas geschehen?«
»Wie man es nimmt.« Ihr Vater räusperte sich. Er war ein hochgewachsener imposanter Mann, der unerbittlich für seine Ziele eintrat. Selten konnte ihn etwas aus der Ruhe bringen und er legte großen Wert auf ein akkurates Erscheinungsbild. Nun war das schwarze schulterlange Haar jedoch heillos zerzaust, der Ausgehmantel nachlässig zugeknöpft. Den braunen Augen fehlte der übliche Glanz und er knetete seine Hände, was Eleonores Unruhe verstärkte.
»Ist etwas mit Agneta?« Ihre Zwillingsschwester wohnte zwei Häuser weiter. Vor kurzem war sie Witwe geworden und trauerte um ihren Mann.
»Nichts dergleichen.« Sein nervöses Spiel hörte auf. Gleichzeitig zog er einen Stuhl heran und deutete darauf. »Du solltest dich setzen, Kind.«
Ihr Herz begann zu rasen. »So schlimm?« Geht es um John, wollte sie fragen. Nein, sie wollte es aus sich herausschreien. Aber sie brachte nur ein Krächzen zustande. Tausend Gedanken wirbelten durch ihren Kopf, als sie ermattet auf den Stuhl sank. Darauf gefasst, dass die nächste Sekunde ihre dunkelste Stunde einläuten würde.
Die Hände des Vaters legten sich sanft auf ihre Schultern. »John van Hoven ist zurück.« Er klang, als würde er ihr die Nachricht seines Todes überbringen, doch das ignorierte Eleonore und wandte abrupt ihren Kopf. Dabei lachte und weinte sie gleichzeitig und spürte, dass sie sich nicht mehr im Griff hatte.
»Was für eine wunderbare Neuigkeit!«, stieß sie schließlich aus und bemerkte das Mitleid in seinen Augen. Mitleid! Als seine Hände von ihren Schultern glitten, schmerzte die Geste, als würde jemand mit Dornen über ihre Haut fahren. Die Gestalt des Vaters verschwand hinter einem Tränenschleier. Sofern John tatsächlich in Holland eingetroffen war, weshalb kam er nicht sofort zu ihr? »Hat dir jemand von Johns Rückkehr erzählt oder hast du ihn gesehen?«
»Letzteres. Ich war zufällig am Hafen.«
»Aber das Stadthaus ist verwaist.« Entgegen jeglicher Vernunft hielt sie an diesem Einwand fest. Er musste John mit jemanden verwechselt haben!
»War es das nicht immer? Er wird wieder bei seiner Mutter wohnen«, zerstreute der Vater ihre Aussage. Kein Zweifel schwang in seiner Stimme mit.
»Hat … er dich gebeten, mir etwas auszurichten?« Sie griff sich an den Hals, als ihr Vater bedächtig den Kopf schüttelte. »Wann sucht er mich auf? Oder soll ich zu ihm kommen? Nun sag schon, Vater, er hat bestimmt nach mir gefragt.«
»Nichts dergleichen hat dieser Mistkerl getan!« Er schlug mit der Faust auf den Tisch. Eleonore zuckte zusammen und schaute erstarrt dabei zu, wie die leere kobaltblaue Blumenvase aus japanischem Porzellan wackelte, bevor sie umfiel und in zwei Hälften zerbrach. »Dieser Hurensohn!«, regte sich der Vater weiter auf und durchmaß den Raum mit großen Schritten, bis er am Fenster einhielt und sich zu ihr umdrehte. »Ich habe kein Wort mit ihm gewechselt. John van Hoven war nämlich zu sehr damit beschäftigt, eine blonde Frau zu küssen. Angeblich haben die beiden sogar während der Überfahrt geheiratet.«
»Was … sagst du da?« Eleonore schluchzte auf. So musste es sich anfühlen, wenn man um sein Leben bangte. Um alles bisher Dagewesene. Um alles, wofür man jeglichen Stolz geopfert, tausend Tränen vergossen und sich wie ein Ertrinkender festgehalten hatte. »Das ist bestimmt ein Irrtum! John wollte seine Angelegenheiten regeln und England für immer verlassen. Von einer Frau war nie die Rede.« Und doch war sie die ganze Zeit über dagewesen!
»Schon lange sind mir Gerüchte bekannt, die sich um eine ominöse Engländerin drehen«, erwiderte der Vater und lockerte seine weiße Halsbinde, als würde auch ihm das Atmen schwerfallen. »Bei den vielen Saufgelagen blieb es nicht aus, dass sich John selbst bemitleidete und andere daran teilhaben ließ. Bis heute habe ich die Sache allerdings ignoriert.«
»Du hättest mit mir darüber reden müssen!« Unverhohlener Hass erfasste sie. Hass auf John, Hass auf die eigene Dummheit, vor allem Hass auf die Andere. Selbst die Gegenwart ihres Vaters war kaum zu ertragen, weil er mit wenigen Worten ihr ganzes Leben zerstört hatte.
»Du ahnst nicht, wie oft ich kurz davor gewesen bin. Doch seit eurer Begegnung hast du glücklich gewirkt«, bekannte er leise. »So glücklich, wie ich es nach dem Tod deiner Mutter lange Zeit nicht an dir erlebt habe. Egal, wie sehr ich mich bemühte, du hast nach etwas gesucht, das du scheinbar bei John gefunden hast.«
»So ist es auch«, bekannte Eleonore schluchzend. »Nach Mutters Tod fehlte mir der Halt und er … warum hat er sich mit mir verlobt? Er wusste, wie verlassen ich mich gefühlt habe und wie hart es mich treffen würde, das erneut durchzumachen.« Bitterkeit lag wie ein schaler Geschmack auf ihrer Zunge.
»Dieser Bursche hat dich nicht verdient. Schon gar nicht deine Liebe, weil er sie nicht auf dieselbe Weise erwidert. Wenn du diesen Verräter am Hafen gesehen hättest …«
»Hör auf«, herrschte sie ihn an, sprang hoch und riss das Hochzeitskleid vom Stuhl. »Oh, Duivel! Ich will es mir nicht vorstellen müssen, nichts davon hören!« Mit einem Aufschrei warf sie das Kleid auf den Boden und trampelte darauf herum. »Und nun geh, Vater. Ich will alleine sein.« Sie zitterte am ganzen Körper. Der Raum drehte sich. Plötzlich spürte sie seine Hände, die sich um ihre Arme spannten. Beinahe hysterisch versuchte sie sich aus der Umklammerung zu befreien, bis ihre Kraft erlahmte. Schluchzend sank Eleonore an seine Brust.
»Du wirst darüber hinwegkommen, Kind.«
»Niemals! Mit dieser Schande … diesem Verrat … am liebsten würde ich mich umbringen.«
Der Vater löste sich von ihr und schaute ihr prüfend ins Gesicht. »Deine Schwester hat ebenfalls einen Verlust zu beklagen. Wenn sie es schafft, ihn zu überwinden, wirst du es erst recht können.«
»Agneta ist Agneta, und ich bin ich.« Sie blickte an ihm vorbei, geradewegs zur gegenüberliegenden Fassade. Auf einmal war sie von Ruhe erfüllt, gleichzeitig gärte ein Plan in ihr. »Meine Schwester leidet im Stillen, ich werde leiden lassen. John soll alles verlieren, mitsamt dieser Frau. Ehe das nicht geschehen ist, werde ich nicht zur Ruhe kommen.«
»Das ist nicht dein Ernst.«
»Und ob.«
»Selbst wenn deine Gründe nachvollziehbar sind, Rache kann keine Wunden heilen.«
»Aber sie macht sie erträglicher.« Eleonore trat einen Schritt zurück. Ihr Schuh blieb am Stoff hängen. Wütend bückte sie sich und riss den Stoff ein, um sich daraus zu lösen. Von allem würde sie sich lösen. Irgendwann, in naher Zukunft. »Du hast John nie zur Gänze akzeptiert und ich kann nicht alleine gegen ihn kämpfen. Aber ich bin deine Tochter, Holland ist dein Staat. In zweifacher Hinsicht wärst du einen Feind los.« Sie richtete sich auf. »John war stets ein Gegner deiner Politik.«
»Natürlich ist er mir ein Dorn im Auge«, pflichtete er ihr bei. »Bisher dachte ich allerdings, dass er vernünftig werden würde, sobald ich sein Schwiegervater bin. Nun hat sich die Lage zwar geändert, doch ich habe mich nie aus gekränkter Eitelkeit gerächt. John mag mit meinen Erzfeinden sympathisieren, aber Eile mit Weile. Alles zu seiner Zeit.«
»Alles zu seiner Zeit«, äffte sie ihn nach. »Deine Tochter wurde zutiefst gedemütigt.« Ihre Stimme war mit jedem Wort lauter geworden. »Das demütigt auch dich! Wie kannst du die Sache deswegen auf sich beruhen lassen? Du bist nicht irgendwer und immerhin hat er mir mit der Verlobung ein Versprechen gegeben.«
»Soll er es einlösen? Ist es das, was du willst? Eine erzwungene Hochzeit?«, zischte er. »Bist du dann glücklicher? Nein, Eleonore, das mögen andere Väter einfordern, ich werde mich jedoch davor hüten. John hat uns bereits lächerlich genug gemacht. Wir schlagen ihn am besten, wenn wir hocherhobenen Hauptes vom Platz gehen. Doch die Zeit der Abrechnung wird kommen, verlass’ dich darauf. Im Augenblick nehmen mich allerdings andere Dinge in Beschlag.«
»Was ist wichtiger als ich?«
»Du wirst ungerecht. Wie oft habe ich dir verziehen? Wie vieles ließ ich dir durchgehen? Deine Eskapaden waren nicht immer einfach. Vielleicht habe ich deswegen geschwiegen, weil ich unendlich froh war, dass du dich durch Johns Hilfe gefangen hast. In diesem Punkt bin ich ihm sogar dankbar. Gleichzeitig bete ich inständig, dass du nicht wieder in alte Muster zurückfällst, was zweifelsohne geschehen würde, wenn du neuerlich Hass in dein Leben lässt.«
»Wie könnte man nicht hassen, wenn einem alles genommen wird?«, schleuderte sie ihm tränenblind entgegen. »Heute wie früher. John war alles für mich, wie Mutter.«
»Ich litt ebenfalls unter ihrem Verlust. Genau wie Agneta.« Darauf wusste sie nichts zu sagen. Weil es nichts zu sagen gab. Weil es ihr im Grunde egal war. »Wir finden einen anderen Mann für dich«, fuhr er gefasster fort. »Einen, der zu seinem Wort steht und wenn es dir hilft, werde ich in nächster Zukunft keine Ehe arrangieren. Allerdings solltest du die Zeit nutzen und dir einen adäquaten Kandidaten suchen. Natürlich standesgemäß und wenn es das Schicksal will, wird dich dieser Mann glücklich machen. Solltest du zu lange warten, werde ich die Sache selbst in die Hand nehmen. Und jetzt muss ich fort. Immerhin habe ich ein Land zu führen.« Seiner Aussage folgte ein hastiger Kuss auf die Stirn, bevor er seinen Dreispitz nahm und hinauseilte.
»Zur Not auch ohne deine Hilfe, Vater«, flüsterte Eleonore. »Darum schwöre ich hier und jetzt, dass in Johns Leben kein Stein auf dem anderen bleiben wird.« Sie lachte trocken auf. »Diese Frau wird sich wünschen, dir nie begegnet zu sein, John. Und du, dass du mir nie begegnet wärst.«
***
»Du liebe Zeit, dieses Haus gehört tatsächlich dir?« Mary-Ann drehte sich langsam ein paar Mal um die eigene Achse und ließ alles auf sich wirken. Von draußen hatte Johns Stadthaus eng ausgesehen, wenngleich mit einer imposanten Höhe. Im Inneren war es jedoch viel geräumiger als vermutet.
»Gefällt es dir?« John blickte sich um, als wäre es nichts Besonderes, obwohl ihn der Stolz in den Augen verriet. Ebenso wie sein Lächeln.
»Ob es mir gefällt?« Mary-Ann gab ihm einen stürmischen Kuss. Einige Tage hatten sie bei Olivia verbracht und sich von der anstrengenden Reise erholt. Eigentlich war sie davon ausgegangen, dass Hope und sie längere Zeit in Johns Elternhaus wohnen würden. Heute Morgen hatte er aber von anderen Plänen erzählt und davon, dass er ein bescheidenes Häuschen an der Goldenen Bucht besitzen würde, in dem er manchmal übernachtet habe und das von nun an ihr gemeinsames Zuhause werden sollte. »Es ist ein Traum.«
Übermütig wie ein kleines Mädchen inspizierte sie alles. Links neben dem Eingang befand sich ein leerer Raum, in dem sich John ein Arbeitszimmer einrichten wollte. Durch die halbgeschlossenen Balken fiel ein heller Lichtstrahl, der den Raum wie ein silbernes Band teilte. Neben seinem künftigen Arbeitszimmer gab es eine riesige Bibliothek. Das dunkle Holz ließ den Raum fast einschüchternd wirken, wie der immense Bücherbestand. Der Vorbesitzer hatte ihn John zur Gänze überlassen. Es würde vermutlich bis ans Ende ihrer Tage dauern, all die Bücher zu lesen.
Weiter hinten erstreckte sich ein großzügiges Esszimmer mit einem großen Kamin, vor dem behagliche braune Armsessel standen. Dann gab es noch einen kleinen Raum, den Mary-Ann in Gedanken bereits zum Salon einrichtete. Dunkelholzmöbel, eine rote Stoffbespannung der Chaiselongue und der Stühle, etwas Dekor und aus dem Raum würde ein Schmuckkästchen werden.
»Was verbirgt sich dahinter?« Sie öffnete die rechte Tür neben der Eingangspforte und fühlte sich, als würde sie Geschenke auspacken.
»Die Gesindeküche. Ich setze nachher ein Gesuch auf, damit wir so schnell wie möglich Personal haben«, informierte John sie. »An der Gartenseite werde ich einen Zubau veranlassen, um unsere Angestellten unterzubringen. Oder stört es dich, sie nahe beim Haus zu haben?«
»Nicht im Geringsten.« Mary-Anns Schritte hallten durch das Foyer, als ihr Blick auf die Treppe fiel. Augenblicklich sträubten sich ihre Nackenhaare, weil sie an White Manor denken musste. Daran, was James ihr beinahe angetan hätte. Aber im nächsten Augenblick schüttelte sie die hässlichen Erinnerungen ab. Sie war in ihrem künftigen Heim und in einem neuen Land. Viel zu lange hatte sie James über sich bestimmen lassen. Es war an der Zeit, das Leben mit ihm zu vergessen, ansonsten läge immer ein Schatten auf ihrem Glück. Das durfte sie keinesfalls zulassen. »Ist es in Holland üblich, keine Vorhänge zu haben?« Mary-Ann deutete auf die großen Rundbogenfenster im Esszimmer.
»Andere Länder, andere Sitten«, meinte John fröhlich, nahm ihre Hand und zog sie zu den Verandatüren. »Mein Garten ist ziemlich verwildert, aber du wirst sicherlich ein Paradies daraus zaubern.« Mit Schwung öffnete er die Türen und sie betraten die weitläufige Terrasse. John hatte nicht zu viel versprochen. Vertrocknetes Gestrüpp wohin das Auge reichte. Der Himmel spiegelte sich in den Lachen wider, die der wenige Schnee hinterlassen hatte. Überall lagen ausrangierte Möbelstücke, Zaunpfähle oder Zweige herum. Es roch nach feuchter Erde. Hohe Ulmen umsäumten das Grundstück und das Plätschern von Wasser war zu hören.
»Da wartet jede Menge Arbeit auf uns«, stellte sie schmunzelnd fest.
»Auf uns?« John schüttelte den Kopf. »Ich muss mich leider um die Geschäfte kümmern.« Sie lachten, während Mary-Anns Blick zu einer alten Wintereiche abschweifte.
»Die Eiche am Hügel«, hauchte sie. Ein Stück Heimat lag vor ihr, diesmal voller wunderbarer Erinnerungen. Nichts, das sie hätte verdrängen wollen. So sehr England mit Schlechtem behaftet war, unter den Schmähungen und Verletzungen fühlte Mary-Ann dennoch eine tiefe Verbundenheit. In England war sie geboren worden und aufgewachsen, hatte ihre verstorbenen Eltern zurückgelassen, Mellys und Elisabeths Grab. Auch William und den Andredsweal, die Kreidefelsen, die weiten Felder und tiefgrünen Täler.
Ohne Zweifel war Holland anders als England, doch sie würde lernen, das Land zu lieben.
»Bist du glücklich?« John legte seine Arme um ihre Taille.
Mit dem Rücken lehnte sie sich an ihn, roch seinen maskulinen Duft nach Leder und Moschus. Nie zuvor hatte sie sich so geborgen gefühlt und dankte dem Schicksal im Stillen, dass John ihren Weg gekreuzt hatte. »Manchmal habe ich Angst, dass es nur ein Traum ist und ich in der nächsten Sekunde neben James aufwache«, gestand sie und blickte zu den Ulmen, die sich mit dem Wind bewegten.
Zärtlich schob John ihr Haar beiseite und küsste ihren Nacken. Wohlige Schauer rieselten über ihren Rücken. »Es ist kein Traum, sondern Wirklichkeit.« Seine Stimme klang heiser. »Wir haben uns endlich gefunden. Nie wieder werde ich dich loslassen.« John zog sie enger an sich. Das azurblaue Taftkleid knisterte wie die Luft zwischen ihnen. Die Gewissheit ihn lieben zu dürfen, egal wann und wo, ließ Mary-Ann erbeben. »Ich begehre dich wie nie eine Frau zuvor. Übrigens ein Grund mehr, mein Elternhaus zu verlassen.« Sein melodiöses Lachen wurde vom Wind mit sich getragen. »Mutters Ohren kleben an jeder Tür und außerdem sind die Wände ziemlich dünn«, raunte er, »worüber ich mir schon in England Gedanken gemacht habe. Doch hier sind wir ungestört.« Sanft drehte er Mary-Ann zu sich herum, hob sie lächelnd hoch und trug sie ins Haus.
Mit dem Fuß warf er wenige Sekunden später die Tür seines künftigen Arbeitszimmers ins Schloss, stellte sie vorsichtig auf die Füße und zog am Bändchen ihres Kleides nahe dem Ausschnitt. Dabei erkundeten seine Lippen sanft ihren Mund, bevor er über ihren Hals glitt und eine brennende Glut hinterließ. Stöhnend bog Mary-Ann ihren Kopf zurück und schloss die Augen, als er ihr Kleid über die Schultern schob und seine Hände ihre Brüste umfingen. Spielerisch und gleichzeitig fordernd nahmen sein Mund und seine Hände Besitz von ihr, bevor sie sich zügellos küssten und hektisch entkleideten.
Erregt sanken sie auf den Boden. Plötzlich fühlte sich Mary-Ann, als wären sie wieder mitten im Wald. Mit jeder Faser ihres Herzens spürte sie John, glaubte den prasselnden Regen auf ihrer erhitzten Haut zu fühlen. Wie eine tosende Welle rollte die Lust durch ihren Körper. Als John in sie eindrang, schrie sie auf und hatte das Gefühl, in der moosbedeckten Erde zu versinken und gleichzeitig Richtung Himmel zu schweben.
Sie drängte sich an ihn, um ihn tiefer in sich aufzunehmen. Bewegte sich schneller, kostete vom Salz auf seiner Haut, hörte sein Keuchen und küsste ihn voller Leidenschaft. Nahe dem Höhepunkt wurden sie immer hektischer, und sie forderte seine ganze Männlichkeit ein. John stöhnte wie unter süßer Folter, als sie gleichzeitig den Gipfel der Lust erreichten.
Erschöpft genoss sie Johns zärtliche Küsse auf ihrem Hals, während sich ihr Herzschlag allmählich beruhigte. Nach wie vor waren sie eins. Mary-Ann fühlte seine Wärme in sich und genoss diesen Augenblick, denn in seinen Armen schritt die Stunde nicht vorwärts. Vielmehr verschmolz die Wirklichkeit mit einer anderen Welt. Und als er sich über sie beugte, schaute sie voller Liebe zu ihm auf. Seine seegrünen Augen glänzten, sie sah sich selbst darin. Zärtlich fuhr sie durch sein schwarzes Haar und berührte die Narbe in seinem markanten Gesicht … um in der nächsten Sekunde zu erstarren. John schaute sie verwundert an. Mary-Ann deutete zum Fenster. Zu sprechen hätte sie nicht vermocht.
Die Balken waren geöffnet!
Er löste sich von ihr und wandte sich um. Hastig griff sie nach ihrem Kleid und hielt es sich zitternd vor den Körper. »Jemand muss uns beobachtet haben«, flüsterte sie und horchte angestrengt in die Stille hinein.
John erhob sich, schlüpfte hastig in die Leibhose und trat ans Fenster. »Das war sicher nur der Wind«, erklärte er wie beiläufig, dennoch hörte sie Anspannung heraus. »In Holland weht er jeden Tag. Mal stärker, mal schwächer. Kein Grund zur Sorge.«
»Auch wenn es nur der Wind war, hätte man uns sehen können.« Das ungute Gefühl verstärkte sich. In Amsterdam Fuß zu fassen würde ohnehin nicht einfach werden. Immerhin lebte Eleonore hier und zweifelsohne hatten viele Mitleid mit Johns ehemaliger Verlobten.
»Du machst dir zu viele Gedanken.« John bückte sich nach seinem Hemd. Im selben Augenblick wurde Mary-Ann auf zwei Handabdrücke am Glas aufmerksam und fror plötzlich. »Davon abgesehen sind die Fenster beinahe blind vor Schmutz und Unrat«, fuhr er fort. »Der Raum ist somit kaum einsehbar.« Er lächelte. Ein gezwungenes Lächeln. Mary-Ann ahnte, dass er die Handabdrücke ebenso gesehen hatte, die sich anfühlten, als wären sie regelrecht in die Scheibe gebrannt.
Mit voller Wucht kam die Angst zurück. Die Angst, dass jemand nach ihrem Glück greifen wollte, um es ihr gewaltsam zu entreißen …
***
England
James saß vor dem Fenster und starrte missmutig in die Winterlandschaft hinaus. Seit Tagen schneite es fast ohne Unterlass und tat es das nicht, regnete es. Eine Stimmung, die zu seiner eigenen passte. Er verabscheute die Tatenlosigkeit, zu der er gezwungen war. Andererseits hatte er keine Ahnung, womit er sich beschäftigen sollte. Alles lag in Trümmern. Nicht nur sein Hab und Gut, auch sein Leben.
»Statt Löcher in die Luft zu starren, könntest du mir helfen.«
James wandte sich Pym zu, der hinter seinem kitschigen Schreibtisch saß. Emsig jagte die Schreibfeder über das Papier. Seine Zungenspitze schob sich zwischen die Lippen, die Stirn lag in Falten.
»Wobei?«, hakte James lustlos nach.
»Es haben sich einige lukrative Geschäfte ergeben und nun stehe ich vor der Entscheidung, ob ich mitmischen soll oder nicht.«
»Benötigst du meinen Sachverstand, um dein Imperium zu vergrößern?« James lachte trocken auf. »Vergiss es. Du kennst mich lange genug. Ich gönne niemandem mehr als mir selbst.«
»Stimmt.« Pym blickte hoch und legte die Feder beiseite. Die Stirnfalten vertieften sich. »Manchmal frage ich mich, warum ich dich vor dem sicheren Tod gerettet habe.«
»Womit du nicht der Einzige bist.« Als James angeschossen im Foyer White Manors gelegen hatte, war Pym plötzlich aufgetaucht. Er hatte ihn nur verschwommen wahrgenommen und war irgendwann in dessen Haus aufgewacht. »Wir sind nicht gerade als Freunde auseinandergegangen. Weshalb hast du mir geholfen?« Nicht zum ersten Mal stellte James diese Frage, worauf er bisher nur lapidare Antworten erhalten hatte.
»Vielleicht aus sentimentalen Gründen.« Pym lehnte sich zurück und verschränkte die Arme vor der Brust. Obwohl es bald Mittag war, trug er einen dunkelblauen Seidenmorgenrock.
»Das hatten wir schon«, wurde James unwirsch. »Du und sentimental. Dass ich nicht lache.«
»Sind meine Gründe nicht egal? Du lebst, das ist die Hauptsache. Nebenbei hast du die Möglichkeit, dein Leben neu zu sortieren und einiges zu überdenken. Eine solche Chance erhält nicht jeder.«
»Du hast nie etwas aus Nächstenliebe getan. Worauf hast du es abgesehen? Auf White Manor? Die Werften?«
»Sie gehören dir nicht mehr, falls du es vergessen haben solltest.«
In James gesellte sich Hass zur Wut, die ohnehin jeden Tag gegenwärtig war. Offiziell galt er als verschollen, weshalb ihm die Werften zwangsenteignet wurden. Mary-Ann hatte den Teufel getan, etwas dagegen zu unternehmen. Lieber setzte sie sich nach Holland ab. Dafür würde sie büßen! »Du hättest dich für die Werften starkmachen können«, wandte James zornig ein. »Immerhin bist du inzwischen ein hohes Tier im Parlament und Cromwells engster Berater.«
Obwohl ihm Pym ein Dach über dem Kopf gab und den Arzt für Behandlung und Stillschweigen bezahlte, nahm sich James ungern ein Blatt vor den Mund. Eher wäre die Hölle zugefroren, als dass er zu Kreuze kriechen würde. In der Ahnung, dass Pym mit Sicherheit einen Plan verfolgte. Einen, für den er ihn lebendig brauchte. Vorerst.
»Mit welchem Recht hätte ich das tun sollen? Mary-Ann ist die Eigentümerin und würde sofort misstrauisch werden. Von William ganz zu schweigen, den ich erneut am Hals hätte. Es ist ohnehin ein Spießrutenlauf, ihn ständig auf falsche Fährten zu locken.«
»Lass ihn herkommen und ich knall ihn ab.«
»Hast du aus dem Desaster mit Sophie wirklich nichts gelernt?« Pym lächelte nachsichtig. »Du solltest dich zügeln, statt auf deine Feinde los zu preschen wie ein Rachegott.«
Abrupt erhob sich James und ging einige Schritte hin und her. Dabei schob er die Hemdsärmel hoch, ballte die Hände und hätte nicht Übel Lust gehabt, auf irgendetwas einzuschlagen. Blindlings, mit voller Kraft. »Nichts ist im Augenblick wichtiger als Rache. Aber vor allem will ich meinen Sohn zurück!« Mit beiden Händen stützte er sich am Schreibtisch ab und blickte Pym zwingend in die Augen. »Dem ungeachtet wiederhole ich mich nur ungern: Warum hast du mir das Leben gerettet?«
Pym beugte sich vor und griff zu den Schwefelhölzern neben den Papieren. In aller Seelenruhe zündete er die Kerze an, die sich nahe von James’ Arm befand. Als die Flamme flackerte, löste sich schwarzer Rauch, der kräuselnd in die Höhe zog. Aus der Wärme wurde binnen Sekunden ein stechender Schmerz. Es roch nach verbrannten Haaren. Dennoch bewegte sich James keinen Millimeter.
»Um ehrlich zu sein, wundert es mich selbst. Scheinbar war ich zur rechten Zeit am rechten Ort und hatte einen meiner guten Tage.« Das verrußte Schwefelholz landete auf dem Papier, bevor Pym ihn wieder in Augenschein nahm. »Mir verdankst du eine zweite Chance. Nutze sie oder lass es. Du entscheidest, ob du weiterhin im Schatten bleiben willst«, er deutete auf die Kerze, »oder Helligkeit in dein Leben lässt.«
»Seit wann bist du unter die Prediger gegangen?« Ein Schmerzlaut entfuhr James, bevor er sich aufrichtete und die brennende Stelle am Unterarm rieb. »Gut oder böse? Ist es das, was du mir sagen möchtest?«
»Man steht nur auf der einen oder auf der anderen Seite. Einen Mittelweg gibt es nicht.«
»Du liebe Zeit, woher hast du diesen Schwachsinn?«
»Bernadettes Gegenwart tut mir gut.« Pyms Cousine und ihre Eltern waren zurzeit auf Besuch. Die junge Frau hatte ohne Zweifel etwas an sich, das die wenigsten Männer kaltließ. Mit Ausnahme von James. Ihre ständige Fürsorge und Gutmütigkeit ließen seinen Magen jeden Tag aufs Neue rebellieren.
»Natürlich. Darauf hätte ich selbst kommen können.« James setzte sich wieder in seinen Sessel. »Bernadettes Hang, jeden bekehren zu wollen, widert mich an. Bei mir beißt sich die Gute jedenfalls ihre schönen Zähne aus.«
»Würdest du ihr zuhören, ginge es dir wie mir. Man überdenkt einiges.«
»Aus keinem von uns beiden wird jemals ein guter Mensch«, folgerte James.
»Ich möchte mich ungern mit dir vergleichen.«
»Weil du so viel besser bist als ich?«
»In der Tat. Ich mag potentielle Feinde auf meine Weise aus dem Feld räumen, aber in meiner Familie hat der Tod keinen Platz. Ein Gespräch, das wir übrigens schon einmal geführt haben, sofern du dich erinnerst.«
»Dunkel. In der Regel streiche ich nichtssagende Unterhaltungen aus meinem Gedächtnis.« James dachte an seine Eltern. An Elisabeth und Melly. »Der Zweck heiligt die Mittel und deine fadenscheinigen Prinzipien erheben dich lange nicht über mich. Wir sind beide Mörder. Mit dem Unterschied, dass du andere Familien zerstört hast. Wenn dich das besser macht, dann träum ruhig weiter.«
»Lieber bin ich ein Träumer, als dass ich mich wie ein wildgewordener Stier auf jedes rote Tuch stürze, das sich mir in den Weg stellt.«
James verengte die Augen. »Noch habe ich nicht mit meiner Rache begonnen.«
»Kein Wunder. Holland ist weit entfernt, womit dir vorerst die Hände gebunden sind. Gleichzeitig musst du dich verstecken, weil du ein Blutbad auf White Manor angerichtet hast. Bis ich das geregelt habe, werden Monate vergehen.« Warum dieser Aufwand? Nicht nur, dass ihm Pym Unterschlupf gewährte, er versuchte sogar ihn reinzuwaschen und schickte William kreuz und quer durch das Land.
Eine Ungewissheit, die James verabscheute! Er hatte schon immer lieber gewusst, mit wem oder womit er es zu tun hatte. Aber Pym war derzeit ein Buch mit sieben Siegeln. Jedoch eines, das auch er im Moment noch brauchte. Wo hätte er sonst hinsollen?
»Ich nehme an, dass du gedanklich bereits mit einem Fuß in Holland bist und dir einen Plan zurechtgelegt hast«, unterstellte Pym ihm.
»Einen Plan ist Mary-Ann keineswegs wert«, fuhr James auf. »Wie konnte sie sich auf diesen Van Hoven einlassen? Als verheiratete Frau. Als eine White!« In Gedanken sah er sie vor sich liegen. Mit durchgeschnittener Kehle, blutüberströmt. Ein Gefühl der Genugtuung ergriff ihn. »Victoria wird dasselbe Schicksal ereilen. Ungestraft nimmt mir niemand meinen Sohn weg.«
»Was ist mit William? Den Van Hoven Brüdern? Alle zu ermorden übersteigt selbst deine Fähigkeiten. Du wirst im Gefängnis landen. Willst du das? In dem Fall hätte ich dich tatsächlich liegenlassen sollen und muss mir ernsthaft überlegen, ob ich mein Intervenieren einstelle. Wozu deine Weste reinwaschen, wenn du dich ohnehin erneut in eine ähnliche Situation begeben willst?«
»Und wieder wundere ich mich darüber, wie sehr dir mein Wohl am Herzen liegt.«
»Alles hat seine Grenzen, James. Ich habe dich gerettet, womit meine gute Tat erschöpft ist. Leider liegt mir Bernadette deinetwegen ständig in den Ohren, wenn du es genau wissen willst.« Pyms Gesicht verdunkelte sich. »Obwohl ich sie laufend vor dir warne, glaubt sie wie üblich an das Gute im Menschen. Sogar was dich betrifft. Deswegen hat sie mich förmlich angebettelt, mich für dich zu verwenden. Einer der Gründe, wieso ich dir William und Konsorten vom Hals halte. Jetzt weißt du also, dass ich es bestimmt nicht für dich mache.«
»Sieh an, die Kleine scheint dir tatsächlich etwas zu bedeuten.« James schüttelte innerlich den Kopf. Für wie dumm hielt ihn Pym? Mochte dieser seine Cousine verehren, den Ausschlag für dessen Hilfe gab bestimmt nicht sie – dass sagte ihm sein Gefühl.
»Bernadette gehört zu meiner Familie. Natürlich bedeutet sie mir etwas.«
»Schön, womit das geklärt wäre. Bei mir ist das Gegenteil der Fall. Diese Frau regt mich auf wie sie mich langweilt.« James blickte aus dem Fenster. »Mir fällt langsam die Decke auf den Kopf.«
»Was du sofort ändern könntest. Hilf mir bei meinen Geschäften und irgendwann helfe ich dir beim Wiederaufbau von White Manor.«
»Das interessiert mich momentan zuletzt.«
»Dann verkauf mir deinen Besitz.« Pym klang auf einmal, als hätte er diesem Satz regelrecht entgegengefiebert.
»Niemals!«, ließ James in barschem Ton verlauten, während es in ihm arbeitete. Ging es Pym in Wahrheit um White Manor? Aber wieso? Das Land war nicht besser oder schlechter als andere Gebiete und sein Anwesen lag ohnehin in Schutt und Asche. Pym hätte sich hundert Herrenhäuser und viel mehr Land kaufen können. »White Manor wird im Besitz eines Whites bleiben, egal wie ich derzeit persönlich dazu stehe. Es ist unverkäuflich.«
Pym rückte mit dem Stuhl zurück und zog die Schublade vor seinem ansehnlichen Bauch auf. »Ich war vor einigen Tagen dort. Mir blutet jetzt noch das Herz, in welchem Zustand dein Land ist. Aber zumindest das hier konnte ich unversehrt retten.« Er hob eine Porzellanfigur in die Höhe. Der Mann mit der Maske!
»Die Figur hat Mary-Ann gehört«, stieß James aus. »Ihr Bruder hat sie ihr geschenkt. Wie kommst du dazu, etwas von White Manor mitzunehmen?«
»Viele persönliche Gegenstände waren nicht mehr vorhanden. Ich schätze, Plünderer haben sich in deinem Haus ausgetobt. Darum nahm ich die Figur an mich. Im Glauben, dass sie dir etwas bedeutet.«
James sprang hoch und riss Pym das Porzellan aus der Hand. »Du hättest das unansehnliche Ding gerne lassen können, wo du es gefunden hast. Andererseits ein edelmütiger Zug von dir«, spottete er. »Glaubst du den Stumpfsinn eigentlich selbst, den du von dir gibst?« Der Stachel des Misstrauens grub sich tiefer.
»Ich dachte, meine Geste würde dich besänftigen. Wenn du in dich gehst … ehrlich in dich gehst … wirst du erkennen, dass es deine Frau nicht einfach hatte. Vergiss sie also und konzentriere dich auf dein eigenes Leben. Heirate, zeuge Nachwuchs und werde meinetwegen steinalt.«
»Ich habe Mary-Ann ein Versprechen gegeben. Das werde ich halten und wenn es das Letzte ist, das ich mache!«
»Dir ist nicht mehr zu helfen.« Es klopfte. »Herein!« Pym klang gereizt.
Die Tür schob sich zaghaft auf, bevor Bernadette mit dem üblichen Lächeln auf den Lippen eintrat. »Ich bitte zu Tisch. Meine Mutter und ich haben gekocht.« Ihr Lächeln vertiefte sich.
»Sie haben gekocht?« James spürte die Figur in seiner Hand. »Gibt es eigentlich irgendetwas, das Sie nicht können?« Seine Frage klang bewusst wie eine Beleidigung.
»Nein«, antwortete sie ungerührt, während Pym seufzend den Raum verließ.
»Sie sind ziemlich von sich eingenommen, Bernadette.«
»Ich versuche immer, mich meinem Gegenüber anzupassen.« Ihr langes schwarzes Haar hatte einen kastanienroten Schimmer.
»Sieh an, Sie haben ja doch Krallen.«
»Wie meinen Sie das?« Offen blickte sie ihm ins Gesicht.
»Sind Sie so dämlich oder tun Sie nur so?«
»Was macht Ihnen Angst?«, überrumpelte sie ihn. »Dass ich Ihnen einen Spiegel vorhalte? Sie finden es womöglich unerträglich, sich anzusehen. Ich hingegen möchte Ihnen zeigen, dass jeder Mensch liebenswert ist.« Sie strich sich glättend über das hellgelbe Kleid.
»Lassen Sie mich gefälligst in Ruhe!« Sein Brüllen ließ sie zusammenzucken und überraschte sogar ihn. Doch es tat gut. So unheimlich gut. »Ich hasse es, wenn man in meinem Leben herumstochert. Verabscheue Menschen, die glauben, alles besser zu wissen. Außerdem haben Sie keine Ahnung, wie es tatsächlich in mir aussieht oder wer ich bin. Also wagen Sie es nicht noch einmal, mich in irgendeine Richtung treiben zu wollen, als wäre ich ein naives Schaf wie Sie.« Bernadette wich weder seinem Blick aus noch bewegte sich ein Muskel in ihrem Gesicht, als er nähertrat. »Sollten Sie an Ihrem beschissenen Leben hängen, lassen Sie mich in Zukunft besser in Ruhe. Ansonsten werden Sie es bitter bereuen!«
Ihr Lächeln war so fehl am Platz, dass seine Wut in Befremden umschlug. »Das war alles?« Sie raffte ihr Kleid. »Um mir Angst einzujagen müssen Sie schon schwerere Geschütze auffahren, Mister White. Und nun sollten wir essen. Ich für meinen Teil habe einen Bärenhunger.«
***
Amsterdam
Mary-Ann war nach wie vor angespannt, als sie bei Olivia zu Mittag aßen. Hope und Jamie unterhielten sich leise miteinander und ernteten dann und wann einen strengen Blick ihrer Granny, wie sie Olivia inzwischen nannten. Den Kindern hatte die Überfahrt gutgetan. Sie strotzten vor Energie und schienen schneller vergessen zu haben als gedacht. Beneidenswert.
»Was ist los mit dir, mein Mädchen?« Olivia warf einen bedeutungsvollen Blick auf Mary-Anns Teller. Der zarte Seehecht mit dem Gemüse dampfte längst nicht mehr und erst jetzt wurde ihr bewusst, dass die Gabel seit geraumer Zeit untätig in ihrer Hand lag. »Hast du Sorgen?«
Mary-Ann fing Victorias fragenden Blick auf, die genüsslich kaute.
»Mami, dürfen wir hinaus ins Freie?« Hope schob ihren leeren Teller zurück und rieb sich den Bauch. Jamie ahmte sie nach, wofür er einen verärgerten Blick ihrer Tochter erntete. Nicht immer waren die beiden einer Meinung.
»Sofern Olivia zustimmt«, antwortete Mary-Ann und legte die Gabel ab. »Immerhin sitzen wir an ihrem Tisch.«
»Schon gut, lasst euch nicht von mir aufhalten, Kinder. Aber zieht euch etwas an. Es ist kühl draußen.« Olivia tippte sich mit dem Zeigefinger an die Wange. »Allerdings kostet das einen Kuss.« Die Kinder lachten und ließen sich nicht zweimal bitten. Abgöttisch hingen sie an Olivia und umgekehrt. »Nun zu dir, Mary-Ann. Wo drückt der Schuh?« Olivia stützte die Ellenbogen auf dem Tisch auf und faltete die Hände ineinander. Die Tür schloss sich. »Du siehst aus wie sieben Tage Regenwetter. Gefällt dir das Haus nicht? Oder bereust du deine Entscheidung, nach Amsterdam gekommen zu sein?«
»Weder noch, Mutter«, antwortete John anstelle Mary-Anns, die ihm ein dankbares Lächeln schenkte. Was sollte sie auch sagen? Dass man sie womöglich in einer eindeutigen Situation beobachtet hatte? Dass sie sich verfolgt fühlte? Selbst für sie hörte sich das ziemlich überspannt an. »Mary-Ann sorgt sich um den Ruf unserer Familie. Es wird nicht einfach für uns, schließlich ist Eleonore nicht irgendwer.«
»Das hättest du dir vorher überlegen müssen, John«, entgegnete Olivia sauertöpfisch. »Deinem genervten Blick nach zu urteilen sage ich dir damit jedoch nichts Neues. Nun gut, wir waren gewappnet, als wir das Schiff verlassen haben. Nicht nur ihr, auch ich bin von der neuen Situation betroffen. Doch wir sind eine Familie und werden das gemeinsam durchstehen.« Es war unklar, ob Olivia tatsächlich hinter ihren eigenen Worten stand. Während der Überfahrt hatte sie jedenfalls zuversichtlicher geklungen. »Am Samstag in zwei Wochen gibt Anna van Gelder ihren legendären Ball. Wir werden vollzählig dort erscheinen und allen damit den Wind aus den Segeln nehmen. Du bist jetzt eine Van Hoven, Mary-Ann. Genau das solltest du der ganzen Welt zeigen und unseren Namen mit Stolz tragen.«
Ein Ball? Aber dazu war sie noch nicht bereit, obwohl sie die Frau von Michiel de Ruyter gern kennenlernen wollte. Der Admiral war der Kapitän des Schiffes gewesen, mit dem sie nach Holland gereist waren und gleichzeitig der Mann, der sie auf hoher See getraut hatte. Ohne zu ahnen, dass sie dem Gesetz nach immer noch James Frau war, obwohl niemand an sein Überleben glaubte. Trotzdem, solange sein Tod nicht bewiesen war, fühlte sich Mary-Ann wie eine Lügnerin. Nicht, dass James ihre Überlegung nur eine Sekunde verdient hätte! Ohne mit der Wimper zu zucken hätte sie sogar neben ihm geheiratet, doch dem alten Admiral gegenüber hatte sie ein schlechtes Gewissen.
»Mutter sagte, dass ihr im Haus an der Bucht wohnen wollt?«, schnitt Benjamin ein anderes Thema an, was Mary-Ann mehr als gelegen kam.
»Es ist wunderschön dort.« Sie wechselte einen liebevollen Blick mit John. »Es einzurichten wird allerdings viel Zeit in Anspruch nehmen. Vom Garten will ich gar nicht erst reden.«
Benjamin betupfte seine Lippen mit dem Mundtuch, bevor er es neben dem Teller ablegte. Dann genehmigte er sich einen Schluck des schweren Rotweins und stellte das Glas mit nachdenklichem Blick auf den Tisch zurück. »Ohne Zweifel ein schönes Anwesen. Aber ist es klug, sich in Eleonores Nachbarschaft niederzulassen, Bruder?«
Verstört blickte Mary-Ann von Benjamin zu John. »Wie meint er das?«
»Nun ja«, druckste John herum und sandte seinem Bruder einen finsteren Blick, »Eleonore wohnt ein paar Häuser weiter. Darüber hätte ich spätestens heute Abend mit dir gesprochen. Zuerst wollte ich sehen, ob dir das Haus überhaupt gefällt.«
»Natürlich gefällt es mir«, bekräftigte Mary-Ann mit einem dumpfen Bauchgefühl, »aber hätte ich das vorher gewusst …«
»Was dann, Liebling?«, unterbrach John sie mit gequältem Ton. »Genau diese Reaktion habe ich befürchtet. Dabei möchte ich endlich in Ruhe leben dürfen, ohne die Vergangenheit mit White oder Eleonores Gegenwart zu fürchten. Sollen wir ewig davonlaufen und uns alles kaputtmachen lassen?«
»Es geht nicht nur um uns«, begehrte Mary-Ann auf. »Meinetwegen hast du diese Frau verlassen. Soll sie täglich unser Glück vor Augen haben? John, wir haben ihr wehgetan. Du hast selbst gesagt, dass sie dich liebt.«
»Mir tut Eleonore ebenfalls leid und demnächst werde ich noch einmal ein Gespräch mit ihr suchen. Aber wie du weißt, hat sie mir bisher den Zutritt zu ihrem Haus verwehrt und ich wüsste nur zu gern, wer ihr postwendend von uns erzählt hat. Sie hätte die Wahrheit von mir erfahren müssen, nichtsdestotrotz liebe ich das Anwesen an der Bucht und werde nicht ihretwegen darauf verzichten. Je früher sie sich mit den Tatsachen abfindet, desto besser ist es für uns alle. Lieber soll sie mich hassen, als dass ich durch zu viel Rücksichtnahme falsche Signale sende.«
»Sei mir nicht böse, wenn ich mich einmische«, Victoria hielt die vollbeladene Gabel nahe am Kinn und nahm John in Augenschein. »Es wäre besser, ihr etwas Zeit zu geben.« Kaum ausgesprochen, schob sie sich den Bissen in den Mund.
»Victoria hat recht. Du bist vermutlich der Letzte, den sie im Moment sehen möchte. Soll ich mit ihr reden?«, bot sich Benjamin an. »Eleonore und ich haben uns immer gut verstanden.«
»Und wir sind Freundinnen.« Victoria schluckte. »Außerdem bringt eine Frau das nötige Feingefühl mit. Ihr Hitzköpfe würdet mehr Porzellan zerschlagen, als ihr kitten könntet.«
»Ich schätze, du warst Eleonores Freundin«, gab Benjamin zu bedenken. »Sie würde dich ebenfalls abweisen, obwohl du recht hast: Wir sollten einen kühlen Kopf bewahren, weil es um weit mehr geht. Unser Unternehmen könnte durch ein Zerwürfnis mit Eleonores Familie erheblichen Schaden nehmen. Vor allem jetzt wäre es ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt. Wie es aussieht, bahnt sich ein zweiter Seekrieg zwischen England und Holland an. Da unsere Auftragslage mehr als dürftig ist, müssen wir Kompromisse eingehen, um die Werft zu halten. Aber nur ein Wort von De Witt und wir haben keine Arbeit mehr.«
»Schiffe für den Krieg umzurüsten nennst du Arbeit?«, empörte sich John und warf das Mundtuch auf den Tisch. »Waren wir uns bei der Überfahrt nicht darüber einig, dass wir das nie wieder tun wollen? Du weißt, wie sehr ich das hasse!«
»Glaubst du, mir geht es anders? Aber wir brauchen volle Auftragsbücher und im Augenblick haben wir keine andere Wahl.« Auch Benjamin wurde zusehends ärgerlich. »Ferner habe ich beschlossen, mich um einen Posten bei der Vereinigten Ostindischen Kompanie zu bemühen. Damit könnten wir unseren Horizont erweitern und konkret in den Handel einsteigen. Wenn wir nebenbei Schiffe umrüsten, was soll’s? Niemand kann uns daran hindern, unser eigentliches Ziel weiterhin zu verfolgen und Handelsschiffe zu bauen.«
»Wie lange feilst du schon an diesen Plänen?« John zog die Lippen zu einem schmalen Strich.
»Das sind nur Überlegungen.«
»Ziemlich ausgereifte, wenn du mich fragst.«
»Wenigstens einer von uns sollte nicht vor lauter Liebe das Unternehmen aus den Augen verlieren«, pflaumte Benjamin ihn an. »Doch lass uns darüber reden, wenn wir konkretes wissen. In erster Linie muss sich die Lage zwischen unserer Familie und der De Witts beruhigen.« Olivia tätschelte Benjamins Hand, der einen tiefen Atemzug machte, bevor er sich mit Daumen und Zeigefinger über den Schnurrbart fuhr. »Einen Versuch ist es wert, John«, fuhr er ruhiger fort. »Wenn ich bei Eleonore nichts erreiche, kannst du neuerlich dein Glück probieren. Also? Bist du einverstanden?«
»Gut«, gab sich John geschlagen. »Obwohl sie denken wird, dass ich dich vorgeschickt habe.«
Benjamin grinste. »Frauen denken sowieso, was sie wollen. Überlass das getrost mir.«
»Als ob du der Nabel der Welt wärst«, zog Victoria ihn auf.
»Immerhin kann ich damit prahlen, zwei Frauen in einem Körper zu haben. Tagsüber bist du Susan, abends Victoria.« Sie hatten beschlossen, bei dem Namen zu bleiben. Wenigstens hier in Holland. Alles andere hätte zu viele Fragen aufgeworfen, was wegen Jamie ohnehin geschehen würde. Doch auch dahingehend hatten sie sich eine Geschichte überlegt. War nur zu hoffen, dass sich niemand in Widersprüche verstrickte.
Wenigstens trug das Geplänkel zwischen Victoria und Benjamin dazu bei, dass sich die Anspannung verflüchtigte. Wenngleich Mary-Ann ahnte, dass sich John insgeheim große Sorgen machte. Auch an ihr waren Benjamins Einwände nicht spurlos vorübergegangen. Was, wenn Johan de Witt tatsächlich seine Macht ausspielte? Nicht nur was die Werft betraf? Jedenfalls war sie nicht nach Holland gekommen, um erneut fliehen zu müssen.
»Vielleicht hätten wir uns in Indien niederlassen sollen«, überlegte John und krauste die Stirn. Mary-Ann warf ihm einen fragenden Seitenblick zu.
»Indien?«, pikiert hob Olivia die Augenbraue, »hast du diesen Jugendtraum immer noch nicht aufgegeben?« Mary-Anns Verwunderung wuchs. John hatte ihr nie davon erzählt.
»Indien ist ein Land, von dem ich schon länger träume.«, erklärte er mit schiefem Grinsen und einem hastigen Seitenblick zu Mary-Ann. »Zumal ein fremdes Land unseren Neubeginn erleichtern würde, weil uns dort niemand kennt.«
»Mag sein«, stimmte Olivia zu und fuhr sich mit dem Daumennagel in den Zwischenraum ihrer Schneidezähne. »Dein Vater in Ehren«, nuschelte sie, »mit Indien hat er dir jedoch einen Floh ins Ohr gesetzt. Louis war eben ein begnadeter Erzähler. Die Wirklichkeit sieht bestimmt anders aus, der du dich übrigens hier stellen solltest. Die Vergangenheit würde euch irgendwann sowieso einholen. Egal, wo ihr seid.« Ihr Blick glitt von John zu Mary-Ann. »Aber ihr werdet das bestimmt meistern.« Sie seufzte aus tiefster Seele. »Ich frage mich, wann Timothy kommt.«
»Das wird eine Weile dauern.« Benjamin gab Victoria einen Kuss auf die Wange.
»Wenigstens kann ich bis dahin meine Zigarren genießen«, geriet Olivia ins Schwärmen, die wieder einmal die Themen wechselte wie andere ihre Leibhose. »Wenn sich der alte Haudegen erst hier breitgemacht hat, wird mir ohnehin der Rauch im Hals steckenbleiben.«
»Er sorgt sich um deine Gesundheit«, warf John ein. »Gib ihm ein paar Monate, dann wird er es aufgeben. So wie wir.«
»Ach komm, die wenigen Jahre, die ich noch habe …«
»Möchtest du lieber verkürzen«, beendete John mit belehrender Miene ihren Satz.
»Im Gegenteil.« Olivia schaute einen nach dem anderen an. »Jetzt, wo alles endlich so ist wie es sein soll, will ich lange Zeit daran teilhaben.«
Kapitel 2
Eleonore eilte durch die enge Gasse, die zu Jan de Keysers Schneiderei führte. Dabei blickte sie weder links noch rechts, weil sie sich im Moment wie unter Dauerbeobachtung fühlte. Die Amsterdamer Gesellschaft zerriss sich das Maul über sie. Selbst das einfache Volk schien darüber informiert, wie übel John ihr mitgespielt hatte. Die mitleidigen Blicke fühlten sich wie spitze Nadelstiche an, auch hämische mischten sich darunter. Man gönnte ihr diese Zurückweisung, weil sie ja alles zu haben schien. Dabei ahnte niemand, dass sie im Tausch gegen John ihr gesamtes Vermögen verschenkt hätte.
Wenn sie diese Gefühle bloß abstellen könnte! Diese tiefen Gefühle, die sich nicht verdrängen ließen. Nächte voller Tränen lagen hinter ihr. Tage, in denen sie kaum den Platz vor dem Fenster verlassen hatte, um Johns Anwesen zu beobachten. In letzter Zeit hatte es dort von Bediensteten nur so gewimmelt. Möbelstücke wurden ins Haus getragen – auf Booten oder Pferdekarren angeliefert – oder Altes wegtransportiert.
Oft hatte sich Eleonore genauso ausrangiert gefühlt. Erst recht, wenn die andere Frau auftauchte. Das blonde Haar hatte in der Lichtflut der kurzen Wintertage wie eine goldene Flamme geglänzt und in Eleonore den Wunsch entfacht, sie möge auf einem Scheiterhaufen elendig zugrunde gehen. Ein verwerflicher Gedanke, den sie jedoch nicht abstellen konnte. Ebenso wenig wie ihren Hass.
»Könntest du bitte auf mich warten?«, forderte Agneta schwerkeuchend. »Wir wollen nur zum Schneider und sind nicht auf der Flucht.«
»Entschuldige.« Eleonore behielt trotz der Aussage ihren schnellen Gang bei. Sie hatte Agneta schließlich nicht gebeten, sie zu begleiten, und konzentrierte sich mit brennenden Augen auf die Fassaden der Häuser. Aber die grauenhaften Bilder in ihrem Kopf ließen sich nicht verdrängen, egal womit sie sich abzulenken versuchte. John hatte mit dieser Frau geschlafen! Auf dem kalten Marmorboden. Ohne Hemmungen. Mit einer Leidenschaft, die sogar durch die geschlossenen Fenster zu spüren gewesen war. Nie hatte er ihr diese Hingabe geschenkt, sie mit derselben Zärtlichkeit berührt. Voller Ehrfurcht ihren nackten Körper betrachtet.
Wäre alles anders gekommen, wenn sie ihm die Chance dazu gegeben hätte? Aber nein, sie hatte ja den christlichen Weg gehen und sich in Keuschheit üben müssen. Wie einfältig war sie gewesen! Hätte er sie entehrt, sogar ein Kind mit ihr gezeugt, hätte er sich nicht so einfach aus der Affäre stehlen können.
»Du denkst schon wieder an ihn.«
»Um das zu erraten, musst du nicht meine Zwillingsschwester sein«, murrte Eleonore und blickte auf die Schneiderei, die vor ihnen auftauchte. Ein unscheinbares karmesinrotes Haus mit abgeblätterter Fassade, das einsam am Ende der verschnörkelten Brücke lag, die sich über die Gracht spannte. Ein Hausboot dümpelte davor. »Weshalb bist du eigentlich mitgekommen? Immerhin verabscheust du seit jeher alles, das mit Mode oder Schönheit zu tun hat.«
»Vater bat mich ein Auge auf dich zu haben«, folgte eine schnippische Antwort. »Glaub mir, ich hätte weit besseres mit meiner Zeit zu tun, als auf dich aufzupassen. Aber in den letzten Wochen gibst du ein Vermögen für neue Kleider aus.«
»Na und? Was geht es dich an?« Wütend stapfte Eleonore über die Brücke.
»Ich bin deine Schwester und nicht dein Feind.« Agnetas schnelle Schritte klapperten hinter ihr auf dem Holz. »Und gerade jetzt werde ich dich bestimmt nicht alleinlassen. Du heulst dir jede Nacht die Augen aus nach John.«
»Auch das ist meine Sache. Also kümmere dich lieber um deine eigenen Wunden. Oder hält sich die Trauer über Jans Tod so in Grenzen, dass du dich aus Langeweile mit mir beschäftigst?« Agnetas Schluchzen ließ sie innehalten. Sie war zu weit gegangen. Eleonore wandte sich um. »Das war ungerecht von mir. Verzeih.«
Agneta wischte sich mit dem Ärmel ihres braunen Leinenkleides über die wässrigen Augen. Der goldene Ehering blitzte auf, den sie nach wie vor trug und ihr Blick verlor sich in der Gracht, als gäbe es keinen schöneren Anblick. Dabei stank es zum Himmel. Angewidert blickte Eleonore auf menschliche Ausscheidungen und Abfälle, die an der Oberfläche vor sich hertrieben. Ihr Magen drehte sich um, wie so oft in letzter Zeit. Kein Wunder, da sie seit Johns Rückkehr kaum etwas gegessen hatte.
Ferner war dies nicht gerade ein Ort, an dem sich ein begnadeter Mann wie Keyser niederlassen sollte, dessen Schneiderei die schönsten Stoffe weit und breit beherbergte. Ebenso wie es kein Ort war, um eine Grundsatzdiskussion zu führen.
»Es tut mir weh, dich so zu sehen«, wandte sich Agneta an sie. Wie blass ihre Schwester aussah, wie leer die rehbraunen Augen waren. Sie musste Jan mehr geliebt haben als Eleonore bisher vermutet hatte. Nur drei Monate waren die beiden verheiratet gewesen. Bei einer Wildschweinjagd war er so unglücklich vom Pferd gefallen, dass er auf der Stelle starb. »Auch Vater macht sich große Sorgen.«
Gegen Eleonores Willen brodelte die Wut neuerlich in ihr hoch. »Vaters Gedanken drehen sich ausschließlich um Holland. Würde man unsere Heimat betrügen, wäre er nicht so zimperlich und würde jeden Verräter eigenhändig erdolchen. Aber es geht ja bloß um mich.«
»Hör endlich mit deinem Selbstmitleid auf. In Wahrheit ging es ohnehin immer nur um dich«, verschaffte sich Agneta Luft. »Eleonore, die Schöne. Eleonore, die Gebildete. Eleonore, die am meisten unter Mutters Tod leidet und deswegen über die Stränge schlagen darf. Egal, ob sie ein Kind ist oder eine Frau von inzwischen zweiundzwanzig Jahren.« Eleonores Hände umklammerten auf schmerzhafte Weise das Brückengeländer. »Ich kann deinen Zorn verstehen«, fuhr Agneta sanfter fort, »doch weder Vater noch ich können irgendetwas dafür.«
»Und wenn schon.« Eleonore setzte ihren Weg fort. Agneta konnte ihr gestohlen bleiben. Was wusste sie schon? Ausgerechnet sie? »Jan ist tot. Da würde es mir auch leichter fallen, damit abzuschließen.«
»Was soll das heißen? Dass du John den Tod wünschst?«, hakte Agneta nach. Eleonore blieb ihr die Antwort schuldig. »Oder dir selbst? Tu Vater das nicht erneut an. Er hat deinen Selbstmordversuch nach Mutters Tod längst nicht verarbeitet.«
»Er hätte mich einfach am Strick lassen sollen.« Ihr Vater war in der Sekunde ins Zimmer gekommen, als sie den Stuhl unter sich umgestoßen hatte. Nie zuvor hatte sie ihn weinen sehen, nur dieses eine Mal, während er den Strick durchtrennte. »Jetzt wäre ich froh darüber.«
»Grundgütiger, Eleonore! Langsam regst du mich wirklich auf.«
»Was für eine Neuigkeit. Wir haben uns nie gut verstanden und daran wird sich nichts ändern. Im Übrigen solltest du umkehren. Du weißt, was Keyser von deinem schlichten Kleidergeschmack hält.« Im Gegensatz zu ihr sorgte sich Agneta kaum um ihr Äußeres. Besser gesagt fehlte ihr das Gespür dafür, wie man sich vorteilhaft kleidete. Trotz Zwilling, sie hätten nicht verschiedener sein können. Alles, was Agneta interessierte, waren Familie und Haushalt. Um Bildung scherte sie sich ebenfalls keinen Deut, weshalb sich der Privatlehrer die Zähne an ihr ausgebissen hatte. Agneta war eine denkbar schlechte Schülerin gewesen.
Die Türglocke schellte, als Eleonore die Schneiderei betrat. Unwillig registrierte sie, dass Agneta nach wie vor an ihr klebte. Noch missmutiger nahm sie die Blicke einiger Schneiderinnen zur Kenntnis, die erschrocken von ihrer Arbeit hochschauten.
»Welche Freude Sie zu sehen, Gnädigste«, ertönte Keysers Stimme, der gerade einen grünen Ekrü-Stoffballen durch den schmalen Gang zwischen zwei hohen Regalen hievte, in denen er Gewebe aus aller Welt lagerte. Sein glänzendes Gesicht war puterrot. Der Gang wie üblich stelzengleich, als hätte er seine zu langen Arme und Beine nicht unter Kontrolle. Die gelbstichigen Augen waren voller Unruhe. Man plauderte offen über seine Trinksucht. Manchmal stank er, als hätte er tagelang in Schnaps getunkt. Dennoch war seine Kleidung an Perfektion kaum zu überbieten und stets nach der neuesten Mode. »Was kann ich für Sie tun?« Ächzend schob er den Stoffballen auf den langen Tisch und breitete ihn aus. Dabei blickte er ständig hinter sich, als würde er befürchten, dass ihn ein Tier aus dem Hinterhalt ansprang.
»Ich brauche einige Kleider.« Eleonore fuhr mit der Hand über das Ekrü. »Ein wunderschöner Stoff. Haben Sie geahnt, dass ich vorbeikomme?« Sie lächelte und dachte an ihr zerschnittenes Hochzeitskleid, das sie hatte entsorgen lassen.
Als hätte sie Keyser mit ihrer Frage in eine peinliche Situation gebracht, griff er hastig zur breitblättrigen Stoffschere und hielt sie ungelenk in der schmalen Hand. »Unsere Auswahl ist enorm, wie Sie wissen. Leider wurde dieser Ballen von einer anderen Dame geordert. Es ist der letzte seiner Art.«
»Das Ekrü reicht für zwei Kleider«, wandte Eleonore ein.
»Da täuschen Sie sich.«
»Ich täusche mich selten.« Was bildete sich dieser Mann ein? Hatte er vergessen, wessen Familie sie angehörte? »Ich könnte mir einen dazu passenden Sommerhut gut vorstellen«, sprach Eleonore ungerührt weiter. »Mit einem breiten Ekrü-Band für eine Schärpe. Was denken Sie?«
Bedächtig begann er den Stoff zuzuschneiden und schenkte ihr nur einen kurzen Blick. »Liebste Eleonore, Ihr erlesener Geschmack beflügelt meine Seele. Doch Sie selbst bestehen seit jeher ausnahmslos darauf, kein Kleid zu tragen, das es in ähnlicher Form gibt.«
»Ich habe die Regel festgelegt und ich kann sie auch wieder ändern.« Eleonore nahm eine Bewegung aus den Augenwinkeln wahr. Als sie den Kopf wandte, wurde ihr heiß und kalt zugleich. Susan schlenderte durch den schmalen Gang und blickte interessiert über die vielen Stoffballen. Wie ein dummes Schaf trottete eine Frau hinterher.
Eine blonde Frau! Mit Sicherheit war es die Engländerin!
Plötzlich hob diese den Kopf und ihre Blicke kreuzten sich.
Der Stoff ist vermutlich für sie bestimmt!, kombinierte Eleonore in Sekundenschnelle. Darum die Geschäftigkeit des Schneiders. Wie alle in Amsterdam war auch er bestens im Bilde. Und wieder einmal nahm sich diese unverschämte Engländerin das, was ihr zustand. Aber nun würde sie mit allen Mitteln um die Ekrüseide kämpfen.
»Ich zahle Ihnen das Doppelte für den Stoff«, bestach Eleonore den Schneider, ohne die Engländerin aus den Augen zu lassen, und bemerkte gleichzeitig, dass Susan auf sie zukam. Verbitterung stieg in ihr hoch. Sie waren befreundet gewesen, doch Susan hatte die Fronten schneller gewechselt, als dass sie bis drei hätte zählen können.
»Eleonore, wie schön dich zu sehen.«
Sie ignorierte Susans dargebotene Hand. »Wir beide haben uns nichts mehr zu sagen.« Zögernd zog Susan ihre Hand zurück. Die Engländerin trat an den Tisch. Sie trug ein Kleid in der Farbe frischerblühter Mohnkelche und einen breitkrempigen Hut, dessen rotes Band mit einer perfekten Masche unter dem Kinn gebunden war. Rosige Wangen, klare grüne Augen, lange Wimpern und ein milder Zug um den Mund wirkten beinahe sympathisch wie die Lachfältchen um die Augen. Nur zwei Stirnfalten zeugten davon, dass sie ein Mensch mit Vorgeschichte war und Eleonore einige Lebensjahre voraushatte.