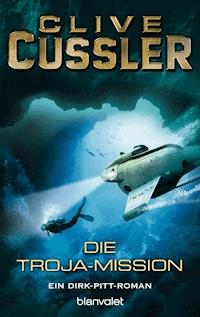
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Dirk-Pitt-Abenteuer
- Sprache: Deutsch
Das NUMA-Team stößt vor der Küste Nicaraguas auf einen Palast, der vor langer Zeit im Meer versunken ist. Er scheint in einem geheimnisvollen Zusammenhang mit der Legende von Troja zu stehen. Gleichzeitig entdeckt Dirk Pitt ein gigantisches Tunnelsystem zwischen dem Atlantik und der Pazifikküste. Und kommt einem unfassbaren Plan auf die Spur, der die ganze Menschheit mit dem Untergang bedroht ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 709
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Clive Cussler
Die Troja-Mission
Roman
Aus dem Englischen von Oswald Olms
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Trojan Odyssey« bei Putnam, New York.
1. Auflage
E-Book-Ausgabe 2015 bei Blanvalet, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, München.
Copyright © 2003 by Sandecker, RLLLP
All rights reserved by the Proprietor throughout the world
By arrangement with
Peter Lampack Agency, Inc.
551 Fifth Avenue, Suite 1613
New York, NY 10176-0187 USA
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2004 by Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com
Redaktion: Rainer Michael Rahn
HK · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-15221-5
www.blanvalet.de
In liebevollem Gedenken an meine Frau Barbara,die unter Engeln weilt
Die Nacht der Niedertracht
Um 1190 v. Chr.Eine Bergfeste am Meer
Es war ein Köder, erschaffen in aller Schlichtheit, aber mit einem tiefen Wissen um die Neugier der Menschen. Und er erfüllte seinen Zweck. Sechs Meter hoch ragte das schmucklose Ungetüm mit seinen vier stämmigen, aus Hölzern gezimmerten Beinen über der Plattform auf, auf der es stand. Auf den Beinen ruhte ein dreieckiger Aufbau, hinten und vorn offen, ein Spitzdach mit einem rundlichen Höcker an der Vorderseite, versehen mit zwei Augenschlitzen. Beide Seiten waren mit Rinderhäuten verkleidet. Die Bewohner der Feste Ilion hatten dergleichen noch nie gesehen.
Manch einen, der etwas Fantasie hatte, erinnerte es entfernt an ein Pferd.
Zu früher Stunde waren die Dardaner aufgewacht und hatten den Ansturm der Achäer erwartet, die ihre befestigte Stadt eingeschlossen hatten, bereit zur Schlacht, so wie auch in den vergangenen zehn Wochen. Doch die Ebene unter ihnen war menschenleer. Sie sahen lediglich einen dichten Rauchschleier, der über die Aschereste dahintrieb, die vom Lager der Feinde verblieben waren. Die Achäer waren mitsamt ihrer Flotte verschwunden. Im Dunkel der Nacht hatten sie ihre Vorräte, die Pferde, Waffen und Streitwagen auf die Schiffe verladen und waren davongesegelt. Hatten nur das rätselhafte hölzerne Ungetüm zurückgelassen. Die Späher der Dardaner kehrten zurück und berichteten, dass das Lager der Achäer verlassen sei.
Außer sich vor Freude darüber, dass die Belagerung von Ilion zu Ende war, stießen die Menschen das große Tor der Festung auf und strömten auf die weite Ebene hinaus, auf der ihrer beider Heere hunderte von Gefechten ausgetragen und ihr Blut vergossen hatten. Zunächst waren sie verwundert, als sie des Ungetüms ansichtig wurden. Die Argwöhnischen unter ihnen vermuteten eine Kriegslist und plädierten dafür, dass man es verbrennen sollte. Doch bald darauf stellten sie fest, dass es nur ein Bauwerk von Menschenhand war, aus grob behauenen Hölzern zusammengezimmert und auf vier Beine gestellt. Ein Mann stieg hinauf, kletterte in den Aufbau und stellte fest, dass er leer war.
»Wenn die Achäer keine besseren Pferde zustande bringen«, brüllte er, »ist es kein Wunder, dass wir gesiegt haben.«
Die Menschen, die sich rundum drängten, lachten und stimmten Freudengesänge an, als Priamos, der König von Ilion, in seinem Streitwagen eintraf. Er stieg ab, nahm huldvoll die Jubelrufe der Umstehenden entgegen und ging um das sonderbare Bauwerk herum, als versuchte er, dessen Sinn zu ergründen.
Nachdem er sich davon überzeugt hatte, dass es keine Gefahr darstellte, erklärte er es zur Kriegsbeute und verfügte, dass es auf Rollen über die Ebene gezogen und vor dem Stadttor zum Gedenken an einen ruhmreichen Sieg über die räuberischen Achäer aufgestellt werden sollte.
Das festliche Treiben wurde jählings unterbrochen, als zwei Krieger einen Gefangenen durch die Menschenmenge zerrten, einen Achäer, der von seinen Gefährten zurückgelassen worden war. Sinon hieß er, und alle wussten, dass er der Vetter des mächtigen Odysseus war, des Königs von Ithaka, eines der Anführer der großen achäischen Räuberhorde. Als man ihn Priamos vorführte, warf er sich vor dem König zu Boden und flehte um sein Leben.
»Warum hat man dich zurückgelassen?«, herrschte ihn der König an.
»Mein Vetter hat auf jene gehört, die mir feindlich gesonnen waren, und mich aus dem Lager verbannt. Wenn ich mich nicht in einem Hain versteckt hätte, als sie ihre Schiffe zu Wasser ließen, hätten sie mich gewisslich hinterhergeschleppt, bis ich ertrunken oder von den Fischen gefressen worden wäre.«
Priamos musterte Sinon eingehend. »Was hat dieses Ungetüm zu bedeuten? Welchem Zweck dient es?«
»Weil wir eure Feste nicht einnehmen konnten und Achilles, der mächtigste unserer Helden, im Kampf gefallen ist, glaubten meine Gefährten, die Götter wären ihnen nicht wohl gesonnen. Deshalb schufen sie dieses Standbild, um sie gnädig zu stimmen, damit sie sicher nach Hause gelangen.«
»Warum ist es so groß?«
»Damit ihr es nicht im Triumph in eure Stadt schleppen und dort zum Gedenken an die größte Niederlage der Achäer seit Menschengedenken aufstellen könnt.«
»Ja, diese Befürchtung kann ich verstehen.« Der weise alte Priamos lächelte. »Aber sie haben nicht bedacht, dass es außerhalb der Stadt den gleichen Zwecken dienen kann.«
Hundert Männer fällten Bäume und hieben sie zu Rollen zurecht. Dann traten weitere hundert Mann mit Seilen an, stellten sich in zwei Reihen auf und zogen die Trophäe über die Ebene, die sich zwischen der Stadt und dem Meer erstreckte. Mehr und immer mehr Männer gesellten sich im Laufe des Tages zu ihnen, legten sich in die Taue und plagten sich im Schweiße ihres Angesichts, um das sperrige Ungetüm den Hang hinaufzuschleppen, der zu der Feste führte. Erst am späten Nachmittag, als das hölzerne Bildnis vor dem großen Tor der Stadt stand, war ihre Mühsal beendet. In Massen strömten die Menschen aus der Stadt, hinter deren Mauern sie sich aus Furcht vor den Feinden seit über zwei Monaten nicht mehr hervorgewagt hatten, und starrten staunend und ehrfürchtig auf das riesige Standbild, das nun das dardanische Pferd genannt wurde.
Außer sich vor Freude darüber, dass der unaufhörliche Kampf ein Ende hatte, zogen die Frauen und Mädchen los, pflückten Blumen und flochten Girlanden, mit denen sie das absonderliche hölzerne Wesen behängten.
»Unser sind Sieg und Friede!«, riefen sie begeistert.
Aber Kassandra, die Tochter des Priamos, die wegen ihrer düsteren Weissagen und ihrer Sehergabe als schwach im Geiste galt, warnte sie. »Erkennt ihr denn nicht, dass dies eine List ist?«, rief sie.
Laokoon, der bärtige Priester, pflichtete ihr bei. »Betört seid ihr vor lauter Begeisterung. Narren seid ihr, wenn ihr den Geschenken der Achäer traut.«
Laokoon wich zurück und schleuderte seine Lanze mit mächtiger Hand auf den Leib des Pferdes. Sie drang bis zum Schaft in das Holz ein und blieb zitternd stecken. Die Menschenmenge aber verlachte ihn ob seines Argwohns.
»Kassandra und Laokoon sind von Sinnen! Das Ungetüm ist harmlos. Nicht mehr als ein paar Bretter und Bohlen.«
»Ihr Toren!«, rief Kassandra. »Nur ein Narr schenkt Sinon, dem Achäer, Glauben.«
Einer der Krieger starrte ihr in die Augen. »Er sagt, da es jetzt Ilion gehört, wird unsere Stadt niemals fallen.«
»Er lügt.«
»Wollt ihr das Geschenk der Götter nicht annehmen?«
»Nicht, wenn es von den Achäern kommt«, erwiderte Laokoon, der sich durch das Getümmel drängte und mit wütenden Schritten in die Stadt zurückkehrte.
Die ausgelassene Meute ließ sich nicht überzeugen. Ihre Feinde waren verschwunden. Für sie war der Krieg vorüber. Jetzt war es an der Zeit zu feiern.
Die Menschen ließen sich von ihrer Begeisterung hinreißen, und niemand schenkte den beiden Mahnern Beachtung. Noch ehe eine Stunde verstrichen war, ließ die Neugier nach, und die Bewohner der Stadt wollten ihren Triumph über die Achäer auskosten. Flöten- und Schalmeienklänge ertönten innerhalb der Mauern der Feste, auf den Straßen wurde getanzt und gesungen, und aus den Häusern, wo der Wein in Strömen floss, wo man lachend die Becher hob und in einem Zug leerte, schallte Gelächter.
In den Tempeln verbrannten die Priester und Priesterinnen Weihrauch, stimmten Lobgesänge an und boten den Göttern Opfergaben zum Dank dafür dar, dass das schreckliche Schlachten vorüber war, bei dem so viele der Tapferen den Tod gefunden hatten.
Voller Freude stimmten die Menschen Hochrufe auf ihren König und seine kühnen Heerscharen an, auf die jungen Helden und alterprobten Krieger, die Verwundeten und die teuren Gefallenen, die in die Unterwelt eingegangen waren. »Hektor, o Hektor, unser großer Heros. Ach, wenn du doch unsern Triumph noch miterleben könntest.«
»Vergebens haben die Achäer, diese Narren, unsere glorreiche Stadt angegriffen«, schrie eine Frau, während sie in wildem Tanz vorüberwirbelte.
»Wie geprügelte Hunde sind sie geflohen«, rief eine andere.
In großen Reden ergingen sie sich, als der Wein ihr Blut erhitzte – die Herrscher in ihrem Palast, die Reichen in ihren großen, auf Terrassen erbauten Häusern, die Armen in ihren schlichten Hütten, die sich dicht an die inneren Mauern der Stadt drängten, wo sie vor Wind und Regen geschützt waren. In ganz Ilion wurde gefeiert und gezecht, verzehrte man die letzten kostbaren Nahrungsvorräte, die man während der Belagerung gehortet hatte, und erging sich im Freudentaumel, als gäbe es kein Morgen. Erst nach Mitternacht ließ das trunkene Treiben nach, als die Untertanen des Königs Primaos in tiefen Schlaf fielen, berauscht vom Wein und in der Gewissheit, dass endlich Frieden herrschte – zum ersten Mal, seitdem die verhassten Achäer die Stadt belagert hatten.
Manch einer wollte sogar zum Zeichen des Sieges das große Tor offen lassen, doch die Besonneneren setzten sich durch, worauf die beiden Flügel geschlossen und verriegelt wurden.
Vor zehn Wochen waren sie unverhofft von Norden und Osten angerückt, mit hunderten von Schiffen, die über die grüne See segelten und in der Bucht landeten, die von der großen Ebene von Ilion umgeben war. Als sie feststellten, dass das Tiefland zu großen Teilen aus Sumpf bestand, schlugen sie ihr Lager auf der Landzunge auf, die ins Meer hinausragte, und entluden ihre Schiffe.
Es war eine leuchtend bunte Flotte, bemalt in den Lieblingsfarben aller beteiligten Königshäuser. Nur unterhalb der Wasserlinie waren die Rümpfe schwarz, da die Kiele mit Pech bestrichen waren. Mit langen Riemen wurden sie fortbewegt, mit einem Ruder am Heck gesteuert. Da sie mit ihrem rechteckigen Segel nicht gegen den Wind kreuzen konnten, wurde es nur gesetzt, wenn achterlicher Wind wehte. Die hoch aufragenden Vorder- und Achtersteven waren mit geschnitzten Vogelköpfen verziert, Falken und Greifen vor allem. Bis zu hundertzwanzig Kämpfer saßen in den Kriegsschiffen, nur zwanzig Ruderer in den Frachtern. Zumeist aber waren samt Kapitän und Steuermann zweiundfünfzig Mann an Bord.
Viele Könige waren darunter, Herrscher über kleine Reiche, die sich zeitweise zu einem Bund vereinten, um die Städte und Siedlungen entlang der Küste zu überfallen und auszuplündern, so wie zweitausend Jahre später die Wikinger. Sie kamen aus Argos und Pylos, aus Arkadien, Ithaka und etlichen anderen Landstrichen. Als mächtige Recken galten sie seinerzeit, obgleich sie kaum mehr als einen Meter sechzig maßen. Doch sie waren grimmige Krieger, gepanzert mit einem Harnisch aus gehämmerter Bronze, der ihre Brust schützte und mit Lederriemen am Oberkörper verschnürt war. Dazu trugen sie Bronzehelme, die sie über Kopf und Gesicht stülpten, manche mit Hörnern bewehrt, andere mit einem spitzen Stachel, aber auf allen prangte das Wahrzeichen ihres Besitzers. Schenkel und Arme hatten sie mit Schienen gewappnet.
Sie kämpften vornehmlich mit der Lanze und griffen nur zu ihrem kurzen Schwert, wenn ihr Spieß geborsten oder verloren gegangen war. Den Bogen benutzten die Krieger der Bronzezeit nur selten, da er als eine Waffe galt, die nur Feiglinge einsetzten. Sie schützten sich mit großen Schilden, hergestellt aus sechs bis acht Lagen Rinderhaut, die mit Lederschnüren an einem Rahmen aus Weidengeflecht befestigt und am Rand mit Bronze verstärkt wurden – zumeist rund, manchmal aber auch in Form einer Acht.
Im Gegensatz zu den Kriegern anderer Königreiche oder Kulturen setzten die Achäer weder Reiterei ein, noch griffen sie mit Streitwagen an. Die Wagen dienten nur als Transportmittel, mit denen Männer und Nachschub zum Schlachtfeld gebracht wurden. Ihre Kämpfe aber trugen die Achäer ebenso wie die Dardaner zu Fuß aus.
Bei diesem Krieg indessen handelte es sich nicht nur um einen Eroberungs- oder Raubzug. Mit dem Angriff auf Ilion wollten die Achäer in den Besitz eines Metalls gelangen, das fast so kostbar war wie Gold.
Bevor sie mit ihren Schiffen vor Ilion landeten, hatten die Achäer zahlreiche Städte und Siedlungen entlang der Küste geplündert, große Schätze und viele Sklaven erbeutet, hauptsächlich Frauen und Kinder. Doch sie konnten nur erahnen, welch ungeheure Reichtümer hinter den dicken Mauer von Ilion lagerten, bewacht von entschlossenen Verteidigern.
Mit bangem Blick musterte manch einer der Krieger die auf einer felsigen Anhöhe stehende Stadt mit ihren mächtigen steinernen Mauern, den Wehrtürmen und dem Königspalast, der in ihrer Mitte aufragte. Nun, da sie das Ziel ihrer Kriegsfahrt vor sich sahen, wurde ihnen bewusst, dass diese Feste nicht so leicht einzunehmen war wie die anderen Städte und Siedlungen, die sie geplündert hatten; sie würde nur in einem langen und mühseligen Feldzug zu bezwingen sein.
Sie bekamen es zu spüren, als die Dardaner einen Ausfall unternahmen, die Achäer während der Landung angriffen und ihre Vorhut beinahe ins Meer warfen, ehe die übrigen Schiffe eintrafen und die Hauptmacht absetzen konnten. Bald darauf zogen sich die Dardaner, nachdem sie den Achäern eine blutige Nase verpasst hatten, vor der Übermacht in den Schutz der Festungsmauern zurück.
Zehn Wochen lang tobte danach die Schlacht auf der weiten Ebene. Die Dardaner setzten sich verbissen zur Wehr. Zwischen dem Lager der Achäer und den Mauern von Ilion türmten sich die Leichen, als die großen Helden beider Seiten zum Kampf gegeneinander antraten und fielen. Jedes Mal, wenn ein Tag zur Neige ging, wurden mächtige Scheiterhaufen aufgetürmt, auf denen beide Seiten ihre Toten verbrannten und anschließend über der erkalteten Asche Grabhügel errichteten. Tausende starben im Verlauf der nicht enden wollenden Gefechte.
Der tapfere Hektor, Sohn des Königs Primos und einer der größten Krieger von Ilion, fiel, desgleichen sein Bruder Paris. Unter den vielen Toten auf Seiten der Achäer waren auch der gewaltige Achilles und sein Freund Patroklos. Nachdem ihre größten Helden erschlagen waren, wollten die Führer der Achäer, die Könige Agamemnon und Menelaos, die Belagerung aufgeben und nach Hause segeln. Die Mauern der Stadt hatten sich als unüberwindbar erwiesen. Zudem wurden die Nahrungsmittel knapp, da sie sich aus den umliegenden Ländereien verpflegen mussten, wo bald kein Feld mehr Früchte trug, während die Dardaner von ihren Bundesgenossen versorgt wurden, die in diesem Krieg zu ihnen hielten.
Bedrückt und von der Niederlage überzeugt, wollten sie ihr Lager abbrechen und davonfahren, als der listenreiche Odysseus, der König von Ithaka, einen Plan für einen allerletzten Angriff ausheckte.
Während Ilion feierte, kehrte die Flotte der Achäer im Schutz der Nacht zurück. Eilends ruderten die Männer von der nahe gelegenen Insel Tenedos los, wo sie sich tagsüber verborgen hatten, geleitet von einem Leuchtfeuer, das Sinon entfacht hatte. Wieder zogen sie ihre Schiffe an Land, legten die Rüstungen an und marschierten leise über die Ebene. Doch diesmal führten sie einen mächtigen Baumstamm mit, der in Schlingen aus geflochtenem Tauwerk hing.
Bei mondloser Nacht rückten sie bis auf hundert Meter an die Mauern vor, ohne entdeckt zu werden. Von Odysseus geführte Späher krochen zu dem großen, pferdeähnlichen Standbild und schoben es vor das Tor.
Unterdessen erschlug Sinon die beiden schlafenden Wachen oben im Turm. Da er das Tor nicht allein öffnen konnte – zehn starke Männer waren nötig, um den schweren Balken zu heben, mit dem die fast zehn Meter hohen Flügel verriegelt waren –, wandte er sich mit einem leisen Ruf an Odysseus.
»Die Wachen sind tot. In der Stadt sind alle betrunken oder schlafen. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, da ihr das Tor aufbrechen könnt.«
Sofort befahl Odysseus den Männern, die den riesigen Stamm getragen hatten, ihre Last auf eine schmale Rampe zu legen, die ins Innere des Pferdes führte. Während der eine Trupp von unten schob, kletterten andere Achäer hinein und zogen den Stamm in den Dachaufbau, hievten ihn hoch und befestigten die Tauschlingen, an denen er hing, am Giebelsparren. Die Dardaner hatten nicht erkannt, was es mit dem von Odysseus ersonnenen Bauwerk für eine Bewandtnis hatte – dass es kein Pferd war, sondern ein Sturmbock.
Die Männer unter dem Dachaufbau wuchteten den Stamm so weit wie möglich zurück und stießen ihn dann nach vorn.
Mit einem dumpfen Schlag traf der spitze Bronzesporn, der vorn am Stamm angebracht war, auf das hölzerne Tor, das bis in die Angeln erschüttert wurde, aber noch nicht aufsprang. Wieder und immer wieder prallte die Ramme gegen die fast einen halben Meter dicken, mit Balken verstärkten Flügel. Bei jedem Stoß splitterte das Holz, aber es gab nicht nach. Die Achäer befürchteten mittlerweile, dass ein Dardaner die Schläge hören, zur Mauer laufen, ihr Heer entdecken und die Krieger wecken könnte, die nach der allzu voreiligen Siegesfeier im Schlafe lagen. Auch Sinon hielt von der Mauerkrone aus Ausschau, ob irgendein Bewohner der Stadt aufmerksam geworden war. Doch diejenigen, die noch wach waren, meinten nur Donner zu hören, der in der Ferne grollte.
Schon sah es so aus, als ob alle Mühe vergebens wäre, doch mit einem Mal brach einer der Torflügel aus der Angel. Odysseus hielt seine Männer dazu an, sich ein letztes Mal ins Zeug zu legen, und schlang selbst die Arme um die Ramme, um dem Stoß mehr Wucht zu verleihen. Mit aller Kraft, die sie aufbieten konnten, schmetterten die Krieger den Sporn gegen das trutzige Tor.
Zunächst schien es auch diesmal nicht nachgeben zu wollen, doch dann hielten die Achäer den Atem an, als der Flügel knarrend und ächzend aus der zweiten Angel brach, nach innen kippte und mit einem Donnerhall aufs Pflaster schlug.
Unter wahnwitzigem Geheul, wie eine Meute ausgehungerter Wölfe, drangen die Achäer in Ilion ein. Einer Springflut gleich, der niemand Einhalt gebieten konnte, stürmten sie durch die Straßen. Die ohnmächtige Wut, die nach zehn Wochen langen, unentwegten Kampfes, bei dem viele ihrer Gefährten der Tod ereilt hatte, in ihrer Brust brannte, schlug in Blutgier und wilde Barbarei um. Niemand war vor ihren Spießen und Schwertern sicher. Um sich hauend und stechend brachen sie in die Häuser ein, töteten die Männer, raubten die Wertsachen und verschleppten die Frauen und Kinder, um hernach alles in Flammen zu stecken.
Die schöne Kassandra flüchtete in den Tempel, wo sie sich im Schutz der Wachen sicher wähnte. Doch Ajax, einer der großen Krieger der Achäer, ließ sich dadurch nicht beirren. Er schändete Kassandra zu Füßen des Standbilds der Göttin. Später sollte er sich, von Reue geplagt, in sein Schwert stürzen.
Die Krieger von Ilion konnten dem grimmen Feind nicht widerstehen. Verwirrt und benommen, trunken vom Wein, torkelten sie aus ihren Betten. Doch ihre Gegenwehr war zu schwach, sie wurden erschlagen, wo immer sie Widerstand leisteten. Nichts konnte die Eindringlinge aufhalten, niemand das Verhängnis verhindern, das über die Stadt hereinbrach. Bald schon flossen Ströme von Blut durch die Straßen. Die Dardaner fochten und fielen, und zumeist starben sie eines elenden Todes. Viele, die in den letzten Atemzügen lagen, mussten noch mit ansehen, wie ihre Häuser in Flammen aufgingen und ihre Angehörigen von den Siegern verschleppt wurden, mussten sich die Schreie ihrer Frauen, das Weinen ihrer Kinder anhören, ehe es im Geheul der Hunde unterging, die zu tausenden durch die Stadt streiften.
König Priamos wurde mitsamt seinem Gefolge und seiner Leibwache erbarmungslos niedergemetzelt. Hekabe, seine Frau, wurde in die Sklaverei entführt. Die Achäer plünderten den Palast, rissen das Gold von Säulen und Decken, schleiften die Wandbehänge und die vergoldeten Möbel davon und steckten die einstmals so prachtvollen Gemächer in Flammen.
Blut troff von den Schwertern und Speeren eines jeden Achäers, die sich wie ein wild gewordenes Wolfsrudel inmitten einer Herde von Schafen gebärdeten. Selbst alte Männer und Frauen, die vor Angst erstarrt oder zu gebrechlich waren, um zu fliehen, wurden nicht verschont.
Die letzten Heldenkrieger der Dardaner wurden einer nach dem andern erschlagen, bis niemand mehr die Lanze wider die blutrünstigen Achäer erheben konnte. Ihre Leiber verbrannten in den Häusern der Stadt, dort, wo sie gefallen waren, als sie ihre Habe und das Leben ihrer Liebsten verteidigen wollten.
Die Bundesgenossen der Dardaner – die Thraker, die Lykier, die Kikonen und die Myser – setzten sich tapfer zur Wehr, doch auch sie wurden rasch überwältigt. Die Amazonen, stolze Kriegerinnen, die im Heer von Ilion fochten, kämpften bis zum bitteren Ende und töteten viele Eindringlinge, bis sie vom übermächtigen Feind erschlagen wurden.
Jedes Haus, jede Hütte in der Stadt stand jetzt in hellen Flammen, und der Feuerschein färbte den Himmel, doch das hemmungslose Morden und Plündern der Achäer ging weiter. Es war, als wollte der Schrecken nie ein Ende nehmen.
Erst als die Achäer des blutigen Tobens müde wurden, verließen sie die brennende Stadt, schleppten ihr Diebesgut davon und trieben die menschliche Beute zu ihren Schiffen. Die gefangenen Frauen, außer sich vor Trauer um ihre hingemordeten Männer, weinten bitterlich, als sie samt ihren verängstigten Kindern weggeführt wurden, wussten sie doch, welch schlimmes Los sie als Sklaven im fernen Achäerland erwartete. In dem grausamen Zeitalter, in dem sie lebten, war dies so Brauch, und obwohl ihnen davor graute, würden sie sich irgendwann mit ihrem Schicksal abfinden. Manche wurden später von ihren Häschern zum Weib genommen, gebaren ihnen Kinder und führten ein langes, erfülltes Leben. Andere hingegen, die misshandelt und geschändet wurden, starben eines frühen Todes. Nirgendwo ist aufgezeichnet, was aus den Kindern wurde.
Das Grauen, das die abziehende Heerschar hinterließ, war indes noch lange nicht vorüber. Viele, die nicht durch das Schwert umgekommen waren, starben den Flammentod, als die lodernden Dächer einbrachen und ihnen den Fluchtweg aus den brennenden Häusern versperrten. Weithin leuchtete die orange-rote Feuerglut, aus der tanzende Funken und Ascheflocken bis zu den Wolken emporwirbelten, die von der See her über die unselige Stadt zogen. Sie kündete von einer Gräueltat, wie sie im Lauf der Jahrhunderte noch oftmals begangen wurde.
Nur wenige hundert waren Tod und Zerstörung entronnen, weil sie ins Landesinnere geflohen und sich in den nahe gelegenen Wäldern verborgen hatten, bis die Flotte der Achäer im Nordosten am Horizont verschwand, dort, wo sie hergekommen war. Zaghaft und zögernd kehrten die Überlebenden von Ilion in ihre einstmals so stolze Stadtfeste zurück, wo sie nur mehr die mächtigen Mauern vorfanden, die einen Haufen schwelender Trümmer umgaben, der einen widerwärtigen Geruch nach Tod und verbranntem Fleisch verströmte.
Sie mochten ihre Häuser nicht wieder aufbauen, sondern zogen in ein anderes Land, wo sie eine neue Stadt gründeten. Im Laufe der Jahre wurden die Asche und die verglühten Überreste vom Wind über der Ebene verstreut, und die Pflasterstraßen und steinernen Mauern versanken im Sand.
Nach einiger Zeit erstand die Stadt wieder, doch sie erblühte nie mehr zu einstiger Größe. Von Erdbeben, Dürre und Seuchen heimgesucht, ging sie schließlich ein weiteres Mal unter und blieb zwei Jahrtausende lang öde und verlassen. Doch ihr Ruhm erstrahlte von neuem, als rund dreihundert Jahre später ein Dichter namens Homer zwei Epen verfasste, in denen er den großen Kampf, der fortan Trojanischer Krieg genannt wurde, und die Irrfahrten des griechischen Helden Odysseus besang.
Odysseus war listig und gerissen und schreckte auch vor Mord und Totschlag nicht zurück, doch am schändlichen Treiben seiner Waffenbrüder mit den versklavten Frauen wollte er nicht teilhaben. Zwar durften sich seine Männer austoben, doch er nahm nur die Schätze mit, derer er bei der Zerstörung der verhassten Stadt, vor der so viele seiner Gefährten gefallen waren, habhaft geworden war. Odysseus war der Einzige unter den Achäern, der keine der schönen Troerinnen verschleppte und zu seiner Mätresse machte. Er sehnte sich nach seiner Frau Penelope und seinem Sohn, die er seit vielen Monaten nicht mehr gesehen hatte, und wollte auf die Insel Ithaka zurückkehren, in sein Königreich, so schnell ihn die Winde trugen.
Nachdem er vor den Mauern der niedergebrannten Stadt den Göttern ein Opfer dargebracht hatte, ließ Odysseus die Segel setzen und fuhr mit seiner kleinen Flotte von günstigen Winden getrieben gen Südwesten, der Heimat entgegen.
Etliche Monate später, nach einem heftigen Sturm auf hoher See, schleppte sich Odysseus eher tot als lebendig durch die Brandung und kroch auf der Insel der Phäaken an Land. Erschöpft fiel er auf einem Laubhaufen am Strand in tiefen Schlaf. Dort entdeckte ihn später Nausikaa, die Tochter des Alkinoos, des Königs der Phäaken. Neugierig ging sie zu ihm und schüttelte ihn, um festzustellen, ob er noch lebte.
Er erwachte, blickte zu ihr auf und war gebannt von ihrer Schönheit. »Bewundernswert bist du, Weib, so wie der Dattelpalmspross, den ich einstens beim Altar des Apollon auf Delos aus dem Boden emporwachsen sah.«
Sie war von dem Gestrandeten angetan und brachte ihn zum Palast ihres Vaters, wo er sich als König von Ithaka zu erkennen gab und in allen Ehren empfangen wurde. König Alkinoos und seine Gemahlin Arete boten ihm ein Schiff an, das ihn in seine Heimat bringen sollte. Doch zuvor musste er ihnen versprechen, dass er dem König und seinem Hofstaat von dem großen Krieg und den Abenteuern berichtete, die er erlebt hatte, nachdem er von Ilion aufgebrochen war. Ein üppiges Gelage wurde zu Ehren des Odysseus ausgerichtet, worauf der sich seinerseits bereit erklärte, seine Heldentaten zu schildern und von seinem Missgeschick zu erzählen.
»Bald nach unserem Aufbruch aus Ilion«, so begann er, »wurden wir von widrigen Winden weit aufs Meer hinausgetragen. Zehn Tage lang waren wir ohnmächtig gegen die tobende See, ehe wir endlich an fremden Gestaden landeten. Dort wurden meine Männer und ich freundlich willkommen geheißen von den Lotophagen, den Lotosessern, wie wir die Einheimischen nannten, weil sie die Früchte eines uns fremden Baumes verzehrten, die ihnen ein beständiges Hochgefühl bescherten. Manche meiner Männer kosteten ebenfalls von der Lotusfrucht, wurden aber bald teilnahmslos und verspürten nicht mehr den Wunsch, nach Hause zu segeln. Als ich sah, dass unsere Heimfahrt dort enden könnte, ließ ich sie mit Gewalt auf die Schiffe schaffen. Rasch setzten wir die Segel und ruderten hurtig hinaus auf die See.
Da ich mich irrtümlich weit im Osten wähnte, segelte ich gen Westen, steuerte nach den Sternen des Nachts und nach dem Stand der Sonne bei Tag. Die Flotte kam an etlichen dicht bewaldeten Inseln vorüber, auf die ein beständiger warmer Regen fiel. Die Inseln wurden von einer Menschenrasse bewohnt, die sich Kyklopen nannte, träge Tölpel, die große Schaf- und Ziegenherden weideten.
Ich nahm einen Trupp Männer mit und suchte nach Nahrung. An einer Bergflanke stießen wir auf eine Höhle, die als Stallung diente, mit einem Gatter versperrt, damit das Vieh nicht fliehen konnte. Wir wollten dieses Geschenk der Götter dankbar annehmen und banden etliche Schafe und Ziegen zusammen, um sie zu den Schiffen zu treiben. Mit einem Mal hörten wir schwere Schritte, und bald darauf füllte ein Hüne von Mann den Höhleneingang. Er trat ein, wälzte einen mächtigen Felsblock vor die Öffnung und nahm sich dann seiner Herde an. Wir aber verbargen uns im Dunkel und wagten kaum zu atmen.
Nach einiger Zeit fachte er die schwelende Glut in der Feuergrube an und bemerkte uns, wie wir uns an die hinterste Wand der Grotte drängten. Niemand hat ein hässlicheres Gesicht als der Kyklop, der nur ein rundes, nachtdunkles Auge besaß. ›Wer seid ihr?‹, herrschte er uns an. ›Warum seid ihr in mein Heim eingedrungen?‹
›Wir sind keine Eindringlinge‹, gab ich ihm zur Antwort. ›Wir kamen in unseren Booten an Land, um unsere Fässer mit Wasser zu füllen.‹
›Meine Schafe wolltet ihr stehlen‹, dröhnte der Riese. ›Ich werde meine Freunde und Nachbarn rufen. Bald werden hunderte kommen, worauf wir euch allesamt kochen und verzehren werden.‹
Obgleich wir achäische Krieger waren, die in einem langen und harten Krieg gefochten hatten, wussten wir doch, dass wir gegen ihre Überzahl nicht bestehen konnten. Ich nahm einen langen Balken vom Gatter eines Schafpferchs und schnitzte ihn mit meinem Schwert spitz zu. Dann bot ich ihm einen aus Ziegenhaut gegerbten Trinkschlauch voll süßen Weines an und sagte: ›Hier, Kyklop, trink den Wein, den ich dir schenke, damit du uns am Leben lässt.‹
›Wie heißt du?‹, wollte er von mir wissen.
›Niemand rufen mich mein Vater und meine Mutter.‹
›Was für ein unsinniger Name ist das?‹ Wortlos leerte das scheußliche Ungetüm den Weinschlauch, lehnte sich an die Wand und fiel in trunkenen Schlaf.
Ich aber ergriff den langen Balken, rannte zu dem schlafenden Riesen und stieß die scharfe Spitze in sein einziges Auge.
Vor Schmerz brüllend torkelte er nach draußen, zog den Pfahl aus seinem Auge und rief um Hilfe. Die Kyklopen, die im Umkreis in Höhlen hausten, vernahmen sein Geschrei und riefen: ›Will dich einer töten?‹
›Freunde, Niemand will mich mit List und Stärke ermorden‹, schrie er zurück.
Sie meinten, er wäre dem Wahnsinn verfallen, und schliefen weiter. Wir aber rannten zu unseren Schiffen, von wo aus ich den blinden Riesen mit höhnischen Worten schmähte.
›Hab Dank, du törichter Kyklop, für die Schafe, die du uns gabst. Und wenn deine Freunde dich fragen, wer dir das Augenlicht raubte, so berichte ihnen, dass es Odysseus war, der König von Ithaka, der dich überlistet hat.‹«
»Bist du danach schiffbrüchig geworden, bevor du hier, auf der Insel der Phäaken, gelandet bist?«, fragte der gütige König.
Odysseus schüttelte den Kopf. »Erst viele Monate später.« Er trank einen Schluck Wein, ehe er fortfuhr. »Nachdem wir von Wind und Strömung weit gen Westen getragen wurden, stießen wir auf Land und warfen vor der Insel Äolia die Anker aus. Dort lebte der gütige König Äolos, der Sohn des Hippotes, des Lieblings der Götter. Er hatte sechs Töchter und sechs stattliche Söhne, deswegen musste er Söhne und Töchter miteinander vermählen. Sie lebten alle zusammen im Palast, wo er mit ihnen und seiner Gattin alle Tage ein Fest feierte und sich jedem erdenklichen Wohlleben hingab.
Vom gütigen König mit Vorräten versorgt, segelten wir los. Aber bald schon gerieten wir in raue See. Erst am siebten Tag, als sich die Gewässer beruhigt hatten, erreichten wir den Hafen einer turmreichen Stadt. Telepylos hieß sie und war der Sitz der Lästrygonen. Meine Flotte steuerte durch die schmale Einfahrt zwischen zwei felsigen Landzungen und warf die Anker aus. Dankbar darum, dass wir wieder festen Boden unter den Füßen hatten, erkundeten wir das Land und begegneten einer Jungfrau, die Wasser schöpfte.
Als wir sie fragten, wer ihr König sei, wies sie uns den Weg zum Haus ihres Vaters. Doch als wir dort eintrafen, stellten wir fest, dass seine Frau eine gewaltige Riesin war, groß wie ein mächtiger Baum, und wir erstarrten bei ihrem grausigen Anblick vor Entsetzen.
Sie rief ihren Gemahl, den Antiphates, der noch riesiger war als sie und zweimal so groß wie der Kyklop. Entsetzt flohen wir zu unseren Schiffen. Doch König Antiphates rief brüllend sein Volk zu den Waffen, und bald darauf eilten tausende Männer herbei, riesenhaft wie Giganten, und warfen von den Klippen herab Felsen auf uns, die fast so groß wie unsere Schiffe waren, und versenkten die ganze Flotte. Nur mein Schiff war geschickt hinter einem Felsen vertäut, sodass es die Steine nicht trafen.
Meine Männer wurden ins Hafenbecken geschleudert, wo die Lästrygonen sie aufspießten wie Fische und ihre Leiber an Land zerrten, sie ausraubten und dann verzehrten. Binnen weniger Minuten rettete ich mich mit meinem Schiff aufs offene Meer. Doch mich befiel tiefe Trauer. Wir hatten nicht nur unsere Freunde und Gefährten verloren, sondern auch die Schiffe, die mit all den Schätzen beladen waren, die wir in Ilion erbeutet hatten. Unser gewaltiger Anteil am Gold der Dardaner lag nun am Grunde des Hafens der Lästrygonen.
Außer uns vor Kummer segelten wir weiter, bis wir zur Insel Äa kamen, der Heimat der Kirke, einer berühmten und bezaubernden Königin, die als Halbgöttin verehrt wurde. Berückt vom Liebreiz der schönen, prachtvoll gewandeten Kirke, freundete ich mich mit ihr an und verweilte drei Monde lang bei ihr. Ich wollte noch länger dort bleiben, doch meine Männer ermahnten mich, endlich an die Rückkehr in die Heimat zu denken, sonst brächen sie ohne mich auf.
Unter Tränen ließ Kirke mich ziehen, doch sie bestand darauf, dass ich eine weitere Reise unternehmen sollte. ›Du musst zum Haus des Hades segeln und die Seelen der Toten nach der Zukunft befragen. Im Schattenreich wirst du den Tod verstehen lernen. Und wenn du deine Fahrt fortsetzt, so hüte dich vor dem Gesang der Sirenen, denn sie werden dich und deine Männer an ihrem felsigen Eiland in den sicheren Tod locken. Verschließe deine Ohren, damit du ihre betörenden Lieder nicht hörst. Wenn ihr der Versuchung der Sirenen entronnen seid, werdet ihr an schroffen Felszacken vorübersegeln, welche die Plankten heißen. Nichts, nicht einmal ein Vogel kann sie überwinden. Dort liegen nur Bretter von Schiffen und Leichen, denn bis auf eines fuhr jedes Schiff, das die Plankten passieren wollte, in sein Verderben.‹
›Und welches Fahrzeug kam durch?‹, fragte ich.
›Die Argo, das Schiff des ruhmreichen Jason.‹
›Und danach segeln wir in ruhiger See?‹
Kirke schüttelte das Haupt. ›Danach werdet ihr zu einem zweiten Felsberg gelangen, der sein spitzes Haupt in die Wolken steckt. Er wird ewig von dunklem Gewölk umfangen und von keinem Sonnenstrahl erleuchtet, ist ganz aus glattem Gestein aufgetürmt, das niemand erklimmen kann. Mitten darin ist eine Höhle, schwarz wie die Nacht. In ihr haust die Skylla, ein schreckliches Ungeheuer, das jeden zerfleischt, der ihm nahe kommt. Zwölf unförmige Füße und sechs Schlangenhälse hat die Unholdin, und auf jedem grinst ein scheußlicher Kopf mit drei dichten Reihen von Zähnen, mit denen sie ihre Opfer zermalmt. Hütet euch vor ihren schnappenden Häuptern und rudert schnell, sonst wird euch alle der Tod ereilen. Danach müsst ihr die Gewässer befahren, in denen die Charybdis lauert, ein mächtiger Strudel, der euer Schiff in die Tiefe reißt. Seht zu, dass ihr sie passiert, wenn sie schläft.‹
Nachdem ich mich unter Tränen von Kirke verabschiedet hatte, nahmen wir unsere Plätze auf dem Schiff ein und legten uns in die Ruder.«
»Seid Ihr wirklich in die Unterwelt gefahren?«, murmelte Arete, des Königs Alkinoos bezaubernde Gemahlin, mit bleichem Gesicht.
»Ja, wir folgten den Anweisungen der Kirke und segelten zum Hades, diesem furchtbaren Reich der Toten. Nach fünf Tagen befanden wir uns im dichten Nebel am Strome Okeanos, der die Erde umgibt. Der Himmel war verhüllt, und wir fuhren durch ewige Dunkelheit, in die niemals ein Sonnenstrahl dringt. Wir zogen das Schiff an Land. Ich stieg allein aus und lief, bis ich zu einer großen Grotte in der Flanke eines Berges kam. Dort setzte ich mich und wartete.
Bald darauf drängten die Seelen der Verschiedenen aus der Felsenkluft und umflatterten mich mit schrecklichem Stöhnen. Entsetzen überkam mich, als meine Mutter erschien. Ich wusste nicht, dass sie gestorben war, denn als ich nach Ilion aufbrach, hatte sie noch gelebt.
›Mein lieber Sohn‹, murmelte sie mit hohler Stimme, ›wie kamst du lebendig in unsere Todesnacht? Bist du noch immer nicht nach Ithaka zurückgekehrt?‹
Mit Tränen in den Augen berichtete ich ihr von den Irrfahrten und dem Tod meiner Krieger auf der Heimreise von Ilion.
›Ich starb an gebrochenem Herzen, aus Gram und Furcht, meinen Sohn niemals wiederzusehen.‹
Bei ihren Worten weinte ich und wollte sie in die Arme schließen, doch sie zerging wie ein Dunsthauch, den niemand zu fassen vermag.
In Scharen kamen sie, Männer und Frauen, die ich einst kannte und achtete. Sie kamen, erkannten mich und nickten schweigend, ehe sie wieder in die Grotte zurückkehrten. Zu meinem Erstaunen sah ich meinen alten Gefährten, den König Agamemnon, unseren Führer vor Ilion. ›Bist du auf See gestorben?‹, fragte ich.
›Nein, mein Weib Klytämnestra mit ihrem Buhlen Ägist und ihrer verräterischen Bande hat mich ermordet. Tapfer setzte ich mich zur Wehr, doch sie waren in der Überzahl und überwältigten mich. Auch Kassandra, die Tochter des Priamos, haben sie gemeuchelt.‹
Danach kamen der edle Achilles, sein Freund Patroklos und der große Ajax, die sich nach ihrer Sippe erkundigten. Doch ich konnte ihnen nichts berichten. Wir sprachen über die alten Zeiten, bis auch sie in die Unterwelt zurückkehrten. Die Seelen anderer Freunde und Kriegsgefährten traten zu mir und erzählten mir von ihrem traurigen Geschick.
Ich hatte so viele unserer großen Toten gesehen, dass mir das Herz vor Kummer schwer war. Schließlich konnte ich es nicht länger ertragen. Eilends verließ ich die Kluft und begab mich an Bord meines Schiffes. Ohne einen Blick zurückzuwerfen, segelten wir durch den Nebel, bis wir wieder der Sonne ansichtig wurden, und nahmen Kurs auf das Eiland der Sirenen.«
»Seid ihr unbeschadet an den Sirenen vorbeigekommen?«, erkundigte sich der König.
»O ja«, gab ihm Odysseus zur Antwort. »Doch bevor wir uns der Gefahr stellten, zerschnitt ich eine große Wachsscheibe mit meinem Schwert, knetete sie und strich das weiche Wachs meinen Reisegefährten in die Ohren. Ich befahl ihnen, mich an den Mast zu binden und nicht auf mein Flehen zu achten, sondern weiterzurudern, da wir sonst an den Klippen stranden würden.
Als die Sirenen unser Schiff auf ihr Felseneiland zufahren sahen, stimmten sie ihren bezaubernden Gesang an. ›Komm, Odysseus, Gepriesener, Ruhm der Achäer, lenke das Schiff an Land, um unsere Lieder zu hören. Denn noch ruderte keiner vorbei im dunklen Schiffe, ehe er aus unserem Mund die Honigstimme vernommen. Jeder kehrt fröhlich zurück, denn er ist dann weiser und hat vieles erfahren.‹
Ihr Gesang war so betörend, dass ich meine Männer anflehte, den Kurs zu ändern, doch sie banden mich nur noch fester an den Mast und ruderten mit rascheren Schlägen, bis die Sirenen nicht mehr zu hören waren. Erst dann zogen sie das Wachs aus ihren Ohren und befreiten mich vom Mast.
Sobald wir das Felseneiland passiert hatten, erwarteten uns mächtige Wogen und der laute Donner der See. Ich ermahnte die Männer, kräftiger zu rudern, während ich das Schiff durch die kochende Brandung steuerte. Ich hatte die Freunde vor der Charybdis gewarnt, nicht aber vor dem Ungeheuer Skylla, das gegenüber drohte, da ich befürchtete, die Gefährten würden die Ruder fahren lassen und sich am Schiffsboden zusammendrängen. Wir kamen zu der von Felsen gesäumten Durchfahrt und gerieten in die wirbelnden Wasser der Charybdis, die brodelte wie ein Kessel über dem Feuer. Während wir mit starrem Entsetzen unser Ende erwarteten, schnappte von oben die Skylla zu und ergriff sechs meiner tapfersten Gefährten. Ich hörte ihre verzweifelten Schreckensschreie, als sie hoch in die Lüfte gerissen wurden, sah ihre Arme und Beine, die sie mir in Todesqual entgegenreckten, ehe sie von den scharfen Schlangenzähnen zermalmt wurden. Es war der entsetzlichste Anblick, der mir auf der Irrfahrt widerfuhr.
Als wir den Ungeheuern glücklich entronnen waren, dröhnte Donner am Himmel. Blitze trafen das Schiff und erfüllten die Luft mit Schwefelgestank. Die furchtbaren Naturgewalten schlugen das Schiff in Stücke und schleuderten meine Gefährten in das tobende Wasser, wo sie jämmerlich ertranken.
Ich hingegen fand den Mast, um den ein langes Lederseil geschlungen war, und band mich an einem Bruchstück des geborstenen Kiels fest. Rittlings setzte ich mich auf das notdürftige Floß und ließ mich von Winden und Strömung treiben. Viele Tage später, als ich mich kaum noch unter den Lebenden wähnte, strandete mein Floß auf der Insel Ogygia, der Heimat der Kalypso. Die Schwester der Kirke war eine schöne Frau von großer Klugheit und verführerischem Reiz. Vier ihrer Untertanen fanden mich am Strand und trugen mich zu ihrem Palast, wo sie mich aufnahm und mich gesund pflegte.
Eine Weile lebte ich glücklich auf Ogygia, liebevoll umsorgt von Kalypso, die das Lager mit mir teilte. Wir vergnügten uns in einem herrlichen Garten, in dem vier klare Quellen entsprangen. Die Bäche schlängelten sich dahin und dorthin durch die Wiesen, gesäumt von Weinstöcken voll reifender Trauben. Grüne Haine mit Schwärmen bunter Vögel, die um die Zweige schwirrten, wucherten auf dem Eiland.«
»Wie lange bist du bei Kalypso geblieben?«, fragte der König.
»Sieben lange Monate.«
»Warum habt Ihr nicht ein Boot gesucht und seid davongesegelt?«, erkundigte sich Königin Arete.
Odysseus zuckte die Achseln. »Weil es auf der Insel kein Boot gab.«
»Und wie seid Ihr dann von dort weggekommen?«
»Die edle, sanftmütige Kalypso wusste um meinen Kummer. Sie weckte mich eines Morgens und teilte mir mit, dass sie meine Heimkehr wünsche. Sie brachte mir Werkzeug, führte mich in den Wald und half mir beim Schlagen der Hölzer, aus denen ich ein seetüchtiges Floß zimmerte. Aus Rinderhäuten nähte sie Segel für mich und besorgte Nahrung und Wasser. Nach fünf Tagen war ich bereit zur Abfahrt. Aber ich war bedrückt, denn sie weinte bitterlich, als sie mich ziehen ließ. Sie war einzigartig unter den Frauen, eine, die jeder Mann begehrt. Wenn ich Penelope nicht noch mehr geliebt hätte, wäre ich mit Freuden bei ihr geblieben.« Odysseus hielt inne, und eine Träne trat ihm ins Auge. »Ich fürchte, sie starb vor Kummer und Einsamkeit, nachdem ich sie verlassen hatte.«
»Was ist aus Eurem Floß geworden?«, wandte Nausikaa ein. »Ihr wart an Land gespült, als ich Euch fand.«
»Siebzehn Tage lang war die See ruhig, doch dann wütete sie von neuem. Peitschender Regen fiel vom Himmel, und ein heftiger Sturm riss das Segel fort. Mächtige Wellen zerschlugen mein zerbrechliches Fahrzeug, bis es kaum mehr zusammenhielt. Zwei Tage lang trieb ich hilflos dahin, ehe ich schließlich an eure Gestade gespült wurde, wo du, liebreizende Nausikaa, mich gefunden hast.« Er stockte kurz. »Und so endet die Geschichte meiner Mühsal und Entbehrungen.«
Wie gebannt hatten alle, die am Gastmahl teilnahmen, der unglaublichen Erzählung des Odysseus zugehört. Jetzt erhob sich König Alkinoos und wandte sich an seinen Gast. »Wir fühlen uns geehrt, dass wir einen so edlen Gast in unserer Mitte haben, und stehen tief in deiner Schuld, weil du uns auf so wunderbare Weise unterhalten hast. Daher überlasse ich dir zum Zeichen meiner Wertschätzung mein schnellstes Schiff samt Ruderern, auf dass es dich in deine Heimat Ithaka bringe.«
Mit bescheidenen Worten bedankte sich Odysseus für die Großmut des Königs. Doch es drängte ihn zum Aufbruch. »Lebt wohl, König Alkinoos. Mögen die Himmlischen dich und deine Gemahlin, die hohe Herrin Arete, und eure Tochter Nausikaa für immerdar segnen.«
So sprach Odysseus und trat über die Schwelle des Palastes, worauf er zum Schiff geleitet wurde. Von günstigen Winden über eine ruhige See getragen, erreichte er schließlich die Insel Ithaka, sein Königreich, wo er mit seinem Sohn Telemachos wieder vereint wurde. Dort traf er auch sein Weib Penelope an, von Freiern bedrängt, die sein Hab und Gut verprassten, worauf er sie allesamt erschlug.
So endet die Odyssee, ein Epos, das die Jahrhunderte überdauerte, das stets aufs Neue die Fantasie anregte und jeden, der es gelesen oder die Gesänge gehört hat, in seinen Bann schlug. Doch die Geschichte entspricht nicht ganz den Tatsachen. Jedenfalls ist nur manches daran wahr.
Denn Homer war kein Grieche. Und der Schauplatz der Ilias und der Odyssee ist nicht jene Weltgegend, in der laut der Sage der Trojanische Krieg stattfand.
Die wahre Geschichte von den Abenteuern des Odysseus liest sich ganz anders, aber das sollte man erst viel, viel später erfahren.
ERSTER TEIL Der Hölle Zorn wütet nicht wie die See
15. August 2006Key West, Florida
1
Dr. Heidi Lisherness war bereits im Aufbruch begriffen, weil sie an diesem Abend mit ihrem Mann ausgehen wollte, als sie einen letzten flüchtigen Blick auf die jüngste Aufnahme eines superschnellen Wetterüberwachungssatelliten warf. Sie war eine füllige Frau mit silbergrauen, zu einem Dutt gerafften Haaren, die wegen der Hitze und der Feuchtigkeit, die im August in Florida herrschten, in grünen Shorts und einem dazu passenden Top an ihrem Schreibtisch saß.
Um ein Haar hätte sie den Computer bis zum nächsten Morgen abgeschaltet. Doch dann fiel ihr auf dem letzten Foto, das der über dem Atlantischen Ozean stationierte Satellit aufgenommen hatte, eine kaum wahrnehmbare Wolkenbildung südwestlich der Kapverden auf, einer Inselgruppe vor der afrikanischen Küste. Sie beugte sich näher an den Bildschirm und sah sich die Sache genauer an.
Für das ungeübte Auge waren am Monitor lediglich ein paar harmlos wirkende Wolken zu sehen, die über der azurblauen See trieben. Heidi aber erkannte etwas weitaus Bedrohlicheres. Sie verglich das Bild mit einer Aufnahme, die der Satellit zwei Stunden zuvor übermittelt hatte. Die Kumuluswolken, Vorboten eines sich anbahnenden tropischen Sturmes, hatten sich schneller zusammengebraut, als sie es in den achtzehn Jahren, in denen sie in Diensten des Hurricane Center der National Underwater & Marine Agency Wirbelstürme über dem Atlantik überwachte und deren Entwicklung vorhersagte, jemals erlebt hatte. Sie vergrößerte die beiden Aufnahmen des noch jungen Sturmtiefs.
Ihr Mann Harley, ein leutselig wirkender Mann mit Walross-Schnurrbart, kahlem Kopf und randloser Brille, kam in ihr Büro und warf ihr einen unwirschen Blick zu. Harley war ebenfalls Meteorologe, arbeitete aber als Analytiker beim National Weather Service, wo er klimatologische Daten für die Wettervorhersagen auswertete, die an private Flugzeuge, Boote und Schiffe übermittelt wurden. »Wo bleibst du denn?«, sagte er und deutete ungeduldig auf seine Uhr. »Ich habe einen Tisch im Crab Pot reserviert.«
Ohne aufzublicken deutete sie auf die beiden nebeneinander stehenden Bilder auf ihrem Monitor. »Die wurden im Abstand von zwei Stunden aufgenommen. Sag mir, was du davon hältst.«
Harley musterte sie eine ganze Weile. Dann runzelte er die Stirn, rückte seine Brille zurecht und beugte sich weiter vor. Schließlich blickte er zu seiner Frau und nickte. »Eine verdammt schnelle Ballung.«
»Viel zu schnell«, sagte Heidi. »Wenn das so weitergeht, braut sich ein gewaltiger Sturm zusammen.«
»Das kann man nie wissen«, erwiderte Harley nachdenklich. »Manchmal treten sie auf wie ein Löwe und verziehen sich wie ein Lamm. Ist alles schon vorgekommen.«
»Stimmt, aber bei den meisten Stürmen dauert es tage-, manchmal wochenlang, bis sie so eine Stärke erreichen. Der hier ist binnen weniger Stunden entstanden.«
»Trotzdem ist es noch zu früh, um vorherzusagen, in welche Richtung er zieht und wo er seinen Höhepunkt erreicht.«
»Ich habe das ungute Gefühl, dass er so unberechenbar bleiben wird.«
Harley lächelte. »Du hältst mich doch sicher auf dem Laufenden?«
»Der National Weather Service wird als Erster Bescheid bekommen«, sagte sie und gab ihm einen leichten Klaps auf den Oberarm.
»Hast du dir schon einen Namen für deinen neuen Freund ausgedacht?«
»Wenn er so schlimm wird, wie ich es für möglich halte, nenne ich ihn Lizzie. Nach Lizzie Borden, der Axtmörderin.«
»Ein bisschen früh im Jahr für einen Namen, der mit L beginnt, aber er klingt ganz angemessen.« Harley reichte seiner Frau die Handtasche. »Mal sehen, wie er sich bis morgen entwickelt. Dann ist immer noch genügend Zeit. Ich habe Hunger. Komm, wir gönnen uns ein paar Krabben.«
Heidi schaltete das Licht aus, schloss die Bürotür ab und folgte ihrem Mann. Aber sie machte sich nach wie vor Sorgen, als sie sich in den Wagen setzte. Und auch beim Essen war sie nicht bei der Sache. Ständig musste sie an den entstehenden Hurrikan denken, denn wenn ihre Befürchtungen zutrafen, konnte er gewaltige Ausmaße annehmen.
Ein tropischer Wirbelsturm, der über dem Atlantischen Ozean aufzieht, wird als Hurrikan bezeichnet. Im Pazifischen Ozean hingegen wird er Taifun genannt und im Indischen Ozean Zyklon. Ein Hurrikan kann schreckliche Naturgewalten entfesseln, die oft mehr Unheil anrichten als ein Vulkanausbruch oder ein Erdbeben und ein weitaus größeres Gebiet verwüsten.
Wie bei der Zeugung neuen Lebens sind auch zur Entstehung eines Hurrikans eine Reihe von Voraussetzungen erforderlich. Zunächst einmal muss sich das Wasser vor der Westküste Afrikas auf über siebenundzwanzig Grad Celsius erwärmen. Danach kommt es infolge der Sonneneinstrahlung zu einer starken Verdunstung. Wenn diese Feuchtigkeit in kühlere Luftschichten aufsteigt, kondensiert sie und bildet dichte Kumuluswolken, wobei es zu heftigen Regenfällen und Gewittern kommt. Gleichzeitig verdichtet sich die Feuchtigkeit der aufsteigenden Luft und gibt große Hitze ab. Durch die Hitze steigt die wirbelnde Luft immer höher, worauf neue Luft nach unten strömt, um die aufsteigende zu ersetzen. All dies zusammen genommen sorgt dafür, dass sich ein tropisches Tief zu einem Sturm auswächst.
Die aufgewühlte Luft wirbelt jetzt mit einer Geschwindigkeit von bis zu sechzig Kilometern pro Stunde beziehungsweise dreiunddreißig Knoten. Durch den zunehmenden Wind sinkt wiederum der Luftdruck an der Wasseroberfläche. Je tiefer aber der Luftdruck sinkt, desto stärker frischt der Wind auf. In diesem System, wie es von Meteorologen genannt wird, entsteht eine verhängnisvolle Zentrifugalkraft, aufgrund derer sich ein Wall aus Wolken, Wind und Regen bildet und um das Auge des Sturmes herumwirbelt. Innnerhalb dieses Auges scheint die Sonne, die See ist relativ ruhig, und nur die weiß brodelnden Wände ringsum, die bis zu fünfzehntausend Meter hoch aufragen können, deuten auf die gewaltige Energie hin, die dort wirkt.
Bislang wird dieses Wettersystem als tropisches Sturmtief bezeichnet, aber sobald der Wind eine Geschwindigkeit von 120 Stundenkilometern erreicht, wird es zu einem ausgewachsenen Hurrikan. Dieser wird entsprechend der Windgeschwindigkeit nach Stärkegraden eingeteilt. Bei 120 bis 150 Stundenkilometern handelt es sich um einen Hurrikan der Kategorie 1, der als schwach gilt. Kategorie 2, mit einer Windgeschwindigkeit bis zu 175 Stundenkilometern, gilt als mittelmäßig. Unter die Kategorie 3 fällt ein starker Sturm mit einer Windgeschwindigkeit zwischen 175 und 210 Stundenkilometern. Windgeschwindigkeiten bis zu 250 Kilometern pro Stunde, wie sie der Hurrikan Hugo erreichte, der 1989 einen Großteil der Strandhäuser von Charleston, South Carolina, vernichtete, gelten als extrem. Und schließlich gibt es noch die echten Giganten, kapitale Wirbelstürme der Kategorie 5 mit einer Geschwindigkeit von bis zu 320 Stundenkilometern, wie sie der Hurrikan Camille erreichte, der 1969 Louisiana und Mississippi heimsuchte und 256 Todesopfer forderte. Eine verhältnismäßig geringe Zahl, verglichen mit den 8000 Menschen, die bei dem schweren Hurrikan umkamen, der im Jahr 1900 Galveston, Texas, völlig verwüstete. Einen traurigen Rekord, was die Anzahl der Opfer angeht, hält allerdings der tropische Wirbelsturm, der 1970 über die Küste von Bangladesch hereinbrach und fast eine halbe Million Tote hinterließ.
Gewaltig sind auch die Verwüstungen. So verursachte der schwere Hurrikan, der 1926 den Südosten Floridas und Alabama verheerte, einen Schaden, der sich nach heutigem Geldwert auf rund 83 Milliarden Dollar belief. Wie durch ein Wunder kamen bei dieser Katastrophe nur 243 Menschen um.
Niemand allerdings, auch nicht Heidi Lisherness, konnte mit der teuflischen Zielstrebigkeit und der Tobsucht von Hurrikan Lizzie rechnen, der alle bislang bekannten atlantischen Wirbelstürme in den Schatten stellen sollte. Schon kurze Zeit nachdem er seine Kraft aufgebaut hatte, sollte er seinen Zug in Richtung Karibisches Meer antreten, um überall, wo er durchzog, Chaos und Verwüstung anzurichten.
2
Elegant und kraftvoll glitt ein großer, gut viereinhalb Meter langer Hammerhai durch das klare Wasser, wie eine graue Wolke, die über eine Wiese zieht. Die großen Augen zu beiden Seiten des flachen, wie ein Stabilisator wirkenden Auswuchses über seiner Schnauze erfassten eine Bewegung, worauf er mit dem Kopf herumfuhr und das Wesen musterte, das unter ihm durch den Korallenwald schwamm. Das Ding sah nicht wie ein Fisch aus. Es war schwarz, hatte zwei rote Längsstreifen an beiden Seiten, und hinten ragten zwei Flossen heraus. Der mächtige Hai befand es für ungenießbar und setzte seine unermüdliche Suche nach einer ansprechenderen Beute fort, ohne zu ahnen, dass dieses sonderbare Wesen ein Leckerbissen sondergleichen gewesen wäre.
Summer Pitt hatte den Hai bemerkt, beachtete ihn aber nicht weiter, sondern widmete sich ihren Forschungen an dem Korallenriff in der Navidad Bank, siebzig Meilen nordöstlich der Dominikanischen Republik gelegen. Diese rund fünfzig Quadratkilometer umfassende Untiefe bestand aus einer Reihe gefährlicher Korallenriffe, die teils nur einen, teils bis zu dreißig Meter unter dem Meeresspiegel lagen. Im Laufe von vier Jahrhunderten waren mindestens zweihundert Schiffe an den scharfzackigen Korallen zerschellt, die ein aus den Tiefen des Atlantischen Ozeans emporreichendes Unterwassergebirge krönten.
Die Korallen in diesem Gebiet waren wunderschön, kerngesund und ragten hie und da bis zu fünfzehn Meter hoch vom Meeresboden auf. Hier gab es zarte Venusfächer und stattliche Hirnkorallen, bunte Geweihkorallen und Seepeitschen, die überall im weiten Blau wucherten wie in einem prachtvollen Garten voller verlockender Kreuzgänge und Grotten. Summer kam sich vor, als schwimme sie durch ein Labyrinth aus Höhlen und Galerien, die manchmal jählings endeten, mitunter aber auch in Schluchten und Cañons führten, die so breit waren, dass man mit einem schweren Lastwagen hätte hindurchfahren können.
Obwohl die Wassertemperatur gut und gern siebenundzwanzig Grad betrug, steckte Summer Pitt von Kopf bis Fuß in einem Viking Pro Turbo 100, einem strapazierfähigen Trockentauchanzug aus vulkanisiertem Gummi. Der schwere, schwarz-rote Anzug, der keinen Zentimeter ihres Körpers unbedeckt ließ, sollte sie vor den chemischen und biologischen Schadstoffen schützen, deren Auswirkung auf die Korallen sie untersuchen wollte.
Sie warf einen Blick auf ihren Kompass und hielt sich etwas weiter nach links, legte die Hände auf den Rücken und verschränkte sie unter den Doppelflaschen, um den Wasserwiderstand zu mindern, und bewegte sich mit raschen Flossenschlägen vorwärts. Sie kam sich in dem sperrigen Anzug und mit der Vollgesichtsbrille unbeholfen vor.
Ihre Figur konnte man in dem weiten Gummianzug kaum erkennen. Nur die klaren grauen Augen hinter dem Glas und die rote Locke, die unter der Kapuze hervorlugte, deuteten auf ihre Schönheit hin.
Summer liebte die See und tauchte für ihr Leben gern. Jeder Tauchgang war für sie ein Ausflug in eine unbekannte Welt. Oftmals stellte sie sich vor, sie sei eine Meerjungfrau, in deren Adern Salzwasser floss. Auf Drängen ihrer Mutter hin hatte sie am Scripps Institute of Oceanography Meeresbiologie studiert und ihr Diplom mit Auszeichnung erworben. Gleichzeitig hatte ihr Zwillingsbruder Dirk sein Examen in Meerestechnologie an der Florida Atlantic University bestanden.
Kurz nach ihrer Rückkehr nach Hawaii hatte ihnen ihre Mutter mitgeteilt, dass ihr Vater, den sie nie kennen gelernt hatten, Direktor für Spezialprojekte bei der National Underwater & Marine Agency in Washington, D.C., war. Erst jetzt, da sie im Sterben lag, berichtete ihre Mutter von ihrer Liebesbeziehung und schilderte ihnen, weshalb sie ihn im Glauben gelassen hatte, dass sie vor dreiundzwanzig Jahren bei einem Seebeben ums Leben gekommen war. Schwer verletzt und entstellt, wie sie war, hatte sie es für besser gehalten, wenn er sein Leben ohne sie weiterführte, sorglos und unbeschwert. Ein paar Monate danach hatte sie Zwillinge zur Welt gebracht. Im Gedenken an ihre unvergängliche Liebe hatte sie Summer ihren Namen gegeben und Dirk nach seinem Vater genannt.
Nach der Beerdigung waren Dirk und Summer nach Washington geflogen, um Pitt senior kennen zu lernen. Der wiederum war zunächst wie vom Donner gerührt gewesen, als plötzlich eine Tochter und ein Sohn vor ihm standen, von denen er nichts gewusst hatte. Danach war er vor Freude schier außer sich geraten; er hatte geglaubt, die Liebe seines Lebens wäre seit über zwanzig Jahren tot. Zugleich war er aber auch zutiefst bedrückt, als er erfuhr, dass sie all die Jahre über mit einer schweren Behinderung gelebt hatte, ohne ihm Bescheid zu sagen, und erst vor einem Monat gestorben war.
Nachdem er die Sprösslinge, von denen er bislang keine Ahnung gehabt hatte, in die Arme geschlossen hatte, quartierte er sie in dem Hangar ein, in dem er wohnte und seine umfangreiche Sammlung alter Automobile verwahrte. Als er erfuhr, dass sie auf den Rat ihrer Mutter in seine Fußstapfen getreten und sich dem Studium der Meeresforschung gewidmet hatten, sorgte er dafür, dass sie bei der NUMA beschäftigt wurden.
Jetzt, nachdem sie zwei Jahre lang an allerlei Projekten auf sämtlichen Weltmeeren mitgearbeitet hatten, waren sie zum ersten Mal mit einem eigenen Forschungsauftrag unterwegs – sie sollten Proben sammeln und die sonderbaren Schadstoffe untersuchen, die die empfindliche Meeresfauna der Navidad Bank und anderer Korallenriffe in der ganzen Karibik vernichtete.
Der Großteil des Riffes wirkte kerngesund und wimmelte von Fischen. Hier tummelten sich leuchtend rote Schnapper, Papageifische und Zackenbarsche, dort schossen kleine, gelb-rot schillernde Tropenfische um die Korallenäste, an denen sich rot-braune Seepferdchen festklammerten. Muränen reckten die scheelen Köpfe aus den Korallen, klappten grimmig die Mäuler auf und zu, als wollten sie jeden Moment mit ihren nadelspitzen Zähnen zuschlagen. Summer wusste jedoch, dass sie nur deshalb so abschreckend wirkten, weil sie mit dem Maul die Luft aus dem Wasser seihten. Menschen griffen sie nur selten an, wenn man ihnen nicht zu nahe kam. Und selbst dann bissen sie so gut wie nie zu.
Ein Schatten strich über eine Sandkuhle inmitten der Korallen. Sie blickte kurz auf, meinte, der Hai wäre zurückgekehrt, um sie näher in Augenschein zu nehmen, stellte aber fest, dass es nur fünf getüpfelte Adlerrochen waren. Einer scherte aus dem Schwarm aus wie ein Kampfflugzeug, umkreiste sie einmal, musterte sie neugierig, schwang sich dann wieder empor und gesellte sich zu den anderen.
Sie schwamm knapp vierzig Meter weiter, glitt über die hornartigen Auswüchse einer Gorgonenkoralle hinweg und sah plötzlich ein Schiffswrack vor sich. Ein großer, gut anderthalb Meter langer Barrakuda stand über den Trümmern und achtete mit kalten schwarzen Knopfaugen auf alles, was in seinem Revier vor sich ging.
Das Dampfschiff Vandalia war 1876 von einem schweren Hurrikan auf die Navidad Bank getrieben worden und zerschellt. Keiner der hundertachtzig Passagiere und dreißig Besatzungsmitglieder hatte den Untergang überlebt. Bei Lloyds in London, der großen Schifffahrtsversicherungsgesellschaft, war sie längst abgeschrieben worden und galt als spurlos verschollen, bis 1982 ein paar Sporttaucher ihre von Korallen überwucherten Überreste entdeckt hatten. Das Wrack der Vandalia war kaum noch zu erkennen. Nach hundertdreißig Jahren war der Rumpf von vorn bis hinten von Schwämmen und Korallen überwuchert. Nur mehr die Kessel und Maschinen, die zwischen den geborstenen Spanten herausragten, verrieten, dass es sich einstmals um ein stolzes Schiff gehandelt hatte. Die hölzernen Aufbauten hingegen waren größtenteils verschwunden, im Salzwasser verfault oder von den vielen Kleinstlebewesen im Meer vertilgt, die sämtliche organischen Stoffe verzehren.
Die Vandalia, 1864 im Auftrag der West Indies Packery Company gebaut, war achtundneunzig Meter lang und rund zwölf Meter breit, hatte Unterkünfte für insgesamt 250 Passagiere und drei große Frachträume. Sie verkehrte zwischen Liverpool und Panama, wo die Passagiere von Bord gingen und mitsamt der Fracht per Eisenbahn über den Isthmus befördert und von der Pazifikküste aus auf anderen Dampfern nach Kalifornien gebracht wurden.
Nur wenige Taucher hatten Überreste von der Vandalia geborgen, da sie inmitten der Korallen nur schwer zu finden war. Zumal von dem Schiff nur wenig übrig geblieben war, nachdem es in jener schrecklichen Nacht von den gewaltigen Wellenbergen des Hurrikans zerschlagen worden war, der es auf offener See überrascht hatte, ehe es sich auf Hispaniola oder den benachbarten Virgin Islands in Sicherheit bringen konnte.
Summer ließ sich von der leichten Strömung über das alte Wrack tragen, blickte hinab und versuchte sich die Menschen vorzustellen, die sich einst an Deck getummelt hatten. Mit einem Mal hatte sie das Gefühl, als schwebte sie über einem verwunschenen Friedhof, dessen Bewohner ihr aus ferner Vergangenheit zuraunten.
Sie warf immer wieder einen Blick zu dem großen Barrakuda, der reglos im Wasser stand. Der gefährlich wirkende Fisch fand hier Nahrung in Hülle und Fülle, denn in und um die alte Vandalia wimmelte es von allerlei Meeresgetier.
Sie riss sich von ihren trübsinnigen Gedanken an das Unglück los und schwamm vorsichtig um den Barrakuda herum, der sie nicht aus dem Auge ließ. In sicherer Entfernung hielt sie inne, warf einen Blick auf das Finimeter und überprüfte den Luftvorrat in ihren Flaschen, bestimmte dann anhand des GPS-Minicomputers ihre Position, stellte mithilfe des Kompasses fest, in welcher Richtung sich das Unterwasserhabitat befand, in dem sie und ihr Bruder lebten, während sie das Riff untersuchten, und las die Anzeige auf ihrer Taucheruhr. Anschließend ließ sie ein bisschen Luft aus ihrer Tarierweste ab, da sie ihrer Meinung nach etwas zu viel Auftrieb hatte.
Sie war kaum hundert Meter weitergeschwommen, als die leuchtenden Farben der Korallenstöcke mit einem Mal verblassten. Die Schwämme und Polypenkolonien wirkten glasig, waren allem Anschein nach schwer geschädigt und teilweise bereits abgestorben. Auch die Sicht wurde plötzlich sehr viel schlechter, bis sie kaum noch ihre ausgestreckten Hände erkennen konnte.
Sie hatte das Gefühl, als wäre sie in dichten Nebel geraten. Es war der rätselhafte »braune Schlick«, ein Phänomen, das seit einiger Zeit in der ganzen Karibik auftrat. Das Oberflächenwasser wirkte wie eine braune Masse, die nach den Worten der Fischer wie Jauche aussah. Bislang wusste niemand, woher dieser Schlick kam oder was ihn verursachte. Manche Meeresforscher meinten, es handele sich um eine Art Algenblüte, aber den Beweis dafür waren sie bislang noch schuldig geblieben.
Seltsamerweise tötete der Schlick offenbar keine Fische, ganz im Gegensatz zu der berüchtigten Roten Flut. Sie mieden nach Möglichkeit jede Berührung mit den Giftstoffen, gingen mit der Zeit aber trotzdem ein, weil ihre Nahrungsgrundlagen und Verstecke vernichtet wurden. Summer bemerkte, dass die normalerweise bunt leuchtenden Seeanemonen, die mit wogenden Armen in der Strömung nach Futter suchten, ebenfalls schwer geschädigt waren. Vorerst wollte sie nur ein paar Proben einsammeln. Eine genaue Vermessung der Todeszone um die Navidad Bank, Fotoaufnahmen von den Verwüstungen sowie chemische Untersuchungen der Schadstoffe, damit man hoffentlich ein Gegenmittel fand, waren für später vorgesehen.
Der erste Tauchgang dieses Projekts diente nur zur Erkundung, um die Auswirkungen des Schlicks festzustellen, damit sie und ihre Kollegen auf dem in der Nähe stationierten Forschungsschiff das Ausmaß der Schäden abschätzen und einen Plan zum weiteren Fortgang ihrer Untersuchungen ausarbeiten konnten.





























