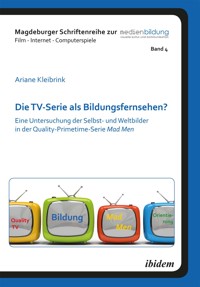
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Magdeburger Schriftenreihe zur Medienbildung
- Sprache: Deutsch
Im Bereich der Fernsehserien machen seit einiger Zeit sogenannte Qualitätsserien von sich reden. Sie sind komplexer angelegt als traditionelle Serien und zeichnen sich durch Genre-Hybridität, kritische gesellschaftliche Themen, erhöhte narratologische Dichte, bekannte Schauspieler, hohes Produktionsbudget, multiperspektivische Erzählweise und ästhetische Visualität aus. Sie kommen im Allgemeinen aus den USA und sind häufig preisgekrönt – wie The Sopranos, Six Feet Under, Breaking Bad, Mad Men oder Homeland. Von einem Wandel in der Fernsehlandschaft ist die Rede, und dementsprechend werden TV-Serien auch zunehmend ein Gegenstand der wissenschaftlichen Auseinandersetzung. Ariane Kleibrink fragt angesichts der Merkmale der Qualitätsserie, welche spezifischen Orientierungsmuster diese für den Zuschauer in komplexen Gesellschaften bereithalten. Sie greift dabei den Ansatz der strukturalen Medienbildung und den Diskurs über Quality-TV auf. Anhand zahlreicher Beispiele zeigt Kleibrink unter Berücksichtigung der strukturellen Eigenschaften der Serie auf, wie diese als gesellschaftlicher Orientierungsrahmen fungiert und Raum für Reflexion gibt. Im Rahmen einer bildungstheoretisch gerahmten Formanalyse der Serie Mad Men arbeitet sie ferner heraus, wie über die Protagonisten das Streben nach personaler Identität unter Bedingungen der Modernisierung inszeniert wird und welche Fragen und Themen Reflexionsanstöße für den Betrachter bieten. Das Buch nimmt im Diskurs über die Qualitätsserie eine neue und spezifische Perspektive im Schnittbereich der Film- und Medienwissenschaft auf der einen und der Erziehungswissenschaftlichen Medienforschung auf der anderen Seite ein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Inhalt
1. Einführung
„A new form of entertainment television has emerged over the past two decades to bothcritical and popular acclaim“ (Mittell 2006, 29).
Verfolgt man die gegenwärtige journalistische, medien- und kulturwissenschaftliche Auseinandersetzung mit aktuellen TV-Serien, besonders aus dem US-amerikanischen Raum, scheint sich ein neuer Trend zu manifestieren. Zahlreiche Autoren leisten Beiträge zur Qualitätsserie als neuerintelligenterMedienform. Serien wieThe Wire,The West Wing,Six Feet Under,Mad Men, Breaking Badund aktuellHomelandsowie einige mehr werden derzeit hochgelobt (vgl. Scharnigg 2012, Alanyali 2012, Kelleter 2012 [online]). Die Berlinale 2013 widmete dem Thema den Panel „TV-Series- The New Cinema?“, in dem mitden Schöpfernder SerieTop Of The Lakeüber den Wandel der Serie und ihre Bedeutung für das Kino diskutiert wurde.
Während das deutsche Fernsehen einen eher schlechten Ruf genießt, werden Qualitätsserien diesem gegenübergestellt, wie hier von der Kulturredaktion des Onlineauftritts der Süddeutschen Zeitung:
„So ist die gebildete Mitte lange vor dem sogenannten 'Unterschichtenfernsehen' geflohen, und zwar zumeist in den Bücherschrank und gelegentlich auch ins Opernhaus. Doch unter der Parole 'Qualitätsfernsehen' ist das Medium in den vergangenen Jahren wieder salonfähig geworden.[...] [M]it diesem Schlagwort[sind]vor allem Serien gemeint, die gerade nicht fürs deutsche Fernsehen produziert wurden“ (Füchtjohann 2012).
In Deutschlandsind diese Serien häufig auf öffentlich-rechtlichen Spartensendern platziert, wie zum BeispielMad Menauf ZDFNeo oderBreaking Badauf ARTE. Da sie nur durch aktives Verfolgen der popkulturellen Publikationen zeitgleich zu ihrer Ausstrahlung in den USA entdeckt und häufig nur auf DVD oder im Internet als Stream rezipiert werden können, sieht Füchtjohann sogar ein Statussymbol in ihnen: „Wer zum Beispiel über die im April angelaufene HBO-Produktion 'girls' mitredet, ist popkulturell offensichtlich gut informiert, kennt sich im Netz gut aus und spricht gut Englisch“ (ders. 2012).
Wie der Titel seines Artikels „Schlaues für Schlaue“ aussagt, drängt sich die Frage auf, was diese hochgelobte Serienform ausmacht. Intelligente Serien für intelligente Menschen? Wie kommt es zu dieser Wahrnehmung?
Die Serie wird immer häufiger zum wissenschaftlichen Gegenstand, besonders seitdem sich die Distributionsarten geändert haben und durch DVD-Boxen und Download- und Streammöglichkeiten im Internet die Serien beziehungsweise einzelne Staffeln als in sich geschlossenes Produkt zeitunabhängig und wiederholt rezipiert werden können. Mit dem Post-Network-Zeitalter (von Amanda Lotz 2007 geprägter Begriff) – gemeint ist eine vielfältigere TV-Landschaft durch mehrere Fernsehkanäle und ihr digitales Angebot – verändert sich die Qualität der Serien, da komplexere Narrationsstrukturen mit einem großen Figurenensemble möglich werden. Autoren und Wissenschaftler heben den cineastischen Stil und die narrative Komplexität der Qualitätsserie hervor. Namhafte Schauspieler, hohes Produktionsbudget, kritische gesellschaftliche Themen, Genre-Hybridität (häufig audiovisuelle Zitate aus anderen Filmen/Romanen), erhöhte Serialität, multiperspektivische Erzählweise und ästhetische Visualität (wiewird erzählt) kennzeichnen die Qualitätsserien (vgl. Cardwell 2007, Nelson 2007, Blanchet 2011).
Nach Kristin Thompson provoziert eine Qualitätsserie in dem Maße, dass wir uns mit dem Medientext auseinandersetzen, er den Zuschauer zum Nachdenkenanregt und auf emotionale Weise bewegt:
„quality series enlightens, enriches, challenges, involves and confronts. It dares to take risks, it’s honest and illuminating, it appeals to the intellect and touches the emotions“ (Thompson 2003, 13).
Diese Argumente legen nahe, dass diese Serien neben ihrem Unterhaltungswert auch einen Bildungswert innehaben, derin dieser qualitativen Studie im Hinblick auf die strukturale Medienbildung untersucht wird.
Zielsetzung
Die strukturale Medienbildung beschäftigt sich mit den drei großen Medienschwerpunkten Film, Internet und Computerspiele,wie Benjamin Jörissen und Winfried Marotzki in dem 2009 veröffentlichten EinführungswerkMedienbildung – Eine Einführungdargelegt haben. Besonders die ersten beiden Kategorien, Film und Internet, werden in der Einführung ausführlich behandelt,undes werdenan Beispielen Bildungsoptionen aufgezeigt.
Ziel dieser wissenschaftlichen Auseinandersetzung ist es, das Bildungspotenzial der Serie, im Besonderen der Qualitätsserie, unter der Perspektive der strukturalen Medienbildung herauszuarbeiten und beispielhaft an der SerieMad Mennachzuvollziehen.
Dabeiwerdendie zentralen Forschungsfragenverfolgt,wie lebensweltliche Orientierung anhand der Protagonisten dargestellt wird und welche Muster und Momente, die dem Zuschauer Reflexionsoptionen ermöglichen können, die Serie bereithält.
Eine zentrale Rolle stellt dabei die Form Serie beziehungsweise Qualitätsserie an sich dar, denn,wie Sarah Kumpf (2011) hervorhebt, werden die Merkmale im Qualitätsserien-Diskurs von den Wissenschaftlern „aus einer allgemeinen Beobachtung heraus, also ohne empirische Grundlage“ (dies., 20) definiert. „Dies ist bisher bezeichnend für den aktuellen Forschungsdiskurs und zeigt, wie wichtig empirische Forschung in diesem Bereich ist“ (ebd.).
Somit soll diese Untersuchung einen Beitrag zum Diskurs der Qualitätsserie leisten.
Als Beispielseriewurdedie SerieMad Menausgewählt, welche wiederholt im Diskurs um Qualitätsserien Erwähnung findet, denn
„[m]it ihrer komplexen und wenig vorhersehbaren Erzählstruktur um Don Draper [Hauptprotagonist der Serie – A.K.], die über Ellipsen und Leerstellen die Zuschauer herausfordert und einbezieht, mit den vielschichtig gezeichneten Figuren und nicht zuletzt ihrem‚cineastischen Stil’weist MADMENwichtige Züge der sogenannten Qualitätsserien auf“ (Köhler 2011, 15, Hervorh. i. Orig.).
Vorgehen
Nach dieser kurzen Hinführung zum Themaerfolgtzu Beginn die bildungstheoretische Verortung dieser Arbeit, indem die strukturale Medienbildungstheorie erläutert wird(Kap. 2).
Daran anschließend erfolgt die Erörterung des Diskurses um die Qualitätsserie (Kap. 3). Hierbei wird neben der Definition der Medienform zunächst dargelegt, wie durch veränderte Distributions-, Rezeptions- und Speichermöglichkeiten sich die Serie zum wissenschaftlichen Gegenstand etablierte. Anschließendwirdauf die aktive Rolle des Zuschauers eingegangenund daraufhin Serienformate und -aufbau vorgestellt. Es folgt ein kurzer Überblick unterschiedlicher Qualitätsvorstellungen und welches Qualitätsverständnis dem Quality-TV-Diskurs zugrunde liegt. Anschließend an eine Betrachtung der unterschiedlichen Ansätze des Aufkommens der Qualitätsserienwerdendie Merkmale dieser mit Beispielen aus der aktuellen Serienlandschaft zusammengetragen.
In Kapitel 4 wird die Qualitätsserie im Kontext der strukturalen Medienbildung betrachtet, unter Berücksichtigung der strukturellen Eigenschaften der Serie, wie sie als Orientierungsrahmen fungieren und wie durch Modalisierungen Raum für Reflexion gegeben werden kann.
Das neoformalistische Filmanalysemodell nach Bordwell und Thompson wird in Kapitel 5 als Forschungsmethodik erläutert. Dabei werden die Grundannahmen des Ansatzes beschrieben sowie das entwickelte Analyseverfahren vorgestellt und die formalen Inszenierungsmittel aufgeführt.
Das Kapitel 6 dient einer inhaltlichen Einführung in die SerieMad Menmit einer tabellarischen Figurenübersicht und einer kurzen Beschreibung der Handlung der analysierten Staffel. Anschließend findet die Form der Serie (Narrationsstruktur) nähere Betrachtung.
Die Analyse der Serie erfolgt in Kapitel 7. Dabei verhandeln die ersten zwei Analysebereiche (Handlungsdimension und Anerkennung) vorrangig Entwicklungen und Umgangsweisen der Protagonisten, während im Bereich Reflexionsweisen auch Momente für Reflexionsoptionen für den Zuschauer herausgearbeitet werden. Im Hinblick auf die strukturale Medienbildungwirdabschließend zu diesem Kapitel eine Zusammenfassung durchgeführt.
Ein allgemeines Fazitwirdin einer Gesamtzusammenfassung der Arbeit in Kapitel 8gezogen, des Weiteren wird ein kurzer Ausblick gegeben.
2. Bildung
In diesem Kapitelwird dasBildungsverständnisbeschrieben, dasdieser Studie zugrunde liegt. Um im empirischen Teil auf die Abschätzung des Bildungspotenzials der SerieMad Meneingehen zu können, werden in den folgenden Zeilen wesentliche Begriffe wie Bildung, Lernen, Orientierungswissen, Reflexion und die Rolle der Medien in diesem Zusammenhang erläutert.
Zunächst ist festzuhalten, dass sich der hier zugrunde liegende Bildungsbegriff von einem materialen Verständnis von Bildung abgrenzt.Das heißt, Bildungist losgelöst von einem Bildungskanon zu verstehen, welcher erlerntes Wissen im Sinne von Informationsanhäufung meint (wie zum Beispiel umfassende Belesenheit oder ein umfangreiches geschichtliches Wissen). In dieser Vorstellung wird „Bildung als Ergebnis des Aneignens bestimmter Inhalte“ (Jörissen/Marotzki 2009, 9) verstanden. Benjamin Jörissen und Winfried Marotzki vertreten hingegen ein formales Bildungsverständnis, bei dem „das Ziel des Bildungsprozesses nicht in Inhalten, sondern in der Form der Selbst- und Weltbeziehung liegt“ (dies. 2009, 11). Bildung bezieht sich in der strukturalen Bildungstheorie auf den Menschen und wendet sich gegen dessen Funktionalisierung, welche mit dem Begriff der Ausbildung verfolgt werden würde (vgl. Jörissen/Marotzki 2009, 9ff.).
2.1 Strukturale Bildungstheorie
Ausgehend von zwei Thesen entwickelte Winfried Marotzki (1990) einen Entwurf einer strukturalen Bildungstheorie. Zum einen erläutert er die These der Individualisierung und zum anderen die These der Kontingenzsteigerung.
Marotzki fußt seine Bildungstheorie auf die zentrale These, dass „gegenwärtig eine Transformation gesellschaftlicher Strukturen und Ordnungsprinzipien von einer Industrie- zu einer Informationsgesellschaft stattfindet“ (Marotzki 1990, 19). Durch computergestützte, technische Neuerungen, die körperliche Arbeit ablösen sowie neue Kommunikationsmöglichkeiten eröffnen, kommt es zu einer Veränderung gegenwärtiger Gesellschaft, die „durch einen vielschichtigen Prozeß der Fragmentierung und Individualisierung gekennzeichnet [ist], der traditionelle Klassenlinien, Organisations- und Politikformen umzustrukturieren scheint“ (ebd., 19f.). Diese Entwicklung führt zu einem neuen Selbstverständnis des Menschen und erfordert ein anderes Erziehungs- und Bildungsverständnis (vgl. Marotzki 1990, 20). In Bezug auf Ulrich Beck erläutert Marotzki, dass der „Individualisierungsschub […] in der Veränderung der Klassenstrukturen, im familiären Beziehungsgefüge und in der Flexibilisierung des Arbeitsortes“ (Marotzki 1990, 22) sowie in zunehmender Arbeitslosigkeit begründet liegt. Identität und „Zentrum des biographischen Entwurfs“ (ebd.) kann nicht mehr eindeutig in Abhängigkeit zu Familie, sozialem Stand und Arbeit gebildet werden, sondern unterliegt größerer Freiheit und muss demnach verstärkt selbst geplant werden. Dass ein Lebensverlauf jedoch nicht mehr nach einem festen Plan zu gestalten ist, dass also Unbestimmtheit bereits einen ständigen Begleiter darstellt, erfordert, dass „Prozesse der Biographisierung gleichsam zur Dauerreflexion moderner Subjektivität“ (Marotzki 1990, 24) werden. Da „Antworten auf die Frage, wie man sein Leben zu organisieren und einzurichten habe, [...] immer weniger verallgemeinert werden [können]“ (ebd.), muss sich das Individuum diese Fragen immer wieder selbst stellen und eigene Antworten darauf entwickeln, also eine ausgeprägte Selbstreflexivität aufweisen.
Neben der Individualisierungs- bzw. Modernisierungsthese erläutert Marotzki die These der Kontingenz, welche mit der These der Komplexitätssteigerung einhergeht und ebenso wichtige Auswirkungen auf ein verändertes Bildungsverständnis hat. Individuen sehen sich in der Moderne mit einer hohen Entscheidungsvielfalt konfrontiert und müssen lernen mit der Masse an Möglichkeiten umzugehen (vgl. Marotzki 1990, 25f.). Kontingenz bedeutet, sich nicht mehr auf einen eindeutigen, festen Lebensplan verlassen zu können, sondern die Erfahrung, dass „Differenzen auch ohne übergreifende Synthesen bestehen können“ (Marotzki 1990, 28). Wie der Mensch mit solchen Momenten der Unbestimmtheit umgehen kann, nimmt die Bildungstheorie in den Blick (vgl. Jörissen/Marotzki 2009, 18), was weiter unten erläutert wird (vgl. Kap. 2.1.1).
Auf diesen Thesen aufbauend entwickelte Winfried Marotzki die strukturale Bildungstheorie, welche er gemeinsam mit Benjamin Jörissen zur strukturalen Medienbildungstheorie (2009) ausarbeitete. Die Autoren fassen den Kern der beiden Ausgangsthesen zusammen:
„Im Zentrum stand dabei der Gedanke, dass der Verlust eindeutiger Werte- und Normsysteme eine Pluralisierung von Selbst- und Weltsichten hervorbringt, welche Unbestimmtheitsräume erzeugt, die der einzelne nur durch reflexive und tentative Erfahrungsmodi produktiv verarbeiten kann“ (Jörissen/Marotzki 2009, 21).
Anhand der Erläuterung großer Krisen der Moderne, die die Autoren Orientierungskrisen nennen, stellen sie inhaltsbezogene Bildung als nicht mehr zeitgemäß heraus. In einer immer komplexer werdenden Welt, welche mit vielen gegenwärtigen Schlüsselproblemen (Friedensfragen, ökologische Probleme etc.) einhergeht und vor allem eine schnelle Entwicklung im Bereich neuer Informations- und Kommunikationstechnologien aufzeigt, sehen die Autoren den Aspekt, sich in dieser Welt orientieren zu können, als wichtigste Kompetenz, die über Flexibilisierung erreicht werden kann (vgl. Jörissen/Marotzki 2009, 15). Orientierungswissen sei wichtigste Ressource zur aktiven Partizipation an der eigenen Kultur (vgl. dies., 28f.). Sie beziehen sich in dem Punkt auf Jürgen Mittelstrass, der seit den 1970er Jahren „den Sachverhalt reflektiert, dass in modernen Gesellschaften der Abstand zwischen Verfügungswissen (Faktenwissen) und Orientierungswissen gewachsen ist“ (Jörissen/Marotzki 2009, 29). Orientierungswissen ist Wissen, welches uns zum Handeln in einer immer komplexer werdenden Welt befähigt (vgl. ebd.). Aus diesem Grund versteht Mittelstrass Bildung als Orientierungskompetenz, dessen sich auch Jörissen und Marotzki anschließen.
Die oben erwähnte These der Kontingenzsteigerung ist im strukturalen Bildungsverständnis zentral. In einer Gesellschaft, in der tradierte Zusammenhänge wie Rollenzuweisungen und Wertvorstellungen an Verbindlichkeit verlieren, sehen sich die Subjekte mit Kontingenzen konfrontiert, Leben mit höheren Unbestimmtheiten. Gemeint ist damit, dass „die Zufälle, die einem Individuum im Leben begegnen, nicht mehr durch umgreifende Orientierungsmuster mit Sinn versehen werden können“ (Jörissen/Marotzki 2009, 16).
Erst in der Konfrontation mit dem Unbestimmten, der Suche nach Orientierungsmustern, werden Bildungsprozesse initiiert, welche durch Pluralisierung und Flexibilisierung gekennzeichnet sind. In diesem Sinne ist die Medienbildungstheorie einestrukturaleBildungstheorie: Nicht die Bildungsinhalte stehen im Mittelpunkt, sondern die strukturalen Aspekte von Bildung, welche Orientierungsprozesse ermöglichen (vgl. Marotzki 1990, 42; Jörissen/Marotzki 2009, 15f.).
„Bildungsprozesse [sind] durch Kontextualisierung, Flexibilisierung, Dezentrierung, Pluralisierung von Wissens- und Erfahrungsmustern, also durchdie Eröffnung vonUnbestimmtheitsräumengekennzeichnet“ (Jörissen/Marotzki 2008, 51, Hervorh. i. Orig.).
Eben jene strukturalen Aspekte sind kennzeichnend für Bildung. Bildung wird als ein Prozess verstanden,„in welchem vorhandene Strukturen und MusterderWeltaufordnung durch komplexere Sichtweisen auf Welt und Selbst ersetztwerden“ (Jörissen/Marotzki 2008, 51). Marotzki und Jörissen beschreiben Orientierungsmomente, die Orientierungskompetenz bzw. Bildung ausmachen:
Flexibilisierungdrückt die Fähigkeit der Umorientierung aus, seine vorhandenen Denk- und Handlungsmuster immer wieder prüfen und sich reflexiv mit ihnen auseinandersetzen zu können (vgl. Jörissen/Marotzki 2008, 56). Eine Pluralisierung von Wissens- und Erfahrungsmustern ermöglicht eine Flexibilisierung der eigenenWeltkonstruktion. Das Moment der Flexibilisierungbedeutet gleichermaßen eine offene Einstellung gegenüber dem Unbekannten, sozusagen einen Suchprozess, derTentativitätgenannt wird: Es müssen passende Regeln neu erfunden werden, um mit dem Neuen und Unverständlichen oder auchunverständlich Bleibenden umgehen zu können (vgl. Jörissen/Marotzki 2009, 19). Dabei geht es nicht um die Erzeugung von Bestimmtheit durch Faktenwissen, sondern vielmehr darum, durch Unbestimmtheit Weltsichten zu flexibilisieren, Vieldeutigkeiten anzunehmen und offen gegenüber Andersartigkeiten zu sein. In diesem Sinne eröffnet Bildung „Heterodoxien, Vieldeutigkeiten undPolymorphien“ (ebd., 21, Hervorh. i. Orig.). Voraussetzung für eine tentative Einstellung ist die eigene Weltsicht als etwas Relatives, etwas Veränderbares anzunehmen. Mit den Merkmalen Flexibilisierung und Tentativität geht dasEinlassen auf Anderes und Fremdeseinher. Auch hier geht es darum, eine offene Haltung gegenüber Unbekanntem und unbekannt Bleibendem einzunehmen, zu lernen,mit Alterität umzugehen, was in einer globalisierten Gesellschaft eine bedeutende Fähigkeit ist (vgl. Jörissen/Marotzki 2008, 56f.).
Diese strukturalen Merkmale machen den Unterschied zwischen Bildung und Lernen aus, welcher im nächsten Abschnitt näher erläutert wird.
2.1.1 Lern- und Bildungsprozesse
Bildungsprozesse zielen auf die Veränderung von Welt- und Selbstverhältnissen. Sie unterscheiden sich somit von klassischen, inhaltsbezogenen Lernprozessen. Dies leitet Marotzki (1990) schon in seinem Entwurf zur strukturalen Bildungstheorie ausführlich her, indem er den „bildungstheoretischen Gehalt“ (ders., 32) des Lernebenenmodells nach Gregory Bateson nachvollziehbar macht. Bateson hat in seiner zentralen ArbeitDie logischen Kategorien von Lernen und Kommunikation(1964) fünf Lernebenen aufgestellt, die unterschiedliche Niveaus zur Bearbeitung eines Problems widerspiegeln (vgl. Marotzki 1990, 34f.).
Jörissen und Marotzki überführen die Lernebenen in vier Ebenen: Lernen I und Lernen II und unterscheiden diese vonBildung I und Bildung II (vgl. dies. 2009, 22f.). Der Unterschied zwischen Lern- und Bildungsprozessen wird von den Autoren durch den Aspekt der Bestimmtheit und Unbestimmtheit auf jeder Ebene verdeutlicht.
Auf der niedrigsten Ebene, dem Lernen I, reagiert das Subjekt mit einer Reaktion auf einen Reiz. Die Reaktion ist starr an den Reiz gekoppelt, das Subjekt kennt nur eine Handlungsmöglichkeit. Diese Ebene ist durch vollkommene Bestimmtheit gekennzeichnet (vgl. Jörissen/Marotzki 2009, 22f.).
Lernen II zielt auf eine Verhaltensänderung ab (vgl. Marotzki 1990, 35). Auf dieser Ebene werden die Kontexte berücksichtigt, in denen ein Reiz unterschiedliche Bedeutungen zugewiesen bekommt, wodurch die Reaktionsmöglichkeiten je nach Kontext auf denselben Reiz variieren. „Die besondere Leistung beim ‚Lernen II‘ besteht also darin, Kontextmarkierungen zu erkennen und einzuordnen (zu klassifizieren)“ (Jörissen/Marotzki 2009, 23). Der Mensch weiß Situationen in unterschiedlichen Kontexten anders zu rahmen, er hat Muster und Schemata zur Erkennung der spezifischen Kontexte entwickelt. Der Reiz weist eine gewisse Unbestimmtheit auf, die Kontexte und Rahmungen (z.B. Schule, Familie, Beruf) bleiben jedoch von Bestimmtheit geprägt: „Wenn wir im Rahmen von Sozialisationsprozessen in soziale Kontexte ‚hineinwachsen‘, sind sie für uns das Selbstverständliche; wir haben zunächst keine Distanz zu ihnen“ (ebd.). Doch wenn diese Rahmen durch Krisen erschüttert und verändert werden, kommt es zu einer Orientierungskrise, da die vorhandenen Ordnungen der Kontexte nicht mehr greifen. Eine Veränderung der Rahmungen selbst wäre die Folgerung, die auf dieser Lernebene jedoch noch nicht geschieht. Dies kann auf der nächsten Ebene, der Bildung I, stattfinden.
Auf der Lernebene Bildung I geht es um eine „Flexibilisierung dieser Rahmungen selbst“ (ebd., Hervorh. i. Orig.). Es kann also festgehalten werden:„Lernprozesse, die sich auf die Veränderung von Ordnungsschemata und Erfahrungsmustern beziehen, nennen wirBildungsprozesse“ (Jörissen/Marotzki 2009, 23, Hervorheb. im. Orig.).Bildungsprozesse verändern sowohl die Art und Weise als auch die Möglichkeiten, wie Welt- und Selbstverhältnisse konstruiert werden können (vgl. ebd.). Bildung I bezieht sich dabei stärker auf den Weltbezug, ermöglicht einen Zugang zu vielen verschiedenen Weltansichten. Zugrunde liegt dabei zunächst die Feststellung, dass die Prinzipien der Weltaufordnung weder wahr noch falsch sein können, welches Jörissen und Marotzki mit dem von Bateson gewählten Beispiel des Tintenkleckses erläutern:
„Es ist wie bei einem Bild, das man in einem Tintenklecks sieht; ihm kommt weder Richtigkeit noch Unrichtigkeit zu. Es ist nur eine Weise, den Tintenklecks zu sehen“ (Bateson 1964, 388 zit. n. Jörissen/Marotzki 2009, 24).
Bildungsprozesse I sind schwer zu initiieren, weil die über Jahre aus Erfahrung aufgebauten Gewohnheiten gestört werden müssen, um eine veränderte Sicht auf Welt bzw. ein verändertes Verhalten zur Welt zuzulassen. Auslöser sind daher oft Krisen und Konflikte (vgl. ebd.). Wenn sich der Mensch über „die Prinzipien der eigenen Verhaltensmuster [bewusst wird], kann er sich auch zu sich selbst anders verhalten“ (ebd.).
„Bildungsprozesse sind in diesem Sinne immer auch als Subjektivierungsprozesse zu verstehen, weil sie neue und komplexere Weisen, sichauf sich und auf die Welt zu beziehen, hervorbringen“ (Jörissen/Marotzki 2008, 52).[1]
Bildung II ist als eine Steigerung und Differenzierung des Selbstbezugs zu verstehen, denn
„aus der Erfahrung, die man in Bildungsprozessen I macht – allgemein und vereinfacht gesprochen die Erfahrung, dass man die Welt auch ganz anders sehen kann – kann man schließlich auf sich selbst schließen, und zwar auf sich selbstalsjemand, der immer und grundsätzlich die Welt so oder so ordnet“ (Jörissen/Marotzki 2009, 24, Hervorh. i. Orig.).
Wir erkennen uns selbst als Konstrukteure unserer Wirklichkeit. Die Steigerung des Selbstbezugs kann erst nach der Dezentrierung von Weltsichten und Pluralisierung von Erfahrungsmustern geschehen, denn nur wenn man erkennt, dass es unterschiedliche Haltungen und Sichtweisen gibt und dass diese nicht miteinander vereinbar sind, sich gegenseitig sogar ausschließen können, man also nicht alle gleichzeitig vertreten kann, stößt man auf Paradoxien. „Wir werden dannauf uns zurückgeworfen,auf dieBegrenztheitunserer Konstruktionsmöglichkeiten“ (Jörissen/Marotzki 2009, 25, Hervorh. i. Orig.) und beginnen vielleicht uns als Urheber zu beobachten (vgl. ebd.).
Hervorzuheben ist jedoch, dass der Mensch nicht gleichzeitig Welt (Weltbezug) und sich selbst als Beobachter von Welt (Selbstbezug) in den Blick nehmen kann, also immer etwas nicht wahrnehmen kann (vgl. ebd.). Bildung II zielt auf eine Freiheit der Gewohnheiten ab, welche aufgrund jahrelanger Erfahrungen mit etablierten Verhaltensmustern schwer bis nahezu gar nicht zu initiieren ist (vgl. Jörissen/Marotzki 2009, 25).
2.1.2 Reflexionsoptionen
Die These, die es im praktischen Forschungsteil zu belegen gilt, besagt, dass die Serie dem Zuschauer Reflexionsoptionen eröffnen kann. Einen Bildungsprozess zu initiieren meint, über Fragen zu reflektieren. Bedingung für die Reflexion ist eine Distanzierung zu dem Gesehenen und generell gegenüber gesellschaftlich vorhandenen Strukturen der Weltaufordnung (vgl. Jörissen/Marotzki 2009, passim).Nach Jörissen und Marotzki wird durch Irritation beim Zuschauer ein Involvement erschwert, wodurch der Zuschauer Raum für Reflexion erhält, denn je „größer das Involvement, desto geringer ist die Kraft der Reflexion“ (dies. 2009, 50). Involvement bedeutet ein Eintauchen in die fiktionale Welt, die den Zuschauer in ihren Bann zieht (vgl. ebd.).
Horst Niesyto (2012) benennt dies „reflexive Distanz“ (ders., 48) und erklärt:
„Die lateinische Wortwurzel von ‚Reflexion‘ geht aufreflexiozurück: biegen, drehen, wenden. Es geht darum, einen Gedanken, eine Position hin- und herzuwenden (re-flektieren), sich in einen Gedankengang zu vertiefen, sich in eine andere Position hineinzuversetzen, eine Situation aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Dieser Prozess des Nach-Denkens ist untrennbar mit der Fähigkeit zu Kritik verknüpft. Die griechische Wortwurzel von ‚Kritik‘ geht aufkrineinzurück: unterscheiden, entscheiden, trennen, richten. Im Prozess des Drehens, Wendens, Vergleichens eines Gedankens, einer Sache, einer Situation (reflexio) entdecken wir Unterschiede und benötigen zugleich Kriterien, Maßstäbe für die Bewertung und Einordnung von Unterschieden und für die Frage, wofür wir uns entscheiden (krinein)“ (ebd., Hervorh. i. Orig.).
Der Prozess der Reflexion ist demnach sehr vielschichtig, neu Erfahrenes oder Gesehenes wird mit Bekanntem verglichen und kann zu einer veränderten Haltung, einer neuen Sichtweise auf etwas führen, also auf eine veränderte Sicht auf Welt, was wiederum auch eine andere Selbstwahrnehmung bedeuten kann.
Multiperspektivität zu erfahren stellt eine wichtige Voraussetzung dar, eine Situation bewerten zu können und andere Positionen einzunehmen, um neue Haltungen entwickeln zu können.
Im folgenden Kapitel wird die strukturale Medienbildungstheorie erläutert, die aufbauend auf die strukturale Bildungstheorie einen medialen Bezug zum Bildungsprozess aufzeigt und die Grundlage dieserStudiedarstellt.
2.2 Strukturale Medienbildung
Während bei Humboldt Flexibilisierung und Dezentrierung über Sprache ermöglicht wird, erachten Jörissen und Marotzki die Medien als wichtiges Orientierungsmittel, das uns Selbst- und Weltbezüge vermittelt und flexibilisiert (vgl. dies. 2009, passim).
Lebenswelten sind Medienwelten geworden. Die strukturale Medienbildung trägt genau dieser Feststellung Rechnung, indem die Theorie davon ausgeht, dass sich Bildungs-, Subjektivierungs- und Orientierungsprozesse grundsätzlich in medialen Interaktionszusammenhängen und medial geprägten Lebenswelten ereignen (vgl. Jörissen/Marotzki 2008, 51; dies. 2009, 30). Die Bedeutung der Medien in der strukturalen Medienbildung umfasst zwei wichtige Aspekte. Einerseits erfordert die Auseinandersetzung mit neuen Medien und immer wieder auftauchenden neuen Phänomenen eine Offenheit und Neugierde, also „eine Bereitschaft zu tentativer Erkundung des (noch) Unbekannten, Begegnung mit (z.B. kulturellem) Anderem und Fremden, Interesse am Erwerb neuer Interaktionsweisen und -muster, etc.“ (Jörissen/Marotzki 2009, 30). Andererseits bieten Medien (besonders das Internet) neue Erfahrungsräume, in denen sich Individuen artikulieren können, partizipieren und Neues produzieren und somit Bildungsoptionen und Chancen nutzen können. Jedoch nicht nur die partizipativen Möglichkeiten des Internets stellen Bildungschancen dar, sondern auch komplexe audiovisuelle Formate werden in der Medienbildung unter dem Bildungsaspekt untersucht.
Besonders das Medium Film stellt eine Parallele zu dieser Auseinandersetzung mit seriellen Formen dar. Auch wenn es wesentliche Unterschiede zu den Strukturmerkmalen einer Serie gibt, trifft die folgende Aussage aus Sicht der Medienbildung ebenso auf die Serie zu:
„Komplexe mediale Formate wie etwa der Film beinhalten ebenfalls ein hohes reflexives Potenzial, indem sie etwa Fremdheitserfahrungen inszenieren, nachvollziehbar und -reflektierbar machen, indem sie Biographisierungsweisen thematisieren, ethische Paradoxa verhandeln usw.“ (Jörissen/Marotzki 2009, 30).
Wie es auch in dieser Studie Ziel der Analyse der SerieMad Menist, gilt es aus Sicht der Medienbildung,
„die reflexiven Potenziale von medialen Räumen einerseits und medialen Artikulationsformen andererseits im Hinblick auf die genannten Orientierungsleistungen und -dimensionen [Erläuterungen unten - A.K.] analytisch zu erkennen und ihren Bildungswert einzuschätzen“ (Jörissen/Marotzki 2009, 39).
Eine Artikulation an sich weist schon einen hohen reflexiven Charakter auf, indem sich der Artikulierende mit einem Problem oder einem Thema auseinandersetzt; er muss seine Aussagen in eine mediale Form bringen und schafft dadurch gleichzeitig eine Distanzierung, wodurch „Artikulationsprozesse [...] somit ein hohes Bildungspotenzial [beinhalten]“ (ebd.). Des Weiteren haben sie in sozialen Räumen einen intersubjektiven Charakter, da die Artikulationen Reaktionen des sozialen Umfelds provozieren. Erreichen die Artikulationen einen gewissen Grad an Komplexität und Elaboriertheit, liegt in der Begegnung mit ihnen selbst ein Bildungspotenzial (vgl. Jörissen/Marotzki 2009, 39). Daraus folgern die Autoren, dass Orientierungswissen in medial geprägten Gesellschaften essentiell über mediale Artikulationen aufgebaut wird,Medien sind demnach „Ort der Manifestation und Artikulation von Weltsichten“ (Jörissen/Marotzki 2008, 52).
Einhergehend mit der oben erläuterten strukturalen Bildungstheorie, die nichtvon Bildungsinhalten ausgeht, sondern die strukturalen Aspekte von Bildung beschreibt (Flexibilisierung, Dezentrierung, usw.), sind bei der Analyse von Medien, in diesem Falle der Analyse einer Serie, die Strukturen des Mediums, die Formelemente, für die Ableitung von Bildungspotenzialen von Bedeutung (vgl. Jörissen/Marotzki 2009, 15, 41). Eine Analyse des Films bzw. der Serie auf rein inhaltlicher Ebene würde der konstruierten Machart des Films nicht gerecht werden und die Gefahr einer reduzierten Lesart mitsich bringen. In Anlehnung an Marshall McLuhan[2]geht es um die sozialisatorische Wirkmächtigkeit der Form des Mediums und nicht nur um den Inhalt (vgl. ebd.).
„Das Konzept einerstrukturalen Medienbildunglenkt somit die Aufmerksamkeit auf die Formelemente der Medien und fragt danach, wie durch sie Reflexion ermöglicht werden kann“ (Jörissen/Marotzki 2009, 41, Hervorh. i. Orig.).
2.2.1 Orientierungsdimensionen
Reflexionsoptionen werden in der strukturalen Medienbildung in vier lebensweltliche Bereiche unterschieden.
Ausgehend von den vier kantschen FragenWas kann ich wissen?, Was soll ich tun?, Was darf ich hoffen?undWas ist der Mensch?formulieren Jörissen und Marotzki vierDimensionen lebensweltlicher Orientierung (Wissensbezug, Handlungsbezug, Grenzbezug und Biographiebezug), die es in medialen Bereichen analytisch zu erkennen und ihren Bildungswert einzuschätzen gilt (vgl. Jörissen/Marotzki 2009,30ff.).
DerWissensbezugist vor allem auf die bedeutende Rolle von Information und Wissen in der heutigen Gesellschaft zurückzuführen. Angesichts der Masse an Informationen ist es wichtig, Quellen bewerten und eine kritische Position zu ihnen einnehmen zu können, „Informations- und Wissensmanagement“ (Jörissen/Marotzki 2009, 31) ist wichtige Metakompetenz geworden. Verfügungswissen (Faktenwissen und prozedurales Wissen) begrenzt sich hierbei auf die Fähigkeit, Dinge benennen zu können, was Voraussetzung ist, um sie unterscheiden zu können. Erst eine Reflexion über Wissen kann zum Aufbau von Orientierungswissen führen (vgl. Jörissen/Marotzki 2009, 31ff.). Welche Wissenslagerungen („Arrangement verschiedener Wissensbestände“ (ebd., 33)) in einem zu untersuchenden Medium präsentiert werden, werden in der Orientierungsdimension Wissen analysiert.
Die zweite Orientierungsdimension, derHandlungsbezug, zielt „auf die Reflexion von Handlungsoptionen im Kontext gemeinschaftlicher und gesellschaftlicher Kontexte. Orientierung mündet letztlich auch im Handeln“ (Jörissen/Marotzki 2009, 34). Es geht in dieser Dimension um den nützlichen Gebrauch des Wissens, um die Frage nach Moral und verantwortungsbewusstem Handeln gegenüber den Mitmenschen. Wenn die Folgen von Handlungsoptionen abgewägt werden, ist schon ein gewisser Reflexionsgrad erreicht, und auch nach der Handlung können durch das Bewerten der Folgen neue Einsichten gewonnen werden, die dem Handelnden eine andere Sicht auf Welt und Selbst ermöglichen (vgl. ebd., 33f.).
ImTranszendenz- und Grenzbezuggeht es unter anderem um den Umgang mit Rationalität und Irrationalität, Phantasie und Traum, Religion und Mythen, Vernunft und Unvernunft, Leben und Tod und Fremdes. Die Frage, wie mit diesen Grenzen umzugehen ist, bedeutet Reflexion, also Bildungsarbeit (vgl. Jörissen/Marotzki 2009, 34). Mediale Formate können beschreiben,
„wie Menschen mit Grenzerfahrungen und Grenzziehungen umgehen, wie flexibel oder restriktiv solche Grenzen gezogen werden, ob sie Grenzen als Herausforderungen erleben oder eher als unüberwindbare Schranken, ob sie sie akzeptieren oder ablehnen. Die Expansion von Komplexität einerseits und die Endlichkeit der Mittel, sie zu begreifen, andererseits zwingt zu einer Anerkennung von Grenzen“ (Jörissen/Marotzki 2009, 35).
Mit der Frage nach dem Umgang mit Grenzen geht die Frage einher, welche Einstellung man selbst dazu einnimmt, was eine Auseinandersetzung mit sich selbst, mit der eigenen Identität bedeutet.
Die vorangegangenen Dimensionen laufen in der vierten Dimension, in der Frage nach dem Menschen, demBiographiebezug, zusammen. Die Identität des Einzelnen wird über biographische Arbeit immer wieder hergestellt, durch den Prozess der Biographisierung. Gemeint ist damit, dass alles bisher Erlebte vom Subjekt in Anbetracht aktueller Erfahrungen in eine sinnvolle Relevanzstruktur gebracht wird, bzw. diese Wertordnung in neuen Lebenssituationen geprüft und gegebenenfalls verändert wird (vgl. Jörissen/Marotzki 2009, 36).
„Durch Reflexion gelingt es uns, das Erinnerte in einen Bedeutungs- und Sinnzusammenhang zu stellen. Insofern ist Erinnerungsarbeit immer zugleichBiographiearbeit“ (Jörissen/Marotzki 2009, 93).
Der Mensch vollzieht somit eine Ordnungsleistung. Durch die von uns erstellte Rangordnung können wir neue Informationen bewerten und wissen, was für uns von Bedeutung und was für uns weniger wichtig ist (vgl. Jörissen/Marotzki 2009, 36f.). Der Biographiebezug zielt auf eine selbst aufgebaute subjektive Relevanzordnung ab, die dem Individuum Orientierung bietet. Die Herstellung und Prüfung dieser Ordnung durch Reflexion sind Biographisierungsprozesse, die einerseits durch viele Medien ausgelöst werden können, andererseits in Medien vollzogen oder nachvollziehbar gemacht werden (vgl. ebd., 37).
Diese vier Dimensionen stellen die lebensweltlichen Bereiche dar, anhand derer die strukturale Medienbildung reflexive Orientierungspotenziale in verschiedenen Medien analysiert. Sie werden in der Erforschung der Bildungspotenziale der Serie erneut aufgegriffen (vgl. Kap. 7).
Im folgenden Kapitel wird in Bezug auf Alfred Schütz und dessen Ausführungen über die mannigfaltigen Wirklichkeiten das Konzept, die Serie als parallele Sinnwelt anzusehen, im Zusammenhang zur strukturalen Medienbildung erläutert.
2.3 Anschlusstheorie an die strukturale Medienbildung
Der Soziologe Alfred Schütz greift in seiner Auseinandersetzung mit der Phänomenologie und der Frage nach Lebenswelt die Gedanken Edmund Husserls auf. Die Phänomenologie Husserls liegt der These zu Grunde, dass es kein für sich selbststehendes Bewusstsein gibt, sondern immer ein Bewusstsein, das auf etwas gerichtet ist bzw. ein Bewusstsein von etwas (vgl. Abels 1998, 64). Der Mensch setzt sich in seinem Bewusstsein mit der Welt in Beziehung. Die Welt, die wir mit anderen Individuen teilen, ist eine vertraute Welt, die wir aus Erfahrungen kennen (vgl. ebd.). Nach Schütz ist dies die alltägliche Lebenswelt, die für den Menschen den zunächst unhinterfragbaren Bezugsrahmen und die Wirklichkeit darstellt:
„In der natürlichen Einstellung finde ich mich immer in einer Welt, die für mich fraglos und selbstverständlich ‚wirklich‘ ist“ (Schütz/Luckmann 1979, 26, Hervorh. i. Orig.).
Angelehnt an William James fasst Schütz den Begriff des Realen als subjektiv auf, denn „alles, was unser Interesse hervorruft, ist wirklich. Einen Gegenstand real nennen heißt, dass dieser Gegenstand in einer bestimmten Beziehung zu uns stünde“ (Schütz/Luckmann 1979, 48). Folglich existiert nicht eine einzige Wirklichkeit, sondern sie differiert von Subjekt zu Subjekt. Die Frage, der Schütz nachgeht, ist, „wie sich im Bewusstsein eine Weltkonstituiertund wie der Mensch sich eine Weltkonstruiert“ (Abels 1998, 66, Hervorh. i. Orig.).
Eine Konstruktion der Welt entstehe, so Schütz, über Erfahrung, indem der Mensch eine erste Erfahrung zu einer bestimmten zweiten Erfahrung in Beziehung setzt, wodurch ein subjektives Relevanzsystem gebildet werde (vgl. ebd., 67). Die Ordnung der Wirklichkeit in diesem Sinne, auch Anschauung oder Vorstellung genannt, erfolge nicht immer bewusst, jedoch auch nicht zufällig:
„Ordnung ist ein Prozess, in dem frühere Erfahrungen mit neuen Erfahrungen verglichen werden und zu einer in sich stimmigen ‚Theorie‘ zusammengebracht werden“ (Abels 1998, 67).
Der im Laufe des Lebens aufgebaute Wissensvorrat dient dabei als Ordnungsschema für neue Erfahrungen und setzt sich aus eigenen unmittelbaren und vom sozialen Umfeld (Eltern, Lehrer usw.) übermittelten Erfahrungen zusammen (vgl. ebd., 74).
Besonders der Aspekt der subjektiv konstruierten Wirklichkeit stellt einen Bezug zu dieserStudiedar, denn erhält ein Bereich Aufmerksamkeit, ist dieser für das Subjekt real. Als Beispiel erwähnt Schütz die Spielwelt oder die Realität des Schauspiels: „Während des Schauspiels ist Hamlet für uns als Hamlet real, nicht als der Schauspieler X, der den Hamlet ‚darstellt‘ “ (Schütz/Luckmann 1979, 48f.).
Schütz setzt sich jedoch nicht auf den Begriff der Realität fest, sondern schreibt von „geschlossenen Sinngebieten [...], deren jedem wir den Akzent der Wirklichkeit verleihen können“ (ebd.). Jedes Sinngebiet und die Erfahrungen, die in dieser Sinnwelt gemacht werden, rufendesseneigenen Erkenntnis- und Erlebnisstil auf.
In seinem AufsatzÜber die mannigfaltigen Wirklichkeiten(1945) verfasst Schütz eine Theorie über plurale Sinnbereiche und beschreibt den Menschen als Weltenwanderer. Neben der Alltagswelt erwähnt Schütz zahlreiche andere Welten, wie die der Wissenschaft, Phantasiewelten, Traumwelt, fiktionale Welten oder die Welt des Rausches ausgelöst durch Drogen wie LSD. Der Mensch wandert in diese Welten und kehrt immer wieder zur Alltagswelt zurück.
Übertragung auf die Serie
Wie Jörissen und Marotzki diese Theorie auf das Internet als eine eigene Welt übertragen (vgl. dies. 2009, 226f.),werden an dieser Stelledie Gedanken Schütz' auf die Serie als eine eigene Sinnwelt bezogen.Die Annahme der AutorinGanz-Blätter, dass wir uns in den narrativen Sinnwelten der Serie in einem geschützten Rahmen auf Ausnahmesituationen, Grenzsituationen und traumatische Erlebnisse einlassen können sowie auf nachhaltige, bewegende Als-ob-Bekanntschaften mit einer emotionalen Nähe zu den Figuren (vgl. Ganz-Blätter 2011, 73ff.), wird auch in dieser Studie vertreten.
„Serielle Erzählungen eignen sich für die Ausbildung solcher nachhaltiger Bindungen besonders gut, weil sie darauf angelegt sind, entwicklungsfähige Spielfiguren, Settings und Handlungsabläufe über längere Zeit bereitzustellen“ (Ganz-Blätter 2011, 75).
Während die Alltagswelt den unhinterfragten Bezugsrahmen für das Wandern in eine andere Sinnwelt bedeutet, können eben jene Erfahrungen in diesen anderen Welten Selbstverständlichkeiten der Alltagswelt in Frage stellen und es kann zu einer Umstrukturierung der eigenen Relevanzstruktur und somit zu einer Umgestaltung des Welt- und Selbstverhaltens kommen (vgl. Jörissen/Marotzki 2009, 227f.). Die in der Serie präsentierten Weltbilder können unser Weltbild der Alltagswelt erschüttern und zu einer Reflexion über diese führen.
Aus pädagogischer Sicht sehen Jörissen und Marotzki das Wandern in andere Welten als wichtige Grundlage für ein Vertrauen in die Alltagswelt und gleichzeitig für ein In-Frage-Stellen dieser, wodurch Biographisierungsprozesse ausgelöst werden können (vgl. dies. 2009, 227).





























