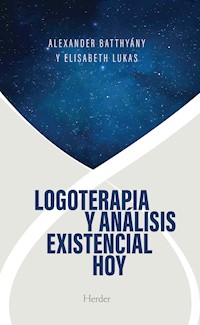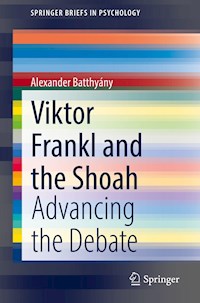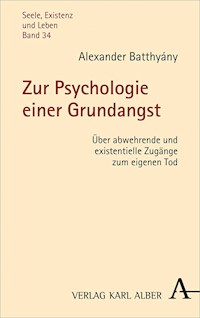19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kösel-Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Eine mitreißende Einladung zum guten Leben
Mitten im Wohlstand und Überfluss unserer Zeit wuchert ein besorgniserregendes Phänomen: Immer mehr Menschen sind in einer tiefen geistigen und existentiellen Verunsicherung und Entmutigung gefangen. Sie ziehen sich aus dem Leben zurück und suchen Ersatzbefriedigung im reinen Konsum oder in bedenklichen Massenbewegungen. Dem materiellen Wohlstand steht mit anderen Worten eine geistig-existentielle Verarmung gegenüber. Einige der Symptome: Menschen verlieren Zugang zu den eigentlichen Werten des Lebens. Wo Zusammenhalt und persönliche Verantwortung unsere Rettung wären, ziehen Kälte, Isolation, Vereinsamung, Entmutigung und Gleichgültigkeit ein.
Alexander Batthyány spürt den Ursachen und Gründen dieser Entwicklung nach. Sein Buch bietet praxisorientierte, wissenschaftlich fundierte persönliche Auswege aus der Gleichgültigkeit an. Jeder Mensch ist aufgerufen, sich in den Strom des Lebens und Teilens zu stellen. Dahinter wartet das Leben mit einer Überraschung auf: Unser Reichtum kommt nicht durch das zustande, was wir bekommen; sondern durch das, was wir zu geben bereit sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Über das Buch
Eine Ermutigung zum guten, engagierten Leben: Mitten im Wohlstand haben die meisten Menschen zwar genug, wovon sie leben können, viele scheinen aber nicht mehr recht zu wissen, wofür es sich überhaupt zu leben lohnt. Unverbindlichkeit, Gleichgültigkeit, Langeweile und Sinnlosigkeitsgefühle greifen um sich. Dieses Buch bietet einen radikalen Gegenentwurf. Es sagt: Der Mensch ist sinnorientiert. Er will also nicht nur, dass es ihm gut geht. Er will auch wissen wozu er gut ist. Anhand seiner Forschungsergebnisse zeigt Alexander Batthyány Wege hin zu einer engagierten, sinnerfüllten Lebensführung.
Alexander Batthyány
Die Überwindung der Gleichgültigkeit
Sinnfindung in einer Zeit des Wandels
Kösel
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2017 Kösel-Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 MünchenUmschlag: Weiss Werkstatt MünchenSatz: Uhl + Massopust, AalenISBN 978-3-641-21218-6V001Weitere Informationen zu diesem Buch und unserem gesamten lieferbaren Programm finden Sie unterwww.koesel.de.
Für Juliane, Leonie und Larissa
Inhalt
Der Traum, den wir einst hatten …
Einleitung: Lebenshaltung und Lebensführung
Lebensbild und Lebenswirklichkeit
Die Krise unseres Menschenbilds: Der verlorene Traum
Die soziale Brisanz der heutigen Krise
Etwas Gutes ist uns zugedacht: Den Traum wiederfinden
Von Anfang bis Ende als Mensch gewollt
Der Mensch: Von Anfang an gewollt
Werteverlust oder Wertekrise?
Reichtum durch Geben: Unsere Freundschaft mit dem Leben
Bis wir Abschied nehmen
Von Sterbenden für das Leben lernen
Die Gegenwart ist offen
Die unverbindliche Daseinshaltung der Gegenwart
Fragen, die das Leben stellt
Der Mensch: Mehr als ein Produkt der Vergangenheit
Die Gegenwart als offener Raum
Mitten im Leben Freiheit
Der Mythos des Abreagierens
Dem Schlechten Gutes entgegenbringen
Was Entscheidungen bewirken können
Der Mythos der Abhängigkeit
Von der eigenartigen Ökonomie der Liebe
Mitten in der Freiheit Verantwortung
Die Hoffnung und den anderen im Blick bewahren, weil es vernünftig ist
Die unerlebte Fröhlichkeit des Alltags
Über das Überwinden innerer Hindernisse
Ermutigung zur Freiheit: Handeln ist mehr Erleben
Über den Raub der Freiheit und seine Kosten
Über die Welt zum Ich
Von der schwierigen Frage, was der Mensch will
Was macht uns glücklich und was sagt das über das Leben selbst aus?
Reduktionismus im Hospiz
Wenn das Ich die Welt aushungert
Kann man sein Glück überhaupt wollen?
Die zu viel wollen
Vom rechten Wollen
Gefühle sind kein Selbstzweck
Zuständliche und gegenständliche Gefühle
Selbstbewusstsein und Selbstwert
Der siebente Tag: Sabbat in Permanenz
Nachwort
Danksagung
Bibliografie
Über den Autor
Anmerkungen
Der Traum, den wir einst hatten …
Einleitung: Lebenshaltung und Lebensführung
Dieses Buch handelt von zwei der menschlichsten Regungen überhaupt: von der Hoffnung und der Bereitschaft, engagiert und wohlwollend am Leben teilzunehmen. Und von der Fähigkeit, einen Sollzustand in der Welt als Auftrag und Anfrage an uns selbst wahrzunehmen: Als Auftrag etwa, dort etwas zum Guten zu wenden zu versuchen, wo man andernfalls bloß schulterzuckend vorbeigegangen wäre.
Es handelt auch von den Gründen, die uns daran hindern können, ein interessiertes, existenziell großzügiges, aufmerksames und zum Teilen bereites, offenes Leben zu führen. Ein Leben, das seine Stärke nicht nur daraus gewinnt, dass wir an uns selbst denken, sondern vor allem daraus, dass wir ansprechbar und interessiert und engagiert bleiben – und zwar auch dann und obwohl uns mit einiger Sicherheit manches von dem, was wir uns vornehmen, nicht oder nur sehr unvollkommen gelingen wird.
Von Florence Foster-Jenkins, der von Musikkritikern einhellig beschieden wurde, sie sei vermutlich die schlechteste Sängerin der Welt, ist der schöne Satz überliefert: »Die Leute mögen sagen, ich könne nicht singen. Aber keiner kann sagen, ich hätte nicht gesungen.« Und es soll keiner sagen können, wir hätten nicht zumindest versucht, dem Leben unser Bestes zu geben – was allerdings voraussetzt, dass wir die Hoffnung nicht aufgeben oder sie, wo das nötig ist, wiedergewinnen.
Von ebendieser Hoffnung handelt dieses Buch. Es handelt genauer von den vielfältigen Beziehungen zwischen unserer Hoffnung, unserem Selbstbild, Weltbild und Menschenbild und unserem persönlichen Erleben, Denken, Entscheiden, Verhalten und Handeln. Es handelt von Einstellungen und Werten und auch davon, dass es Welt- und Selbstbilder gibt, die unser Leben und Zusammenleben eher gelingen lassen, und solche, die uns und anderen sowohl das Leben als auch selbst noch das Sterben schwerer machen, als es womöglich sein müsste. Der Blick auf das eigene Selbstbild, Menschenbild und Weltbild ist nicht nur ein Schlüssel zum Verstehen unseres Erlebens und Handelns, sondern auch zur Veränderung und Reifung und schließlich: zu einem gelingenden, erfüllenden Leben – persönlich und sozial.
Denn Einstellungen lassen sich ändern. Das gelingt nicht nur durch Überzeugungsarbeit und Appelle (damit sogar meist weniger), sondern vor allem durch das Verstehen und Anerkennen einiger mitunter überraschend einfacher, aber umso leichter vergessener oder übersehener Gegebenheiten des Daseins.
Wenn wir diese Gegebenheiten in den Blick nehmen, lassen sich Einstellungen sogar oft wesentlich leichter korrigieren. Und diese Korrektur bewirkt auch eine tiefgreifendere und nachhaltigere Veränderung unseres Verhaltens als etwa der bloße Vorsatz, von heute an so und nicht anders zu entscheiden, zu handeln, zu reagieren. Die meisten von uns wissen es aus eigener Erfahrung: Es ist verhältnismäßig leicht, hehre Vorsätze zur Änderung des eigenen Verhaltens zu fassen, aber ebenso schwer, diese Vorsätze auch über längere Zeit konsequent umzusetzen. Zahlreiche psychologische Forschungsarbeiten bestätigen diesen Erfahrungsbefund.1 Sie legen vielmehr nahe, dass der Schlüssel zum Verstehen und Ändern unseres Verhaltens weniger nur im Verhalten selbst, als vielmehr in den unserem Handeln zugrunde liegenden Einstellungen, Erwartungen und Haltungen liegt. Anders gesagt: Unser Handeln und unsere Lebensführung sind bis zu einem gewissen Grad stets auch »Symptom« und Ausdruck unserer Lebenshaltung.
Es gibt somit einen bedeutenden Zusammenhang zwischen dem, was wir über uns, unsere Mitmenschen und die Welt glauben, und dem, was wir von uns selbst, anderen und dem Leben insgesamt erwarten. Und es ist wichtig, wie viel Hoffnung wir in uns selbst und das Leben setzen. Von diesen Erwartungen und Hoffnungen hängt wie gesagt ein Großteil unseres Handelns und Verhaltens, vielleicht sogar unser gesamter Lebensentwurf, ab. Dieser Zusammenhang ist genau genommen so stark, dass sich uns das Verhalten anderer überhaupt erst in dem Maße richtig erschließen will, in dem wir in der Lage und bereit sind, die Dinge so zu sehen, wie sie sich dem anderen darstellen. Das gilt für Individuen ebenso wie für ganze Gesellschaften.
Das Verstehen geschichtlicher Ereignisse oder fremder Kulturen beispielsweise setzt voraus, dass wir uns die Mühe machen, in ihr Welt- und Menschenbild einzutauchen und es nachzuvollziehen. Bis uns das gelingt – und vorausgesetzt, dass es uns gelingt –, wird die Begegnung mit einer fernen geschichtlichen Epoche oder Kultur eine Begegnung mit etwas Fremdem und als solche vielleicht exotisch und interessant sein, letzten Endes aber unbegreiflich und verborgen und stets nur Stückwerk bleiben. Der Grund: Die Welt des anderen hat sich uns noch nicht erschlossen; es ist uns »gedanklich fern« – also erschließt sich uns auch sein Verhalten und Handeln nicht:
A vereinbart mit B, dass er diesen am nächsten Morgen begleiten werde, ein Haus zu besichtigen, das B erwerben will. Die beiden machen sich auf den Weg; plötzlich erklärt B, er werde das Haus doch nicht heute besichtigen und vielmehr nach Hause zurückkehren. Er gibt anfänglich keine Gründe an; auf Drängen sagt er schließlich: »Aber haben Sie denn nicht die schwarze Katze gesehen, die über den Weg lief? Es wäre sicher nichts Gutes herausgekommen.« B lebt in der Welt des Aberglaubens, der Vorzeichen, in der Ereignisse beachtenswert und bedeutungsvoll, bestimmend für das Handeln werden, die in der Welt des A einfachhin nicht existieren, weil die dort keine Rolle spielen.2
Schwarze Katzen gibt es auch in der Welt desjenigen, der ihnen keine größere Bedeutung beimisst. Aber es ist gerade diese zusätzliche Bedeutung oder auch genereller die Bereitschaft, hinter Vorkommnissen und Dingen, die dem einen ganz belanglos erscheinen, weitere Bedeutungszusammenhänge zu vermuten, die den Unterschied zwischen Verstehen und Unverständnis unseres eigenen Verhaltens oder des Verhaltens anderer ausmacht.
Lebensbild und Lebenswirklichkeit
Nun ist das Verstehen und Nachvollziehen anderer Standpunkte, das sagt uns die psychologische Forschung ebenso wie wahrscheinlich auch die Alltagserfahrung der meisten, kein besonders leichtes Unterfangen.3 Mehr noch – dieselbe Forschung legt auch nahe, dass uns nicht einmal das Verstehen und Nachvollziehen unserer eigenen Welt- und Selbstbilder immer und auf Anhieb gelingen will.4 Das liegt vermutlich unter anderem daran, dass ein Großteil der Einstellungen und Ideen, die unserem Welt- und Menschenbild zugrunde liegen, nur selten bewusst erworben und noch seltener regelmäßig rational auf ihre Wirklichkeitsnähe hin durchleuchtet wurden und werden.
Würde man sie aber durchleuchten, würde man vielleicht bald feststellen, dass manche dieser Einstellungen gar nicht mehr zu unseren Lebenswirklichkeiten passen, womöglich sogar widersprüchlich sind (»Gleich und gleich gesellt sich gern« ist mindestens so einleuchtend wie »Gegensätze ziehen sich an«). Wieder andere mögen sich kurzfristig bewähren, uns aber langfristig mehr Schaden als Nutzen bringen; und wieder andere mögen nur uns Nutzen bringen, unsere Umwelt und Mitmenschen aber schädigen, entwerten, verletzen. Wobei im Folgenden noch zu untersuchen sein wird, ob Verhalten, das nur uns nutzt und das Wohlergehen anderer ignoriert, nicht auch zu jenen Lebensweisen zählt, die uns selbst langfristig am meisten schaden: entweder, weil wir durch ein solches ichbezogenes Handeln weit hinter dem zurückbleiben, was wir an Talenten und Fähigkeiten für das Gute und Wertvolle einzusetzen und in die Welt auszusenden fähig wären; oder, weil wir heute auf das Wohlwollen, die Hilfe und Unterstützung eben jener Menschen angewiesen sein können, die wir gestern noch als bloßes Mittel zum Zweck für unser eigenes kleines »Glück« benutzten.
So oder so: Am Beispiel der egoistischen Lebenshaltung lässt sich leicht illustrieren, wie eng die Beziehung zwischen unserem Lebensglück und unserer Lebenseinstellung wirklich ist. Diese Einstellung, von der man eigentlich im ersten Moment erwarten sollte, dass sie zumindest – oder wenigstens – dem, der sie sich zum Lebensprinzip gemacht hat, dienlich sein sollte, kann viel Leid hervorbringen. Eine solche Haltung zu korrigieren, ist um ein Vielfaches leichter, wenn man sie als das begreift, was sie wirklich ist: nämlich ein grundlegendes existenzielles Missverständnis über das Verhältnis zwischen unserem persönlichen Lebensglück, unserer Erfüllung und dem, was wir von uns und der Welt erwarten. Anders formuliert: Was sich im Endresultat wie ein moralisches Defizit ausnimmt, ist unter einem anderen Blickpunkt oft nur die Folge einer Lebenshaltung, die sich wohl die wenigsten zu eigen gemacht haben, weil sie ichsüchtig und moralisch etwas fragwürdig ist. Wenn man dem Egoisten seinen Egoismus vorhält, nimmt man daher nicht selten einen vergeblichen Kampf auf. Man kämpft gegen ein Symptom an, nicht aber gegen dessen Gründe und Ursachen. »So ist die Welt nun einmal – jeder muss an sich und seinen Vorteil denken, weil niemand anderer es für einen tut«, mag der Egoist zum Beispiel denken.
In einer so gedeuteten Welt stellen nicht nur schwarze Katzen, sondern nahezu alle Menschen eine Bedrohung dar. Sie werden zu Gegnern, Konkurrenten, Feinden. Auch wenn einem also das Verhalten, das aus einer solchen Haltung erwächst, moralisch zweifelhaft erscheint: Es wäre ungerecht, dem Betroffenen sein trauriges Missverständnis und Misstrauen, das seiner Lebenshaltung zugrunde liegt, vorzuwerfen. Denn niemand sucht sich bewusst aus, einem Missverständnis zum Opfer zu fallen. Wer sich daher in einer von ihm als kalt und egoistisch erlebten (oder gedeuteten) Welt selbst kalt und egoistisch verhält, muss deswegen nicht unmoralisch sein; er kann auch bloß glauben und sogar selbst beklagen, dass die Spielregeln des Lebens nun einmal so geartet sind. Deswegen macht es auch wenig Sinn, ihm mangelnde Moral vorzuhalten. Helfen und aus seiner egoistischen Abgeklärtheit befreien kann sich ein solcher Mensch vielmehr dadurch, dass er seine Sicht auf die Welt nochmals durchleuchtet und dabei vielleicht erkennt, dass die Spielregeln des Lebens letztlich bei Weitem nicht so unbarmherzig sind, wie er bislang angenommen hat. Vielleicht erkennt er dann auch, dass er womöglich gerade durch sein eigenes Verhalten das wahr macht, was er von der Welt und der menschlichen Natur befürchtet.
Kurz: Ein Schlüssel zum Menschen ist das Bild, das er sich von sich, von anderen Menschen und der Welt macht. Leider scheint es, als ob gerade die Gegenwart von einer Krise des Menschenbilds sondergleichen heimgesucht wird. Vielleicht stand sich der Mensch – womöglich auch angesichts der historischen Entgleisungen und Katastrophen des vergangenen Jahrhunderts, womöglich aber auch angesichts des unerhörten Reichtums und der schier endlosen Möglichkeiten unserer Tage – selbst noch nie so fremd und misstrauisch gegenüber wie heute, vielleicht auch noch nie so existenziell obdachlos in einer Welt, die ja trotz allem Unglück des letzten Jahrhunderts und trotz aller Verunsicherung dennoch vorübergehend seine Heimat ist.
Die Krise unseres Menschenbilds: Der verlorene Traum
Viele Menschen beklagen heute eine Krise unserer Werte und sagen damit nichts anderes, als dass ihnen ihre eigenen oder Lebensentwürfe im Allgemeinen fraglich oder wenigstens hinterfragenswert vorkommen, sie aber auf der Suche nach verbindlichen und tragfähigen Antworten nicht fündig werden. Irgendwie, so scheint es, haben viele und hat vielleicht ein beachtlicher Teil der Wohlstandsgesellschaft im Allgemeinen den Kompass verloren und mit dem Kompass den Blick auf Haltung, Richtung und den eigenen Lebensweg, vom eingangs erwähnten Lebensidealismus und der Hoffnung ganz zu schweigen.
Die psychologische Forschung weiß in diesem Zusammenhang von einem zunehmend um sich greifenden Lebensgefühl der Demoralisierung, Lebensskepsis, Unverbindlichkeit, Resignation und Verunsicherung vor allem in den reichen Industrienationen zu berichten.5 Menschen ziehen sich in der Folge zurück von einer Welt, von der sie nicht mehr viel erwarten oder von der sie einst viel mehr erwarteten, um sich angesichts unerfüllter Hoffnungen nur umso enttäuschter abzuwenden.
Das ist ein durchaus paradoxes Phänomen, wenn man sich zugleich vor Augen hält, dass diese existenzielle Verwahrlosung sich anscheinend insbesondere dort auszubreiten scheint, wo der Mensch materiell relativ abgesichert ist und kaum unmittelbare Not leidet. Zumindest für Europa und Nordamerika gilt, dass selbst ein relativ entbehrungsreiches Leben noch immer weit davon entfernt ist, wirklich entbehrungsreich zu sein, wenn man etwa den Maßstab der vorhergehenden Jahrhunderte oder ärmerer Landstriche der Gegenwart herbeizieht. Zugleich sind das die beiden Kontinente, in denen sich das vom österreichischen Psychiater, Neurologen und Begründer der Logotherapie und Existenzanalyse, Viktor E. Frankl, so benannte »existenzielle Vakuum« zahlreichen Studien zufolge seit Jahrzehnten am rasantesten ausbreitet. So gut wie seit der Mitte des vergangenen Jahrhunderts ging es dem Menschen in Europa und Nordamerika jedenfalls noch nie (und selten wurde damit zugleich die soziale Ungleichheit, Ungerechtigkeit und leider auch die Gleichgültigkeit des Wohlhabenden gegenüber dem Notleidenden sichtbarer). Der Wohlstand für alle – oder auch nur für viele – hat in einem großen natürlichen Experiment eines jedenfalls recht deutlich gemacht: Das ersehnte erfüllte Leben wird noch lange nicht Wirklichkeit, wenn der Mensch wirtschaftlich und physiologisch grundversorgt ist, in Friedenszeiten leben und sich in wachsender sozialer Freiheit nach seinen eigenen Wünschen und Fähigkeiten entfalten darf. Das Wirtschaftswunder hat vielmehr eine ganze Reihe seltsamer psychologischer Phänomene hervorgebracht, die in dieser Virulenz und Ausbreitung bis dahin unbekannt waren: Mitten im Wohlstand greifen Unzufriedenheit, Langeweile, Verdrossenheit, Gleichgültigkeit, Gewalt, Suchterkrankungen, Sinnlosigkeitsgefühle und Frustration um sich. Die angesichts der Entbehrungserlebnisse der vorvergangenen Jahrhunderte eigentlich naheliegende Idee, der Mensch werde endlich zu seinem Glück und seiner Erfüllung finden, wenn er keine akute Überlebensnot mehr erleide, hat sich so weit jedenfalls nicht bewahrheitet, wenn und solange dem äußeren Reichtum eine mitunter beträchtliche innere, geistig-seelische Verarmung gegenübersteht. Marx’ oft zitierte Wendung, der zufolge das Sein das Bewusstsein bestimme, bestätigte sich somit nicht – vielmehr scheint es vielerorts, als verdunkle das falsche Bewusstsein auch das noch so materiell abgesicherte Sein. Diese Verdunklung zeigt sich heute vor allem in einer um sich greifenden Sinn- und Existenzkrise des »modernen Menschen« – er hat viel, manchmal sogar zu viel oder gar nicht selten viel zu viel, und glaubt bisweilen immer noch, dass er einfach noch mehr bräuchte, um endlich glücklich und erfüllt zu sein. Bis er resigniert und in dieser Resignation auf das bloße Überleben zurückfällt und sich in die Unverbindlichkeit des Alltags und in eine Art fatalistische oder provisorische Erwartungslosigkeit zurückzieht.6 Alles scheint ihm nun gleichgültig, nichts spricht ihn an. Ein solches Lebensgefühl der Unverbindlichkeit ist seinerseits der Boden, auf dem sich weitere Haltlosigkeit und mangelnde Orientierung ausbreiten können. Wo soll man Halt und Orientierung finden – oder gar: anderen bieten – wenn Unverbindlichkeit den Blick auf die Vielfalt und Wirklichkeit des Lebens verschleiert?
Nun besteht angesichts solcher Befunde über die »Pathologie des Zeitgeists« (Viktor Frankl) kein Grund, alarmistisch zu werden. Man braucht sich diesen Zustand auch nicht dramatischer vorstellen, als er tatsächlich ist. Vielleicht wird er gerade sogar deswegen, weil er meist relativ symptomarm und einigermaßen erträglich ist, oft übersehen und noch öfter resigniert als die Normalität des Alltags hingenommen, vielleicht sogar zur Normalität des Alltags erklärt. Es handelt sich um eine oft stumme Entmutigung oder Verflachung, die sich wie ein trüber Unterton in den Alltag einschleicht und den Betroffenen die Fähigkeit oder Bereitschaft nimmt, aktiv und lebendig am Leben teilzunehmen.
Die vielleicht augenscheinlichsten Merkmale dieses Syndroms sind daher auch vor allem Mangelerscheinungen: Zum Beispiel ein Mangel an Begeisterungsfähigkeit, Ansprechbarkeit, ein Mangel aber auch an der Bereitschaft, Eigen- und Mitverantwortung zu übernehmen und sich gestaltend ins Leben einzubringen – also über das Nötigste hinaus am Leben teilzunehmen, mitzuwirken und sich zu engagieren.
Eine Patientin sagte es einmal sehr treffend: Irgendwie gehe sie das Leben nicht so wirklich viel an. Ihr komme vielmehr alles etwas uninteressant und langweilig und das Meiste gleichbedeutend (bzw. bedeutungslos) und ebenso wenig gültig wie das Nächste vor. Das weist schon sprachlich das verbreitete Gefühl der Gleichgültigkeit und des damit einhergehenden Verlusts an Begeisterungsbereitschaft und Interesse aus.
Das Problem ist unter anderem, dass eine solche Lebenshaltung oftmals wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung wirkt: Wen die Welt wenig angeht und wer sich von der Welt und sich selbst nichts oder zu wenig erwartet, und wer sich von nichts oder kaum etwas in der Welt persönlich und verbindlich angesprochen fühlt, der fühlt sich auch dann noch nicht angesprochen, wenn bildlich gesprochen das gesamte Orchester nur auf seinen Einsatz wartet. Er wartet mit, verpasst seinen Einsatz und ist doch feinfühlend genug, um zu merken, dass das Lebensstück um eine Stimme verarmt ist und er selbst zugleich etwas verpasst.
Viele berichten dann von dem vagen Gefühl, das Leben zu versäumen und manches Mal ist man sogar geneigt, dieser Klage zuzustimmen – wenn auch mit einigen Abstrichen. Denn diese Menschen versäumen zwar vielleicht nicht so sehr ihr Leben, aber: ihr Leben versäumt sie. Es richtet sich Tag für Tag mit bestimmten Möglichkeiten und Aufgaben an diese Menschen; es wartet auf ihren Beitrag, darauf, dass sie sich einbringen, darauf, dass sie in der Welt etwas bewirken, das ohne sie nicht, oder nicht so und in dieser Weise, geworden wäre. Aber sie sind oder sie stellen sich taub für diese Anfragen, oder vielleicht sind sie wirklich nicht mehr ansprechbar; oder vielleicht sind sie ansprechbar, zugleich aber so entmutigt oder durch vage Ängste gehemmt, dass sie sich nicht zutrauen wollen oder können, überhaupt etwas Relevantes im Leben zu bewirken. Oder ihr Misstrauen dem Leben gegenüber ist zu groß: Sie halten ihren Beitrag für bedeutungslos oder die Welt gar nicht für form- und gestaltbar und sich selbst daher bloß für ein Rädchen in einem Räderwerk, dessen Mechanik dem Einzelnen selbst gar keine Bedeutung und Eigen- und Mitverantwortung zugesteht.
Vermutlich wäre es falsch, diese Möglichkeiten als Alternativen zu beschreiben, als würde die eine die andere ausschließen. Es ist wohl eher so, dass in ein und derselben Person einmal dieses und einmal jenes Motiv der Entmutigung vorherrschen kann. Auf den einfachsten Nenner heruntergebrochen aber ist es ein ums andere Mal ein resigniertes Welt- oder Menschenbild, vor dessen Hintergrund Unverbindlichkeit und Entmutigung einziehen und jene Initiative, Verantwortung, Lebendigkeit und Lebensfreude untergraben, die menschliches Dasein zugleich doch idealerweise wesenhaft auszeichnen und diesem Leben Sinn, Tiefe und Bedeutung geben.
Die zunehmende Verbreitung dieser resignativen Haltungen überschattet und verdunkelt nicht nur das Leben des Einzelnen, sie hat auch mit Blick auf die gesellschaftliche Entwicklung einen hohen Preis. In der Resignation erblindet man nämlich nicht nur für das eigene Glück, sondern im selben Maße oft auch für das Leid und die Not der anderen. Dabei wäre es gerade die Bereitschaft, sich vom Auftrag, der unausgesprochen mit dem Leid, der Not und Bedürftigkeit anderer im Raum steht, ansprechen zu lassen, die einen von der Gleichgültigkeit befreien könnte.
Es hat somit schon eine besondere Tragik, dass ausgerechnet im Wohlstand und Überfluss der Gegenwart viele mit ihrem Leben so grundlegend unzufrieden und so gelangweilt und frustriert sind, weil es ihnen an sinnvollen Aufgaben zu mangeln scheint – und sie zugleich nicht sehen können oder wollen, wie sehr und wie dringend ihr persönlicher Einsatz eigentlich gefordert wäre und wie viele Sinnmöglichkeiten auf unseren Einsatz und unsere Zuwendung warten, leider oft vergeblich.
Zum anderen trifft die Resignation scheinbar oft gerade diejenigen, die sich enttäuscht vom Leben abwenden, weil und obwohl sie ursprünglich hohe Ideale hatten, diese aber als unerfüllt oder unerfüllbar abschreiben und ihre Hoffnung nun fahren lassen.
In die so entstehende Leerstelle zieht Gleichgültigkeit ein – eben jenes Gefühl, das alle Initiative, jeden Idealismus und Glauben an eine verantwortlich zu gestaltende bessere Zukunft untergräbt und uns auf eine graue Alltagsroutine zurückwirft, die wir ertragen und beklagen und vorübergehen lassen, ohne recht zu wissen, was das Ganze eigentlich für einen Sinn und ob unser Leben irgendeine nennenswerte Bedeutung hat. Einige der psychologischen und sozialen Ursachen, Gründe und Auswirkungen des existenziellen Vakuums werden wir im weiteren Verlauf dieses Buches noch eingehender analysieren – vor allem aber werden wir uns Wege ansehen, wie man wieder aus diesem Vakuum heraus- und zurück ins Leben finden kann.
Eines aber kann man schon vorab ahnen, auch ohne die aktuelle Forschung eingehender zu befragen: Einer Gemeinschaft und der Welt im Gesamten kann es nicht guttun, wenn sie diejenigen als aktive Mitspieler und Gestalter verliert, die überhaupt einmal für Hoffnungen und Ideale offen waren. Denn sie verliert ihre Besten, bzw. sie verliert allgemeiner das Beste am Menschen: seine Bereitschaft, über den Tellerrand seines eigenen momentanen Befindens zu sehen und sich dort ansprechen zu lassen, wo sein Beitrag der Welt guttäte. Damit verliert sie ihr Bestmögliches. Sie verliert nämlich genau jene Kräfte, die in den »natürlichen Verlauf der Dinge« engagiert und wohlwollend einzugreifen bereit sind, auf dass einerseits Neues und Lebendiges in die Welt gesetzt wird und andererseits auch eine noch so brüchige Situation oder abwendbare Not durch unseren Beitrag gewendet werden kann: dass also selbst da, wo der »natürliche Verlauf der Dinge« nichts Gutes verheißen würde, etwas Gutes wachsen oder zumindest Not gelindert werden kann.
Eine solche Welt wird buchstäblich trostlos – denn auch Trost ist etwas, das nicht in den natürlichen Verlauf der Dinge gelegt ist. Trost wächst vielmehr auf dem Boden der Bereitschaft einer Person, sich von der Bedürftigkeit eines anderen ansprechen zu lassen – also das Leid des anderen nicht gleichgültig hinzunehmen, sondern ihm zumindest ein freundliches Wort oder eine helfende Hand zu bieten. Trostlos ist eine Welt aber nicht nur, weil der in der Gleichgültigkeit gefangene Mensch die Gabe verliert, die Trostbedürftigkeit der anderen als etwas zu erkennen, das ihn angeht – sondern auch, weil er selbst seine enttäuschten Hoffnungen und seine subjektiv erlebte Bedeutungslosigkeit vielleicht nie ganz verwinden wird.
Denn er ist und bleibt ja dennoch Mensch; und Hoffnung und der Wille zum Sinn sind zutiefst menschliche, sogar bestimmende menschliche Eigenschaften. Auch das belegen mittlerweile zahlreiche psychologische und auch klinische Studien7, die größtenteils auf den Impuls Viktor Frankls und der von ihm entwickelten Logotherapie und Existenzanalyse zurückgehen. Unter allen uns bekannten Lebewesen ist es einzig der Mensch, der Glauben hat, Hoffnung und Liebe – und allem Anschein nach nur der Mensch in diesem Ausmaß. Das sagt schon viel über unsere Bestimmung aus und es sagt auch viel mehr über die innere und existenzielle Struktur menschlichen Daseins aus, als wir manchmal wahrzuhaben bereit sind: Idealismus und Verantwortung sind uns in die Wiege gelegt; sie sind Teil unserer Natur.
So ist der Mensch etwa das einzige Wesen, das in die Welt tritt und bereits mit seinem Eintreten in die Welt sieht: Diese Welt ist bedürftig, sie wartet auch auf meinen Beitrag, also lass uns daran mitwirken, dass sie ein besserer Ort für viele wird. Dieser phänomenologische Befund sagt uns zwar noch nicht, ob diese Hoffnungen auch eine objektive Entsprechung haben – er sagt aber zumindest, dass der Mensch nicht nur als das weise (sapiens), sondern vor allem: als das hoffende und nach Sinn strebende Wesen in die Welt getreten ist. Wie gesagt – noch wissen wir nicht und werden im Laufe dieses Buches noch zu untersuchen haben, inwieweit diese Hoffnung bloß ein Wunschtraum oder nicht auch Auftrag und die dem Menschen eigentlich zugedachte Wirklichkeit ist. Wohl aber kann man an dieser Stelle schon sagen: Dieser Traum ist dem Menschen ins Wesen geschrieben. Der unglücklich verabschiedete Traum hinterlässt Leerstellen und verursacht Schmerzen, die sich auch durch eine noch so intensive Betäubung und Ablenkung durch die Freizeitindustrie nicht wirklich stillen lassen werden. Daher die eben erwähnte Trostlosigkeit einer Welt ohne Sinn und Auftrag und Eigen- und Mitverantwortung. Gleichgültigkeit ist die Absage an diese Verantwortung. Sie ist, mit anderen Worten, eine Chiffre dafür, dass man sich aus dem Spiel des Lebens genommen hat. Dort, wo das Leben auf mich zählt, steht jetzt eine Leerstelle.
Die soziale Brisanz der heutigen Krise
Einmal abgesehen von dem privaten Leid, das eine solche Erlebnisweise mit sich bringt, bergen die beschriebenen Entwicklungen des Zeitgeists auch brisante soziale Folgen. Denn leider lassen sich die Kräfte, die diese Leerstelle füllen, nicht immer von positiven Idealen und Hoffnungen leiten. Bisweilen haben sie gar keine anderen als das bloße Eigeninteresse, das sie durchzusetzen versuchen, indem sie auf alle nur denkbaren und meist einfachen Wege die Massen mobilisieren wollen. Dazu Viktor Frankl:
So kommt es, dass [der verunsicherte Mensch] entweder nur will, was die anderen tun – und da haben wir den Konformismus –, oder aber er tut nur, was die anderen von ihm wollen, und da haben wir den Totalitarismus.8
Einer der einfachsten und historisch vielfach erprobten Wege der Mobilisierung einer haltlosen und verunsicherten Masse ist demnach etwa die Fanatisierung. Diese gelingt am leichtesten und schnellsten nicht durch das Fördern und Einfordern positiver Ideale und Verantwortung, sondern durch das Abgrenzen und Herabsetzen von bestimmten Gruppen, oftmals sogar ausgerechnet derjenigen, die eigentlich unsere Unterstützung, Ermutigung und Großherzigkeit am meisten bräuchten.
Es ist daher vermutlich kein Zufall, dass die Zeit eines immer stärker um sich greifenden Resignationsgefühls zugleich auch eine Zeit des erneuten Erstarkens populistischer Protestbewegungen ist, deren Denken meist mehr von Eingrenzung und Ablehnung als von Hoffnung und Aufbruch geprägt ist. Im Kern solcher Bewegungen steht also meist nicht mehr ein Traum, nicht mehr die Hoffnung, nicht mehr die Utopie, sondern die Verunsicherung und Angst, die in die vom einstigen Traum hinterlassene Leerstelle hineinwuchert.9
Psychologen und Soziologen stellen heute tatsächlich vermehrt eine in diesem Ausmaß neue Bewegung des Zeitgeists fest: Wut und Ablehnung als Lebenshaltung. Forschungsarbeiten legen nahe, dass solche Bewegungen auf eine auf den ersten Blick unerwartete Weise ein psychologisch zunächst attraktiv erscheinendes Angebot machen: Sie bieten Überwindung der eigenen Gleichgültigkeit an. Aber sie bieten zugleich selten einen gleichwertigen Ersatz für die Hoffnungen und Ideale an, die viele davor an die Gleichgültigkeit verloren haben. Das Problem ist, dass dieses Angebot meistens gar kein Angebot für etwas ist; es ist in der Regel ein Angebot gegen etwas oder jemanden – und es scheint daher auch oft relativ beliebig, gegen wen oder was sich das jeweilige Programm richtet.
Die sozialpsychologische Forschung zeigt es immer wieder und seit Jahrzehnten: Existenziell entwurzelte und verunsicherte Menschen sind politisch verführbarer. Sie vermissen und suchen in der Ablehnung und Feindseligkeit jenen Gestaltungswillen und jene Motiviertheit, die man unter psychologisch intakteren und konstruktiveren Umständen dadurch bekommt, dass man sich von sich aus für etwas oder jemanden engagiert und positive Eigen- und Mitverantwortung übernimmt.10
Etwas Gutes ist uns zugedacht: Den Traum wiederfinden
Man kann diese Entwicklungen so hinnehmen und resignierend feststellen: Das ist nun einmal die Normalität des beginnenden 21. Jahrhunderts, so ist der Mensch. Oder – und das ist die Spur, die wir in diesem Buch verfolgen – man beschreibt diese Entwicklungen als Entgleisungen und Störungen eines dem Einzelnen eigentlich zugedachten idealeren, ausgeglicheneren, reiferen und insgesamt mit sich und der Welt und ihren Aufgaben versöhnteren Zustands. Vielleicht erscheint diese Perspektive vor dem Hintergrund der bisherigen Bestandsaufnahme der um sich greifenden Gleichgültigkeit und der damit einhergehenden Erkaltung der Welt auf den ersten Blick als allzu optimistisch. Immerhin traut diese alternative Sicht der Welt zu, dass es diesen idealeren Zustand gibt, in dem der Mensch nicht entwurzelt und ratlos vor den unbeantworteten Fragen des Lebens steht, sondern seinen Ort gefunden hat und sich daran erfreut, seiner Bestimmung und Verantwortung in der Welt gerecht zu werden.
Ich werde aber in diesem Buch versuchen, anhand unterschiedlichster Argumente und wissenschaftlicher Forschungsergebnisse zu belegen, dass diese Alternative nicht nur optimistisch ist, sondern vor allem: realistisch. Ich will – mit anderen Worten – zeigen, dass sie unserem Wesen entspricht und darüber hinaus im Leben selbst angelegt ist.
Entscheidend ist für den Moment, dass wir diesen uns zugedachten Ort nie finden werden, wenn wir von vornherein nicht zumindest versuchsweise daran zu glauben und darauf zu hoffen bereit sind, dass es ihn gibt – und auch, dass es unser uns bestimmter Ort ist. Und dass es praxisorientierte und klinische und wissenschaftlich bewährte Perspektiven gibt, denen zufolge ein engagiertes, erfülltes und sinnvolles Personsein nicht bloß möglich ist, sondern unsere natürliche Daseinsweise. Eine Daseinsweise, die Unbestimmtheit als Freiheit erlebt und die Hoffnung auf das Bessere nicht nur als Wunsch an die Welt richtet, sondern auch als eigenen Auftrag und eigene Verantwortung erkennt, das viele Gute, das nie Wirklichkeit würde, wenn wir es nicht aussenden, anzugehen: Was nicht gewesen wäre ohne uns, das zeugt von uns.
Es geht hier also um nichts weniger als um eine Rehabilitation eben jenes Traums, der dem Menschen seit jeher vorausgeht und dessen Zu-Grabe-Tragen unter dem Schlagwort des »Werteverfalls« dem Menschen der Gegenwart so schwer zuzusetzen scheint.
Im weiteren Verlauf dieses Buches werde ich aber auch den Nachweis zu erbringen versuchen, dass es diesen so oft genannten Werteverfall vermutlich gar nicht gibt. Das ist die gute Nachricht: Der Traum ist nicht eigentlich vergangen, wenngleich wir ihn gelegentlich aus den Augen verlieren. Es scheint vielmehr, als würden weniger die Werte verfallen als unsere Bereitschaft, vielleicht auch unser Glaube an unsere Fähigkeit, diese Werte im alltäglichen Leben zu verwirklichen, und die Einsicht, dass es sich lohnt, sie zu Leitlinien unseres Entscheidens und Handelns zu machen. Es ist auch möglich – und wird in der psychologischen und ideenhistorischen Forschung diskutiert –, dass unsere postmoderne Zeit eine wie auch immer begründete Skepsis gegenüber Werten und Idealismus gewonnen und im selben Maße das Vertrauen in die Tragfähigkeit dieser Werte verloren hat. Auch das werden wir uns ansehen.
So oder so: Das Wissen um und das positive Annehmen der Werte ist im Allgemeinen nicht so sehr das Problem. Die meisten von uns wissen oder ahnen im Innersten recht genau, was wert- und sinnvoll wäre und was nicht. Woran es aber bisweilen zu mangeln scheint, ist das Wissen, wie man konkret und realistisch wert- und sinnorientiert und engagiert leben kann; und auch das Wissen darum, dass sinnorientiertes, verantwortliches Handeln nicht nur die Welt bereichert, sondern auch uns selbst. Dass im Gegenzug nicht nur die Welt, sondern auch wir selbst geistig und seelisch verarmen, wenn wir den lebensnahen Kontakt zum Sinn verlieren und uns das Bewusstsein unserer Verantwortung, Sinnmöglichkeiten zu verwirklichen, verloren geht.
Dazu kommt: In dem Augenblick, wo nicht mehr Sinn und Werte unser Erleben und Verhalten prägen, bestimmt notgedrungen etwas anderes, das als Ersatz herhalten muss, unser Entscheiden und Handeln. Das kann das bloße und reine Eigeninteresse und die Abhängigkeit von guten Gefühlen sein – von eben jenen guten Gefühlen, die sich normalerweise als Effekt und Nachklang des Sinn- und Wertvollen einstellen. Allerdings habe ich es schon angedeutet: Auf Dauer macht uns ein durch reines Eigeninteresse und die Jagd nach guten Gefühlen geleitetes Handeln nicht nur einsam, es schneidet uns von der Fülle der Wirklichkeit und ihrer Möglichkeiten ab. Genau genommen schneidet es uns vom Leben selbst ab, denn Leben ist grundlegend und grundsätzlich bestimmt durch Teilen, Teilhaben, Involviertsein, Zuwendung und Ansprechbarkeit.
Von Anfang bis Ende als Mensch gewollt
Der Mensch: Von Anfang an gewollt
Wie kein anderes Wesen ist der Mensch vom ersten Augenblick an auf die Zuneigung und das Wohlwollen anderer angewiesen. Kein Wesen tritt so wehrlos in die Welt wie der Mensch. Keiner von uns hätte je seine frühe Kindheit und Jugend überlebt, wenn uns nicht jemand gestillt, genährt, gewärmt, geschützt und aufgezogen hätte: Entweder die eigenen Eltern oder, wo dies nicht möglich war, jemand anderer, der sich unser sogar ohne den sonst handlungsanleitenden »Elterntrieb« angenommen hat. Am Anfang hat jemand Ja zu uns gesagt. Ohne dieses Ja hätten wir nicht einen Tag überlebt, ohne dieses Ja würden wir heute nicht sein.
Menschliches Dasein ist mit anderen Worten von Anbeginn an auf Zustimmung durch andere, auf Wohlwollen und auf Liebe angewiesen. Das gilt schon in den allerersten Lebensjahren, und dieses Indiz soll an dieser Stelle zunächst ausreichen, um darzulegen, dass das Ringen um ein tragfähiges Selbst- und Weltbild lebenspraktisch, sogar überlebensrelevant ist. Dieses Indiz veranschaulicht auch, wie sehr Sinn, Wert, Großzügigkeit und Güte von Anfang an in unser Leben und Überleben eingewoben, wie sehr sie die eigentliche Grundsubstanz und Tragfläche unseres Daseins sind. Und es veranschaulicht, weshalb die Suche nach der Hoffnung lohnt und dringlich ist: denn es geht hier um nicht weniger als um unsere andernfalls gefährdete Lebensgrundlage.