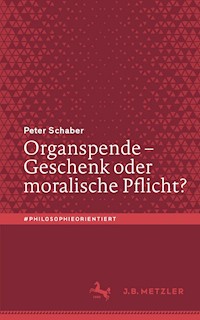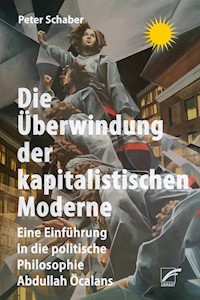
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unrast Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Abdullah Öcalans Gefängnisschriften sind nichts weniger als der Entwurf einer erneuerten linken Gesamtschau auf die Welt im Ganzen. Nach dem Scheitern des realexistierenden Staatssozialismus hat Abdullah Öcalan die theoretischen Grundlagen der kurdischen Freiheitsbewegung von Grund auf umgekrempelt. In einer Odyssee durch Tausende Jahre Menschheitsgeschichte erforscht er Patriarchat und Klassengesellschaft, aber auch die Perspektiven eines Kampfes für radikale Demokratie, soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit. Die vorliegende Einführung ermöglicht einem breiten Publikum einen verständlichen Zugang zu seinen umfangreichen Schriften, in denen er so hartnäckig wie optimistisch gegen die vermeintliche Alternativlosigkeit des Bestehenden anschreibt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 219
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Peter Schaber ist Mitglied des linken Medienkollektivs lower class magazine. Er schrieb mit an zwei Büchern zum Kampf der Kurd*innen gegen Faschismus und Besatzung: Hinter den Barrikaden. Eine Reise durch Nordkurdistan im Krieg (edition assemblage 2015) und Konkrete Utopie. Die Berge Kurdistans und die Revolution in Rojava (Unrast 2017). Im Zuge seiner Kurdistanaufenthalte engagierte sich Schaber in zivilen und militärischen Organisationen der kurdischen Freiheitsbewegung. Nach einem Artikel zu seinen Erfahrungen im Krieg gegen den sogenannten Islamischen Staat leitete die Bundesanwaltschaft ein Terrorismusverfahren gegen ihn ein..
Peter Schaber
Die Überwindung der kapitalistischen Moderne
Eine Einführung in die politische Philosophie Abdullah Öcalans
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar
Peter Schaber:
Die Überwindung der kapitalistischen Moderne
2. Auflage, Dezember 2020
eBook UNRAST Verlag, März 2022
ISBN 978-3-95405-104-5
© UNRAST-Verlag, Münster
www.unrast-verlag.de | [email protected]
Mitglied in der assoziation Linker Verlage (aLiVe)
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung
sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner
Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter
Verwendung elektronischer Systeme vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag: UNRAST Verlag, Münster
Satz: UNRAST Verlag, Münster
Inhalt
Vorbemerkungen
Kapitel 1Methode und Wahrheit: Jenseits von Mythologie, Religion und Szientismus
Wahrheitssuche
Mythos, Religion, Positivismus
Ein sinnvolles Ganzes
Kapitel 2Zwei Ströme in der Menschheitsgeschichte
Der Ausgang aus dem Paradies und die Errichtung des Zikkurat
Die »Gesellschaft an sich«
Kämpfe im Chaos – gegen den Determinismus
Öcalan und die Welt-System-Theorie
Kapitel 3Die Zentralzivilisation: Klassen, Patriarchat, Staat
Staat und Nation
Kapitalismus und Monopol
Patriarchat
Klasse
Macht
Kapitel 4Der Aufbruch: Demokratische Moderne und Sozialismus
Die Wiederbelebung der demokratischen Gesellschaft
Demokratie ohne Staat
Öko-Industrie und Öko-Gemeinschaften
Demokratische Nation und »neuer Mensch«
Selbstverteidigung der moralisch-politischen Gesellschaft
Kapitel 5Die Erneuerung der Kaderpartei
Kaderpartei und revolutionäre Führung
Strategie und Taktik
Internationalismus
Kapitel 6Wiedergeburt aus der Krise: Kurdistan und der Nahe Osten
Die greise Mutter der Zivilisation
Die kurdische Zwickmühle
Renaissance und demokratischer Aufbruch
SchlussKeine Blaupause, sondern eine Aufgabe
Literatur
Primärquellen
Weitere Literatur
Anhang
Wenn du leben willst, dann lebe in Freiheitvon Abdullah Öcalan
Einige Ergänzungen zur Biografie Abdullah Öcalans nach 1999von Reimar Heider / Internationale Initiative ›Freiheit für Öcalan - Frieden in Kurdistan
Anmerkungen
Vorbemerkungen
Im Frühjahr 2017 saß ich zusammen mit einigen anderen Deutschen, die auf dem Weg nach Rojava/Nordsyrien waren, in einer Guerilla-Stellung der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) im Nordirak. Es war unklar, wann wir unseren Weg fortsetzen würden. Da wir unvorhergesehen in dem kleinen Camp gestrandet waren, mussten die beiden noch sehr jungen Kämpfer, die uns betreuten, irgendein Programm für uns aus dem Hut zaubern. Und das bevorzugte Programm in der kurdischen Guerilla ist Bildung. Wir setzten uns also unter einen Baum und Heval Azad, der mit Anfang 20 ältere der beiden Freunde, begann, uns die Geschichte der Befreiungsbewegung zu erzählen. Und natürlich die Geschichte Abdullah Öcalans.
Es gab vor Ort keine Lehrmaterialien, keine Bücher, an die er sich hätte halten können. Er wusste das einfach aus dem Effeff. Dass Abdullah Öcalan am 4. April 1949 in Amara (türkisch: Ömerli) geboren wurde; wie sehr ihn seine Familienverhältnisse beeinflusst hatten; wie er die türkische Linke kennenlernte und Aktivist der marxistischen Studierendenbewegung in der Türkei wurde; wie Öcalan dann begann, Kurdistan als Kolonie zu verstehen; wie er mit Hakki Karer, Kemal Pir und einer Hand voll weiterer Genoss*innen anfing, die PKK, die Arbeiterpartei Kurdistans, aufzubauen. Welche Bücher Öcalan wann schrieb, wann er ins syrische und libanesische Exil ging; wie er dann 1999 entführt und auf der Gefängnisinsel Imrali eingekerkert wurde. Und wie er schließlich in Isolationshaft eine neue ideologische Grundlage für Partei und Bewegung schuf. »Wer keine Geschichte hat, hat keine Zukunft, erklärt uns Öcalan«, sagte Heval Azad, wenn man ihn fragte, warum er das alles weiß.
Heval Azad kannte seinen Öcalan. Und doch war er kein »Experte« oder dergleichen. Den Lebensweg und die Ideen ihres Vorsitzenden zu kennen, ist für die meisten der PKK-Kämpfer*innen obligatorisch. Sie sind Teil der perwerde, Schulungen, die manchmal einige Wochen, manchmal mehrere Monate dauern. Und die Lektüre der dicken Schwarten des inhaftierten Vordenkers bringt über so manchen Winter und so manche längere Phase des Verharrens in Höhlen, wenn der Feind mal wieder seine Drohnenarmee schickt.
Die Kenntnis von Abdullah Öcalans Wirken und Denken ist im Nahen Osten allerdings kein Spezialwissen ausschließlich derer, die sich entschieden haben, ihr Leben der Revolution zu widmen. In jenen vier Ländern, auf deren Territorium die Siedlungsgebiete der Kurd*innen verteilt sind, hat Öcalan Millionen Anhänger*innen. Seine Theorie vermochte, was vielen anderen linken Entwürfen der Gegenwart versagt blieb: Sie wurde eine materielle Kraft in einer wirklichen revolutionären Auseinandersetzung. Sie ist zur ideellen Grundlage einer geschichtsmächtigen Bewegung geworden.
Das zog auch die Aufmerksamkeit zahlreicher internationalistischer Linker – vor allem, aber nicht nur aus Europa – auf sich. In Deutschland reicht die Tradition anarchistischer, autonomer und kommunistischer Kurdistansolidarität lange zurück, aber vor allem seit 2014 ist ein erneutes, gesteigertes Interesse an der kurdischen Bewegung zu verzeichnen. Als damals kurdische Freiwillige den Islamischen Staat daran hinderten, die symbolträchtige nordsyrische Stadt Kobanê einzunehmen, begann weltweit eine breitere Öffentlichkeit, die demokratischen und fortschrittlichen Ideale der kurdischen Befreiungsbewegung wahrzunehmen. Und für viele wurde der Aufbau einer demokratischen Föderation von Kurd*innen, Araber*innen, Christ*innen mitten im Syrienkrieg ein Referenzpunkt für eigene Hoffnungen auf Befreiung.
Die kurdische Bewegung ist keine kleine Nischengruppe. Sie ist – wegen der nach dem Ersten Weltkrieg durchgesetzten imperialistischen Grenzziehung im Nahen Osten – in vier der wichtigsten Staaten der Region präsent: Irak, Iran, Syrien, Türkei. Und darüber hinaus existiert in vielen Nationen dieser Erde – von Frankreich und Deutschland über Russland bis nach Lateinamerika und die USA – eine politisch aktive kurdische Diaspora.
Die kurdische Bewegung ist zudem keine Eintagsfliege. 1978 wurde die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) gegründet, am 15. August 1984 begann sie den bewaffneten Kampf. Zum Zeitpunkt der Niederschrift dieses Textes ist sie weit davon entfernt, nun wirklich und ganz, ganz endgültig »ausgelöscht« zu werden, wie das türkische Regime seit Jahrzehnten alle paar Monate verlautbaren lässt. Im Gegenteil, ihre Konzepte und Ideale wurden Realität im Norden Syriens und weit über die kurdischen Siedlungsgebiete hinaus bis in die mehrheitlich arabischen syrischen Provinzen Raqqa und Deir ez-Zor hinein. Im Südosten der Türkei, also Nordkurdistan (kurdisch: Bakur), sind jene Parteien und sozialen Organisationen, die sich an den Ideen Abdullah Öcalans orientieren, trotz Massenverhaftungen, Absetzung gewählter Repräsentant*innen und Militäroperationen der türkischen Armee immer noch die stärkste politische Kraft. Und in der gebirgigen Grenzgegend zwischen dem Nordirak und der Türkei behauptet sich die Guerilla allen Flächenbombardements und Bodenoperationen zum Trotz.
Die Erfolge wie Verfehlungen, die Errungenschaften wie Mängel dieser Millionenbewegung sind mit dem Namen Abdullah Öcalan aufs Engste verbunden. Er gilt der Bewegung als serokatî, als die politisch-ideologische Leitung. Und auch, wenn er sich seit nunmehr 20 Jahren in Haft befindet, blieben seine Gefängnisschriften so wirkmächtig, dass sie die sich an ihm orientierenden Parteien und Organisationen bis heute prägen.
Ruft man sich all das in Erinnerung, wirkt es erstaunlich, dass es bislang keine Einführung in sein Gesamtwerk in deutscher Sprache gibt (und ähnliches gilt für die meisten anderen europäischen Sprachen). Das auch deshalb, weil Öcalan wirklich deutlich mehr als bloß tagespolitische Erklärungen zu Papier gebracht hat. Er hat über die Jahre Dutzende Bücher geschrieben, und das keineswegs auf die konkrete kurdische Situation beschränkt, sondern durchaus mit dem Ziel, sozialistische Theorie generell neu aufzustellen.
Wie auch immer man zu den Thesen Öcalans stehen mag, man wird nicht bestreiten können, dass ein derartig umfassendes Konvolut von Schriften, wie er es niedergeschrieben hat, gerade in einer Zeit der umfassenden theoretischen wie praktischen Krise der Linken zur Kenntnis genommen werden sollte. Die vorliegende Einführung hat zum Ziel, einen ersten Einstieg in die Theorie Öcalans zu liefern. Sie ist der Versuch einer durchaus systematischen, wenn auch sicher nicht vollständigen Einführung in das Denken des kurdischen Revolutionärs. Ich habe mich bemüht, so nah am Gedanken des Urhebers wie möglich darzustellen, was Öcalan schreibt – ohne es zu kritisieren oder zu bewerten. Ich wurde in den vielen Jahren der Auseinandersetzung mit der kurdischen Bewegung nie »Apoist«, also nie voll und ganz Anhänger der Lehre Abdullah Öcalans. Zugleich glaube ich aber, dass er immens wichtige Impulse für eine Linke gibt, die sich verloren hat und sich auf der Höhe der Zeit wiederfinden will.
Das Ziel der vorliegenden Einführung war zum einen, stringent, möglichst kurz und systematisch aufgebaut darzustellen, was Öcalan schreibt und denkt. Die vorliegende Darstellung ist dabei sicher, das muss man der Fairness halber dazusagen, eine unter mehreren möglichen Interpretationen. Das trifft natürlich generell zu, wenn man über die Gedanken von jemand anderem schreibt. Aber es hat zudem einen sachlichen Grund in den dem kurdischen Revolutionär aufgezwungenen Arbeitsbedingungen. Er beschreibt sie am Beginn der Soziologie der Freiheit so: »Einige Bemerkungen zu meiner Schreibtechnik werden erhellend und entschuldigend wirken. Unter den Bedingungen meiner Einzelhaft wird mir nur jeweils ein Buch, eine Zeitschrift und eine Zeitung in der Zelle gestattet. Es war nicht möglich, Notizen zu machen und mit Zitaten zu arbeiten.« Er habe versucht, deshalb alles in Gedanken zu speichern und es danach aufzuschreiben. Aber: »Die größte Schwäche dieser Methode ist jedoch, dass das menschliche Gedächtnis den Makel des Vergessens trägt. Keine Notizen machen zu können, war daher hinderlich. Als ich mich daran machte, diesen Band zu schreiben, kam obendrein ein neues Verbot: Ich durfte keinen Stift in der Zelle haben. Nachdem am zehnten Tag der ›Bunkerstrafe‹ dieses Verbot aufgehoben wurde, begann ich sofort zu schreiben.« (SdF, S23)
Ähnlich wie bei den berühmten Gefängnisschriften Antonio Gramscis können wir auch bei der Lektüre Öcalans die Spuren dieser äußeren Umstände nicht außer Acht lassen. Eine der Auswirkungen ist etwa, dass man Öcalan immer mindestens zweimal lesen muss. Man muss aus dem Gesamten die systematische Stoßrichtung gewinnen und dann die einzelnen Passagen im Lichte dieses Systementwurfs lesen. Denn er verwendet häufig für ein und denselben Sachverhalt verschiedene Begriffe, dann aber wieder ein und denselben Begriff für verschiedene Sachverhalte. Irgendeine Passage herauszureißen, macht häufig wenig Sinn. Man muss die einzelnen Stellen vom systematischen Ganzen her lesen. Die Schriften sind zudem Selbstverständigung. Sie haben einen systematischen Anspruch, aber sie zeigen dennoch ein Denken im Werden.
Die vorliegende Einführung versucht, den zugrunde liegenden Systementwurf herauszuarbeiten. Ihr eigentliches Ziel aber ist, dass das Buch zum Weiterlesen und zum eigenen Studium Öcalans anregen möge.
Bedanken möchte ich mich für die tatkräftige Unterstützung der Genoss*innen der Internationalen Initiative Freiheit für Öcalan sowie des Unrast Verlags. Mein besonderer Dank gilt meiner Familie und all jenen Genoss*innen, mit denen ich in den vergangenen Jahren über die hier verhandelten und tausende andere Themen diskutieren durfte. Und erinnern will ich an diejenigen, die vieles an Ideen zu diesem Buch beigetragen haben – wie die britische Internationalistin Anna Campbell, der deutsche Internationalist Michael Panser und Mahir Sengali, meinem Kommandanten in den jesidischen Widerstandseinheiten (YBS), denen ich leider nicht mehr danken kann, weil sie im Kampf gegen Faschismus, Kolonialismus und Krieg gefallen sind.
Kapitel 1Methode und Wahrheit: Jenseits von Mythologie, Religion und Szientismus
Die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), die Abdullah Öcalan im November 1978 mitbegründete und der er bis heute vorsteht, war in allen ihren Phasen eine recht eigenständige und eigensinnige Gruppierung[1]. Sie hat, obwohl sie andere revolutionäre Strömungen zu schätzen wusste, nie versucht, ihr Heil in wahlweise Russland, China oder Albanien zu suchen und kann dementsprechend nicht einfach als »stalinistische«, »maoistische« oder »hoxhaistische« Organisation definiert werden.
Dennoch kann man sagen, dass sie ab ihrer Gründung eine antikoloniale marxistisch-leninistische Partei war, die ein sozialistisches, geeintes Kurdistan anstrebte. Als solche konnte die endgültige Niederlage des sowjetischen Sozialismus Anfang der 1990er-Jahre nicht spurlos an ihr vorübergehen. Anders als viele direkter an Moskau gebundene Bewegungen wurde der epochale Einschnitt für die PKK aber kein Anlass zu Resignation, Sozialdemokratisierung oder Rückzug in Traditionspflege. Vielmehr machte sie sich auf eine lang andauernde Suche nach der Weiterentwicklung der ideologischen Grundlage des Sozialismus, die in den 1990er-Jahren begann und in den sogenannten »Paradigmenwechsel« – einer deutlichen Veränderung der Programmatik der kurdischen Freiheitsbewegung – Anfang der 2000er-Jahre mündete.
Dieser »Paradigmenwechsel« stellt weder einen Bruch mit schlechthin allem dar, was die PKK zuvor vertrat, noch lässt er sich an einem einzigen Punkt festmachen; vielmehr betrifft er eine einschneidende Zäsur in zentralen Bereichen der Weltanschauung: Der philosophischen Grundlage, der Frage nach dem Staat, der Rolle der Frau, der Aufgabe von Partei und Guerilla, der Rolle der Demokratie bei der Erkämpfung des Sozialismus. Der Darstellung all dieser Neuerungen wird sich die gesamte vorliegende Einführung zu widmen haben.
Der Ausgangspunkt aber für die abkürzend »Paradigmenwechsel« genannten weltanschaulichen Veränderungen liegt in einer einfachen Einsicht Abdullah Öcalans: Keine der antikapitalistischen, antikolonialen Kräfte des 20. Jahrhunderts hatte gesiegt. Sie alle hatten – auf ganz unterschiedliche Weise – Niederlagen erlitten. Kapitalismus und Liberalismus assimilierten »zuerst die deutschen Sozialdemokraten, anschließend die realsozialistischen Systeme einschließlich Russlands und Chinas und zuletzt die Systeme der nationalen Befreiung. Alle drei Strömungen erlitten gegen den Liberalismus eine klare Niederlage, und leider haben sie bisher dazu keine klare Selbstkritik geleistet« (DKZ, S84).
Öcalan verortet alle diese Strömungen unter den demokratischen Bewegungen der Moderne, denen er auch die kurdische zurechnet. Insofern wird seine Kritik an ihren Fehlern zu einer Selbstkritik. Diese Selbstkritik aber ist zum einen gerade nicht dadurch motiviert, aufhören und abschließen, oder gar dem Kapitalismus das »Ende der Geschichte« gönnen zu wollen. Sondern durch die Frage, wie man denn nach der Niederlage des 20. Jahrhunderts im 21. Jahrhundert weitermachen könnte.
Und sie ist zum zweiten nicht auf billige Antworten aus. Der Grund der Niederlage ist nicht allein in den brutalen, oft hinterhältigen Angriffen des Klassenfeinds zu suchen – die gab es zuhauf. Die schwierigere Frage ist: Warum konnten sich Sozialdemokratie, Marxismus, Anarchismus und antikolonial-demokratische, feministische, ökologische Bewegungen denn nicht gegen diese Angriffe wehren, wenn sie, wie sie behaupteten, eine entwickeltere, humanere Alternative zum Kapitalismus präsentierten?
Öcalans Antwort ist: Diese Strömungen waren nicht in der Lage, einen eigenen Zivilisationsstrang zu etablieren. Sie verblieben – ideologisch wie in ihrer Praxis – genau jenem System verhaftet, das sie eigentlich überwinden wollten. »Die sowjetische Erfahrung hat klar gezeigt, welch katastrophaler Fehler die These vom Kampf zweier Klassen innerhalb einer einzigen Zivilisation war. Da es nicht gelang, die Gussformen der europäischen staatlichen Zivilisation zu durchbrechen, konnte keine spezifisch sowjetische Zivilisation errichtet werden. Weil man in großem Maße die Schablonen der kapitalistischen Moderne zugrunde legte, ließ sich nicht vermeiden, dass man schließlich ihr glich. In der Geschichte kam es zu vielen ähnlichen Situationen. Wenn ihr mit den Waffen (dem Lebensstil der Zivilisation) Anderer kämpft, werdet ihr wie die Anderen. Dass solche Situationen eintreten, hängt damit zusammen, dass es Revolutionen nicht gelingt, eigene Zivilisationsformen zu bestimmen.« (DKZ, S299f)
Was heißt das? Wie wir an mehreren Stellen im Durchgang durch Öcalans Werk sehen werden, reichen die Vorwürfe tief: Philosophisch habe sich schon Marx nicht ausreichend vom bürgerlichen Wissenschaftsparadigma abgesetzt, woraus ein Reduktionismus auf das im engeren Sinn Ökonomische und ein Determinismus in der Geschichtsbetrachtung entstanden sei; der Staat sei als neutrales Instrument zur Klassenherrschaft auch des Proletariats über die Bourgeoisie begriffen worden und habe diejenigen verändert, die ihn zum Einsatz brachten; das Patriarchat sei unterschätzt worden; die Veränderung der aus dem Kapitalismus erlernten Lebensweise sei nicht tiefgreifend genug gewesen und so weiter und so fort.
Die theoretischen Verkürzungen zusammen mit den Angriffen des Gegners führten zur »Entstellung« des Realsozialismus: »Die Zivilisation der demokratischen Gesellschaft, die mit der sowjetischen Oktoberrevolution begonnen hatte, wurde gegenüber dem neuen Hegemon schrittweise zurückgedrängt, entstellt und assimiliert; in den 1990er Jahren wurde das Sowjetsystem offiziell abgeschafft, doch die Politik der Aushöhlung von innen hatte bereits lange vorher begonnen.« (DKZ, S157)
Dasselbe gilt für die antikolonialen Bewegungen: »Die nationalen Befreiungsbewegungen, die sich zumeist entlang einer realsozialistischen Linie entwickelten, hatten von vornherein den Nationalstaat als Maximalprogramm. Wenn wir uns jedoch vor Augen führen, dass sich das von ihnen etablierte Modell nur durch Kollaboration mit den kapitalistischen Monopolen wie USA, EU, IWF und Weltbank auf den Beinen halten kann, so dürfen wir uns über ihre antidemokratischen und zunehmend konservativeren Strukturen nicht wundern.« (DKZ, S281) Anderen, die niemals an die Macht kamen, erging es nicht besser: Es gelang dem System auch, »anarchistische, feministische, ökologische und einige weitere radikale Bewegungen zu marginalisieren.« (DKZ, S371).
Öcalans These ist: Zu einem Zivilisationsstrang gehören weder nur ökonomische Basis, noch nur ideologischer Überbau. Und man kann keinen neuen begründen, wenn man nicht die gesamte menschliche Existenz neu bestimmt. Ein ökonomistischer Sozialismus, der die mit Staatlichkeit und Patriarchat einhergehenden Machtverhältnisse für sekundär erklärt, wird genauso scheitern wie ein liberaler Feminismus, der meint, die Gleichberechtigung der Geschlechter sei als gleiche Teilhabe am Kapitalismus zu erreichen, oder ein Anarchismus, der seinen Freiheitsbegriff dem bürgerlichen Individualismus entlehnt. Der Kapitalismus ist für Öcalan die jüngste Entwicklungsphase einer Jahrtausende alten »Zivilisation«, die auf staatlicher Herrschaft, Patriarchat und Klassenspaltung basiert. Und die Jahrtausende Zeit hatte, ihre ideologischen Formen zu entwickeln, die das Denken durchdrungen und zur Systemerhaltung trainiert haben. Halbe Sachen führen zu keinem Ausweg aus dieser Geschichte.
Das alles ist aber kein Grund zur Verzweiflung. Öcalan übt so harte Kritik nicht, um zu beweisen, dass alles sinnlos sei, sondern um den Weg für einen neuen Aufbruch freizumachen: »Das Erwünschte und Erträumte ist zerfallen, weil es im Kern diesen Träumen nicht gerecht werden konnte, ihnen nicht entsprach«, schreibt er im Rückblick auf die sozialistischen Versuche des 20. Jahrhunderts. »Anstatt sich darüber zu freuen oder darüber zu trauern, ist es der Weg der Wissenschaft, diesem Träumen nachzuspüren, indem hinterfragt wird, was an ihm Wirklichkeit ist – und Erfolge sind bisher immer auf diesem Weg erzielt worden.« (GE1, S422)
Wir wir sehen werden, erstreckt sich Öcalans Neubewertung des Erwünschten und Erträumten auf die gesamte Menschheitsgeschichte. Er entwirft nicht weniger als eine auf einer eigenen Methodik basierende Gesamtschau auf die Geschichte der Kämpfe um Freiheit und Gleichheit. Und aus dieser Evaluierung entwirft er ein Modell, das er als strategische Leitlinie nicht nur für die kurdische Freiheitsbewegung vorschlägt.
In ein so umfangreiches Werk relativ kurz und lesbar einführen zu wollen, einen Überblick über das Ganze des Denkgebäudes geben zu wollen, heißt natürlich auch, einen Preis zu bezahlen, was die Detailtreue angeht. Nicht alle Überlegungen können wiedergegeben, auch die Nuancen etwa in sprachlichen Veränderungen in verschiedenen Entwicklungsphasen nicht berücksichtigt werden. Der Versuch, dieser Einführung ist es, einer breiteren Leser*innenschaft Grundzüge des Denkens Abdullah Öcalans vorzustellen – und das in einer systematischen Ordnung, die hoffentlich ein wenig vermittelt, wie er zu bestimmten Schlussfolgerungen kommt.
Wahrheitssuche
Einfach ist es nicht, wesentliche Züge des Denkens von Abdullah Öcalan kompakt und verständlich darzustellen. Fesselnder und konkreter wäre es sicher mit den populären Themen einzusteigen, die in der politischen Debatte heute eine Rolle spielen: Demokratischer Konföderalismus, Frauenbefreiung, ideologische und militärische Selbstverteidigung. Doch dann läuft man Gefahr dauernd abschweifen und ausholen zu müssen, um zu erklären, wie der Autor auf diese Dinge kommt. Man könnte zwar, wie in einem Programm, die Resultate seines Denkens aufzählen, aber dann fehlt die Genese des Gedankens – und damit das eigentlich Interessante, gerade dann, wenn man nicht nur folgen, sondern kritisch nachvollziehen will.
Beginnen wir deshalb mit einer vielleicht ungewöhnlichen, aber trotzdem auf der Hand liegenden Frage: Abdullah Öcalan hat im Verlauf der letzten Jahrzehnte ein Konvolut an Schriften geschaffen, das – zumindest, was seinen Reichtum an Themen angeht – an die enzyklopädischen Ansätze großer Philosophen des 19. Jahrhunderts erinnert. Aber wozu? Warum schreibt der in Isolationshaft sitzende Chef einer bewaffnet kämpfenden Guerilla-Bewegung dermaßen dicke Bücher? Warum beschäftigt er sich mit Überlegungen zu Atomen und Pflanzenwelt, Gilgamesch und Ištar, Religion und Mythologie, Descartes und Hegel, neolithischer Revolution und Renaissance, Positivismus und Dialektik? Wenn wir ihn ernst nehmen, muss uns klar sein, dass das einen Grund hat, der wenig mit der tödlichen Langeweile auf der Gefängnisinsel Imrali zu tun hat. Und noch weniger mit der Hoffnung auf Applaus aus der internationalen akademischen Zunft. Öcalan hat einen guten Grund, sich all dieses Wissen anzueignen, es zu ordnen und aufzubereiten.
Mit der marxistischen Tradition teilte er lange vor seiner Einkerkerung und teilt er noch heute die Einsicht, dass die Art und Weise, wie wir die Welt verstehen, eng damit zusammenhängt, wie die Gesellschaft verfasst ist, in der wir leben. Und die Überzeugung, dass wir, wenn wir die Welt verändern wollen, ihre Dynamik, ihre Widersprüche und die Möglichkeitsräume, die sich in ihr öffnen, begreifen müssen. Politische Philosophie ist ein notwendiger Teil der Befreiung von einer als bedrückend und erniedrigend empfundenen Realität.
Schon lange vor seiner Entführung im Jahr 1999, in einer Rede zum 1. Mai 1995 vor Absolvent*innen der Parteischule der PKK, skizzierte Öcalan diesen Zusammenhang zwischen politischer Philosophie und Befreiung anschaulich. Diejenigen, die von Kapitalismus und Kolonialismus zu einer gebeugten Existenz verdammt werden, können sich ihrer Ketten nicht ohne politisch-philosophische Selbstvergewisserung entledigen, lautet seine These. Ein romantisierendes oder gar idealisierendes Bild der Unterdrückten, Geknechteten und Geschundenen ist Öcalan schon damals fremd. Im Gegenteil, solange das Volk sich nicht befreit, lebt es, wie er sagt, in einer »verfluchten Realität«: »Die eigene Realität nicht eigenständig und frei zu sehen, sich dafür aber auf den Weg der eigenen Ausbeuter zu begeben; kriechend, dieser Würdelosigkeit schmeichelnd, ist die niedrigste und minderwertigste Ebene, auf die man gelangen kann«, schimpft er. Die Unmündigkeit der Untertanen ist einer der Garanten des Fortbestehens von Ausbeutung und Unterdrückung. Und deshalb lag, so Öcalan, den Herrschenden immer am meisten daran, die subalternen Klassen von eigenständigem Denken abzubringen: »Zu jeder Zeit wurden mit äußerster Sorgfalt die Unterdrückten, Werktätigen dazu angehalten, nicht vertieft zu denken, vor allem sollten sie nicht philosophisch-politisch denken.«[2]
Das Motiv bleibt im Denken Öcalans erhalten. Später, auch lange nach dem sogenannten Paradigmenwechsel, wird er am Sozialismus des 20. Jahrhunderts bemängeln, die Veränderung in der Mentalität der Proletarier nicht als Voraussetzung, sondern als fast automatische Konsequenz des Sieges über die frühere herrschende Klasse gesehen zu haben. Die Frage, wie wir unser Denken und unsere Gewohnheiten zu ändern haben, damit ein anderes gesellschaftliches Zusammenleben möglich wird – der traditionelle Topos vom »neuen Menschen« -, ist für die Arbeiterpartei Kurdistans genauso wie für ihren Vordenker ein tragendes Motiv politischer Arbeit.
Was Öcalan in seinem Mai-Vortrag von allen Werktätigen fordert, spiegelt seine eigenen Erfahrung wieder. In autobiografischen Texten hat er immer wieder betont, wie für ihn die Suche nach Wahrheit zu einem Moment der Befreiung wurde. »Am Anfang des Abenteuers, das mein Leben werden sollte, fehlte es mir an allem«, schreibt er. Seine Familie – er wurde im nordkurdischen Ömerli geboren – sei Teil »einer zerfallenden Gesellschaft« gewesen und so habe sie sich selbst verloren. Alles, was dann bleibt, »sind leere Köpfe, anfällig für die endlosen Lügen der Herrschenden.« Die »Wahrheitssuche« begreift Öcalan als Voraussetzung für die Selbstermächtigung der Unterdrückten. »Mein Begriff von Wahrheit machte eine revolutionäre Veränderung durch«, schreibt er über die Resultate seiner vertieften Studien im Knast. »Die kapitalistischen Dogmen zu zerreißen und Geschichte und Gesellschaft mit der ihnen innewohnenden Wahrheit neu zu erkennen, bereitete mir großes Vergnügen. Seither betrachte ich mich als ›Wahrheitssucher‹. Durch ein holistisches Verständnis von Wahrheit gewann alles eine unvergleichlich höhere Bedeutung; sei es im gesellschaftlichen, physikalischen oder biologischen Bereich. Unter Gefängnisbedingungen konnte ich beliebig viele revolutionäre Wahrheiten entdecken. Nichts sonst hätte mir so viel Kraft zum Widerstand verleihen können.« (zit. n. Network I, S31)
Das Suchen nach Wahrheit ist nun aber gar keine so einfache Angelegenheit. Denn es ist ja nicht das bloße Auswendiglernen dessen, was in einer gegebenen Gesellschaft ohnehin schon als Wahrheit gilt. Karl Marx und Friedrich Engels haben einst geschrieben: »Die herrschenden Ideen einer Zeit waren stets nur die Ideen der herrschenden Klasse.« Wenn da was dran ist, ist es eigentlich selbstverständlich, dass der Bruch mit einer bestimmten Weise gesellschaftlichen Zusammenlebens den Bruch mit den dominanten Ideen dieses Zeitalters mit einschließt. Und so beginnt Öcalans Buch über die kapitalistische Zivilisation mit dem Satz: »Zu den ersten Dingen, die ich bei der Ausarbeitung meiner Stellungnahme gegen das kapitalistische System tun muss, gehört die Befreiung von seinen geistigen Prägungen.« (DKZ, S25)
Soweit, so gut. Wenn wir Kapitalismus, Staat, Patriarchat, Unterdrückung und Ausbeutung überwinden wollen, müssen wir also auch den »geistigen Prägungen«, auf denen diese Verhältnisse fußen, eine Absage erteilen. Doch hier wird es kompliziert.
Denn was ist überhaupt »Wahrheit«? Und wie denken wir über diese »geistigen Prägungen« nach, die wir als zu überwindende identifiziert haben? Die Art und Weise, wie wir über etwas räsonieren, also die Methode unseres Denkens, ist ja ihrerseits weder ungeschichtlich noch neutral. Das kommt uns vielleicht so vor, weil wir es so gelernt haben. Aber selbst ein oberflächlicher Exkurs in die Geschichte des Denkens zeigt rasch, dass dem nicht so ist. Nicht nur was – also der Inhalt des jeweiligen gesellschaftlichen Denkens –, sondern auch wie über die Welt gedacht wird – also die Methode des Denkens – veränderte und verändert sich historisch.
Mythos, Religion, Positivismus
Bevor wir also zu Öcalans Geschichtsphilosophie, seiner Theorie des »neuen Menschen« oder seiner Kritik von Staat und Kapital kommen, hält er uns an, zu überlegen, wie wir eigentlich nachdenken. Ist die Methodik, die wir in den Universitäten und Schulen lernen oder im Wissenschaftsbetrieb anwenden, absolut und unfehlbar? Haben unsere gerade aus der Unmittelbarkeit erwachenden Vorfahren am Beginn der menschlichen Geschichte genauso »wissenschaftlich« gedacht wie wir heute? Und wenn nein, wie haben die denn gedacht? Ab wann haben andere unserer Vorfahren nicht mehr so gedacht? Und warum? Wieso ändern sich Methoden des Denkens? Und welche Methoden haben welche Resultate, Stärken und Schwächen?
Öcalan befasst sich ausführlich mit drei »Methoden« oder Denkweisen: der »mythologischen«, der »religiösen«/«dogmatischen« und der »wissenschaftlichen«/«positivistischen«. Die Chronologie, die er anbietet, geht grob so: Die früheste Menschheit, als sie gleichsam ihre Augen aufschlägt, nimmt die Welt »animistisch« wahr. Alles ist beseelt, der Mensch selbst sowie ihn umgebende Natur. Den »Animismus« kann man allerdings noch nicht im eigentlichen Sinne als eine »Methode« bezeichnen, verharrt er doch noch in der völligen Unmittelbarkeit. Die erste identifizierbare Methode kommt mit der Mythologie auf. Sie bewahrt die Allbeseeltheit, differenziert sie aber bereits in einzelne Göttergestalten aus. Naturgegenstände und Ereignisse werden zu Gött*innen. In der die Menschen umgebenden Welt wimmelt es von ihnen: Fluss- und Berggötter, Gött*innen der Fruchtbarkeit, des Schicksals, der Arbeit, der Kunst. In der Form der mythologischen Erzählung versucht sich der Mensch in der sinnstiftenden Erklärung dessen, was ihm und um ihn herum geschieht.
Ungefähr mit dem Anfang der geschriebenen Geschichte – und damit etwa zeitgleich mit der Festigung von patriarchalen, urbanen, staatlichen Klassengesellschaften – beginnt die Ablösung der Mythologie als vorherrschende Weltanschauung durch Religionen. Und diesen wird wiederum durch jene »wissenschaftliche Methode« der Garaus gemacht, die mit dem modernen Kapitalismus ab dem 16. Jahrhundert die welthistorische Bühne betritt[3].