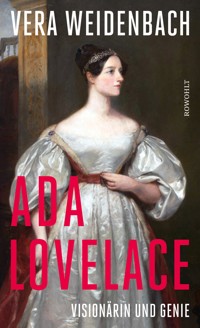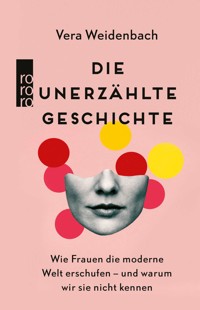
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Frauen veränderten schon immer die Welt: Sie waren nicht nur «die Ersten ihrer Art», sie waren die Ersten überhaupt. Sie forschten, schrieben Weltliteratur und läuteten neue Epochen in der Kunst ein. Vera Weidenbach macht endlich sichtbar, welchen Anteil Frauen an unserer modernen Welt haben. In Wahrheit schuf nicht Walt Disney den ersten Trickfilm, sondern Lotte Reiniger. Rosalind Franklin beschrieb die DNA, Ada Lovelace das erste Computerprogramm und Lise Meitner die Kernspaltung. Camille Claudel prägte die Bildhauerei der Moderne, und Margarete Steffin brachte die Stimmen der kleinen Leute in die weltberühmten Stücke von Bertolt Brecht. «Diesem Buch geht es nicht um Erfolgs- oder Held*innengeschichten. Und das ist gut so. Vera Weidenbach braucht kein Pathos und keine Verklärung der westlichen Moderne, um sie mit scharfem Blick und klarer Sprache umzuschreiben und zu zeigen, was in den meisten Büchern bis heute fehlt: die Geschichte ihrer Frauen.» Şeyda Kurt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Vera Weidenbach
Die unerzählte Geschichte
Wie Frauen die moderne Welt erschufen – und warum wir sie nicht kennen
Über dieses Buch
Frauen haben schon immer die Welt verändert: Sie haben geforscht, Weltliteratur geschrieben und neue Epochen in der Kunst eingeläutet. Die Namen dieser Frauen kommen in Geschichtsbüchern allerdings nicht vor. In Wahrheit hat nicht Walt Disney den Zeichentrickfilm erfunden, sondern eine Frau. Es waren auch Frauen, die die DNA, den ersten Algorithmus und die Kernspaltung beschrieben haben. Eine Frau hat die Bildhauerei der Moderne geprägt, und ebenso war es eine Frau, die die Stimmen der kleinen Leute in die Stücke von Bertolt Brecht gebracht hat. Vera Weidenbach ändert die Geschichtsschreibung, und wir erkennen, welchen Anteil Frauen wie Rosetta Tharpe, Clara Immerwahr, Lucia Moholy, Nellie Bly und Margarete Steffin an unserer modernen Welt haben.
Vita
Vera Weidenbach, 1990 geboren, studierte Philosophie, Biologie und Politik und besuchte die Deutsche Journalistenschule. Sie ist freie Journalistin und Kolumnistin. Als Reporterin hat sie aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin über Bundespolitik in Radio und Fernsehen berichtet. Außerdem hat sie Nachrichten gesprochen und macht Podcasts. Zusammen mit ihren Kollegen von der Produktionsfirma ikone media wurde sie 2020 für den Podcast «Affäre Deutschland» mit dem Reporterpreis ausgezeichnet.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2022
Copyright © 2022 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung zero-media.net, München
Coverabbildung kkgas/Stocksy; Westend61/Getty Images; FinePic®, München
ISBN 978-3-644-01229-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Es ist Zeit für eine andere Geschichtsschreibung
1 Das große Erwachen
2 Ein Krieg so nah und doch so fern
3 Jahre mit Klauen und Fangzähnen
4 Das Dunkel der Nacht
5 Der große Kater
6 Alles so schön bunt hier
Epilog
Verschwinden lassen
Rekategorisierung
Zweiklassengeschichte
Dank
Es ist Zeit für eine andere Geschichtsschreibung
Frauen haben schon immer die Welt verändert. Sie haben große Erfindungen gemacht. Sie haben gerechnet und geforscht. Sie haben Weltliteratur geschrieben und neue Epochen in der Kunst eingeläutet. Die Namen dieser Frauen kommen in den Geschichtsbüchern allerdings nicht vor. Frauen sind nicht nur in der Datenbasis unsichtbar, von der unsere Welt immer mehr abhängt, sondern ebenso in der Geschichte. In Wahrheit hat nicht Walt Disney den Zeichentrickfilm erfunden, sondern eine Frau. Es waren auch Frauen, die die DNA, das erste Computerprogramm und die Kernspaltung beschrieben haben. Eine Frau hat die Bildhauerei der Moderne geprägt, und ebenso war es eine Frau, die die Stimmen der kleinen Leute in die weltberühmten Theaterstücke von Bertolt Brecht gebracht hat.
Ich schreibe die Geschichte nicht um. Ich erfinde nichts dazu, sondern halte mich an die Fakten. Es ist also immer noch die gleiche Geschichte, und doch könnte sie uns wie eine andere vorkommen. Denn in dieser Geschichte treten die altbekannten Persönlichkeiten in den Hintergrund, von denen wir bislang angenommen haben, sie seien die entscheidenden, prägenden Gesichter unserer modernen Welt. Wir kennen sie von den Fluren der Universitäten und den Rathäusern: diese weißen Köpfe von Männern, die Wichtiges getan haben. Schnurrbart reiht sich an Schnurrbart. Ihre unerschütterlichen Nachnamen: Kant, Marx, Darwin. In diesem Geschichtsbuch sehen wir andere, die handeln, die uns die Welt erklären, die versuchen, sie zu interpretieren und zu beschreiben – es sind Frauen.
Unser kulturelles Gedächtnis ist ein Männergedächtnis. Im doppelten Sinn: zum einen, weil es überwiegend an Männer erinnert. Zum anderen, weil auch die Kategorien, nach denen darin Anerkennung zugesprochen wird, von Männern festgelegt wurden. Männer haben entschieden, wer ein großer Denker, ein großer Schriftsteller, ein großer Maler genannt wird. Wer groß genug ist, um neue Epochen einzuläuten und Zeiten zu wenden.
Frauen, die es bisher in diesen Kanon geschafft haben, schafften das auch, weil Männer über sie sagten, sie würden schreiben oder denken «wie Männer» oder zumindest nicht wie Frauen. Normalerweise kennen wir die Namen von Frauen in der Geschichte, weil sie Liebhaberinnen, Mitarbeiterinnen oder Musen von Männern waren. Oder wir kennen sie als absolute Ausnahme von der Regel – wie Jeanne d’Arc oder Marie Curie. Solche Ausnahmefrauen haben zwei Funktionen: Auf der einen Seite sollen sie beschwichtigen – wie alle Quotenfrauen. Auf der anderen Seite sind sie so außerordentlich, dass sie nicht mehr normal sein können. Sie zeigen: Frauen, die es in die Weltgeschichte schaffen, sind etwas, das natürlicherweise nicht vorkommt. Was bloß nicht entstehen soll, ist der Eindruck, dass Frauen genauso klug und stark sind wie Männer und es schon immer waren, egal, wie wenig sie durften. Dass es in allen Disziplinen, der Wissenschaft, der Kunst, der Musik, der Literatur, schon immer Frauen gab, die genauso Standards gesetzt haben wie Männer. Nur hat es eben niemand so genannt.
Ich hätte über alle Epochen und Zeiten schreiben können. Denn egal, in welchem Jahrhundert – große Frauen finden sich überall, wenn man einmal anfängt, danach zu suchen. Ich hätte bei der Steinzeit anfangen können; der Mensch ist ein Jäger und Sammler, lernen wir in unseren Biologiebüchern. Schon hier kommen Frauen nur am Rande vor, in den Höhlen und am Feuer mit einem Baby an der Brust. Dabei sagt uns die Wissenschaft schon lange etwas anderes[1].
Es gibt Knochenfunde, die belegen, dass Frauen ebenso auf die Jagd gegangen sind wie Männer. Dass sie auch draußen unterwegs waren und gegen wilde Tiere kämpften. Aber das ist nicht die Geschichte, die wir in der Schule lernen und die wir immer und immer wieder abbilden. Wir denken, diese Bilder von der heteronormativen Steinzeitfamilie beruhen auf Fakten, auf objektiver wissenschaftlicher Erkenntnis. Aber in Wahrheit wissen Archäologen sehr wenig darüber, wie Menschen in der Steinzeit gelebt haben. Klar ist, dass es sehr viele verschiedene Gesellschaftsformen gegeben hat; die Theorie der Jäger und Sammler stammt von männlichen europäischen Wissenschaftlern aus dem neunzehnten Jahrhundert.
Unsere Vorstellungen davon, wie Männer und Frauen sich vermeintlich natürlich verhalten, sind mächtig. Jungen werden zu Abenteurern, die sich zwischendurch mal prügeln müssen, und Mädchen sollen nett sein und mit Puppen spielen. Das alles hängt miteinander zusammen und beeinflusst tief in uns, wie wir über uns selbst in der Welt sprechen und uns unsere Rolle und Aufgabe darin vorstellen.
Ich werde hier allerdings nicht viel mehr von der Steinzeit erzählen. Ich schreibe in diesem Buch über die Zeit, in der die Welt entsteht, wie wir sie heute kennen. Es ist die Zeit, in der alles anfängt, immer schneller zu werden. In der die Menschen beginnen zu glauben, dass Technik und Wissenschaft unser Leben besser machen und uns vorwärtsbringen. In der alles von dieser Vorwärtsbewegung erfasst wird, nur, um zweimal in riesigen Katastrophen zu enden – in Krieg und Zerstörung. Trotzdem geht es danach wieder weiter, es geht immer vorwärts.
Dieses Vorwärts wurde nicht nur von Männern vorangetrieben, wie man bei einem schnellen Blick in die Geschichtsbücher denken könnte, sondern es wurde maßgeblich von Frauen beeinflusst. Es war eben nicht so, dass die Männer draußen unterwegs waren, die Welt verändert, Kriege angezettelt, andere Staaten und Völker unterworfen haben, während das Leben der Frauen vor allem drinnen stattfand. Nicht nur Männer waren Jäger des Fortschritts, sondern auch Frauen. Und bemerkenswerte Frauen haben auch nicht vor allem für Emanzipation und Frauenrechte gekämpft, sondern die Kunst, Medienwelt, Politik und Wissenschaft für uns alle vorangetrieben, auch für die Männer.
Die Moderne ist die Zeit, in der alle Sicherheiten und Werte verloren gehen. Gott ist tot, und es ist noch nicht entschieden, was an seine Stelle tritt. Das Subjekt ist plötzlich auf sich alleine gestellt und mit der ganzen Situation ziemlich überfordert. Und doch muss es versuchen, die Welt neu zu deuten.
Der Mensch ist das einzige Tier, das von Ideen, Überzeugungen oder Glauben angetrieben wird und handelt, das für solche Ideen bereit ist, zu sterben und zu töten. Die Geschichte der Moderne kann deshalb als ein ständiger Widerstreit von Ideen erzählt werden. Als Bewegung und Gegenbewegung. Als Widerstand und in neuen Strömungen.
Die Geschichte der westlichen Welt verehrt ihre Helden meistens wegen ihrer Macht und ihres Einflusses, wegen ihres Genies und ihrer Originalität. Um Erfolg zu haben, musste in dieser Geschichte erobert und dominiert werden. Groß ist darin nur, wer niemanden neben sich hat. Aber das bedeutet immer, dass Andere dafür kleingemacht werden oder ganz verschwinden müssen. Es ist kein Zufall, dass ich in diesem Buch viele Geschichten von genau diesen Anderen erzähle.
Dadurch wird die Geschichte der Moderne zur Reise eines Antihelden. Antihelden haben keine übernatürlichen Fähigkeiten. Sie sind normale Menschen mit Fehlern. Sie sind nicht stärker als wir und nicht schlauer oder schöner. Deshalb mögen wir sie auch meistens gern. Der Antiheld in diesem Buch ist die Frau. Über die Jahrhunderte ist sie immer wieder gescheitert – wie es sich für Antihelden gehört. Sie wurde vergessen und übergangen, sie wurde ausgelacht und kleingeredet. Und ihre Stärke liegt darin, dass sie trotzdem weitergemacht hat. Dieses Buch feiert seine Protagonistinnen, weil sie die Welt verändert haben, und nicht, weil ihnen am Ende jemand eine Medaille überreicht hätte. Es stellt damit die Maßstäbe infrage, nach denen wir in der Vergangenheit Ruhm verteilt haben. Denn wir werden sehen: Nicht diejenigen, die am Ende die Preise gewonnen haben, haben sie auch wirklich am meisten verdient.
Geschichte wird von denjenigen bestimmt, die sie erzählen und deuten. In der Vergangenheit waren das vor allem weiße Männer, die vor allem die Geschichten von Männern erzählt haben. Sie haben es immer mit einer bestimmten Absicht getan: um die Macht und den Einfluss der herrschenden Gruppe zu sichern. Und aus dem gleichen Grund haben sie andere Geschichten nicht erzählt, oder nicht komplett oder anders, als man sie hätte erzählen können.
Wenn wir heute versuchen, Frauen einen Platz in der Geschichte zu geben, passiert das meistens, indem wir gleich dazusagen, dass sie es als Frau geschafft haben. Was daherkommen soll wie eine besondere Würdigung, ist in Wirklichkeit die Verfestigung einer Zweiklassengeschichte. Als hätten Frauen ohnehin nie in der gleichen Liga gespielt wie Männer. Als hätten sie wegen ihres Geschlechts anders gerechnet oder gemalt und nicht, weil jeder große Künstler ohnehin anders malt und jeder Mensch ohnehin anders denkt als ein anderer, weil er eben ein anderer Mensch ist.
Es gibt keine getrennte Frauen- und Männergeschichte. Die ganze Geschichte ist unsere Geschichte, in der Frauen endlich einen angemessenen Platz erhalten müssen. Das schaffen wir nicht, indem wir versuchen, die Leistungen von Frauen an die Maßstäbe anzupassen, die Männer gesetzt haben, denn es ist Zeit, andere Kategorien für Helden zu erschaffen. Helden, für die andere Menschen nicht getötet, versklavt oder unterworfen werden mussten. Die Frage ist auch: Welche Vorbilder wollen wir haben?
Geschichte beeinflusst unseren Blick auf die Welt und wie wir uns darin sehen. Wir stricken unsere Geschichte aus handelnden Personen und wichtigen Ereignissen. Dieser Stoff ist die Grundlage für das, was wir unsere Kultur, unsere Zivilisation nennen, wenn wir erklären, «wo wir herkommen», wer wir sind. Vielleicht sprechen wir das nie so wirklich aus, aber es passiert in jedem von uns – mit den Bildern, die uns in den Kopf kommen, wenn wir an die Steinzeit denken, und mit den Namen, die uns einfallen, wenn wir an wichtige Persönlichkeiten denken.
Diese Geschichten haben Frauen bisher immer gezeigt, dass sie nicht nach ganz oben gehören. Aber der Grund dafür ist nicht, dass es ganz oben solche Frauen nicht gab, sondern, dass man sie nicht sehen wollte. Das ist das Problem mit Geschichten, die nicht erzählt werden: Irgendwann ist es so, als wären sie gar nicht passiert. Wenn eine Geschichte für die Menschen heute keine Rolle mehr spielt, ihr Denken und Leben nicht mehr beeinflusst, dann ist sie irgendwann einfach verschwunden.
Es ist an der Zeit, neue Statuen zu errichten, um zu zeigen, dass unsere Vergangenheit viel mehr weibliche Stimmen und Gesichter hat, als die bisherige Geschichtsschreibung uns glauben machen will. Geschichte ist ein Teil unserer Identität. Und Frauen sollen ihre Identität nun in einer Geschichtsschreibung finden können, in der sie vorkommen, in der sie einen Platz ganz oben haben. Keine Frau, die nach oben will, muss sich noch fragen: Bin ich da wirklich richtig? Denn die Geschichte zeigt ihr, dass dort längst ihr Platz ist.
«No assertion in reference to a woman is more common, than that she possesses no inventive or mechanical genius … But, while such statements are carelessly or ignorantly made, tradition, history, and experience alike prove her possession of these faculties in the highest degree. Although woman’s scientific education has been grossly neglected, yet some of the most important inventions of the world are due to her.»
Matilda Joslyn Gage
«Disobedience, in the eyes of any one who has read history, is man’s original virtue. It is through disobedience that progress has been made, through disobedience and through rebellion.»
Oscar Wilde
1Das große Erwachen
An der Schwelle zur Moderne ist der Gegensatz zwischen den Verheißungen der Zukunft und den Verhältnissen der Gegenwart riesig. Mitte des 19. Jahrhunderts sind die Träume in den europäischen Metropolen zwar groß, aber die Wohnungen klein. Die neuen Fabriken bieten viele Arbeitsplätze, an Webstühlen und den ersten Fließbändern, aber der Lohn ist schlecht, nach zehn Stunden Arbeit schmerzt der ganze Körper vom Stehen, Beugen, Schleppen. In Berlin, London und Paris sind die meisten Menschen arm. Sie erwachen morgens in einem Bett, das sie sich mit der ganzen Familie teilen. Die Küche ist die Stube ist das Bad. Weil die Hinterhöfe so dicht und eng sind, fällt kaum Licht in das Zimmer. Die Winter sind lang und dunkel.
Schwerfällig ist die Industrialisierung dabei, alles umzuwälzen: die Arbeit, die Gewohnheiten, die Landschaft. Das Zentrum der großen Veränderungen ist Großbritannien. Es ist die Zeit von Königin Victoria.
Langsam übernimmt das Schnaufen der Eisenbahn den Takt des Lebens. Die ersten Strecken werden durch Wälder geschlagen und über Felder gebaut. Bis jetzt sind nur wenige damit gefahren, die Königin hat es schon ausprobiert: «quite charming». Aber es wird noch mehrere Jahrzehnte dauern, bis ein ganzes Eisenbahnnetz entsteht, das den Menschen die Chance gibt, die Welt neu zu entdecken.
Heute wissen wir, dass Erfindungen den Fortschritt in dieser Zeit beschleunigen: die Glühbirne, der Motor, der Fernsprecher. Aber obwohl sie schon gefeiert werden, bleiben sie für die Menschen zunächst Verheißung; ihre volle Wirkung werden sie erst in ein paar Jahrzehnten entfalten. Noch klackern die Hufeisen der Pferde über das Pflaster.
Auch neue Ideen beginnen alte in Frage zu stellen. Das Bürgertum zweifelt seit der Französischen Revolution im Jahr 1789 immer häufiger seine Monarchen an. Und denen gehen immer häufiger die Antworten auf Fragen einer Gesellschaft aus, die immer komplexer wird, auf die Armut in den Arbeitervierteln und die Gefahren in den Fabriken. Eigentlich ist die ganze Geschichte der Moderne ein Widerstreit von alten Ideen gegen neue.
In der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts beherrschen jedoch die alten Ideen Europa. Ihnen liegt ein zentraler Gedanke zugrunde: Sie gehen nicht davon aus, dass Menschen prinzipiell gleich sind, egal ob Christentum, Monarchie, Imperialismus oder Patriarchat sie eint, dass es eine Hierarchie geben muss, eine vermeintlich göttliche oder zumindest natürliche Ordnung. Oben steht letztlich immer ein weißer Mann. Gott steht in dieser Vorstellung über dem König, der weiße Eroberer steht über dem schwarzen Ureinwohner, und der Mann steht über der Frau[1]. Diese Vorstellung durchzieht als Grundgerüst alle Ebenen der westlichen Gesellschaften.
Die alten Ideen sind stark, denn sie stützen sich gegenseitig und sind bewaffnet. Aus ihnen sind die Kathedralen und die Schlösser der Könige gebaut, sie stehen auf den Wappen mit den großen Adlern und noch größeren Löwen. Sie geben Männern mit Schnurrbärten, Stahlhelmen und Uniformen die Macht, Armeen zu befehlen. Sie halten die Waffen der Soldaten, und mit ihnen fahren sie auf Schiffen zu neuen Kontinenten.
Zuerst sieht es so aus, als würde auch die Industrialisierung die bestehenden Verhältnisse weiter stützen. Der neue Reichtum der Fabriken fließt in die Hände einiger weniger Industrieller und Aristokraten. Die Zahl der Arbeiter wächst, aber sie haben noch keine Macht.
Die Moderne beginnt zu rütteln, an den vermeintlich unumstößlichen Sicherheiten der Eliten. Aber so einfach werden sich die alten Ideen nicht geschlagen geben. Und dem Zweifel begegnen sie meistens mit Gewalt.
Noch ist die britische Gesellschaft streng in Oben und Unten aufgeteilt, und auch der Fortschritt und die Wissenschaft sind Sache der Oberschicht – und die sieht sie auch als Unterhaltung. Die wichtigen Familien Londons schmücken sich mit den wichtigsten Wissenschaftlern und laden sie in ihre Salons ein. Dort werden abseits der akademischen Räume Ideen ausgetauscht und neue Erfindungen vorgeführt.
Auf diesem Nährboden wächst das Mögliche immer näher an das Unmögliche heran, und manche Ideen wuchern sogar noch weit darüber hinaus. Wir messen große Denker häufig daran, wie weit sie ihrer Zeit vorauseilen. Wie sehr unterscheidet sich ihre Lebensrealität von dem, was sie sich vorstellen oder herbeirechnen können? Die Unwahrscheinlichkeit ihrer Ideen macht ihre Originalität aus. Gehen wir danach, ist Ada Lovelace eine der größten Denkerinnen der Moderne.
Weil sie reich und adelig ist, geben berühmte Mathematiker Lady Lovelace Privatunterricht. Einer davon ist der Erfinder Charles Babbage. Zum ersten Mal treffen sie sich im Jahr 1833 bei einer Soiree im Haus der Babbages, da ist Ada Lovelace siebzehn Jahre alt. An diesem Abend führt Babbage eine Maschine vor, die mathematische Gleichungen lösen kann.
Lovelace ist begeistert von der Maschine und von Babbages Idee für seine nächste, genannt Analytical Engine. Sie soll nicht nur plus und minus, sondern auch komplizierte Formeln mit Zahlen und Buchstaben lösen können.
Lovelace wird Babbages Schülerin und schreibt ein paar Jahre später an der Übersetzung eines Aufsatzes über die Analytical Engine, den wiederum ein Mathematiker auf Französisch geschrieben hat, nach dem einzigen Vortrag, den Babbage jemals über seine Maschine in der italienischen Stadt Turin gehalten hat. Mit diesem Text will Ada Lovelace dem Erfinder helfen, denn seine Maschine ist kleinteilig und aufwendig und er braucht Geld, um weiter daran arbeiten zu können. Um die britische Regierung zu überzeugen, Charles Babbage weiter zu fördern, müsste man nur zeigen, was die Rechenmaschine alles könnte, wenn sie gebaut wird, denkt Ada Lovelace. Sie kennt die komplette Entwicklung der Analytical Engine und weiß deshalb viel mehr darüber als der Mathematiker, der den Aufsatz geschrieben hat.
Jahrelang arbeitet Babbage an den Plänen für seine Maschine. Ständig verändert er sie wieder ein wenig, schmeißt ein paar alte Teile raus und setzt neue ein. Trotzdem schafft es Ada Lovelace, das Prinzip der Maschine festzuhalten – und vor allem das Potenzial zu erkennen, das in ihr steckt. Sie übersetzt den Aufsatz nicht nur ins Englische, sondern schreibt ihre eigenen Gedanken dazu. Am Ende sind ihre Notizen gut doppelt so lang wie der eigentliche Text.
Der Entwurf für die Maschine besteht im Prinzip aus drei Teilen: einem Rechner, einem Arbeitsspeicher und einem Lochkartenleser[2], über den Befehle in die Maschine eingegeben werden können, welche Berechnungen sie ausführen soll.
Mitte des 19. Jahrhunderts gibt es in Großbritannien schon Webstühle, die automatisch verschiedene Muster weben können. Diese Muster sind in Lochkarten codiert, die dem Webstuhl sagen, welcher Faden wohin gehört. Die Lochkarten geben dem Webstuhl sozusagen das Programm vor, mit dem ein bestimmtes Muster entsteht. So ähnlich soll das auch bei Babbages Maschine funktionieren: «Am treffendsten können wir sagen, dass die Analytical Engine algebraische Muster webt, gerade so, wie der Jacquard-Webstuhl Blätter und Blüten»[3], schreibt Ada Lovelace.
Der Unterschied ist, dass man mit algebraischen Mustern so viel mehr machen kann als mit Stoff. «Der Operationsmechanismus (…) könnte (…) mit anderen Dingen als Zahlen operieren.» Dazu müsste man nur für die grundlegenden Relationen der Objekte entsprechende mathematische Relationen finden, die «sich zugleich an die Programmsprache sowie die Mechanik der Maschine anpassen ließen».[4]
Was Ada Lovelace damit meint, ist, dass die Maschine alle Vorgänge ausführen könnte, die sich in mathematischen Formeln ausdrücken lassen, sodass die Maschine sie versteht und umsetzen kann. Das klingt abstrakt, weil es abstrakt ist. Was Ada Lovelace hier als Erste beschreibt, ist das Prinzip eines Computers. Die Wirklichkeit wird von der Maschine in Zahlen, Formeln und Befehle zerlegt. Alle Vorgänge, die in solchen Formeln, also in einer Sprache für die Maschine, beschrieben werden können, kann sie dann auch ausführen.
Sie könnte zum Beispiel Musik komponieren: «Angenommen, etwa die grundlegenden Relationen der Tonhöhen in der Harmonie- und Kompositionslehre könnten auf diese Art und Weise ausgedrückt und an die Maschine angepasst werden, so könnte sie ausgefeilte und allen Regeln der Kunst gehorchende Musikstücke von beliebiger Komplexität und Länge komponieren.»
Mit einem Programm also, das der Maschine das Notensystem mit den für sie passenden Formeln beibringt, könnte die Maschine selbst Lieder schreiben. Heute heißen diese Formeln Algorithmen und sind die Grundlage aller Computerprogramme.
Und so eines schreibt Ada Lovelace dann auch gleich noch: Sie denkt sich eine konkrete Berechnungsanweisung für die Analytical Engine aus. In einer Tabelle beschreibt sie die Formeln für konkrete Schritte, die die Maschine machen müsste, um die sogenannten Bernoulli-Zahlen zu berechnen. Die vertikalen Spalten ihrer Tabelle beschreiben, wie sich die Zahlen mit einer neuen Operation verändern müssten[5], um am Ende zum richtigen Ergebnis zu kommen. Die Verfahren, die Lovelace dabei benutzt, lernen Informatiker noch heute.
Ada Lovelace ist auch die Erste, die zwischen Hardware und Software unterscheidet, also zwischen der Maschine und ihrem Programm[6].
Die Hardware wird allerdings nicht fertig. Charles Babbage ist ein glückloser Erfinder. Wieder stellt er einen Förderantrag bei der britischen Regierung, aber weil er ständig neue Ideen hat, glauben ihm seine Geldgeber irgendwann nicht mehr, dass seine Maschine fertig wird. Sie besteht aus mehr als 8000 Einzelteilen[7]; Zahnräder über Zahnräder, die ineinandergreifen, und feine Mechanismen, die sich bei jedem Rechenschritt ein Stückchen weiterdrehen. Die Teile sind viel zu klein und filigran für die Mechanik der Zeit, und es ist unsicher, wie man sie herstellen könnte. Der Regierung erscheint das alles zu kompliziert und vage. Babbages Antrag wird abgelehnt.
Im Jahr 1843 erscheinen die Übersetzung des Aufsatzes von Ada Lovelace und ihre sogenannten Notes in der Zeitschrift Taylor’s Scientific Memoirs. Die Tabelle, die sie darin für Babbages Maschine berechnet hat, ist das erste Computerprogramm, geschrieben für eine Maschine, die nie gebaut wird. Hätten Ada Lovelace und Charles Babbage das Geld und die technischen Möglichkeiten gehabt – der Computer hätte vielleicht schon 1843 erfunden werden können und nicht erst 100 Jahre später.
Geträumt hatte Ada Lovelace schon immer groß. Als Kind träumt sie vom Fliegen. «I am going to begin my paper wings tomorrow and the more I think about it, the more I feel almost convinced that with a year or so’s experience and practice I shall be able to bring the art of flying to very great perfection.»[8] Das schreibt sie mit zwölf Jahren in einem Brief an ihre Mutter und plant ein Buch über «Flyology» zu schreiben. Damit träumt sie sich auch aus einer unbarmherzigen Gegenwart heraus: Ihr Leben lang ist sie immer wieder sehr krank und über lange Zeit ans Bett gefesselt. Ständig hat sie Anfälle, fällt in Ohnmacht und hat Asthmaattacken.
Gleichzeitig verlangt ihre Mutter, dass sie Mathematik und Physik lernt, der Tagesablauf ist streng in Lerneinheiten getaktet. Mit Literatur und Poesie oder Geisteswissenschaften wie Philosophie soll Ada nicht in Berührung kommen. Die Mutter hat Angst, dass ihre Tochter so wird wie der Vater – der romantische Dichter Lord Byron. Den hat Ada Lovelace nie kennengelernt, weil er England nur wenige Monate nach ihrer Geburt verlässt.
Seine Gedichte sind beliebt und haben ihn in ganz England bekannt gemacht. In der Londoner Gesellschaft sorgen aber seine vielen Affären mit Frauen und wahrscheinlich auch Männern für eine dunkle Faszination, mit der sich Lord Byron umgibt. «Byronmania», nennt das Adas Mutter. Sie ist die Einzige, die der Dichter in London heiratet, aber auch das bedeutet für ihn nicht viel. Als er England Richtung Italien verlässt, bleiben außer den vielen Geschichten auch viele Schulden übrig.
Adas Mutter hält ihre Tochter also von allem Metaphysischen fern, um den Einfluss des Vaters zu mindern. So wird sie Mathematikerin. Trotzdem gibt ihr unbekannter Vater Ada das Gefühl, etwas Besonderes zu sein und eine höhere Bestimmung zu haben.
«Ich glaube, ich besitze die einzigartigste Kombination von Eigenschaften, die mich perfekt dafür macht, ein Entdecker von Geheimnissen der Natur zu werden», schreibt sie. «Ich habe (…) eine Intuition für versteckte Dinge; (…) riesige Denkkapazitäten; drittens: Meine Konzentrationsfähigkeit.»[9]
Um mit ihrer Krankheit klarzukommen, nimmt Lovelace Opium und andere Medikamente; sie hat ständig Schmerzen. Im Jahr 1852 stirbt sie in London an Gebärmutterkrebs, mit 36 Jahren. Bis das, was sie erdacht hat, Wirklichkeit wird und die Welt verändert, wird es noch sehr lange dauern.
In seinen Memoiren schreibt Babbage später, er habe Ada Lovelace gefragt, warum sie nicht einen eigenen Aufsatz zur Analytical Engine geschrieben habe, obwohl sie sich so gut damit auskennt. Auf diese Idee sei sie gar nicht gekommen, antwortet sie. Auch dazu, dass sie überhaupt ihre eigenen Gedanken zur Übersetzung hinzufügt, habe er sie ermutigen müssen, schreibt Babbage weiter.
Unterzeichnet hat Ada Lovelace ihren Text nicht mit ihrem vollen Namen, sondern nur mit den Initialen A.A. L[10]. Das habe «Lord L.», also ihr Mann, vorgeschlagen, schreibt sie später in einem Brief an Babbage. So könne sie kenntlich machen, dass sie die Autorin ist, ohne ihren Namen zu nennen. «Es ist nicht mein Wunsch, zu verkünden, wer es geschrieben hat», schreibt Lovelace. Die Autorschaft wird zur Formalie: Es gehe darum, alles, was später noch von ihr erscheine, mit «Produktionen» dieser A.A. L assoziieren zu können – nicht aber direkt mit der Person Ada Augusta Lovelace[11]. Es ist eine Lösung für ein eigentlich unlösbares Problem: Wie wird man Autorin, ohne Autorin zu sein?
Frauen fehlen in der Geschichte auch, weil ihre Namen häufig nicht neben ihren Erfindungen und über ihren Texten stehen. Das ist verhängnisvoll in einer Gesellschaft, in der es so viel zählt, der Erste zu sein. Wir denken, dieses Kriterium mache unsere Geschichte objektiver, denn auf den ersten Blick scheint es wie ein fairer Maßstab: Der Erste und damit der Beste gewinnt den Wettkampf um Erfolg. Allerdings hat das Ganze einen großen Haken: Die Regeln für den Wettkampf sind nicht objektiv und fair. Und wer sie bestimmt, bestimmt auch die Geschichte. Wir erzählen Geschichte, als bestehe sie aus Fakten, als kommentierten wir nur, was auf dem Spielfeld geschehen ist. Wie diese Fakten zustande gekommen sind, fragen wir seltener.
1883 beschreibt die amerikanische Frauenrechtlerin Matilda Joslyn Gage in ihrem Essay Woman as an Inventor, warum Männer häufig den Ruhm und das Geld bekommen für die Arbeit, die eigentlich Frauen gemacht haben[12].
Gage zählt darin eine wichtige Erfindung nach der anderen auf, die Frauen gemacht haben. Sie rechnet vor, wie viel sie damit zum Wohlstand der USA und auch anderer Länder beigetragen haben. Aber ihre Namen kennt fast niemand. Der Grund ist simpel: Frauen können Patente Ende des 19. Jahrhunderts für ihre Erfindungen nicht unter ihrem eigenen Namen anmelden, sondern nur unter dem des Ehemanns oder des nächsten männlichen Verwandten. Damit werden Frauen nicht bloß vom finanziellen Erfolg ihrer Ideen ausgeschlossen, sondern können auch nicht bestimmen, was mit ihrer Erfindung passieren soll. «Sie hat kein Recht, keinen Anspruch und keine Macht über diese Arbeit ihres eigenen Verstandes.»[13] Die Folge: Frauen als Erfinderinnen werden nicht gesehen und in der Geschichtserzählung ausgelassen. Ihre Leistungen verschwinden. Immer wieder lesen wir, dass Frauen nichts erfinden konnten, weil sie von Männern unterdrückt wurden. Aber eigentlich ist dieses Bild falsch. Frauen haben immer sehr viel erfunden, aber weil sie unterdrückt wurden, weiß das heute kaum noch jemand.
Die Patente sind nur ein Beispiel dafür, wie sich die Namen von Männern vor die von Frauen schieben und sie überdecken. In den 1990er-Jahren gibt die Soziologin Margaret Rossiter dem Phänomen einen Namen: Sie benennt es nach Matilda Joslyn Gage den Matilda-Effekt[14].
Wir werden ihm noch häufiger begegnen, denn er lässt sich nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in der Kunst, der Literatur und der Architektur beobachten.
Als Erfinder der Analytical Engine gilt für die nächsten 100 Jahre jedenfalls erst einmal Charles Babbage. Dabei wollte er mit seiner Maschine nur schneller rechnen können; Ada Lovelace war diejenige, die die Idee weiterdachte und ihr volles Potenzial begriff. Sie erkannte, welche Macht in Zahlen steckt, wenn man sie mit Technik verbindet. Sie erkannte, dass Zahlen und mathematische Formeln eine Sprache sind, die eine Maschine lernen kann[15]. Die Maschine, die die Sprache versteht und die Befehle ausführt, kann dann eigentlich alles machen – Musikstücke komponieren oder Telefon und Kamera und Zeitung in einem sein. Heute halten wir diese Maschinen ganz selbstverständlich ans Ohr, aber so nah wie Ada Lovelace kommt dem Computer nach ihr lange keiner mehr.
Ada Lovelace kann auch Mathematikerin werden und das erste Computerprogramm schreiben, weil sie reich ist, weil ihre Familie reich ist. Und sie kann sich deshalb auch noch mehr erlauben. Sie soll spielsüchtig gewesen sein und versucht haben, den Ausgang von Pferderennen zu berechnen; Babbage und sie sollen sich ein Notizbuch mit ihren Vorhersagen hin- und hergeschickt haben. Auf eine Formel für den Zufall sind sie allerdings nicht gekommen und verloren stattdessen viel Geld.
Während Lady Lovelace auf Opium einen Teil ihres Vermögens verspielen kann, ohne dadurch größeren Schaden davonzutragen, lebt der Großteil von Londons Bevölkerung im Elend. London ist die größte Stadt der Welt und die erste mit mehr als fünf Millionen Einwohnern. Viele Viertel würden wir heute als Slums bezeichnen, in denen immer wieder Krankheiten ausbrechen.
Flora Tristan zieht durch diese Arbeiterviertel und schreibt im Jahr 1840 auf, welches Elend sie dort sieht. Sie besucht Schulen, Gefängnisse und Bordelle. Eigentlich ist ihr Text eine große Reportage, wenn sie die Prostituierten auf der Waterloo Road beschreibt: «Es war ein heißer Sommerabend; in allen Fenstern und Hauseingängen standen Frauen und lachten und scherzten mit ihren Freiern. Nur halb bekleidet, einige nackt bis zur Hüfte, boten sie einen abscheulichen Anblick und die kriminellen und zynischen Blicke der Männer erfüllten mich mit schrecklicher Vorahnung.»[16]
Der Reichtum der Oberschicht beruht auf der Armut der Arbeiter, schreibt Tristan. Das sehen aber die wenigsten: «Die meisten Reisenden sind zufrieden mit einem oberflächlichen Blick und geblendet vom Luxus des Reichtums (…), ihnen ist nicht bewusst, dass es in der Metropole viele Viertel gibt, die alles Übel, Laster und Böse der Menschheit beherbergen.»[17]
Sie schreibt auch auf, was sie in Londons Fabriken erlebt: «Brot wurde als Luxus gesehen. Den meisten Arbeitern fehlt es an Kleidung, Möbeln, Kohlen und gesundem Essen – es gibt nicht einmal Kartoffeln! Sie verbringen jeden Tag zwölf bis vierzehn Stunden eingesperrt in kleinen Räumen, wo sie mit jedem Atemzug der faulen Luft Fasern von Baumwolle, Wolle oder Flachs oder Teilchen von Stahl oder Eisen einatmen.»[18]
Als sie das schreibt, ist die Sozialistin schon zurück in Frankreich. Sie fährt durch die großen Städte Lyon, Nîmes, Marseille, Toulouse und besucht auch dort die Arbeiterviertel. Hier geht es den Arbeiterinnen und Arbeitern nicht viel besser als in Großbritannien.
Flora Tristan hält Reden in den Fabriken und fordert die Menschen auf, sich zusammenzuschließen. Nur gemeinsam könnten sie genügend Macht gegen die reichen Industriellen entwickeln, so ihre Idee. Sie fordert Mindestlohn und bessere Arbeitsbedingungen. Die Politiker in den Städten schicken Polizisten zu den Versammlungen, auf denen sie spricht, und versuchen, sie einzuschüchtern: Man durchsucht ihre Sachen und konfisziert ihre Papiere.
Aber Flora Tristan setzt ihre Tour fort und schreibt ihre Ideen auf, denn sie belässt es nicht bei praktischen Forderungen. In ihrem wichtigsten Text L’Union Ouvrière – «Die Arbeiterunion» – schreibt sie, die Arbeiter müssten sich organisieren und als eine Klasse verstehen, so, wie die Bourgeoisie nach der Französischen Revolution ein Klassenbewusstsein entwickelt hat. Am Ende müsse eine «Union universelle des ouvriers et des ouvrières» – ein «weltweiter Zusammenschluss der Arbeiter und Arbeiterinnen» stehen, schreibt sie in ihrem Manifest[19].
Ihr Anspruch ist umfassend: Es dürfe kein «Unterschied gemacht werden zwischen Nationalitäten oder männlichen und weiblichen Arbeitern, zu welchem Land auch immer sie auf dieser Erde gehören».[20]
Weil sie zuerst keinen Verleger findet, der ihre Bücher veröffentlichen will, sammelt sie das Geld für den Druck selbst. Bei einflussreichen Künstlern und Schriftstellern, aber auch in den Arbeitervierteln geht sie von Tür zu Tür und sammelt winzige Beträge, aber am Ende bekommt sie schließlich genug zusammen. Die schmale Broschüre im Taschenformat, die «in die Schirmmützen der Arbeiter hineingestopft» werden kann, wird im Jahr 1843 veröffentlicht und ein Erfolg[21]. Es werden mehrere Auflagen gedruckt, ebenfalls finanziert von Arbeiterinnern und Arbeitern.
Ihre Reisen unternimmt Flora Tristan allein, und oft lebt sie dabei in feuchten Räumen und ernährt sich nicht gut. Sie wird krank, setzt ihre Reise trotzdem fort, aber es geht ihr immer schlechter. Kurz nachdem sie 1844 in der französischen Stadt Bordeaux ankommt, stirbt sie, wahrscheinlich an einer Typhusinfektion.
Auf Flora Tristans Grab auf einem Friedhof in Bordeaux steht ein Denkmal. Nach ihrem Tod sammelten die Arbeiter und Arbeiterinnen dafür Geld und finanzierten es selbst. Immer mehr sind in Verbänden und Gewerkschaften organisiert. Im Oktober 1848 ist das Denkmal fertig, und als es enthüllt wird, strömen fast achttausend Menschen auf den Friedhof. «Les travailleurs reconnaissant», steht auf dem Sockel – «Die dankbaren Arbeiter».
Im gleichen Jahr erscheint das Kommunistische Manifest von Karl Marx und Friedrich Engels. Es schließt mit dem Satz «Proletarier aller Länder vereinigt euch!» und gilt heute als die Geburtsstunde für den Kommunismus. Dabei hat Flora Tristan diesen Gedanken bereits fünf Jahre zuvor aufgeschrieben.
Es ist bekannt, dass Marx Flora Tristan und ihren Aktivismus für die französischen Arbeiter kannte. Direkt bezieht er sich nirgendwo auf sie oder ihre Schriften. Die beiden Denker unterscheiden sich aber auch in zwei zentralen Punkten: Tristan will die Verhältnisse ausdrücklich für Männer und Frauen zugleich verbessern. Und zwar, weil das nicht nur der Frau, sondern genauso dem Mann nutze, argumentiert sie. Die Verhältnisse, unter denen die Arbeiter leben, die schwere Arbeit, die vielen Kinder, um die sich niemand kümmern könne, das Elend, das alles mache ein glückliches Familienleben unmöglich.
«Die Frau ist alles im Leben eines Arbeiters» schreibt sie[22]. Das Leben von Männern werde immer auch von Frauen geprägt: Jungen lernen von ihren Müttern, bevor sie in die Schule kommen, alte Männer werden von Frauen gepflegt. Wäre es dann nicht im Interesse der Entwicklung des Kindes und des Wohlergehens des alten Mannes, dass die Frau gut ausgebildet ist und über viel Wissen verfügt? Im Moment mache die Beziehung zwischen Mann und Frau niemanden glücklich, weder die Unterdrücker noch die Unterdrückten. Warum die Fähigkeiten und Intelligenz der Frau verkommen lassen, wenn man sie doch genauso gut für den Fortschritt nutzen könnte? Ohne die Berücksichtigung der Frau hält Tristan eine Weiterentwicklung der Gesellschaft nicht für möglich. Bleibe die Frau zurück, bleibe die ganze Menschheit zurück.[23]
Im Kommunistischen Manifest spielen Frauen dagegen nur eine Nebenrolle. Zwar gibt es mehrere Verweise auf die Arbeit von Frauen, aber es beschränkt sich auf die Feststellung, dass die Bourgeoisie die Frau als Produktionsinstrument ansehe. Von gleichen Rechten für Mann und Frau ist dort nicht direkt die Rede.[24]
Flora Tristan gilt heute vor allem als Feministin, doch diese Einschätzung greift zu kurz. Sie ist eine der ersten Sozialistinnen, deren Theorie mit Blick auf die Frau umfassender ist als die der Männer, die ihr folgen. Sie hat die Gleichstellung der Frau in ihrer zentralen Forderung mitgedacht und die doppelte Diskriminierung als eines der wichtigsten Probleme des Proletariats erkannt. Denn immerhin machen Frauen auch zahlenmäßig die Hälfte dieser Gruppe aus.
Außerdem lehnt Flora Tristan Gewalt als Mittel des Klassenkampfes strikt ab. An die Arbeiter schreibt sie: «Eure Aktion liegt bei euch, es ist keine Revolte mit bewaffneter Hand, Aufruhr auf öffentlichen Plätzen, Flächenbrand oder Plündern. Nein; denn die Zerstörung würde eure Übel nicht beheben, sondern sie noch schlimmer machen.»[25]
Damit Ideen Wirkung entfalten können, müssen Menschen dazu gebracht werden, nach ihnen zu handeln. Erst in der Aufforderung an die Arbeiterinnen und Arbeiter, sich zu vereinigen, dem damit entstehenden Klassenbewusstsein und der folgenden Organisation in politische Gruppen und Parteien wird eine Idee Wirklichkeit, und zwar in dem Sinne, dass sie eine Wirkung entfalten, also etwas verändern kann. Sozialismus und Kommunismus entstehen als Gegenbewegung zu Nationalismus und Kapitalismus.
Das Gegeneinander dieser Ideen wird die Welt nicht mehr loslassen. Es wird Revolutionen und Kriege hervorbringen und viele Menschenleben fordern.
Denn es ist die Revolution, wie Marx und Engels sie im Auftrag der kommunistischen Partei in ihrem Manifest beschreiben, das die Grundlage der Programmatik der europäischen Arbeiterbewegung wird. Sie schließen Gewalt als Mittel des Klassenkampfes nicht aus, wie es Flora Tristan getan hat. Sie sehen Gewalt für ein Gelingen der Revolution zwar als letztes Mittel an, halten es aber gleichzeitig sogar für unvermeidlich[26]. Auch die Bolschewiki in Russland machen die Theorie von Marx als Strategie später zur Grundlage ihrer Revolution[27].
Im Jahr 1848 entfachen die neuen Ideen von Sozialismus und Kommunismus zum ersten Mal in ganz Europa einen Umbruch. Gemeinsam mit liberal eingestellten Mitgliedern der Bourgeoise. Bürger, Studenten und Arbeiter gehen in Paris, Berlin, Wien und London auf die Straßen. Sie fordern Presse- und Versammlungsfreiheit, manche sogar die Abschaffung der Monarchie. Kurz sieht es so aus, als könnten sie etwas verändern. Überall in Europa werden für kurze Zeit neue Verfassungen eingeführt und Bürgerparlamente eingesetzt. Aber es dauert nur ein paar Monate, bis die Bataillone der Fürsten und Könige die Revolution niederschlagen. Aber die neuen Ideen leben trotzdem weiter. Und verändern, wie die Menschen die Welt sehen.
Die Denktradition, die dem Sozialismus zugrunde liegt, ist der Materialismus. Den gibt es schon in der Antike, aber in der Moderne kommt er wieder zurück. Er ist nicht nur eine politische Strömung, sondern enthält grundlegende Überzeugungen, die dann wieder zu politischen Einstellungen führen können. Der Materialismus geht davon aus, dass es nur diese eine Welt gibt, in der wir leben. Es gibt also kein Jenseits, in dem alles besser werden könnte, wie es beispielsweise die Bibel den Menschen verspricht. Praktisch lässt sich von dieser Annahme die Forderung ableiten, dass der Mensch noch in diesem Leben und auf dieser Erde glücklich werden sollte.
Auch an die Existenz von Gott zu glauben ist für Materialisten eher schwierig. Der Atheismus entwickelt in der Moderne eine neue Kraft, und politische Ideologien übernehmen immer mehr die Rolle der Religion, den Menschen eine Identität zu stiften. Die Kirche hat für die Monarchien über Jahrhunderte eine legitimierende Funktion übernommen. Weil jede Kritik an Gott deshalb auch eine Kritik an den bestehenden Verhältnissen ist, werden der Materialismus ebenso wie der Sozialismus von den konservativen Regierungen Mitte des 19. Jahrhunderts abgelehnt und verfolgt. Philosophische Schriften werden verboten, einigen Professoren der Lehrauftrag entzogen.
Der Materialismus nimmt an, dass die Umstände, unter denen der Mensch lebt, stärker sind, als sein Wille frei ist. Das heißt, dass er nur bis zu einem gewissen Grad so handeln kann, wie er gerne will. Daraus folgt: Wenn das Glück von den Umständen abhängt, sollte der Mensch versuchen, die Verhältnisse so zu ändern, dass er und möglichst viele andere ein gutes Leben haben können.
Damit sich Umstände verändern lassen, müssen sie erst einmal so beschrieben werden, wie sie sind. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als es noch nicht so viele Zeitungen gibt, übernehmen diese Aufgabe zum großen Teil Romane. Die Autoren sezieren die Lebensumstände bis ins kleinste Detail. Es entstehen die großen Gesellschaftsromane: Stolz und Vorurteil erscheint anonym, Ellis Bell schreibt Sturmhöhe, Currer Bell schreibt Villette und Jane Eyre, George Eliot schreibt Middlemarch.
Die Autoren analysieren in ihren Büchern das Innenleben ihrer Figuren. Sie bilden nicht nur die Realität ab, sondern auch, wie sie auf die Menschen wirkt. George Eliot beschreibt in Middlemarch, was die Gesellschaft und ihre Regeln und Zwänge mit den Gefühlen und Wünschen der Menschen anstellen. Und Sturmhöhe zeigt, wie ein grausames Umfeld einen Menschen grausam werden lässt, gegenüber der Person, die er am meisten liebt.
Und noch etwas haben die Autoren gemeinsam. Sie schreiben nicht unter ihrem eigenen Namen: Anonym erscheinen die Bücher von Jane Austen. Ellis und Currer Bell sind die Brontë-Schwestern. George Eliots richtiger Name ist Mary Ann Evans. Den Frauen geht es nicht so sehr darum, sich zu verstecken; aber ein männlicher Name gibt ihnen überhaupt erst die Chance, ernst genommen zu werden. So begründet es Charlotte Brontë 1850:
«Wir haben uns nicht als Frauen zu erkennen gegeben, denn – ohne jemals anzunehmen, dass unser Schreiben und Denken nicht dem entspricht, was ‹feminin› genannt wird – hatten wir die vage Vermutung, dass auf Autorinnen mit Vorurteilen geschaut wird.» Das gelte nicht nur für negative Kritik, sondern auch für positive: «Uns war aufgefallen, dass Kritiker ihre Schelte als persönliche Waffe benutzen und als Belohnung. Schmeicheleien sind kein wahres Lob.»[28] Die Autorinnen wollten nicht nur als weibliche Schriftsteller gelesen werden, sondern einfach nur als Schriftsteller. Sie wollten, dass ihre Texte bewertet werden und nicht ihr Geschlecht.
Mary Ann Evans beginnt zu schreiben, aber noch keine Bücher. Mit 31 Jahren zieht sie aus der Provinz nach London, und ein Freund lässt sie als Redakteurin für die Westminster Review arbeiten – einer Zeitschrift mit Texten über Philosophie und Wissenschaft. Faktisch leitet sie die Zeitung von 1851 bis 1853 – alles unter männlichem Pseudonym: Diese Anonymität gibt ihr die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Sie schreibt nicht nur eigene Texte. Briefe zeigen, dass sie auch entschieden hat, welche Texte gut genug waren, um in der Zeitschrift zu erscheinen; dass sie verärgerte Autoren besänftigt und mit ihnen über ihr Honorar verhandelt und die inhaltliche Ausrichtung der Zeitschrift mitbestimmt. Später schreibt Evans in einem Brief über diese Zeit: Es war eine Arbeit, «zu der kein großer Ruhm gehörte, aber bei der ich sicher war, ich könnte sie zuverlässig und gut machen».[29]
Obwohl sie als Journalistin erfolgreich ist, leidet Mary Ann Evans weiter unter ihren Ambitionen, denn eigentlich verlangt sie Unmögliches von sich: Sie will nicht zu den besten Schriftstellerinnen der Welt gehören, sondern zu den besten Schriftstellern der Welt. Ihr Geschlecht, befürchtet sie, könnte das verhindern, weil man ihr als Frau von Anfang an nicht zutraut, Weltliteratur hervorzubringen. Erst mit 36 Jahren beginnt Evans Geschichten zu schreiben. Und wieder schützt sie das Pseudonym vor den kritischen Blicken der Konventionen. Es hilft ihr, die Warnungen, die Angst vor dem Scheitern zu vergessen und sich ganz aufs Schreiben zu konzentrieren. In Briefen an ihre Freunde wird deutlich, dass sich Evans für ihre Ambitionen, ihren Drang nach Ruhm geschämt hat. Mehrmals nennt sie es ihre größte «Sünde». Sie sieht ihren Ehrgeiz als Fehler, als etwas Unanständiges.
Der Grund für Evans’ Scham lässt sich am Ursprung des Wortes Genie illustrieren, dem lateinischen Genius. So wurden die persönlichen römischen Schutzgötter von Männern genannt, die vor allem deren Potenz beschützen sollten. Die Vorstellung von der geistigen Kraft, etwas zu erschaffen, ist also eng verbunden mit der Vorstellung biologischer Potenz. Was wir an einem Genie bewundern, dessen Mut, Konventionen einfach beiseitezuwischen und etwas nie Dagewesenes zu schaffen, kann als Zeugung gedeutet werden und bekommt dadurch eine immanent sexuelle Komponente, die mitschwingt, wenn über Künstler und ihr Werk gesprochen wird.
Diese Vorstellung der Erschaffung eines Kunstwerks als sexuellen Akts war für Frauen in der Geschichte verhängnisvoll. So konnte ihnen ihr Genie immer negativ ausgelegt werden; es wurde mit einem Hang zur Promiskuität oder unmoralischem Verhalten gleichgesetzt. Das gilt in allen Bereichen der Kunst – in der Literatur ebenso wie der Malerei oder der Musik. Und auch das sieht man schon bei den Römern: Das weibliche Gegenstück zum römischen Genius sind die Lunos – Schutzgöttinnen, die vor allem für Prostituierte zuständig waren.
Das Bild vom männlichen Genie lebt von dessen Kompromisslosigkeit für seine Kunst und sein Kunstwerk, für das es Grenzen überschreiten darf, zu denen wir noch kommen werden. Manchmal schreiben Kritiker von der «rasenden Leidenschaft» eines Komponisten oder Malers. Frauen, die talentiert sind und gute Künstlerinnen werden wollen, bringt das immer in die Gefahr, dass sie sich damit lächerlich machen. Für anständige Frauen ist es nicht möglich, ernsthaft Kunst zu machen, weil sie dann als unbescheiden und unmoralisch gelten und kein Mann sie mehr heiraten will.
Indem Künstlertum mit männlicher Potenz gleichgesetzt wird, können Frauen, die so gute Kunstwerke schaffen wie Männer, immer als unnormal dargestellt werden – mit für sie teilweise schwerwiegenden sozialen Folgen.
Wie das Patriarchat Frauen davon abhalten will, Kunst zu machen, beschreibt Joanna Russ in ihrer quasi dialektischen Gebrauchsanleitung How to suppress women’s writing.
Ein offizielles Gesetz, das es Frauen verboten hätte zu schreiben, gab es in Europa nicht. Trotzdem bestand ihre Freiheit nur nominell, also dem Anschein nach. Die Hindernisse, die Frauen im 19. Jahrhundert vom Schreiben abhalten sollten, sind viel subtiler und in vieler Hinsicht sogar effektiver, meint Russ. Denn wenn die Mitglieder der «falschen» Gruppen in einer vermeintlich freien und gleichen Gesellschaft doch einfach großartige Bücher schreiben könnten, es dann aber nicht tun, beweisen sie gleichzeitig damit, dass sie nicht dazu in der Lage sind. «Der Trick besteht also darin, die Freiheit so nominell wie möglich zu machen und dann – weil ein paar so-and-so’s es trotzdem tun werden – Strategien zu entwickeln, um die entstandenen Werke zu ignorieren, zu verteufeln oder zu schmälern.»[30]
Diese Strategien wirken bis heute in allen Bereichen der Kunst weiter fort. Wir werden noch sehen, wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Mary Ann Evens’ erstes Buch als George Eliot, Adam Bede, wird zum Bestseller. 16000 Exemplare verkaufen sich im ersten Jahr nach Erscheinen. Es wird in mehrere Sprachen übersetzt. Das ist ihr Glück und Unglück zugleich, denn ganz England spekuliert, wer sich hinter dem Namen George Eliot verbirgt. Der Verdacht fällt auf den Pfarrer Joseph Liggins, der in Eliots Heimatort Arbury in Warwickshire lebt. Zuerst ist Evans froh, dass die Vermutungen in eine falsche Richtung gelenkt werden, aber dann behauptet Liggins tatsächlich, der Autor von Adam Bede zu sein. Ihm scheint die Rolle so sehr zu gefallen, dass er Interviews gibt und Fans empfängt.
In London wird Mary Ann Evans unruhig. Sie hat sich auch im echten Leben noch einmal einen neuen Namen gegeben und nennt sich jetzt Marian Lewes. Obwohl sie mit dem Literaturkritiker George Henry Lewes nicht verheiratet ist, lebt sie mit ihm zusammen und hat auch seinen Namen angenommen – nicht offiziell natürlich. Eigentlich ist es diese Beziehung, von der sie nicht will, dass sie bekannt wird. Ihre Familie hat deshalb schon den Kontakt zu ihr abgebrochen; mit ihrem Halbbruder kommuniziert sie nur noch über einen Anwalt, und ihre Schwester wird sie ihr ganzes Leben nicht mehr wiedersehen.
Um zu verhindern, dass Pfarrer Liggins am Ende zum Bestsellerautor wird, gibt sie ihre Identität bekannt. Da schreibt sie schon an ihrem nächsten Roman The Mill on the Floss, aber sie macht sich große Sorgen, dass ihr Verlag wegen der Empörung über ihre Beziehung zu Lewes abspringt. Tatsächlich befürchtet der Verlag, dass Eliots Identität den Verkäufen schaden könnte – gerade bei Familien. Aber als herauskommt, dass George Eliot eine Frau ist, steigen die Verkaufszahlen von Adam Bede sogar noch einmal. Schon nach weniger als einem Jahr wird das Buch ein zweites Mal aufgelegt.
Allerdings werden die doppelten Standards sichtbar, als bekannt wird, wer sich hinter dem Pseudonym verbirgt, denn sofort ändern die Kritiker danach ihren Ton. Die Zeitung Saturday Review gibt das später offen zu: «Um einfach die Wahrheit zu sagen, ohne falsche Höflichkeit: Alle fanden es zu gut für eine Frauengeschichte.»[31] Was die Kritiker vorher an George Eliots Buch gelobt haben – authentische Figuren und die kraftvolle, direkte Sprache –, gilt jetzt als anstößig, weil es eine Frau geschrieben hat.
Diese Angriffe auf ihre Person als Autorin erlebt nicht nur George Eliot. «Die meisten talentierten weiblichen Autoren dieser Periode wurden kritisiert für ihre ‹Grobheit› oder das Fehlen weiblicher Kultiviertheit.»[32] Auch bei Jane Eyre «gaben viele Kritiker direkt zu, dass sie fanden, das Buch sei ein Meisterwerk, wenn es ein Mann geschrieben hat, und schockierend oder abartig, wenn es von einer Frau stammt.»[33] «Pollution of Agency», nennt Russ diese Strategie, um herausragende Werke von Frauen zu diskreditieren.
Eine weitere Methode der Kritiker bestand darin, in Frage zu stellen, dass es die Frauen selbst waren, die das Buch geschrieben haben – nicht unbedingt in dem Sinne, dass ihnen ein Mann dabei geholfen haben könnte (obwohl es auch diese Behauptungen immer wieder gegeben hat, zum Beispiel gegen Virginia Woolf), sondern eher, so heißt es tatsächlich einmal, «der Mann in ihrem Innern hat es geschrieben».[34] Und dabei geht es immer um die Teile des Textes, die besonders rau und kühn oder besonders logisch und klar daherkommen – eben die Passagen, die vorher gelobt wurden.
Andere Kritiker behaupteten, nicht die Autorin habe den Aufbau und die Komposition des Romans kontrolliert, sondern eine übersinnliche Kraft habe sie durch die Person aufs Papier gebracht. Das behauptet man über Emily Brontës Sturmhöhe; die Autorin sei nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen[35].
Unterdrückung funktioniert am besten, wenn die Unterdrückten nicht bemerken, dass sie gerade unterdrückt werden. Und am allerbesten ist es, wenn sie die Fehler nicht im System suchen, sondern bei sich selbst. Bei George Eliot funktionierte es: Sie stellte das Wertesystem, das sie umgab, nicht infrage, sondern suchte einen Weg für sich, trotzdem tun zu können, was sie wollte. Ihr Weg zeigt, wie gut die ungeschriebenen Gesetze, die Frauen vom Schreiben abhalten sollten, funktionierten.
Die Schuld daran, dass Frauen nicht ernst genommen wurden, gab George Eliot nicht einer von Männern dominierten Gesellschaft. Sie selbst erlebte viel mehr, dass ihr Männer Chancen gaben, eine Zeitung zu leiten, oder sie ermutigten, einen Roman zu schreiben, wie ihr Mann George Henry Lewes es tat. Stattdessen wendet sich Eliot gegen andere Schriftstellerinnen, die ihrer Meinung nach mit seichten und schlechten Büchern den Ruf von Frauen belasten – das schreibt sie in einem Essay Silly novels by lady novelists.
In diesen Romanen sind die Hauptfiguren schöne und intelligente Frauen, deren einziges Ziel es aber ist, den Mann ihrer Träume zu finden und zu heiraten. Diese Bücher seien gefährlich, argumentiert Eliot, weil sie suggerierten, eine gute Bildung mache Frauen bloß «selbstgefällig und langweilig».[36] Die Sprache dieser Bücher sei nicht authentisch, denn sie verwechsle «Unschärfe mit Tiefe, Schwülstigkeit mit Eloquenz und Gehabe mit Originalität». Auf keinen Fall wollte George Eliot mit diesen Schriftstellerinnen verwechselt werden.
Der Realismus in der Literatur wäre nicht zu denken, hätten Frauen nicht zum Stift gegriffen und angefangen zu schreiben. Das ist auch möglich, weil sich die Gesellschaft in der Moderne wandelt und immer komplexer wird. «Es kam eine Veränderung, die ich, wenn ich die Geschichte umschreiben würde, ausführlicher beschreiben und für wichtiger halten würde als die Kreuzzüge und Rosenkriege. Die Frauen der Mittelklasse beginnen zu schreiben», notiert die Schriftstellerin Virginia Woolf über ihre Vorgängerinnen etwa siebzig Jahre später[37]. Denn eine Gesellschaft wird durch ihre Bücher ebenso geprägt wie durch Kriege und Revolutionen.
In ihrem Essay A Room of One’s Own denkt Virginia Woolf im Jahr 1929 darüber nach, unter welchen Bedingungen Kunst entstehen kann. Und sie kommt auf ganz praktische Dinge, wie finanzielle Unabhängigkeit, die keine der Frauen im 19. Jahrhundert hatte.
Die großen Schriftstellerinnen dieser Zeit sind weder Adelige, noch gehören sie zur Arbeiterklasse. Innerhalb dieser Struktur können sie einige Freiräume nutzen, die es ihnen ermöglichen zu schreiben. Sie sind zwar nicht reich, weil sie meistens unverheiratet bleiben, aber die Familie gibt ihnen eine gewisse Sicherheit.
«Man kann nicht anders, als einen Moment mit dem Gedanken zu spielen, was passiert wäre, wenn Charlotte Brontë, sagen wir 300 im Jahr bekommen hätte»[38], fragt sich Woolf – wenn Brontë also finanziell unabhängig und selbstständig gewesen wäre und sich ganz aufs Schreiben hätte konzentrieren können. Aber genau das ist nicht vorgesehen. Es wird akzeptiert, wenn Frauen schreiben, aber nur, solange es ein Zeitvertreib bleibt. Deshalb haben die Autorinnen auch kein Arbeitszimmer, einen Ort mit genug Ruhe und genug Zeit zum Schreiben. Jane Austen zum Beispiel hatte nie ein eigenes Zimmer, schreibt ihr Neffe später in seinen Memoiren. Sie schrieb den größten Teil ihrer Bücher im allgemeinen Wohnzimmer, wo ständig Leute ein und aus gingen und sie unterbrachen. Vor den Bediensteten und Gästen versteckte sie ihre Manuskripte immer wieder.