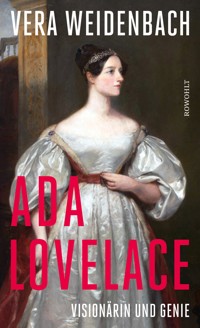
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ada Lovelace und der Aufbruch in die digitale Welt Ada Lovelace war eine geniale Mathematikerin. Anfang des 19. Jahrhunderts dachte sie Technologien voraus, die unsere Welt veränderten. Trotz der Beschränkungen, die Frauen ihrer Zeit auferlegt waren, gelang es Ada durch ihre umfassende Bildung, eine führende Rolle in der konzeptuellen Entwicklung eines Vorläufers des modernen Computers zu übernehmen – eine Leistung, die grundlegende Prinzipien der Programmierung und Informatik vorwegnahm. Ihr Leben spiegelt auch den außergewöhnlichen Balanceakt zwischen den gesellschaftlichen Pflichten einer Frau und wissenschaftlichem Genie wider, ein Spagat, der ihre Errungenschaften umso bemerkenswerter macht. Vera Weidenbach erzählt in dieser Biografie über die Leistungen einer Pionierin des Programmierens und was passiert, wenn der wissenschaftliche Ehrgeiz einer Frau auf die patriarchalen Strukturen des 19. Jahrhunderts trifft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Vera Weidenbach
Ada Lovelace
Visionärin und Genie
Über dieses Buch
Ada Lovelace und der Aufbruch in die digitale Welt
Ada Lovelace war eine geniale Mathematikerin. Anfang des 19. Jahrhunderts erdachte sie Technologien, die unsere Welt veränderten. Geboren in eine Zeit starrer gesellschaftlicher Konventionen, setzte sie neue Maßstäbe für Frauen in der Wissenschaft. Trotz der Beschränkungen, die Frauen ihrer Zeit auferlegt waren, gelang es Ada durch ihre umfassende Bildung, eine führende Rolle in der konzeptuellen Entwicklung eines Vorläufers des modernen Computers zu übernehmen – eine Leistung, die grundlegende Prinzipien der Programmierung und Informatik vorwegnahm. Ihr Leben spiegelt den außergewöhnlichen Balanceakt zwischen den gesellschaftlichen Pflichten einer Frau und wissenschaftlichem Genie wider, ein Spagat, der ihre Errungenschaften umso bemerkenswerter macht. Lange gerieten ihre Erkenntnisse in Vergessenheit, und ihr Name ist den meisten noch immer unbekannt. Wäre das anders, wenn sie ein Mann gewesen wäre? Vera Weidenbach erzählt das aufregende Leben dieser außergewöhnlichen Forscherin und dekonstruiert das herkömmliche Bild männlicher Genies. Die erste Biografie über die Pionierin des Programmierens.
Vita
Vera Weidenbach, 1990 geboren, studierte Philosophie, Biologie und Politik und besuchte die Deutsche Journalistenschule. Sie ist freie Journalistin und Kolumnistin. Als Reporterin berichtet sie für table.briefings über Bundespolitik und den Nahostkonflikt. Zuvor war sie im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin tätig, hat Nachrichten gesprochen und macht Podcasts. Zusammen mit ihren Kollegen von der Produktionsfirma ikone media wurde sie 2020 für den Podcast «Affäre Deutschland» mit dem Reporterpreis ausgezeichnet. Ihr erstes Buch «Die unerzählte Geschichte» erschien 2022 im Rowohlt Verlag.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, August 2025
Copyright © 2025 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Redaktion Mathematik Carl Foth und Anna Siffert
Abbildung auf Seite 158/159: mauritius images/CBW/Alamy Stock Photos
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Ada Lovelace. Gemälde von Margaret Sarah Carpenter, 1836. Sammlung Government Art Collection, London (commons.wikimedia.org/PD-Art)
ISBN 978-3-644-02095-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für alle Frauen, die wir waren und die wir noch sein werden.
That brain of mine is something more than merely mortal; as time will show.
— A.A.L.[1]
Prolog
Es gibt keine Genies. Dieser Satz ist wahr, obwohl dieses Buch von einem erzählt. Es gibt keine Genies, wie viele von uns sie sich vorstellen: Männer in ihren Labors oder an ihren Schreibtischen, die ganz alleine, nur durch die Macht ihres Verstandes, Großartiges hervorgebracht haben. Ein Akt der Zeugung. Davon spricht auch der Ursprung des Wortes Genie: Genien hießen bei den Römern die Schutzgötter der männlichen Potenz. In diesem herkömmlichen Sinne sind Genies aber eine Erfindung des Patriarchats. Sie dienen anderen Männern als Vorbilder, wandelnde Versprechen, dass auch sie so weit und so hoch hinauskommen können, wenn sie sich nur anstrengen und alle Konkurrenten ausschalten. Denn ganz oben kann schließlich nur einer stehen.
Für Frauen war die Kopplung von Genie an Virilität und an als traditionell männlich geltende Eigenschaften wie Rationalität, Durchsetzungs- und Innovationskraft verhängnisvoll. Denn sie ermöglichte es, Kreativität und Schaffensdrang als etwas für Frauen Unanständiges und Unnormales zu deklarieren. Frauen müssen sich dann entscheiden, ob sie Teil der respektablen Gesellschaft bleiben wollen oder ihrer Leidenschaft nachgehen und schwerwiegende soziale Folgen in Kauf nehmen. Als traditionell weiblich galten Geduld, Emotionalität, Sensibilität, Kooperationsbereitschaft, Fürsorglichkeit und Empathie – Eigenschaften, die auf die Bedürfnisse eines Gegenübers ausgerichtet sind. Beides, Frau sein und Genie, wurde so fast unmöglich.
Das gilt auch für Ada Lovelace. Geboren in einer Zeit, in der eng geführte Geschlechterrollen das Leben von Frauen und Männern bestimmten – besonders in der Oberschicht –, war es für sie nicht vorgesehen, Mathematikerin zu werden. Wissenschaftliches Arbeiten wurde für Frauen im 19. Jahrhundert nur als Zeitvertreib toleriert. Und doch fand Ada Zugang zu einer Welt, die fast ausschließlich Männern vorbehalten war; in einer Zeit, in der das Leben der Menschen durch neue Entwicklungen in Wissenschaft und Technik umgekrempelt wurde, in der eine Erfindung die nächste jagte. Ada Lovelace hat daran geglaubt, dass sie zu Höherem bestimmt war. Man könnte das Größenwahn nennen, den sie von ihrem Vater, dem notorischen romantischen Dichter Lord Byron, geerbt hat. Einige Biografen haben das so gedeutet. Oder man erkennt darin eine Eigenschaft, die es braucht, um mutig einen eigenen Weg zu gehen, originelle und revolutionäre Ideen zu entwickeln und diese entschlossen umzusetzen, sie Wirklichkeit werden zu lassen. Ada fand in der Wissenschaft und der Mathematik eine Möglichkeit, ihre überbordende Energie und Schaffenskraft zu kanalisieren und auszudrücken. Sie fand darin einen Weg, der Enge ihrer Rolle in der Gesellschaft zu entkommen. Sie dachte weit über die Zahlen hinaus. Ihre größte Leistung liegt darin, dass sie in der Maschine, die der Erfinder Charles Babbage als bloße Rechenmaschine baute, das Potenzial erkannte, das eigentlich in einer rechnenden Maschine steckt: Man kann ihr fast alle Tätigkeiten beibringen. Sie verstand die Maschine besser als ihr Erfinder. Sie hat die Funktionsweise eines Computers und der Informatik so akkurat beschrieben wie niemand sonst vor ihr, und sie hat die wissenschaftlichen und metaphysischen Implikationen einer Technologie erkannt, hundert Jahre bevor diese Wirklichkeit wurde. Die erste Anwendung, die sie für diese rein theoretische Maschine schrieb, ist ein vollwertiges Programm. Ada Lovelace ist die erste Programmiererin der Geschichte, die Begründerin dieser Wissenschaft.
Dieses Buch ist ihre Biografie und noch ein bisschen mehr als das. Ich will das Leben von Ada Lovelace als ihre Geniewerdung erzählen und das herkömmliche Bild des (männlichen) Genies dekonstruieren. Ada Lovelace hatte eigentlich alles, was ein Genie ausmacht. Wäre sie ein Mann gewesen, hätten wir wahrscheinlich schon vor Jahrzehnten Postkarten von ihr kaufen können mit ihren klügsten Zitaten darauf. Aber weil sie eine Frau war, ist sie vielen noch immer unbekannt. Denn auf solchen Postkarten sind Genies abgebildet, wie sie das Patriarchat erfand: Männer mit weißen, wirren Haaren, die streng, aber auch ein bisschen gütig dreinschauen. Geniewerdung hängt zu achtzig Prozent von guter Vermarktung ab. Gäbe es das Foto von Albert Einstein nicht, auf dem er die Zunge herausstreckt, wäre er nur halb so bekannt, davon bin ich überzeugt. Ich hoffe, mit diesem Buch auch eine Art Ada-Lovelace-Kult zu begründen und sie in die Sphären der Popkultur zu erheben. Gute Zitate von ihr gibt es genug.
Bisher hat Ada außerhalb des englischsprachigen Raums nur in wenigen Kreisen die Bekanntheit erlangt, die sie verdient; ihr Einfluss, der bis in unsere Gegenwart und darüber hinaus reicht, wird erst langsam vollumfänglich anerkannt. In der deutschen Programmier- und Hackerszene war ihr Name gerade für Frauen ein wichtiger Bezugspunkt, um in der männerdominierten Szene einen Platz zu beanspruchen. So war sie im Chaos Computer Club (CCC), der größten Gemeinschaft von Hackern und Hackerinnen in Europa, eine Identifikationsfigur, erzählte mir die Digitalpolitikerin Anke Domscheit-Berg. Die weiblichen Hacker sind im CCC unter dem Namen «Hacksen» organisiert und beziehen sich in Vorträgen und Aktionen immer wieder auf Ada. «Sie war so etwas wie ein Türöffner, um auch auf viele andere Frauen in der Computer- und Technikgeschichte aufmerksam zu machen», sagt Domscheit-Berg. Ada sei irgendwann in der Szene sehr bekannt geworden, und das habe auch das Bewusstsein geschärft für die Leistungen von Frauen wie Hedy Lamarr und Grace Hopper, die dann einen Platz in der Hacker-Community bekamen.
Für den Geniekult um Ada ist also noch Luft nach oben. Zur Wahrheit gehört, dass es kein Genie alleine schafft. Schaut man sich die Biografien von beliebigen Genies genauer an, wird schnell klar, dass sie nie alleine so weit gekommen wären. Die Voraussetzungen, um Leistungen zu erbringen, die unsere Welt revolutionieren, sind banal und oft struktureller Natur. Schnell wird klar, warum es im Patriarchat[1] eigentlich nur für Männer möglich war, ein Genie zu werden (abgesehen davon, dass Männer auch die Kategorien festlegen konnten, wer und was als Genie gelten durfte, aber das ist eine andere – unerzählte – Geschichte). Virginia Woolf benennt in ihrem Buch «A Room of One’s Own» Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit Menschen ein Kunstwerk erschaffen können. Dazu gehören ganz praktisch Zeit und Geld und eben ein Raum, in dem man ungestört arbeiten kann. Genies brauchen also immer Menschen, die ihnen Arbeit abnehmen, sie beschützen und ihnen dabei helfen, an sich selbst zu glauben. Genies brauchen ein Supportsystem, sowohl emotional als auch materiell. Nur so bleibt genug Raum für die eigenen großen Gedanken. Und zu guter Letzt braucht ein Genie Vorbilder für die eigene Arbeit. Gedankliche Schultern, auf denen es stehen kann, einen Horizont, vor dem es die eigenen Ideen weiterentwickeln kann. Ein Genie braucht Vorbilder nicht nur, um ihnen nachzueifern, sondern auch, um sie abzulehnen und ihre Ideen zu verwerfen. Darin liegt Fortschritt. Warum das für Frauen ein Problem ist, hat Mithu Sanyal in ihrem Buch «Vulva – Die Enthüllung des unsichtbaren Geschlechts» beschrieben: Es sei für weibliche Künstler schwierig, gegen eine bestimmte Richtung aufzubegehren und Neues zu schaffen und sich weiterzuentwickeln. Die Autorin hebt damit auf fehlende weibliche Vorbilder ab, korrigiert sich aber gleich darauf selbst: «Korrekter müsste es heißen, dass es durchaus Traditionen gibt, dass diese jedoch ebenso traditionell blockiert und verleugnet werden, sodass es für Schriftstellerinnen, Künstlerinnen, Musikerinnen unglaublich schwer ist, darauf zurückzugreifen.»[2] Denn es gibt sie ja: weibliche Vorbilder – zuhauf sogar, aber ihre Namen und ihre Leistungen sind in vielen Fällen noch immer so unbekannt, wie Ada Lovelace es lange war.
Auch Ada hätte nicht erdenken können, was sie erdacht hat, ohne ihre Vorbilder, ihre Freunde und den Reichtum ihrer Familie, der ihr einen gewissen Bewegungsspielraum gewährte. Sie hatte Lehrer, Mary Somerville, Charles Babbage und Augustus De Morgan, die ihre Talente förderten. In diesem Ökosystem konnte sie arbeiten, und ihre Ideen konnten über die anderer hinauswachsen. Das, obwohl es Ada Lovelace gar nicht hätte geben dürfen. Frauen, die so intelligent waren wie Ada und die so gut rechnen konnten, waren im 19. Jahrhundert nicht vorgesehen.
Und fast wäre sie deshalb in Vergessenheit geraten. Ihr Hauptwerk wird heute meistens nur «Notes» genannt. Das sind Anmerkungen zu einer Übersetzung, die knapp dreimal so lang sind wie der Originaltext. Darin schreibt sie im Jahr 1843 das erste Computerprogramm. Ihr Text ist aber nicht mit ihrem Namen unterzeichnet, sondern nur mit ihren Initialen, die auch noch einen Druckfehler enthalten. A.L.L. steht da statt A.A.L.
Deshalb wird erst 1948, über hundert Jahre später, überhaupt bekannt, dass Ada Lovelace die Autorin der «Notes» ist. In Großbritannien ist sie lange vor allem als die Tochter Lord Byrons bekannt. Und noch immer kommen die meisten englischsprachigen Bücher über sie selten ohne den Namen des Vaters im Titel aus. Nachdem ihre Autorenschaft gesichert ist, passiert die nächsten hundert Jahre erst einmal, was im Patriarchat passiert, wenn Männer feststellen, dass eine Frau genauso großartige Dinge schaffen kann wie sie, obwohl sie keinen Penis hat. Menschen versuchen, sie auf ihren Platz zu verweisen. Eine Frau ein Genie? Das kann nicht sein. Danach reden sie ihre Leistungen klein. Lovelace wurde von Historikern zur Mitarbeiterin, zur Interpretin des Werks des großen Mannes Charles Babbage gemacht. Nur zögernd wurden diese Einschätzungen infrage gestellt, ihre Leistung anerkannt und sie zur ersten Programmiererin der Geschichte – nicht ohne herauszustellen, sie sei unnormal und unsympathisch und vielleicht auch psychisch krank gewesen. Eine ihrer Biografinnen verwendet im Anhang ihres Buches siebzehn Seiten darauf, Ada posthum eine manische Depression zu diagnostizieren.
Alle diese Mechanismen, die Werke von Frauen zu verleumden und kleinzureden, haben Feministen bereits erforscht. Sie sind über Jahrhunderte erprobt und zum großen Teil immer noch wirksam. Die Schriftstellerin Joanna Russ beschreibt sie in ihrem Buch «How to suppress women’s writing», das eigentlich Schullektüre sein sollte, aber nicht einmal in deutscher Übersetzung vorliegt. Die Werke von Frauen aus dem Kontext zu reißen, ist eine beliebte Strategie, um kollektive und einzelne Leistungen zu schmälern – das alles gilt auch für die Werke anderer Gruppen, die nach der Meinung der herrschenden Klasse keine Kunst oder Erfindungen machen sollten; das betraf in der westlichen Kulturgeschichte vor allem People of Colour oder queere Menschen. Laut Russ werden solche Werke entweder ignoriert, oder sie werden von der Mehrheitsgesellschaft aus ihrer Tradition herausgerissen, sodass sie als «Einzelfälle» und «unnormal» klassifiziert werden können, eine Wertung, die dann auf den Autor ausgedehnt wird, um diesen persönlich anzugreifen. Eine Strategie, der nur schwer zu begegnen ist, sagt Russ, und die nicht nur im 19. Jahrhundert angewendet wurde.[3]
Dieses Vorgehen ist so wirksam, weil Relevanz auch an Einfluss gemessen wird, den eine Person durch ihre Arbeit auf nachfolgende Generationen hat. In der Geschichtsschreibung können wir in Bezug auf herausragende Werke von Frauen und Menschen aus anderen unterdrückten sozialen Gruppen oft beobachten, dass sie als Ausnahmen dargestellt werden statt als Teil eines Kanons. Das soll zum einen den Eindruck vermitteln, dass eine bestimmte Gruppe viel weniger Einfluss hatte, als das tatsächlich der Fall war. Und zum anderen soll es verhindern, wie Mithu Sanyal schreibt, dass Menschen dieser Gruppen auf Traditionen und Vorbilder zugreifen können. Wenig wirkt entmutigender, als den Eindruck zu haben, die erste Person sein zu müssen, die jemals einen bestimmen Weg einschlägt: die erste Person einer Gruppe, die Weltliteratur schreibt, die erste Person, die mit ihrer Erfindung die Welt verändert. Wie verrückt das klingt. Unweigerlich mag man sich denken: Wenn es vor mir niemand geschafft hat, warum sollte dann ausgerechnet ich es schaffen? Bin ich wirklich gut genug? Ich stelle die These auf, dass Frauen diesen Gedanken überdurchschnittlich häufiger haben als Männer. Das Patriarchat ist noch immer in unseren Köpfen. Und aus diesem Grund erzähle ich in diesem Buch nicht nur Adas Geschichte, sondern nehme Bezug auf viele, die vor ihr und die nach ihr kamen. Ich werde zeigen, dass Ada in der Mathematik und der Informatik kein einsames Genie ist. Sondern dass sie in einer Reihe mit Frauen steht, die vor ihr und nach ihr die Welt verändert haben.
Für Frauen sind diese Erzählungen wichtig, denn sie zeigen, dass Genies wie Ada nicht die Ausnahme von der Regel sind. Geniale Frauen sind so normal wie geniale Männer, und es gab sie schon immer, auch wenn die patriarchale Geschichtsschreibung dafür gesorgt hat, dass sie nicht die Anerkennung für ihre Leistungen bekamen, Männer ihnen diese Anerkennung klauen konnten oder sie übergangen wurden und wir ihre Namen deshalb heute meistens nicht kennen – und das gilt nicht nur für die Mathematik.
Wenn Ada die Wahl gehabt hätte, wäre sie sehr wahrscheinlich Mathematikerin geworden. Ihrem Stand gemäß wäre sie nach Cambridge gegangen wie ihr Vater und wie der Erfinder Charles Babbage, und vielleicht hätte sie Aufsätze über spezielle Probleme in der Logik oder der Algebra geschrieben, die heute niemanden mehr interessieren würden. Aber wie so viele vor und nach ihr hatte Ada diese Wahl nicht. Ada hat als Mathematikerin gearbeitet, drei Kinder bekommen und ihre Pflichten als Ehefrau erfüllt. Das war die Voraussetzung dafür, dass sie überhaupt wissenschaftlich arbeiten konnte, denn das Patriarchat hat Frauen nie nur eine Person sein lassen, nie nur Mathematikerin oder nur Dichterin. Frauen konnten ihre Zeit und ihre Energie anders als Männer nicht im gleichen Maß auf eine bestimmte Arbeit fokussieren. Eine Tatsache, an der sich kaum etwas geändert hat.
Die Supportsysteme von männlichen Genies bestehen ja meistens in der Ausbeutung der Energie von Ehefrauen und Müttern oder Frauen (und zum Teil auch Männern), die für sehr wenig Geld für sie arbeiten, die ihnen die Arbeit in Familie und Haus abnehmen und dadurch Zeit und Raum für die Arbeit der Männer schaffen. Die Philosophin Iris Marion Young schreibt in ihrem Aufsatz «Five Faces of Oppression»: «Freiheit, Macht, Status und Selbstverwirklichung der Männer sind möglich, eben weil Frauen für sie arbeiten».[4]
Frauen sind deshalb meistens aus einem «Trotzdem» heraus zu Genies geworden, aus einem Trotzen gegen die Umstände, die sie umgeben haben. Und dieses «Trotzdem» prägt ihr Denken, macht sie kreativer als viele Männer, lässt sie Dinge außerhalb des üblichen Rahmens sehen. Es ist an der Zeit, diese Stärke zu feiern, die Frauen sich aus der Unterdrückung erkämpft haben. Denn Genie besteht oft darin, Zusammenhänge zwischen Disziplinen und Themen herzustellen, die bisher nicht existierten. Und oft leisten dies Menschen, die zu keiner bestehenden Ordnung dazugehören. Sie sind Außenseiter aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer Hautfarbe oder ihrer Klasse. Sie sehen deshalb Zusammenhänge, die andere nicht sehen, lassen diese Erfahrungen in die eigene Arbeit einfließen und schaffen etwas Neues. Das Wesen von Wissen ist ein Netzwerk - sowohl im Kleinen im menschlichen Gehirn als auch innerhalb einer Disziplin oder im ganz Großen, auf der ganzen Welt. Ein Netzwerk aus Informationen und Verbindungen, die immer wieder neu geknüpft werden müssen. «Bahnbrechend» nennen wir oft Gedanken und Ideen, die solche neuen Verknüpfungen oder ganz neue Zweige in dem Netzwerk erschaffen. Sie entstehen aus den Verbindungen, die bereits existieren, und sind gleichzeitig etwas noch nicht Dagewesenes. Stellen wir uns Genie so vor, wird klar, warum es niemals komplett singulär und im leeren Raum wirken kann. Die bestehenden Verbindungen sind Gedanken und Ideen von anderen Menschen, mit denen das eigene Denken vernetzt ist. Das meine ich, wenn ich sage, niemand denkt für sich allein. Wir alle denken auf den Schultern oder in Verbindung mit anderen.
Zugegeben, die systematische Unterdrückung von Frauen über Jahrhunderte positiv umzudeuten, ist ein Risiko, ein zweischneidiges Schwert. Denn es ist nicht schönzureden, dass die Rahmenbedingungen für Frauen einen ganz praktischen Mangel an Zeit und Zugang zu Material und Wissen bedeuten, mit dem sie zu kämpfen hatten und noch immer haben. Es ist der Grund für die weniger großen Œuvres, die Frauen in der Geschichte insgesamt vorweisen können und die von Historikern immer wieder benutzt werden, um die Leistungen eines Mannes als bedeutender zu bewerten als die einer Frau.
So können wir zwar über die französische Kommunistin Flora Tristan sagen, dass sie fünf Jahre vor Karl Marx bereits ein Manifest verfasst hat, in dem sie die Arbeiter dazu aufrief, sich ihrer Situation bewusst zu werden und sich zu organisieren. In diesem Sinne müsste sie eigentlich als Begründerin des Kommunismus benannt werden. Aber wir können nicht auf ihre Tausende Seiten umfassende Analyse des kapitalistischen Wirtschaftssystems verweisen. Flora Tristan war zu sehr damit beschäftigt, vor ihrem Ehemann zu fliehen, der sie erschießen wollte, und dann damit, durch die Fabriken Frankreichs zu ziehen, um die Arbeiterinnen und Arbeiter über ihre Situation aufzuklären. Ihr Leben ist Teil ihres Werks, aber so werten es Historiker bisher nicht. Deshalb ist ihr Name nur sehr wenigen bekannt.
Und: Nicht jeder und jede schafft es, aus widrigen Umständen gestärkt hervorzugehen. Wir können das Leid, aus dem Großartiges entsteht, nicht glorifizieren, weil die herrschende Klasse dies zu einer Legitimation ihrer Handlungen umdeuten könnte und weil es einfach nicht so hart sein sollte, wie es für viele Menschen aufgrund der Zufälle, wo und wann sie geboren wurden, ist. Dass es viele Frauen trotzdem geschafft haben, ändert nichts daran, dass es Unterdrückung gab und gibt. Es verändert aber, wie Frauen auf die Geschichte und damit auf das eigene Leben und die eigenen Pläne schauen können. Es ist nicht der Blick eines Opfers, sondern der Blick eines Gewinners. Es ist kein Blick der Schwäche, sondern des Glaubens an die eigene Stärke.
Durch diese Brille schaue ich auf das Leben von Ada Lovelace. Ihr mathematisches Denken hätte sich nicht mit dem ihr eigenen praktischen Weitblick mischen können, wenn die Umstände sie nicht dazu gezwungen hätten, kreativ zu werden, um ihrer Leidenschaft nachzugehen. Ada Lovelace hat das sogar selbst als ihre eigene Stärke erkannt. Sie wusste um ihre Intelligenz, und sie wusste, dass eine ihrer Stärken darin lag, einen anderen Blick auf die Mathematik und die Analytische Maschine zu haben als ein Mathematiker, der nur ein Mathematiker ist. Diese Stärke ist es, der sich Frauen bewusst werden und die sie für sich nutzen müssen. Denn es ist eine verbindende Stärke – eine Erfahrung, die so viele Frauen teilen.
Es ist auch diese Stärke, die der Feminismus heute braucht, um aus dem Stillstand herauszukommen, in dem er gerade steckt. Stellen wir uns den Feminismus als ein Netzwerk aus Erfahrungen aus Wissen, aus Büchern und Aktivist*innen auf der ganzen Welt vor, ist dieses Netzwerk löchrig; an vielen Stellen fehlen Verbindungen. Dass es so schwerfällt, diese Löcher zu schließen, liegt daran, wie die anderen Verbindungen zustande kamen.
Feminismus ist nicht neutral. Rafia Zakaria beschreibt in ihrem Buch «Against White Feminism», wie sich eine Deutungshoheit des weißen westlichen Feminismus durchgesetzt hat und dass imperialistische Sichtweisen darin bestehen geblieben sind und weißen Geschichten darin mehr Wert zugesprochen wird als denen von Frauen of Colour und Schwarzen Frauen.[5]
Feminismus leidet heute darunter, und immer wieder diskutieren Feministen, ob es einen Neuanfang braucht und der Feminismus abgeschafft gehört, weil so vieles fundamental falsch gelaufen ist, dass er nicht mehr erneuert werden kann. Weil das seinen Gegnern ermöglicht, ihn zu diskreditieren. So wie der Feminismus jetzt ist, kann er nicht bleiben, wenn er für alle Frauen Fortschritt bedeuten soll, das ist sicher. Und doch liegt trotz der vielen Fehler auch eine Stärke in der Größe des Netzwerks aus Wissen und Erfahrungen.
Ich glaube, der Weg, den eine feministische Bewegung gehen muss, liegt in der Öffnung. Darin, zu erkennen, dass die Mechanismen, die Frauen klein halten, auch auf andere Gruppen übertragbar sind. Sie müssen in den gemeinsamen Kampf gegen das Patriarchat integriert werden. Um das zu beweisen, hilft es, zu verstehen, wie Unterdrückung funktioniert, und den Blick nicht auf die Unterdrückung von Frauen zu verengen. Nach Iris Marion Young besteht eine Unterdrückung, wenn eine soziale Gruppe Ausbeutung, Marginalisierung, Machtlosigkeit, kulturellem Imperialismus oder Gewalt ausgesetzt ist. Eine der fünf Kategorien reiche aus, um von Unterdrückung zu sprechen.[6]
Während weiße Feministinnen Kategorien wie Ausbeutung und Marginalisierung bekämpft haben, konnten sie von anderen Kategorien wie white supremacy als ordnunggebendem Prinzip der Gesellschaft profitieren und haben damit die Machtverhältnisse sogar häufig gefestigt.
Ich habe mit dieser Biografie über Ada Lovelace zwischendurch gehadert, weil ich ein feministisches Buch schreiben wollte und weil es mir so erschien, als könnte man vieles, was der Feminismus heute an Geschichten bräuchte, und viele Fragen, die man heute an die Gesellschaft stellen müsste, anhand von Adas Leben nicht erzählen. Man könnte erwidern, dass eine Biografie in erster Linie doch das Leben einer Person nacherzählen sollte und die Ansprüche, die ich an dieses Buch und diese Person stelle, somit vielleicht übertrieben sind. Aber das stimmt nicht so ganz, denn: «Biographien spielen in der Zeit und Gesellschaft ihrer Entstehung. Nicht der Zeit des Biographierten»,[7] sagt die Autorin Angela Steidele in «Poetik der Biografie».
Dieses Buch über Ada Lovelace spielt also nicht im 19. Jahrhundert, sondern im Jahr 2024. Das Leben von Ada Lovelace muss sich heute von dieser Zeit und von dieser Autorin andere Fragen gefallen lassen als vielleicht noch vor dreißig oder fünfzig Jahren. Zum Beispiel, ob es gerechtfertigt ist, Lovelace als feministisches Idol zu stilisieren, was einige Personen und Organisationen tun, die vor allem die Zahl von Frauen in Informatikberufen steigern wollen. Die Gefahr liegt auch im Begriff «Genie». Dieser Begriff verlockt dazu, Personen zu verklären und sie unfehlbar zu machen. Dabei können mehrere Dinge über eine Person gleichzeitig wahr sein.
Es ist wahr, dass Ada Lovelace – ebenso wie ihr größtes Vorbild Mary Somerville – eine großartige Wissenschaftlerin war und wahrscheinlich auch nie mehr sein wollte. Dass sie gedacht hat, was noch niemand vor ihr gedacht hat, und ein ganzes Feld in der Mathematik begründete, auch wenn dieses Feld erst mit über hundert Jahren Verspätung entstand. Gleichzeitig war Ada keine laute Frau. Sie war keine Widerstandskämpferin. Sie hat sich in diesem Sinne nicht für andere und ihre Rechte eingesetzt. Ihr größter Widerstand liegt darin, dass sie ihren eigenen Weg trotz allem gefunden hat und gegangen ist.
Das Leben von Ada Lovelace stellt die Frage, die sich die meisten Mitglieder einer unterdrückten Gruppe irgendwann stellen: Ist es besser, die Umstände umzuwälzen und das System zu konfrontieren, auch wenn das bedeutet, unermessliche Energie aufbringen zu müssen, das System vermutlich mit aller Kraft zurückschlägt und am Ende womöglich nichts gewonnen ist? Oder ist es besser, innerhalb des Systems einen Weg für das eigene Fortkommen zu finden und damit das System auch von innen auszuhöhlen? Es ist eine Frage der Radikalität. Aber es ist auch eine Frage der Wertsetzung: Welche Formen des Widerstands feiern wir? Was erkennen wir als «Feminismus» an? Der westliche Feminismus neigt dazu, nur die besonders radikalen und kämpferischen Errungenschaften von Frauen zu feiern. Ironischerweise sind das männliche Maßstäbe, die damit an Feministinnen angelegt werden. Dabei ist Resilienz über die Jahrhunderte eines der wichtigsten Mittel von Frauen gewesen, gegen das Patriarchat zu bestehen und ihre Würde zu behalten. In diesem Sinne ist auch Ada Lovelace ein feministisches Vorbild.
Es ist das Privileg einer neuen Generation von Feminist*innen, all das zusammenführen zu können. Wir haben die Chance, das Unrecht und die unterschiedlichen Ausmaße und Auswirkungen der Diskriminierung heute wie gestern zu beschreiben und anzuerkennen. Es ist unsere Aufgabe, die fehlenden Verbindungen im großen Netzwerk zu schließen und neue Verbindungen zu anderen Bewegungen und ihrem Wissen und ihren Erfahrungen zu schließen, um daraus eine neue Bewegung zu formen.
Die Träume
I believe myself to possess a most singular combination of qualities exactly fitted to make me preeminently a discoverer of the hidden realities of nature.
— A.A.L.[8]
Ada fliegt. Zumindest wenn sie die Augen schließt. Gerade baumelt sie waagerecht an Gurten von einem Holzbalken im Stall und schwingt ein wenig hin und her. Sie stellt sich vor, ein Vogel zu sein und Flügel zu haben. Wie würde sie dann in der Luft liegen? Wie würde es sich anfühlen? Sie spannt den ganzen Körper an und breitet die Arme aus. Die Flügel müssten doppelt so groß sein, denkt sie. Mindestens. Gestern hat sie stundenlang die Flügel einer Krähe studiert und gezeichnet, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Ada steht mit ihren Flugversuchen noch am Anfang. Immerhin hat sie schon die Bediensteten dazu überredet, ihr zu helfen, in einer der Boxen im Stall ein Labor für ihre Experimente einzurichten. Am Boden zwischen ein paar Strohhalmen liegen die Zettel mit ihren Skizzen und Berechnungen.
Die Dreizehnjährige ist sich sicher: Könnte sie Flügel konstruieren, die wie bei einem Vogel den Proportionen ihres Körpers entsprechen, sodass sie stark genug wären, sie zu tragen, könnte sie selbst durch die Luft fliegen. In einem Brief an ihre Mutter schreibt sie:
Ich weiß, dass Sie über das, was ich jetzt erzähle, lachen werden, aber ich werde die genauen Abmessungen der Flügel eines Vogels im Verhältnis zu seiner Körpergröße nehmen und dann umgehend ein Paar papierne Flügel in genau der gleichen Größe wie die der Vögel in Proportion zu meiner Größe herstellen.[9]
Die Briefe an ihre Mutter unterschreibt die dreizehnjährige Ada in dieser Zeit mit dem Spitznamen Carrier Pidgeon, also Brieftaube. Sie fragt ihre Mutter nach einem Buch, in dem die Anatomie der Flügel von Vögeln genau beschrieben wird. Selbst einen Vogel auseinandernehmen und sezieren will sie nämlich nicht.
Die Idee vom Fliegen ist für die junge Ada Lovelace nicht nur ein Traum. Sie überlegt ganz praktisch, wie sie das Problem der Schwerkraft angehen und überwinden könnte. Mit Draht will sie die Papierflügel steif und stabil genug machen. Und nicht nur das:
Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr bin ich fast schon davon überzeugt, dass ich es mit etwas Erfahrung und Übung im Ablauf eines Jahres schaffen werde, die Kunst des Fliegens zur Perfektion zu treiben. Ich denke darüber nach, ein Buch über Flyology zu schreiben, mit einem illustrierten Tafelteil, falls ich jemals wirklich eine Flugmethode erfinde. […] Mein Buch über Flyology soll eine Liste der Vorteile enthalten, die sich aus dem Fliegen ergeben, und es soll außerdem eine umfassende Erläuterung der Anatomie eines Vogels beinhalten.[10]
Ada denkt all das in einer Zeit, in der Fliegen tatsächlich noch ein Traum ist. In der noch niemand jemals in ein Flugzeug gestiegen ist. Wir stehen an der Schwelle zur Moderne, einer Zeit, in der technische Erfindungen und Fortschritte das Leben der Menschen so sehr und so schnell verändern wie niemals zuvor. Die Eisenbahn revolutioniert gerade erst das Reisen über Land, und die Dampfmaschine ist die modernste Technologie zum Antrieb von Maschinen. Der Glaube an Wissenschaft und Technik wird zu einem Glauben an eine große Zukunft.
Umso erstaunlicher der Briefwechsel: Hier entwickelt ein junges Mädchen unter Berücksichtigung neuester Technologien Ideen, die gerade erst auf den Plan treten, zum ersten Mal überhaupt erdacht werden. Für Ada aber handelt es sich bei ihrer Flugmaschine nicht um bloße Tagträumerei, sondern um Ideen, die mithilfe von technischem Know-how verwirklicht werden können:
Ich spiele mit dem Gedanken, eine Art … Dampfmaschine zu entwerfen, die, wenn ich es denn fertigbringe, noch wunderbarer sein wird als ein Dampfschiff oder ein Dampfwagen. Ich möchte etwas in Form eines Pferdes mit einer Dampfmaschine im Inneren machen, die so konstruiert ist, dass sie ein riesiges Paar Flügel antreibt, die an der Außenseite des Pferdes befestigt sind, und zwar so, dass sie es hoch in die Luft tragen, während eine Person auf seinem Rücken sitzt.[11]
Bis dahin waren Flugmaschinen lediglich zum Gleiten konzipiert. Erst im Jahr 1842, also noch einmal über zehn Jahre später, ließen sich William Henson und John Stringfellow eine patentieren, die sich selbst durch die Luft bewegen und mit Dampf angetrieben werden sollte. Ihre Zeichnungen haben tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit mit Adas Maschine: in der Mitte ein Gehäuse mit der Dampfmaschine und links und rechts weit aufgespannte Flügel. Der aerial steam carriage flog allerdings nicht, weil die Maschine nicht genug Energie erzeugte, um ihr eigenes Gewicht, geschweige denn das von Passagieren zu tragen. Auch die Aerial Transit Company der beiden Erfinder scheiterte an der Finanzierung, weil ihnen niemand glaubte, dass es gelingen könnte.
Auch Adas Mutter, Lady Byron, ist skeptisch, was Adas Flugambitionen angeht. Die alleinerziehende Mutter ist streng. Obwohl sie viel unterwegs ist, kontrolliert und überwacht sie Adas intellektuelle und persönliche Entwicklung sehr genau. Oder sie lässt überwachen. Die Bediensteten und Adas Gouvernanten müssen ihr regelmäßig per Post Report geben. Ständig ist sie in Sorge, dass Adas Fantasie mit ihr durchgehen könnte. Vor allem als das Mädchen in ihrem Labor im Stall tatsächlich anfängt, ihre Flügel zu bauen. Lady Byron schreibt ihrer Tochter einen Brief, in dem sie zur Mäßigung mahnt.
Am 8. April 1828 antwortet Ada:
Meine liebste Mami. Ich habe heute Morgen Ihren Brief erhalten, und ich glaube wirklich nicht, dass ich oft an die Flügel denke, wenn ich mich doch eigentlich auf andere Dinge konzentrieren sollte, aber es war sehr freundlich von Ihnen, mich darauf hinzuweisen.[12]
Ada versucht, ihre Mutter davon zu überzeugen, dass sie nicht zu sehr über Flyology nachdenkt, indem sie all ihre anderen Aktivitäten beschreibt. Sie schließt den Brief mit einer Art Kompromissvorschlag:
Ich werde jetzt doch sehr viel kleinere Flügel bauen, als ich es ursprünglich beabsichtigt hatte, und sie werden in jeder Hinsicht perfekt proportioniert sein, in Art und Form exakt wie die eines Vogels, und auch wenn sie nicht annähernd groß genug sein werden, um erste Flugversuche mit ihnen zu unternehmen, so werden sie doch völlig ausreichen, um jedem mein Flugprojekt genau zu erläutern, außerdem werden sie mir als Modell für meine zukünftigen echten Flügel dienen …
Ihre liebende Brieftaube[13]
Die wichtigsten Eigenschaften von Adas Denken, die auch ihr späteres Arbeiten ausmachen, werden bei den Bemühungen um ihre Flugmaschine bereits deutlich: Es ist die Fähigkeit, Fantastisches mit abstrakten technischen Methoden, Material und Form zusammen zu denken. Sie verbindet das zu etwas Neuem, noch nie Dagewesenem. Sie sieht die praktischen Gegebenheiten nicht nur als Restriktionen, sondern als Möglichkeiten. Sie folgt einem Gedanken, dem Flügel eines Vogels, bis sie an seine Grenzen stößt, und nimmt dann eine weitere Möglichkeit dazu, um das Problem zu lösen: Die Flügel allein werden sie nicht tragen können, realisiert die Dreizehnjährige und inkorporiert die Dampfmaschine, die modernste zur Verfügung stehende Antriebsmethode, als zusätzliche Energiequelle. Von dieser Notwendigkeit ausgehend, passt sie das Design ihrer Maschine an: ein Pferdekörper in der Mitte, auf dem man reiten kann. Nicht mehr der Mensch selbst fliegt, er wird von der Maschine durch die Luft getragen.
Es mag auf den ersten Blick seltsam erscheinen, dass Lady Byron den Plänen ihrer Tochter so schnell einen Riegel vorschiebt. Denn eigentlich wächst Ada in einem fortschrittlichen Haushalt auf, wovon auch die Briefe zeugen. Hier ermutigt eine junge Mutter ihre Tochter dazu, eigenständig zu denken und ihr Wissen zur Anwendung zu bringen – jedenfalls bis zu einem gewissen Grad. Einige Jahre später wird diese Frau eine erste industrielle Schule für Kinder der Arbeiterklasse gründen, in der die praktische Ausbildung an Maschinen oder auf dem Feld mit Fächern wie Literatur oder Musik kombiniert wird. Und dieses Engagement kommt nicht von ungefähr. Adas Mutter, geboren 1792, die mit Mädchennamen Anne Isabella (genannt Annabella) Milbanke heißt, war das einzige Kind gesellschaftlich liberal eingestellter Eltern, die ihrer Tochter eine umfangreiche Bildung ermöglichten. Annabella kommt als Einzelkind zur Welt, als ihre Eltern schon fünfzehn Jahre verheiratet sind. Dementsprechend lernt sie, sich selbst wichtig zu nehmen. Als Teenager stellen ihre Eltern Dr. William Frend für Annabella ein, der gerade seine Tutorenstelle in Cambridge verloren hat, weil er ein Pamphlet für den Frieden veröffentlichte, in dem er die Kirche von England scharf angriff. Er ist ein radikaler Reformer und gibt Annabella Unterricht auf Universitätsniveau. Sie studiert Philosophie und Literatur, liebt aber vor allem die Mathematik. Frend propagiert soziale Reformen, ist aber kein Atheist wie andere seiner radikalen Zeitgenossen, sondern überzeugter Unitarier. Er lehnt die Theorie der Dreifaltigkeit der Kirche ab und glaubt an eine zentrale göttliche Kraft. Diese Kombination aus Religiosität und dem Glauben an gesellschaftlichen Fortschritt prägen Annabellas Familie.
Im Jahr 1828 ist Annabella eine geschiedene, finanziell unabhängige Frau. Sie ist religiös, aber nicht so sehr in einem spirituellen Sinn. Die christlichen Vorstellungen von Menschlichkeit und Anstand und die Pflichten, die damit einhergehen, dienen ihr als Ordnungsprinzip. Sie ist keine kalte Person, aber reserviert, und teilt ihre Gefühle nur selten. Vor einigen Jahren hat sie das große Vermögen ihres Onkels geerbt. Sie besitzt Grundstücke, die Mieteinnahmen abwerfen, von denen sie mit Ada gut leben kann. Zusätzlich gehören ihr Kohleminen im Norden des Landes, deren Gewinne sie zu einer reichen Frau machen.
Diese sozioökonomische Situation, ihr Titel und ihr Reichtum, sind wichtige Voraussetzungen dafür, dass die spätere Ada Lovelace, die als Mädchen noch Ada Byron heißt, schaffen kann, was sie schaffen wird. Gleichzeitig kann sie ihrem Stand nicht entgehen. Er wird sie in allen Bereichen ihrer intellektuellen Entwicklung einengen und bremsen.





























