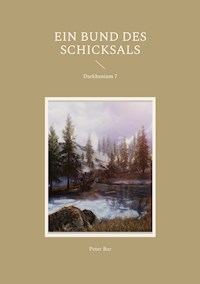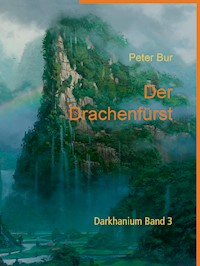5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
In einem herrlichen Tal im hohen Norden Cirunas, umgeben von einem Ring unüberwindlicher Berge, liegt die Stadt Sepharis - Zentrum des Königreichs Londurin. Lediglich ihren Bewohnern und einigen Verbündeten des Reiches ist der geheime, verborgene Weg dorthin bekannt. Eines Tages aber wird das Reich von einer Bande verfeindeter Wilder aus den finsteren Wäldern Tiizlas überfallen. Eine grössere Abteilung der hehren Streimacht des Reiches, unter der Führung des jungen Kommandanten Joran, verfolgt die blutrünstigen Angreifer über die Grenzen des Landes hinaus und durch die Weiten der verschneiten Wildnis und stellt sie am Saum des feindlichen Reiches. Noch während des Kampfes aber stellt sich heraus, dass Joran sein dunkles Gefühl nicht trog und weit mehr hinter dem Überfall steckt, als es auf den ersten Blick scheint. Dunkle Mächte bedrohen das Königreich, und die Sicherheit der geschützten Stadt scheint nicht länger gewährleistet. Von banger Furcht getrieben, wagt Joran einen verzweifelten Versuch, seine Truppen durch die tödliche Einöde der Eiswüste zu führen, um auf kürzestem Weg in seine bedrohte Heimat zurückzukehren. Doch auch er und sein Gefolge schweben in Gefahr, werden sie doch von einem schwarzen Schatten verfolgt, der Finsteres im Schilde führt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 536
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Die verborgene Stadt
Kapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Kapitel 19Kapitel 20Kapitel 21Kapitel 22Kapitel 23Kapitel 24ImpressumKapitel 1
Bald hatte er es geschafft. Nur noch ein paar Schritte, dann würde er endlich das Schlachtfeld vom Hügel aus überblicken können. Die martialischen Laute des Gefechtes vernahm er schon seit einer Weile; das Klingen und Krachen der Waffen und das wilde Geschrei vieler Kehlen durchwirkten die kalte Luft und breiteten sich in der Stille jener ansonsten menschenverlassenen und tief verschneiten Winterlandschaft weit aus.
Aldaram, sein kräftiges schwarzes Schlachtross, sank mit jedem Schritt tief in die weisse Schneeschicht ein und hinterliess eine deutlich erkennbare Spur, die sich schlangengleich durch das hügelige Gelände zog. Der Hengst war angetan mit einer schweren schwarz-roten Rüstung über einem wallenden Tuch von scharlachroter Farbe, das vom Wappen der Königsstadt Sepharis geziert wurde – einem schwarzen feuerspeienden Adler. Stolz schnaubte er, atmete in der eisigen Luft graue Dunstwolken aus, die sich rasch verflüchtigten. Er zeigte bereits erste Anzeichen von Erschöpfung, denn er hatte eine lange, beschwerliche Reise hinter sich, und seinem Rücken war eine schwere Last aufgebürdet.
Der Ritter, der ebenfalls von Kopf bis Fuss in einen prächtigen schwarz und rot lackierten Stahlpanzer gehüllt war, stemmte die Beine in die Steigbügel, um über die Kante des grossen Hügels zu spähen. Doch es gelang ihm lediglich, einige undeutliche, verschwommene Bewegungen wahrzunehmen – selbst für seine kundigen Augen viel zu wenig, um die Lage wirklich einschätzen zu können.
Joran Saller lehnte sich wieder ungeduldig in den wohlgeformten, reich verzierten Sattel zurück und wartete. Mit seiner behandschuhten Hand tätschelte er liebevoll den kräftigen, mit Stahlplatten gepanzerten Hals seines Pferdes, das mit stolzen Bewegungen gemächlich die mächtige Hügelschulter erklomm und sich unermüdlich durch den tiefen Schnee vorankämpfte, der das ganze Land unter sich begrub.
“Gut so, du hast es beinahe vollbracht, Aldaram. Nur noch wenige Schritte trennen uns vom Kamm“, sprach Joran mit einer wohlklingenden, warmen Stimme, die jedoch ein wenig vom schweren, reich geschmückten Helm verzerrt wurde, der auf seinem Haupt ruhte.
Durch diese Worte bestärkt, trabte das Schlachtross das letzte Stück des Hügels hinauf und blieb auf dem breiten Grat schnaubend stehen. Nun konnte Joran das Kriegsgeschehen auf der Ebene endlich betrachten, und er machte sich sogleich ein Bild der gegenwärtigen Lage. Ruhig glitt sein Blick über das tosende Schlachtfeld, das sich unter ihm ausbreitete, und seine Augen erfassten jede Kleinigkeit.
Der lange Hang, auf dem er stand, lief geschwungen in eine weite Ebene aus, die unter einer dicken Schneeschicht lag. Weit dehnte sie sich in alle Richtungen aus, abgegrenzt durch einen gewaltigen Wald aus verschneiten Tannen, dessen finsterer Saum dem Hügel gegenüberstand. Gross und mächtig waren die Nadelbäume, die dunklen, harzigen Stämme alt und stark, und die ausladenden Äste bildeten stolze Kronen, obwohl sie vom Gewicht des Schnees niedergedrückt wurden. Wie ein gewaltiger Wall standen sie da, Geheimnisse und Schrecken bergend, die sich in ihren Tiefen tummelten.
Dies war der grosse Tannenwald von Tiizla, und erst wenige wagemutige Männer des Königreichs hatten es gewagt, das unheilvolle und legendenumrankte Schattenreich unter den verflochtenen Nadelzweigen zu betreten, und noch weniger waren je zurückgekehrt, um von ihren Taten zu berichten. Der Wald war die Heimat der Lukher, eines mächtigen und streitbaren Barbarenvolkes, das seit ewigen Zeiten mit dem Königreich Londurin im Krieg stand. Obgleich diese Wilden durch eine weglose, todbringende Eiswüste von den Grenzen des zivilisierten Reichs getrennt waren, drangen sie immer wieder plündernd und mordend ins Hoheitsgebiet des Königs ein, verwüsteten Dörfer und Siedlungen der Krone, schändeten die wehrlosen Bewohner und stifteten Unheil und Schrecken. Selbst die grossen Städte, wie Tjorin, Orovin oder Sepharis selbst, waren nicht gänzlich gefeit gegen ihre Übergriffe.
An diesem Tage lieferte sich eine Abteilung der schlagkräftigen und gut organisierten Streitmacht aus der stolzen Hauptstadt, welche weit über die Grenzen ihres Landes hinaus gerühmt wurde, ein blutiges Gefecht gegen dieses wilde Volk. Obwohl die Barbaren einmal mehr in der Überzahl waren, glaubte Joran schon nach einem einzigen Blick zu wissen, dass die Streitkräfte des Reiches einen weiteren ruhmvollen Sieg erringen würden. Denn während die Wilden – allesamt grosse, kräftige Leute mit zerzausten hellen Haaren und struppigen Bärten, die sich in zottige Tierfelle hüllten, welche zur Abschreckung mit vielerlei Fangzähnen, Hörnern oder Krallen geschmückt waren – ohne jegliche Planung ungestüm drauflos schlugen, nicht ahnend, was die Kampfgenossen zur selben Zeit taten, fochten die Soldaten der Stadt in geordneten Gruppen, angeführt von gewissenhaften Hauptleuten. Die sepharischen Truppen waren nicht nur hervoragend gepanzert und ausgerüstet, sie wussten auch gut mit Schild, Schwert und Lanze umzugehen. Gnadenlos stiessen sie den scharfen, glänzenden Stahl in die Leiber der brüllenden Barbaren, derweil sie sich selbst vor den schmetternden Hieben ihrer Feinde schützten, die mit grobschlächtigen Keulen, schweren Äxten oder Hämmern aus sprödem Eisen bewaffnet waren.
Joran konnte von seiner erhöhten Stellung aus das gesamte Schlachtfeld mühelos überblicken. Beruhigt stellte er fest, dass auf Seiten der Königlichen lediglich eine Handvoll Soldaten von den wuchtigen Schlägen der Barbaren niedergemacht worden waren, während aufseiten der Lukher beinahe schon ein Viertel ihrer Leute ihr Leben gelassen hatten. Doch dies verwunderte den Ritter nicht im Mindesten, denn er gewann den Eindruck, dass die Wilden sich am heutigen Tage besonders ungeschickt anstellten und sich in ihrer chaotischen Kampfweise nicht selten selbst in die Quere kamen.
Und eben diese Beobachtung erfüllte ihn mit Unbehagen. Ihm fiel auf, dass er in dem hektischen Durcheinander auf der Ebene keinen Anführer der Wildlinge ausmachen konnte – einen Häuptling oder Kriegsfürsten, der zumindest ansatzweise für Ordnung in seiner Horde und ein halbwegs planvolles Vorgehen sorgte. Niemals zuvor hatten die Lukher es gewagt, ohne die Anwesenheit eines solchen in den Kampf zu ziehen, denn in ihrem archaischen Glauben galten diese Auserkorenen als Verkörperung ihrer blutigen Kriegsgötter. Die Gegenwart dieser meist gewaltige Hünen mit einer besonders abschreckenden Ausstrahlung stellte sicher, dass die Geister der Gefallenen in allen Ehren in ihr düsteres Segensreich einkehren konnten. Fehlte ein Kriegsfürst auf dem Schlachtfeld, waren die Barbaren ewiger Verdammnis geweiht, was ihnen ein grösseres Schrecknis war, als die namenlosen Wesen, die im Wald von Tiizla umgingen.
Dieses merkwürdige Verhalten seiner Feinde liess den Ritter nachdenklich werden. Sein Blick schweifte vom Geschehen des Schlachtfeldes ab und verlor sich in der Leere. Fragen beschäftigten seinen Verstand, deren Beantwortung ihm nicht möglich war. Ein ungutes Gefühl, wie die Vorahnung eines schrecklichen Ereignisses, beschlich sein Herz gleich einem bösen Schatten.
Ein lautes, schrilles Wiehern schreckte ihn auf, und er fuhr erbebend aus den Tiefen seiner Überlegungen. Aldaram tänzelte unruhig auf dem Grat des Hügels umher, stellte die Ohren gerade auf und schnaubte. Stolz und majestätisch nickte das Schlachtross mit seinem Haupt und scharrte mit den Vorderhufen im tiefen Schnee.
Joran beugte sich wieder über den Sattel, beklopfte den Hals des Hengstes und sprach beruhigend auf ihn ein. Das Tier musste irgendetwas gewittert haben, denn sonst würde es nicht in solch aufgeregter Weise gebärden. Der Ritter wusste, dass sein junges Reittier geschult worden war, degestalt auf mögliche Gefahren oder Geräusche zu reagieren. Doch er fragte sich, was dieses Gebaren ausgelöst haben mochte, denn ausser den üblichen Waffenlauten der nahen Schlacht vermochte er nichts wahrzunehmen.
Als sich der schwarze Hengst wieder beruhigte, horchte Joran konzentriert in die Ferne, versuchte, etwas auszumachen, was das Verhalten Aldarams hätte erklären können. Doch er vernahm nur die Geräusche des wilden Kampfes, die fast tierartigen Schreie der angreifenden Barbaren, das Klirren von Metallrüstungen, das krachenden Getöse schmetternder Hiebe und das grässliche Ächzen sterbender Menschen.
Doch dann drangen plötzlich weitere Geräusche in seine geschärften Ohren. Sie schienen sich von hinten an ihn anzuschleichen, immer lauter und deutlicher. Er hörte die unverkennbaren Klänge schwerer Panzer, das Schnaufen mehrerer Pferde und gedämpfte, durch Helme verzerrte Stimmen.
Joran zog sanft, doch bestimmend an den ledernen Zügeln und befahl seinem treuen Hengst damit, sich umzuwenden. Das kräftige Pferd gehorchte und vollbrachte eine majestätisch elegante Drehung und blieb seitwärts auf der langen Hügelkuppe stehen. Diese Position ermöglichte es dem Ritter sowohl die Schlacht als auch die nahenden Personen im Auge zu behalten.
Regungslos beobachtete Joran die berittenen Truppen, wie sie sich ihm gemütlich und ohne jegliche Hast näherten, seiner tiefen Spur im weissen Teppich folgend. Stolz und königlich wehten die Banner der Hauptstadt, einen feuerspeienden schwarzen Adler auf rotem Feld zeigend, im eisigen Wind, der in schwachen Böen über das Land strich. Der Kern dieser doch grossen Gruppe bildeten etwa fünfzig Panzerreiter, edle Ritter in mächtigen Plattenrüstungen auf kräftigen Pferden, die sich ausdauernd durch den Schnee voranarbeiteten. Neben ihnen her ritten gut hundert Reiter auf grossen, bedrohlich wirkenden Wölfen mit zotteligen Fellen, meist grau oder weiss. Sowohl die Soldaten als auch die leichtfüssigen Tiere waren nicht so schwer ausgerüstet wie die Ritter und wirkten schon aus der Ferne schneller und behänder. Hinter den Kämpfern kamen schliesslich noch etliche schwer beladene Schlitten, die Ausrüstung, Zelte, Proviant und allerlei anderes aufgebahrt hatten.
Joran Saller beobachtete das ganze Treiben geduldig von seiner Warte aus. Er sass ruhig in seinem Sattel und blickte vom Hügel herunter auf die dahinstampfende Kavallerie. Die bleiche Wintersonne, die hoch und fern am blassblauen, wolkenlosen Himmel stand, kaum fähig, auch nur das Geringste zu erwärmen, liess die schwarz-roten, blankpolierten Rüstungen aufblitzen.
Als die vordersten Reiter den Rand des geschwungenen Hügels erreichten, erscholl eine laute Stimme und befahl ihnen zu halten. Die Berittenen blieben am Fuss der Anhöhe stehen und verstummten. Es folgte ein Moment des Schweigens, und nur die Laute der tobenden Schlacht, das leise Hecheln einiger Wölfe und das Schnauben der edlen Pferde durchbrach die Stille des Landes.
Einem weiteren Befehl der lauten Stimme folgend, drängten die vorderen Ritter ihre jeweiligen Tiere zur Seite. Die geschlossene Gruppe teilte sich wie ein lebendiger stählerner Vorhang, und aus der Mitte trat ein hochgewachsenes, königliches Pferd, anmutig und schön. Die grosse Decke, welche dem braunen Ross auf den Schultern lag und bis zu den Knöcheln herabreichte, war mit schönen Mustern bestickt, die funkelnden Rüstungsteile waren mit Gold überzogen, und geschickte Hände hatten sie verziert. Im mächtigen, geschmückten Sattel sass ein Ritter, dessen prunkvoller Panzer ebenfalls in Gold erstrahlte, wie ein winziger Splitter der Südlandsonne. Seine mit feinen Gravuren versehene Rüstung bestach durch noch mehr verzierende Bestandteile als diejenigen der anderen Ritter. Aus einer Halterung in der Mitte des prächtigen Topfhelms schossen grosse schwarze Vogelfedern empor und bildeten eine stolze Zier, die im Wind leicht raschelte.
General Eodol Harkland brachte sein braunes Pferd zum Stehen, indem er die Zügel nach hinten riss; das stolze Tier wieherte. Er blickte den hohen Hügel hinauf zu Joran, der ihn respektvoll mit einer Faust auf der Brust begrüsste.
“Kommandant Saller, wie beurteilen Eure fachmännischen Augen das Geschehen der Schlacht?“ fragte der General trocken, ohne den Gruss zu erwidern. “Kommen die Infanteristen zurecht, oder ist unser Erscheinen auf der Ebene dringend erforderlich?“
“Ich glaube nicht, dass unsere Anwesenheit wirklich vonnöten ist, Herr General“, antwortete Joran in höflichem Ton. “Unsere Fusstruppen haben trotz der Überzahl der Lukher die Lage im Griff. Soweit ich es zu beurteilen wage, wird unser Anblick allein wohl schon genügen, um diese Wilden in die Flucht zu schlagen.“
“Das hört man gern“, meinte der General emotionslos. “Das bedeutet also, dass mein Plan aufgegangen ist.“
“So ist es, Herr General“, erwiderte Joran. “Es war wahrlich ein geschickter Zug, die beiden verschiedenen Stämme zu trennen, die an der Zerstörung des Dorfes und am Raub des Schildes beteiligt waren. Der Kampf des heutigen Morgens hat uns keinen einzigen Verlust eingebracht, und wir haben die wertvolle Beute bereits aus den dreckigen Händen dieser Barbaren entreissen können, die Ihrer Majestät so wichtig ist. Wie ich bereits erwähnt habe, wird auch dieses Gefecht hier schon bald vorüber sein.“
“Dann gibt es demnach nichts mehr zu melden, Herr Kommandant?“ fragte Harkland, während er sein tänzelndes Pferd zügelte.
“Leider doch, Herr General“, sprach Joran. “Als Erstes möchte ich noch anmerken, dass ich das Gefühl habe, dass die Lukher wahrscheinlich Verstärkung aus dem Wald erhalten haben, denn sie erscheinen mir zahlreicher als heute morgen, als wir sie stellten und vom anderen Stamm trennten. Was mich aber mehr beunruhigt, ist die Tatsache, dass ich bis anhin noch nirgendwo einen Kriegsherren ausmachen konnte. Die Lukher kämpfen völlig kopflos, ohne die tückische List eines Anführers. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache.“
General Harkland schwieg einen Augenblick und liess sich die Worte seines Kommandanten durch den Kopf gehen. Dann meinte er: “Es ist wahrlich seltsam, denn noch nie sind diese Wilden das Wagnis eingegangen, ohne Kriegsherren gegen uns ins Feld zu ziehen. Doch ob Euer ungutes Gefühl hier angebracht ist, erscheint mir fraglich, Herr Kommandant. Es sollte Euch eher beruhigen, denn wenn keiner die Lukher führt, ist es für uns ein Leichtes, sie zu besiegen.“
“Das mag sicher der Wahrheit entsprechen, Herr General, doch sollte man nicht ausser Acht lassen, dass die Lukher dadurch noch unberechenbarer geworden sind, selbst für Euch oder mich“, fügte Joran seine Bedenken hinzu.
“Wie Ihr meint, Kommandant Saller“, sagte Harkland trocken. “Aber bedenkt, dass der Anführer vielleicht schon heute morgen mit dem anderen Stamm vertrieben worden sein könnte. Das würde einiges erklären. Doch nun sollten wir zur Tat schreiten, ehe der Tag sich dem Ende neigt, denn wer weiss, was in der Nacht alles aus diesem finsteren Wald kriecht. Ich möchte mich nach Sonnenuntergang wirklich nicht so nah an seinem Saum aufhalten.“
Nach diesen Worten hob er seinen rechten Arm hoch in die kalte Luft und befahl den wartenden Truppen, den breiten Hügel zu erklimmen. Und während die Berittenen den geschwungenen Hang erstiegen, wendete Joran sein unruhiges Pferd, so dass er wieder gerade auf das Schlachtfeld herabblicken konnte.
Noch immer sahen seine suchenden Augen nirgends eine Spur von einem Kriegsfürsten. Stattdessen wurde er in den Reihen der Lukher einiger Gestalten gewahr, die nicht dem üblichen Angesicht dieses Volkes entsprachen, und dies machte ihn stutzig. Sie waren kleiner und schmächtiger gewachsen, keine solch bärenartige Hünen mit struppigem Haar und bärtigen Gesichtern, und sie kämpften mit Speeren oder altertümlichen Kurzschwertern; einige besassen gar kleine Rundschilde, die mit Tierfellen überzogen waren und ihre Gewandung verriet mehr handwerkliches Geschick. Das ungute Gefühl in seinem Magen verstärkte sich bei ihrem Anblick. Er wurde den Verdacht nicht los, dass sich bald schon etwas Unerwartetes und Schreckliches ereignen würde.
Als er die anderen Reiter bemerkte, die sich zu beiden Seiten auf dem breiten Hügelkamm aufreihten, um dann in einer gewaltigen Welle auf die Feinde herabzustossen, erwachte Joran aus seinen düsteren Gedanken. Zu seiner Linken erkannte er nun den Generalen in seiner verzierten goldenen Rüstung, zu seiner Rechten Major Malik Lawler, den obersten Anführer der hier versammelten Wolfsritter.
Auf ein Kommando Harklands nahmen die Berittenen ihre Lanzen und Wappenschilde aus den Halterungen an den Flanken ihrer Reittiere und bereiteten sich auf den Kampf vor. Auch Joran streifte seinen Schild über den linken Unterarm und ergriff die lange, hölzerne Lanze. Dann wartete er auf den Angriffsbefehl.
Harkland liess sich damit etwas Zeit, sandte erst seinen eigenen erfahrenen Blick über die verschneite Ebene und beobachtete kurz das blutige Treiben. Sein braunes Pferd überragte den Hengst seines Kommandanten um gut einen Pferdekopf, doch war Aldaram etwas kräftiger gebaut als der Braune, der auf langen Stelzen stand. Beide Tiere schnaubten, als würden sie sich gegenseitig anfeuern.
Eine gewisse Anspannung ergriff seinen Körper, je länger Joran auf den Befehl warten musste. Er sah, dass es den Lukhern nun gelungen war, einige weitere tapfere Soldaten zu töten, und er war sich seiner eigenen Worte nicht mehr ganz sicher. Womöglich war die Kavallerie doch nicht so überflüssig, wie er erst angenommen hatte, und es schien ihn gar zu drängen, endlich ins Kampfgeschehen einzugreifen. Sein Herz pochte in der schwer gepanzerten Brust; er konnte den rasenden Puls deutlich im Kopf spüren. Sein reich geschmückter Topfhelm drückte ihm schwer auf die Schultern.
Auch Aldaram wurde von einer inneren Unruhe geplagt. Der schwarze Hengst war noch sehr jung und hatte bislang nur wenig Kampferfahrung sammeln können. Joran hatte ihn erst vor einem halben Jahr erworben, und doch verstand er sich bereits besser mit ihm als mit seinem vorherigen Schlachtross, das bei einem Gefecht unweit der Hauptstadt von einer gewaltigen Streitaxt gefällt wurde, die ihm ein Lukher in die Brust getrieben hatte.
Noch immer schwieg General Harkland und starrte auf die Ebene herunter, wo sich der Schnee an einigen Stellen schon rot gefärbt hatte. Die in kleinen Gruppen kämpfenden Soldaten schienen immer noch die Oberhand zu besitzen, doch auch ihre Verluste häuften sich nun rascher. Die Lukher verstanden es mittlerweile besser, die kleinen Truppen aufzuspalten und im Einzelkampf die teilweise unerfahrenen oder verschüchterten Krieger niederzustrecken. Mit wildem Gebaren und beeindruckendem Gebrüll vermochten die blonden Hünen so manchen Soldaten zu erschrecken.
Plötzlich übertönte eine mächtige Stimme all die anderen Geräusche und liess gar einige der wartenden Tiere scheuen, die immer noch unbewegt auf dem Hügel standen. Ein riesiger Barbar, der gerade einen älteren Sepharier mit seiner gewaltigen Doppelaxt enthauptet hatte, bemerkte die lange Reihe berittener Krieger und meldete es seinen Stammesgefährten. Schnell scharten sich gut vier Dutzend blutrünstige Lukher um den vermeintlichen Anführer und traten todesmutig der Übermacht auf der Anhöhe entgegen, brüllend und kreischend.
Eodol Harkland atmete die kalte Luft tief ein, als er die Wilden nahen sah. Dann wandte er seinen behelmten Kopf zur Seite und warf seinem jungen Kommandanten einen bedeutungsvollen Blick zu. Joran wusste nichts zu erwidern, denn irgendwie verschlug es ihm die Sprache.
Während sich die Barbaren waffenschwingend näherten, schon fast den Fuss des Hügels erreicht hatten, hob Harkland seinen Arm. Noch einmal sah er sich kurz um, vergewisserte sich, ob seine Reiter auch wirklich bereit waren, und liess den Arm dann schwungvoll nach unten gleiten.
Mit dem Aufschrei: “Für Sepharis und das Königreich Londurin!“ senkten die Reiter ihre Lanzen und gaben den Tieren die Sporen. Wie eine gewaltige Lawine stürmten sie auf die etwas stockenden Barbaren herab, weissen Schnee aufwirbelnd, der sich in feinen Wolken im Wind zerstreute.
Krachend wie der Donner eines gewaltigen Gewitters trafen die Reiter auf die furchtlosen Lukher, die gnadenlos niedergeritten wurden. Wer nicht von einer Lanze durchbohrt wurde, der kam unter die Hufe eines wiehernden Pferdes oder wurde gar von den blitzenden Zähnen eines Wolfes zerfetzt. Die Wilden hatten keine Chance, obwohl sie es tatsächlich schafften, eine Handvoll Reiter mit in den Tod zu reissen, indem sie einfach blindlings drauflos schlugen.
Ein Jubel brach aus, als auch die bereits etwas ermüdeten Fusstruppen der königlichen Streitmacht auf die Ankunft ihrer Reiterei aufmerksam wurden. Mit neuem Mut und frischer Stärke warfen sie sich wieder ins Gefecht.
Die Kavallerie trennte sich nach dem ersten verheerenden Stoss auf und eilte einigen geschwächten Kompanien zu Hilfe, die gewisse Schwierigkeiten mit besonders wilden Lukhern bekundeten, oder rückte denjenigen Feinden zu Leibe, die sich bisher kaum am Gefecht beteiligt hatten und nun in den Wald zu fliehen begannen.
Joran Saller hielt sich anfangs an der Seite des Goldenen Generals auf, der von einer Leibwache aus vier Rittern umgeben war. Auch wenn sie hin und wieder einige Wilde mit ihren mächtigen Lanzen aufspiessten, begaben sie sich nicht ins Innere der Schlacht, sondern hielten immer noch vergebens nach einem barbarischen Kriegsherren Ausschau. Allmählich aber wurde Harkland es leid, nur am Rande des eigentlichen Getümmels auf und ab zu reiten. Er war ein erfahrener Kämpfer und nicht umsonst ein General der vielleicht schlagkräftigsten Armee des Kymmerischen Kaiserreichs. Er gab seinen Mannen den Befehl, ins Herz der Schlacht vorzudringen, und preschte, einen alten Kriegsgesang anstimmend, durch den knöcheltiefen Schnee davon.
Joran aber verhielt noch einen Augenblick länger am Rande des Geschehens. Es störte ihn sehr, nirgends einen Anführer der Lukher auszumachen, als wäre dies ein erster Beweis seiner düsteren Vorahnungen, die ihn seit dem frühen Morgen heimsuchten. Die Anwesenheit der seltsamen Krieger mit den bemalten Gesichtern, deren er bereits auf dem Hügel gewahr geworden war, verstärkten sein mulmiges Gefühl noch, denn es schien ihm, als hätte er sie schon einmal gesehen, auch wenn er sich an keine Begebenheit erinnern konnte. Sie waren ihm auf eigentümliche Art vertraut und doch gänzlich fremd, und etwas in ihm war davon überzeugt, dass diese Wilden hier nicht sein durften.
Plötzliches Geschrei liess den jungen Ritter auffahren. Er schleuderte seinen wachsamen Blick in Richtung des Waldes, der unweit von ihm entfernt dunkel und bedrohlich in den Himmel ragte wie ein Heer uralter und schweigender Riesen. Eine Gruppe Wolfsritter hatte dort gerade einige Lukher in die Flucht geschlagen, als sie überraschend von einer Übermacht übefallen wurden. Eine Horde Barbaren stürmte zwischen den stolzen Stämmen der hohen Tannen hervor und spülte gleich einer Welle über die Soldaten herein. Selbst mit der Unterstützung ihrer grossen Wölfe kamen sie gegen die Wildlinge nicht an und fielen unter ihren Hieben.
Joran glaubte in diesem Hinterhalt die List eines Häuptlings zu erkennen, und als tatsächlich ein riesiger Kerl mit einer gespickten Keule in der Pranke, gekleidet in das eisgraue Fell eines grossen Wolfes, dessen Schädeldach er auf dem Kopf trug, aus dem Wald fegte und gerade den letzten Sepharier mitsamt seines Reittieres niederschlug, verspürte der Ritter so etwas wie Erleichterung und trieb Aldaram daraufhin entschlossen in den Kampf.
Viele Barbaren gingen dem Kommandanten und seinem mächtigen Streitross aus dem Weg, sprangen zurück und liessen ihn unbehelligt passieren. Nicht aber der mächtige Häuptling, der sich zu voller Grösse aufrichtete und den Ritter mit üblen Worten in seiner rauen und heidnischen Sprache herausforderte.
Im auflodernden Feuer der Kampfeswut holte Joran das Letzte aus seinem Pferd heraus, das wie ein Sturmwind durch die tiefe Schneeschicht donnerte. Er senkte die gewaltige Lanze und zielte auf die kaum bekleidete haarige Brust des brüllenden Lukhers, der seine grobe Keule schwang.
Krachend stiess die Lanze des Ritters in den kräftigen Körper des Wilden, der von der gewaltigen Wucht des Treffers von den Beinen gerissen wurde, einige Fuss weit durch die Luft segelte und dann hart aufschlug.
Joran spürte einen heftigen Schlag im Arm, als sich die Spitze seiner Waffe in den Lukher bohrte und mit einem splitternden Knacken entzweibrach. Mit lauten Befehlen brachte er Aldaram kurz vor dem düsteren Waldrand zum Halten. Der schwarze Hengst vollbrachte auf Anweisung seines Reiters eine elegante Drehung, denn Joran wollte sichergehen, dass er den Häuptling auch wirklich getötet hatte. Mit grimmigem Gesicht suchte er die Leiche des Lukhers im Gewirr der toten Wolfsritter.
Ein gewaltiger Schrecken suchte ihn heim, als er sah, wie sich sein tot geglaubter Gegner stöhnend erhob. Der grosse Barbar richtete ächzend seinen Oberkörper auf und betrachtete benommen und verärgert zugleich die Spitze der hölzernen Ritterlanze, die sich tief in seine linke Schulter gebohrt und diese völlig zertrümmert hatte. Der Schmerz musste unerträglich sein, und Blut quoll in Strömen aus der grässlichen Wunde. Dennoch hielt der Wildling den betäubenden Qualen mit einem zornigen Grollen stand und ergriff mit seiner unverletzten Hand den abgebrochenen Schaft der Lanze, um ihn mit einem Brüllen aus der toten Schulter zu reissen.
Als dies getan war, kämpfte er sich auf die Beine und suchte taumelnd, doch keineswegs kampfunfähig nach seiner Keule, die er im Sturz verloren hatte. Er fand sie im Schnee liegend und hob sie auf. Dann küsste er ihren robusten, mit Leder und Fellstreifen umwickelten Griff und liess einen bärengleichen Schrei entgleiten.
Als er den Ritter erkannte, der ihn niedergeworfen hatte und nun erstarrt auf seinem kräftigen Pferd sass, schien gewaltige Wut in ihm aufzukochen. Er knurrte und entblösste dabei sein gelbliches furchteinflössendes Gebiss, während er mit langen Schritten auf die Leiche eines Wolfsritters zustapfte. Ein hämisches Grinsen im wüsten, bärtigen Gesicht, begann er den toten Soldaten vor den Augen des entrüsteten Ritters genüsslich zu verstümmeln und forderte diesen damit erneut heraus.
Die grässliche Tat des Lukhers liess Zorn in Joran aufkommen, die seinen Schrecken vertrieb. Seine linke Hand krampfte sich um den Riemen seines Schildes, und er biss die Zähne fest zusammen, um die Wut zu zügeln. Er wollte nicht kopflos gegen diesen Wilden ankämpfen, der aber gleichwohl einer Strafe für sein schändliches Verhalten bedurfte. Nicht länger soll dieser Unhold das Antlitz der Sonne geniessen, schwor sich der Ritter.
Schnaufend warf Joran seine abgebrochene Lanze mit einer schwungvollen Bewegung in den Schnee. Dann griff er an seine Seite und zog das wunderschöne Schwert seines Vaters aus der mit filigranem Gold beschlagenen Scheide. Singend fuhr die edle silbrige Klinge aus dem schwarzen Leder und funkelte wie ein Stern im blassen Licht des kalten Tages. Der Griff der Waffe war aus poliertem schwarzem Holz gefertigt, und ein Knauf aus Gold schmückte ihn. Die geschickten Hände eines Zwergs hatten der Parierstange, die ebenfalls aus Gold geschaffen war, die Gestalt eines stolzen Adlers verliehen, der seine Schwingen im Gleitflug weit ausgebreitet hatte. In meisterhafter Vollendung hatte der zwergische Schmied nicht nur das Gefieder des Vogels mit feinsten Gravuren angedeutet sondern auch die scharfe Klinge mit einem vielschichtigen geometrischen Muster versehen und feinste Runen in den Stahl geritzt. Dieses Schwert war eine Einzelanfertigung, das Geschenk eines wandernden Taroxon, der sich damit vor fast dreissig Jahren bei Cyberius Saller bedankte, einem der letzten grossen Helden Sepharis, weil dieser ihn und einige seiner Freunde gerettet hatte. Und seit seinem heroischen Tod wurde die Waffe von Joran geführt, Cyberius' jungem Sohn.
Als der verwundete Barbar sah, wie der stolze Ritter sein Schwert zum Kampf zog, hob er seine grobschlächtige Keule in die Luft und schwang sie in weitem Bogen, während sein linker Arm schlaff von der blutenden Schulter hing. Deutlich zeigte er mit diesem Gebaren, dass er sich nicht vor einem schwer gepanzerten, berittenen Reiter fürchtete.
Bevor Joran sein Schlachtross zum Angriff drang, bäumte sich Aldaram trotz der schweren Last wiehernd auf und ruderte anmutig mit den kräftigen Vorderbeinen in der Luft. Dann preschte er los, schnaubend wie ein wütender Stier.
Noch bevor der heranstürmende Ritter ihn erreichte, schlug der hünenhafte Barbar seine Waffe mit grosser Wucht in den Schnee und schleuderte seinem Gegner eine weisse Wolke entgegen, um diesem die Sicht zu nehmen und ihn durcheinander zu bringen. In der Tat konnte Joran für einen kurzen Augenblick nur noch aufgewirbelten Schnee erkennen, der an seine Rüstung prasselte, und sah sich gezwungen blind draufloszuschlagen. Zischend fuhr seine stählerne Klinge durch die Luft und traf. Doch nur einen Herzschlag später prallte etwas hart gegen seinen Rücken und warf ihn stöhnend nach vorn.
Der Lukher hatte sich nach seiner hinterlistigen Schneeattacke rasch um die eigene Achse gedreht und dann seine Keule mit aller Kraft in den Rücken des vorbeiziehenden Ritters geschlagen. Dieser Hieb verursachte ein grosse Delle in der schweren Rüstung, und die spitzen Metalldornen durchdrangen gar den Panzer, blieben aber im darunterliegenden Kettenhemd hängen.
Nach diesem Treffer stürzte Joran beinahe vom Rücken seines Pferdes. Er verlor den Halt in seinem Sattel und rutschte, vom Gewicht der Rüstung heruntergezogen, langsam zur Seite. Doch mit aller Kraft hielt er sich an Zügel und Sattel fest und kämpfte sich ächzend nach oben, bis er wieder aufrecht sass.
Der heftige Schlag bereitete dem Ritter einige Schmerzen, doch ausser einer ordentlichen Prellung schien er keinen Schaden angerichtet zu haben. Der schwere Harnisch und der Kettenpanzer hatten den Ritter vor Brüchen und ernsthaften Verletzungen bewahrt, die ein solcher Hieb mühelos hätte verursachen können.
Etwas gereizt zerrte Joran an den Zügeln und wendete sein Pferd erneut, um zu sehen, ob der Barbarenführer immer noch aufrecht stand. Er war sich sicher, dass seine Klinge etwas getroffen hatte, doch wusste er nicht, wo er den Wildling erwischt hatte.
Abermals packte ihn der Schreck, als er den Lukher tatsächlich noch stehen sah. Der gewaltige Kerl grinste ihn mit finsterem Gesicht an und leckte mit der Zunge das Blut, das von einer Schnittwunde über der Wange in das Gewirr seines struppigen Bartes floss.
Nun hatte der junge Ritter endgültig genug von seinem Widersacher. Er musste diesen dreckigen Hund einfach töten, das geboten ihm seine Ehre und der eigene Stolz. Schliesslich war er der Kommandant einer mächtigen Armee, ein ausgebildeter und vielgerühmter Offizier und Ritter, und mit einem solchen Barbaren sollte er doch fertig werden. Er erhob sein schönes Schwert und richtete die Klinge herausfordernd auf den Lukher, der darob höhnisch zu lachen begann.
Mit einem kurzen Fersendruck drängte er seinen Hengst zum Laufen, und Aldaram bahnte sich einen Weg durch den Schnee. Das Rüstzeug und die zusätzlichen Waffen, die an den Hüften des Pferdes baumelten, schepperten metallisch, als sie aneinander prallten.
Wieder schwang der Wilde seine todbringende Keule mit einem Arm, wirbelte sie über seinem Kopf durch die eisige Luft. Auch er hatte genug vom Spielen und wollte dem Ganzen nun ein Ende setzen. Mit grossem Ungestüm hieb der Lukher auf den herandonnernden Ritter ein, wobei er wie ein Bär brüllte. Seine Waffe traf dröhnend auf den dreieckigen Wappenschild und schlug diesen weit davon.
Joran kümmerte sich nicht darum, dass die ledernen Riemen seines Schildes durch die Wucht des Aufpralls rissen, und er seinen Schild einbüsste, der davongeschleudert wurde. Er hielt sich mit grossem Geschick aufrecht im Sattel und hieb seine Klinge zielsicher in den Nacken des ungeschützten Lukhers. Dieser schrie laut auf, taumelte blutspuckend noch einige Schritte weiter und fiel dann vornüber in den Schnee, wo er reglos liegen blieb.
Joran zügelte sein Pferd, liess es wenden und steuerte es auf den gefallenen Barbaren zu. Er kämpfte sich in voller Rüstung aus dem Sattel und trat, beinahe knietief in die Schneedecke einsinkend, auf den grossen Kerl zu. Sein Schwert hielt er kampfbereit in der Faust, als er mit dem gestiefelten Fuss den riesigen Körper anstiess. Nichts geschah, der Wilde rührte sich nicht.
Da er wissen wollte, welchen Kriegsfürsten er in diesem Kampf niedergestreckt hatte, drehte er den schweren Leib mühsam um. Und einmal mehr suchte ihn der kalte Griff des Entsetzens heim, denn kaum hatte er den toten Wilden auf den Rücken gewendet, erkannte er, dass es sich nicht um einen jener gefürchteten Anführer handelte. Dieser Mann war vielleicht kein gewöhnlicher Lukher gewesen, doch ein Kriegsfürst war er ebensowenig.
Joran starrte beklommen auf die Leiche seines Gegners nieder, sah in die glanzlosen, erstorbenen Augen, die nun trüb waren. Das Unbehagen kehrte auf krabbelnden Beinen wieder und schlug seine eisigen Klauen in sein pochendes Herz. Nirgendwo konnte er bei dem Barbaren die Zeichen ausmachen, die Symbole ihrer heidnischen Kriegsgötter, die ihn als Auserkorenen und Kriegsführer ausgewiesen hätten. Soweit der Ritter erkennen konnte, trug der tote Hüne keine auffälligen Schmucknarben, Feuermale, Tätowierungen oder Amulette auf sich, die seine besondere Stellung innerhalb ihrer primitiven Stammeskultur zweifelsfrei belegt hätten.
Seufzend kehrte der Kommandant dem Gefallenen daraufhin den Rücken, und nachdem er seinen Schild aufgehoben hatte, mühte er sich wieder in den Sattel. Mit einem kurzen Befehl trieb er den stolzen Hengst an und ritt ins Herz der tobenden Schlacht.
Kapitel 2
Talina Norrik wich mit einer geschickten Bewegung einer niederfahrenden Streitaxt aus, die, ihr Ziel verfehlend, mit einem dumpfen Poltern im Schneeboden aufschlug. Der bärtige, grauhaarige Lukher, der diese grobschlächtige Waffe führte und nun in geduckter Haltung seitwärts der Kriegerin stand, richtete seine eisblauen Augen, die unter den buschigen Brauen hervorblitzten, zornig auf seine Gegnerin. Sein vernarbtes, hässliches Gesicht verzog sich zu einer widerwärtigen Maske, während in seiner breiten Brust ein dröhnendes Knurren aufstieg.
Talina aber liess sich von diesem Barbaren keineswegs einschüchtern, auch wenn er bedeutend grösser war als sie und über mehr Kraft verfügte. Noch bevor der Wilde seine Axt aus dem Schnee heben konnte, schlug sie ihren Wappenschild in einer ausholenden Geste gegen seinen Schädel, und der Mann torkelte benommen zurück.
Aber ehe Talina auch nur die Zeit für einen einzigen Gedanken fand, vernahm sie ein bedrohliches Gebrüll hinter sich. Geistesgegenwärtig wirbelte sie herum und brachte gerade noch rechtzeitig ihren Schild zwischen sich und einen gespickten Streitkolben. Es krachte ohrenbetäubend, und die Wucht des heftigen Schlages warf sie nach hinten.
Ihr linker Unterarm schmerzte, so stark war der Hieb gewesen, doch ansonsten war sie unverletzt. Vor sich sah sie nun einen zwar kleinen, jedoch äusserst kräftig gebauten Lukher, der bereits wieder seinen Streitkolben in schwungvollen Drehungen durch die Luft wirbelte.
Talina duckte sich keuchend unter einem sausenden Schlag hindurch, der ihr mühelos den Schädel mitsamt Helm zertrümmert hätte. Dann senkte sie ihren Schild, holte mit dem rechten Arm aus und schlug ihr Schwert gegen das stämmige Bein des Wildlings. Die lange, geschmeidige Stahlklinge schnitt tief in den Oberschenkel und zerfetzte den Muskel.
Der Lukher schrie entsetz auf und hielt sich die blutende Wunde, während er von der Kriegerin zurückwich. Sein Gesicht hatte für den Augenblick seinen grimmigen Ausdruck verloren und verzog sich in Linien der Qual.
Talina aber verspürte keinerlei Mitleid mit einem solchen Kerl, richtete sich wieder auf, in der Absicht dem Verwundeten den Rest zu geben. Doch dazu kam sie vorläufig nicht, denn der Wildling mit dem grauen Zottelhaar hatte sich mittlerweile von ihrem Schildschlag erholt und stürzte sich erneut auf sie.
Wieder reagierte die Kriegerin blitzartig und wehrte einen tödlichen Schlag mit dem zerbeulten Schild ab. Das scharfe Axtblatt grub sich in den schwarzen Adler des Wappens und blieb darin stecken. Talina nutzte dies aus, stiess ihren linken Arm mit aller Kraft hoch, wodurch ihr Gegner, der seine Axt nach wie vor mit beiden Händen umklammert hielt, gezwungen war, ihrer Bewegung zu folgen. Gleichzeitig führte sie mit dem Waffenarm einen tiefen Streich, dergestalt mit ihrem Schwert den nun ungeschützten Bauch des Barbaren aufschlitzend.
Der Mann stöhnte, liess seine Waffe entfahren und presste seine groben Hände auf die tödliche Wunde. Das Blut floss in dünnen Rinnsalen durch die Spalten seiner Finger und färbte den Schnee rot. Mit einem letzten gequälten Seufzer sackte er schliesslich tot zusammen.
Talina jedoch blieb noch immer keine Zeit zum Verschnaufen, denn der andere Lukher hatte in seinem Schmerz zu neuer Wut gefunden. Mit rauem Geschrei griff er die Kriegerin abermals an und erhoffte sich ein leichtes Spiel, da sie mit dem Rücken zu ihm stand. Mit voller Wucht schlug er seinen Streitkolben gegen ihren behelmten Kopf.
So schnell und geschmeidig wie eine Raubkatze tauchte Talina erneut unter dem schmetternden, doch einfallslosen Hieb hindurch, nutzte die kurze Zeitspanne, um mit dem Arm aus den ledernen Schlaufen ihres Schildes zu schlüpfen, das wegen der darinsteckenden Streitaxt nur zur Last geworden war, und sich vom Lukher wegzudrehen. Dann war sie bereit zum Angriff und zögerte damit keinen Augenblick. Mit beiden Händen erhob sie ihr blutbesudeltes Schwert zum Schlag und liess es niederfahren.
Der kleine, stämmige Mann hatte sich gerade umgewendet, als ihn die edle Schneide traf und ihm das Gesicht spaltete. Mit heiserer Stimme hauchte er sein Leben aus und fiel mit einem dumpfen Krachen auf seinen toten Gefährten.
Keuchend blieb Talina über den beiden stehen, ihr silbriges Schwert fest in der behandschuhten Hand. Tief sog sie die kalte Winterluft in ihre Lungen und atmete wabernde Dampfwolken aus, die rasch vom trockenen Ostwind zerstreut wurden. Endlich war es ihr vergönnt, sich ein wenig zu erholen und einen Augenblick lang ruhig durchzuatmen, denn ihr kleiner Trupp hatte eben eine wilde Gruppe Barbaren niedergemacht.
Kurz liess sie einen prüfenden Blick über die Umgebung schweifen. Noch immer tobte die Schlacht in unverminderter Härte. Vor wenigen Augenblicken waren die Berittenen eingetroffen und demonstrierten nun den Lukhern ihre überlegene Stärke. Diese aber gaben sich noch lange nicht geschlagen und liessen sich nicht vertreiben. Mit zähem Willen hielten sie den sepharischen Streitkräften entgegen, denn sie wurden von einer Horde seltsamer Kämpfer unterstützt, die mit den Kriegern anderer Stämme aus dem nahen Wald gestürmt kamen. Sie selbst hatte zwar noch keinen dieser fremdartigen Wilden bekämpft, doch gesehen hatte sie schon einige, und sie wusste sich nicht zu erklären, woher dieses Volk stammte und warum es an der Seite der Lukher gegen die Truppen aus Sepharis focht.
Talina Norrik bekleidete trotz ihres jungen Alters bereits den Rang einer Majorin, da sie einer wohlhabenden Familie von Offizieren entsprang und eine meisterliche Schwertkämpferin war. Auch hatte sie sich schon in einigen Gefechten als kühne Anführerin erwiesen und war als furchtlose Streiterin bekannt.
Doch all diese grausamen Kämpfe, daran sie bereits teilgenommen hatte, hatten ihre umwerfende Schönheit nicht zu beeinträchtigen vermocht. Noch immer bewahrte sie sich ein bildhaftes, liebreizendes Antlitz unter dem harten Stahl, das nicht durch Narben oder andere Wundmale entstellt wurde. Ihr Gesicht war ebenmässig und makellos, die Haut hell und geschmeidig, milchfarbener Seide gleich. Ihre grossen, geschwungenen Augen waren von einem hellen Blau und schimmerten wie reine Edelsteine. Sie hatte langes goldblondes Haar, dass unter dem Helm hervorquoll, ihr in schwungvollen Wellen über die Schultern fiel und nun im Wind spielte.
Trotz der rot-schwarzen Stahlrüstung, die zwar längst nicht so schwer und einschränkend wie die mächtigen Panzer der Ritter, aber dennoch eine Last war, bewegte sie sich mit einer sinnlichen Anmut und verband im Kampf weibliche Eleganz mit tödlicher Härte. Sie trug einen leichten, aufgewölbten Helm mit geschwungenen Wangenschützern, einem beweglichen Visier, das bei Bedarf nach oben geschoben werden konnte, und einem wehenden roten Federbusch als Zier. Ein robuster Harnisch mit abgerundeten Schulterplatten sorgte für einen ausreichenden Schutz ihres Rumpfes. Leichte Schienen für Beine und Arme vervollständigten ihre Rüstung.
Bewaffnet war sie gut. In der Hand hielt sie nach wie vor ihr scharfes Langschwert, aus den besten Schmieden Sepharis’ stammend, elegant und tödlich. An einem Gürtel an ihrer Hüfte hing zusätzlich ein schwerer Dolch, und ein etwas unedleres Kurzschwert war mit Lederriemen am rechten Oberschenkel angebunden. Die mächtigste Waffe aber war ihr Anderthalbhänder, den sie in einer beschlagenen Lederscheide auf dem Rücken trug. Dieses beeindruckende Grossschwert, welches eine breite, bläulich schimmernde Klinge aus bestem Stahl besass und den Namen Eiswind trug, war ein Erbstück, das sich schon seit vier Generationen im Besitz ihrer Familie befand.
Nachdem sie sich etwas erholt hatte und wieder ruhig atmete, trat sie zu ihrem Schild, der zerschunden im Schnee lag. Sie hob ihn auf, zog die schwere Axt aus seiner Mitte und musterte ihn mit verzerrter Miene. Obwohl er bereits ziemlich stark beschädigt war, entschied sie, dass sie durchaus noch Gebrauch von ihm machen konnte. Daher streifte sie ihn mit einem Schulterzucken über ihren linken Unterarm und wandte sich der Einheit zu, die unter ihrem Kommando stand.
Die dreiundvierzig Soldaten, welche das harte Gefecht halbwegs unversehrt überstanden hatten, reihten sich sogleich geordnet auf und nahmen Haltung an, als ihre Anführerin mit kräftigen Schritten auf sie zu stapfte. Ihre einheitlichen Rüstungen unterschieden sich nicht von derjenigen Talinas, nur dass ihren Helmen der wehende Haarbusch fehlte. Auch sie waren mit Schild, Schwert, Dolch und Kurzschwert bewaffnet und führten zusätzlich robuste Speere mit breiten Spitzen, dafür aber keine anderthalbhändigen Schwerter.
Talina blieb gelassen vor ihrer Einheit stehen und liess ihren Blick über die Männer und Frauen schweifen, die ihrem Befehl unterstanden und bislang tapfer gegen die furchteinflössenden Wildlinge gefochten hatten. Die auf Gehorsam und Ordnung gedrillten Soldaten verhielten reglos und starrten in die Leere, die Schilde an die herausgestreckte Brust gedrückt, die Speere aufgerichtet an ihrer Seite. Aber die Majorin war zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht daran interessiert, ob ihre Mannen sich auch inmitten anhaltender Kampfhandlungen darauf verstanden, strammzustehen, daher schweiften ihre blauen Augen alsbald in die Ferne und hielten nach neuen Gegnern Ausschau.
“Da vorne sehe ich einen kleinen Trupp, der Schwierigkeiten bekundet, sich einer Horde Barbaren zu erwehren“, sagte sie mit kräftiger Stimme und richtete ihre blutige Schwertspitze auf einen niedrigen Hügel, der mit einigen verkrüppelten Tannen bestanden war und sich ganz in der Nähe des Waldrandes einsam aus der verschneiten Ebene emporwölbte. An seinem Fuss kämpften fünfzehn Soldaten verzweifelt und führerlos gegen eine mehr als dreifache Übermacht. “Es scheint mir dringend geboten, dass wir das Kräfteverhältnis zu unseren Gunsten wenden.“
Kaum waren die Worte gesprochen, schon lief die Kriegerin los, und der ganze Trupp folgte ihr im Gleichschritt. Mit einem Schlachtruf auf den Lippen stürzten sie sich auf die Barbaren, die ihr Herannahen bemerkt und sich ihnen zugewandt hatten.
Talina an der Spitze hieb ihr Schwert kraftvoll in die Seite einer rothaarigen Wildlingsfrau, die ihre Axt zum Angriff hoch erhoben hatte und deshalb völlig ungeschützt war. Noch bevor ihre Leute sich der anderen annehmen konnten, war die Majorin bereits über den Körper der gestürzten Frau gesprungen und hatte ihre Klinge mit einer raschen Bewegung in den Bauch des nächsten Lukhers getrieben.
Ein kurzer, heftiger Kampf entspann sich, doch unter Talinas Führung gewannen die einheitlich agierenden Sepharier rasch die Oberhand und drängten die Lukher allmählich zurück. Fünf der Wilden bekamen es da mit der Angst zu tun und setzten sich von den vorstossenden Soldaten ab, um über den Hügel in den nahen Wald zu flüchten.
Das blutige Gefecht am Fusse der Anhöhe aber forderte auch aufseiten der Sepharier einige Opfer. Bereits acht Soldaten hatten ihr Leben gelassen, und zwei weitere fielen kurz nacheinander unter den wuchtigen Schlägen eines blonden Hünen, der mit seinem Streithammer die Köpfe seiner Gegner zu Brei zerschlug. Erst Talinas Schwerthiebe vermochten den Lukher zu fällen, der die Ohren seiner früheren Opfer an einem Lederband um seinen kräftigen Hals trug.
Doch noch bevor der grosse Mann mit einem dumpfen Krachen tot auf dem Boden aufschlug, sah der Korporal der anderen Gruppe eine grosse Rotte der fremdländischen Wildlinge zwischen den schiefen Baumstämmen auf dem Hügelkamm auftauchen. Die in Pelzjacken und Hosen gekleideten Krieger sammelten sich um einen jungen Mann, dessen Gesicht mit blauer Farbe bemalt war. Er war ziemlich klein, besass aber einen stattlichen Körperbau, und sein schrilles Kreischen liess die Soldaten unten erschaudern.
Nur Talina liess sich davon nicht einschüchtern. Die blonde Kriegerin bewahrte einen kühlen Kopf und erteilte ihren Leuten umgehend einige Befehle. Auf ihre Anweisungen hin reihten sich die Soldaten nebeneinander auf, bereit, es mit der Überzahl feindlicher Krieger aufzunehmen. Talina stellte sich hinter ihre Mannen und wartete den Angriff der Barbaren ab.
Dieser liess nicht lange auf sich warten. Der bemalte Anführer zog ein grosses, altertümliches Breitschwert aus seinem Gürtel, hob es hoch in die Luft und liess es mit einem wilden Brüllen über dem Kopf kreisen. Die anderen schlossen sich seinem Kriegsschrei an, dann stürmten sie wie eine Flutwelle auf die wenigen Soldaten herab.
Talina sog die kalte Winterluft scharf zwischen ihren Zähnen ein, als sie feststellen musste, dass es mehr Wilde waren als erst angenommen. Ihr Herz hämmerte heftig gegen ihre Brust, und beklemmende Furcht breitete sich aus. Doch ganz im Gegensatz zu ihren Leuten, die im Angesicht einer solch grossen Schar in Unruhe gerieten, hatte sie ihre aufkommende Angst fest im Griff. Sie beruhigte ihren Trupp mit selbstbewussten Reden und machte den Soldaten Mut.
Kurz bevor die ersten Wilden waffenschwingend auf die Reihen der Sepharier trafen, befahl Talina ihren Leuten die Speere gegen die anrennenden Gegner auszurichten. Und so geschah es, dass die vordersten Barbaren ungeschützt in die spitzen Stahlklingen liefen und daran aufgespiesst wurden.
Sofort liessen die Soldaten ihre Speere aus den Händen gleiten und zogen ihre Schwerter, um der nächsten Welle entgegenzutreten. Doch einige waren etwas zu langsam und wurden von den anstürmenden Wilden gnadenlos massakriert.
Nun warf sich auch Talina grimmig ins Gefecht. Beinahe wie eine Tänzerin glitt sie durch das heftige Gewühl und schwang ihr Schwert durch die Luft, durchtrennte Hälse, zerschnitt Bäuche und durchbohrte Schultern und Rücken. Geschickt wehrte sie die schmetternden Hiebe der Gegner mit dem Schild ab, tauchte unter ihren Schneiden hindurch und kreuzte mit einigen die Klinge.
Im wilden, blutigen Durcheinander versuchte Talina, den Anführer auszumachen, um ihn zum Zweikampf zu stellen. Als sie ihn erkannte, wie er gerade sein Breitschwert durch die gepanzerte Brust einer jungen Soldatin stiess, die schreiend am Boden lag, rannte sie wütend auf ihn zu.
Der Barbar bemerkte sie, zog seine Klinge aus dem Leib der toten Frau und drehte sich grinsend der Majorin entgegen. Doch diese hatte einige Probleme damit, zu ihm zu gelangen, denn zwei grosse, stämmige Kerle in braunen Fellwesten und genähten Lederhemden stellten sich ihr in den Weg. Einer von ihnen schlug mit einem Streitkolben auf sie ein, während der andere, der ein Kurzschwert führte, mit ihr focht.
Talina musste ihre ganze Geschicklichkeit einsetzen, um diese beiden streitbaren Burschen zu überwinden. Mit einer eleganten Drehung brachte sie sich schliesslich aus der Reichweite der Barbaren und gönnte sich einen winzigen Augenblick der Ruhe. Dann sprang sie unvermutet mit dem Schild voran gegen einen ihrer überraschten Widersacher und stiess ihn zu Boden. Indes stach der andere mit seiner Klinge zu. Doch die Kriegerin parierte die Attacke mit ihrem geschmeidigen Schwert und ging ihrerseits zum Angriff über. Wuchtig schlug sie ihren zerbeulten Schild in das Gesicht des Mannes, dann folgte ein rascher, tödlicher Hieb mit dem Schwert, der den zurücktorkelnden Wilden beinahe enthauptete. Noch bevor dieser in den Schnee sackte, wirbelte Talina herum und schlug ihre Klinge in den Hals des anderen, der sich noch nicht ganz erhoben hatte.
Keuchend wandte sich die Majorin abermals dem Anführer zu, der nun etwas abseits des stürmischen Gefechts auf sie wartete. Sein schmales Gesicht, das eine blaue Kriegsbemalung trug, lächelte nicht mehr; es war düster und konzentriert. Mit beiden Händen hielt er sein archaisches Breitschwert in kampfbereiter Stellung.
Talina warf ihren nun völlig unbrauchbar gewordenen Schild davon und umfasste das Heft ihres Schwertes ebenfalls mit beiden Händen. Der Schnee knirschte unter ihren schwarzen Stiefeln, als sie mit kräftigen Schritten auf ihren Gegner zuging.
Noch bevor sie ihn erreicht hatte, griff der Mann mit einem schallenden Schrei an und wuchtete seine Klinge gegen ihren Hals. Doch die Kriegerin vermochte den Schlag abzuwehren, auch wenn sie feststellen musste, dass allmählich eine lähmende Müdigkeit in ihr aufstieg. Während sie sich mit dem Barbarenführer duellierte, kroch die Erschöpfung in zunehmendem Masse in ihre Glieder und machte ihr zu schaffen. Immer schwerer wurden ihre Arme, und beständig büsste sie an Reaktion, Gewandtheit und Stärke ein. Je länger der Kampf andauerte, umso mehr Schwierigkeiten besass sie, sich gegen den Wilden zu verteidigen. Anfangs hatte sie die Oberhand inne und konnte ihren Gegner gar mit einem kurzen Streich am Arm verwunden, doch allmählich verlor sie ihre Überlegenheit und drohte ihm gar zu unterliegen, da er keinerlei Anzeichen machte zu ermüden.
Schliesslich schlug der Barbar Talina das Schwert aus der Hand und verpasste ihr einen Tritt, der sie zu Boden warf. Die Kriegerin hatte nicht mehr genügend Kraft sich rasch zu erheben, denn ihr Körper wollte ihr nicht mehr gehorchen, und Furcht übermannte sie. Sie blieb erschöpft im Schnee liegen und tastete gehetzt nach ihrem Schwert, den Blick stets auf ihren Gegner gerichtet, in dessen Fratze sie nur noch das Verlangen nach Töten erkannte.
Der Barbarenführer schien es richtig zu geniessen, dass er die Majorin niedergeworfen hatte. Er bleckte seine Zähne zu einem schrecklichen Grinsen, während in seinen hellen Augen ein blutrünstiger Funke erglomm. Er sah, dass seine Gegnerin mit der einen Hand nach dem Griff ihrer entfallenen Waffe tastete und verwehrte ihr dies, indem er seinen Fuss auf ihren Schwertarm stellte.
Talina stöhnte vor Schmerzen auf und versuchte sich mit aller ihr verbliebenen Kraft aufzurichten. Doch noch bevor sie auch nur den Kopf heben konnte, trat der Wilde ihr mit dem Stiefel ins hübsche Gesicht. Die Kriegerin sank benommen zurück.
Nun war Talina dem Barbaren hilflos ausgeliefert, denn der harte Treffer hatte sie an den Rand der Ohnmacht geschleudert. Alles um sie herum verschwamm in einem wirren Nebel, löste sich zu unscharfen Formen auf, die sich nicht mehr unterscheiden liessen. Es kam ihr vor, als würden dicke Schleier sich über sie senken. Sie sah nur noch farbige Schatten, die sich bewegten, während langsam eine tiefe Dunkelheit alles zu verschlingen begann.
Doch noch bevor diese Finsternis sie völlig verschluckte, erwachten ihre lahmen Gedanken zu alter Frische, denn ein unerwartetes Geräusch übertönte das Geschrei der Kämpfenden ringsum. Es war ein hoher, schriller Laut, ein majestätischer Klang: das Wiehern eines Pferdes!
Talina zwang sich, ihre schweren Lider aufzureissen und erkannte über sich den Barbarenführer, der sein Breitschwert zum tödlichen Schlag erhoben hatte. Doch auch ihn schreckte das Wiehern auf, und er verharrte zu lange in seiner Stellung.
Sofort reagierte die Kriegerin, zerrte ihren Dolch aus der Scheide an ihrem Gürtel und stiess die blitzende Klinge ins rechte Bein des Wildlings. Der schrie entsetzt auf und richtete den Blick ungläubig auf seinen Oberschenkel, wo der Dolch seiner Gegnerin bis zum Heft im Muskel steckte. Ehe er in einem Anfall feuriger Wut und blinder Rache die Majorin zerstückeln konnte, stiess diese ihn mit beiden Beinen von sich. Er torkelte zurück und schrie plötzlich erneut auf, doch diesmal völlig verängstigt.
Der schneebedeckte Boden erbebte leicht unter donnernden Hufen, und der scheppernden Klang stählerner Rüstungsteile erfüllte die kalte Winterluft. Ein mächtiges schwarzes Tier, auf dem ein schrecklicher Dämon sass, preschte heran, eine Wolke aus Schnee aufwirbelnd. Der Barbar versuchte noch, diesem Unhold zu entkommen und wandte sich zur Flucht. Doch verwundet und hinkend war er bei weitem zu langsam, um dem Verhängnis zu entgehen. Eine silbrige, doch blutbefleckte Klinge sauste singend durch die Luft und fällte ihn.
Talina richtete sich mühsam auf, musste jedoch noch einen Augenblick im Schnee sitzen bleiben, da ein starkes Schwindelgefühl sie übermannte. Vor sich erkannte sie nun ein schwarzes Pferd in voller Kriegstracht, das mit einem Schnauben grosse Dampfwolken erzeugte, und auf seinem Rücken thronte ein Ritter, dessen Rüstung im bleichen Sonnenlicht leicht glänzte. In der rechten Faust hielt er ein prächtiges Schwert, dass die Kriegerin trotz ihrer Benommenheit sofort erkannte.
“Obwohl ich mit den folgenden Worten einen üblen Frevel begehen werde, muss ich dir sagen, dass du nicht besonders gut aussiehst“, sagte der Ritter in sanftem Ton.
“Ich glaube kaum, dass ich schlimmer aussehe als ich mich momentan fühle. Und dennoch bleibe ich bei Weitem hübscher als du“, meinte Talina schmunzelnd. Sie schob ihr Visier hoch und rieb sich die schmerzende Wange.
“Bist du verletzt?“ fragte der Ritter besorgt. “Ich könnte dich zu den Feldschern bringen.“
Talina schüttelte den Kopf. “Ich danke dir, Joran, aber nein. So schlimm ist es auch nicht – eine Beule, nichts weiter. Er hat mich mit dem Stiefel voll erwischt.“
Joran seufzte. “Ich glaube, er würde sich diese Tat niemals verzeihen, wenn du deinen Helm vom Kopf genommen und ihm dein bildschönes Antlitz gezeigt hättest“, meinte er in schmeichelndem Tonfall.
Ein liebevolles Lächeln legte sich auf die Lippen der blonden Kriegerin. Selbst mitten im Gefecht vermochte der Ritter solch schöne Worte zu sprechen, für die er neben seiner Kampfkunst in der ganzen Stadt, wenn nicht gar im ganzen Königreich berühmt war. Joran Saller war nicht bloss der jüngste Mann in der Geschichte Londurins, der den Rang eines Kommandanten der Streitkräfte bekleidete, sondern auch ein begehrter Junggeselle und umschwärmter Frauenheld. Dass er ein äusserst gutaussehender Mann war, liess sich nicht leugnen, auch wenn davon im Augenblick nicht viel zu erkennen war hinter dem geschmückten Grosshelm und der schweren Plattenrüstung. Darüberhinaus erwies er sich als ein geschickter Redner, der mit wohlklingenden, gewählten Worten und verführerischen Gesten wohl jede Frau zu betören vermochte. Äusserst hilfreich war ihm dabei gewisslich seine immense Ausstrahlung, die wie eine übernatürliche Aura anmutete und ihn zum Traum aller jungen Damen der Königsstadt machte.
“Ich glaube, du solltest dich lieber wieder dem Kampf widmen als mir Honig ums Maul zu schmieren“, sagte Talina streng, obwohl sie natürlich einmal mehr berührt war.
“Denkst du, ich wäre Kommandant geworden, wenn ich mitten im Feuer eines Gefechts belanglose Schwätzchen hielte? Bei der der Vierzehn, Majorin Norrik, ich fürchte, Ihr wurdet schlimmer zugerichtet als ich zuerst angenommen habe“, erwiderte Joran beinahe spöttisch. Doch dann schlug seine Stimme sofort wieder um. “Sieh dich doch um. Die Schlacht neigt sich allmählich dem Ende zu. Ich glaube, es stört niemanden, wenn wir uns für einen Moment unterhalten. Die Lukher werden von unseren Einheiten an allen Fronten arg bedrängt und ziehen sich immer weiter zurück, denn die Ausfälle der im Wald versteckten Verstärkungen sind mittlerweile versiegt. Es scheint mir nur noch eine Frage der Zeit, bis sie die Flucht ergreifen und sich in ihr finsteres Waldland absetzen.“
Während Talina ihr Schwert mit einem Tuch notdürftig säuberte, folgte sie Jorans Anregung und liess ihren Blick über die Umgebung schweifen. Am Fusse des Hügels, wo sie stand, lagen zahlreiche Leichen darnieder, und der aufgewühlte Schnee war rot vom vielen Blut. Tatsächlich hatte ihre kleine Truppe die grosse Schar der seltsamen Barbaren besiegt, auch wenn neben ihr lediglich achtunddreissig Soldaten diesen Ansturm überlebt hatten. Wie viele der fremdländischen Wildlinge geflohen waren und wie stark Jorans Eingreifen zu diesem Erfolg beigetragen hatte, konnte sie nicht sagen.
Etwas nachdenklich schwenkte sie ihr Augenmerk in die fernere Umgebung, und erkannte, dass Joran die Lage richtig eingeschätzt hatte. Es tobten an einigen Stellen zwar noch heftige Kämpfe, doch es hatte fürwahr den Anschein, als wären die Lukher mitsamt ihrer eigentümlichen Unterstützung bald geschlagen. Und doch konnte sie das mulmige Gefühl nicht abstreifen, wenn sie am Saum des grossen Waldes entlang blickte, dass die geflohenen Feinde sich nach wie vor in der Nähe aufhielten und lauerten, verborgen in den dichten Schatten unter den mächtigen Tannen.
Erschreckend war auch, dass die Verluste auf ihrer Seite weit grösser waren als lange vermutet. Während am Anfang der Schlacht bloss einige wenige Soldaten ihr Leben im Kampf gelassen hatten, mehrten sich nun die Gefallenen mit jedem Augenblick. Selbst die Kavallerie war davon nicht verschont geblieben; beinahe ein Fünftel der Ritter und Wolfsreiter blieb erschlagen im Schnee liegen.
“Diese verfluchten Lukher“, murmelte Talina wütend vor sich hin, als sie die zahlreichen Leichen überflog, die verstreut auf der weiten Ebene lagen. Ein tiefer Seufzer entrang sich ihrer Kehle.
“Sie erweisen sich heute als ziemlich zäh. Sie weigern sich hartnäckig ihre Niederlage einzugestehen, obgleich sie ihrem eigenen Tod längst ins grausige Antlitz starren. Irgendetwas ist hier faul. Ich verspüre ein banges Ziehen, das mich schon den ganzen Tag quält und sich von Stunde zu Stunde noch zu verstärken scheint“, meinte Joran, der seine Gedanken laut aussprach.
Talina sah zu ihm hoch. “Mir ergeht es gleich“, sagte sie. “Ich empfand es bereits als seltsam, dass meine Einheit, die zu Übungszwecken vorübergehend nach Tjorin versetzt wurde, mitten in der Nacht den Befehl erhielt, eine grosse Horde Lukher zu verfolgen, die sich an der Stadt vorbeizustehlen versuchte. Für solcherlei Unternehmungen waren wir eigentlich nicht ausgerüstet.“
“Das mag sein, doch wir hatten allen Grund dazu, sie nicht entkommen zu lassen. Wie du wohl weisst, hatten diese verfluchten Bastarde es tatsächlich gewagt, tief ins Hinterland Londurins einzudringen, ein ganzes Dorf niederzubrennen und das wertvolle Geschenk für den Sohn des Kaisers zu rauben, das dort angefertigt wurde. Es war daher nur folgerecht, dass eine solche Tat nicht ungesühnt bleiben und der König Truppen ausschicken würde, um sie zu verfolgen und zur Rechenschaft zu ziehen. Leider aber verlief die Hatz nicht annähernd so, wie Harkland und ich sie geplant hatten. Wir hätten die beiden Stämme schon viel eher einholen sollen. Irgendwie müssen die Lukher äusserst schnell durch die Wälder und Ebenen Wilderlands vorangekommen sein, dass wir sie erst hier, am Rande des Tannenwaldes, stellen konnten."
Talina nickte. "Ja, das ist fürwahr sonderbar. Man könnte fast denken, sie seien Tag und Nacht ohne Rast unterwegs gewesen."
"Mehr noch erscheinen mir die ganzen Umstände merkwürdig, die uns an diesen Ort geführt haben", meinte Joran auf einmal und brach das kurze Schweigen, das zwischen ihnen eingetreten war. "Woher wussten die Lukher von dem Schild und seiner Bedeutung? Ich kann mich einfach nicht damit abfinden, dass der Überfall auf Tibrin ihrem gängigen Verlangen nach Tod und Zerstörung entsprang. Es war ein geplanter Raubzug, ganz so, als hätten sie es darauf angelegt, von uns verfolgt zu werden."
Talina blickte ihren Jugendfreund fragend an. Ihre sanft geschwungenen Augenbrauen schoben sich zusammen, und ihre Lippen kräuselten sich. Feinste Fältchen durchzogen ihre Stirn. “Meinst du, sie haben uns hergelockt, um uns hier, am Saum ihres verfluchten Waldes, eine Falle zu stellen?“
“Ja, das ist meine Vermutung“, antwortete der Ritter. “Du siehst doch selbst, wie immer wieder neue Krieger aus den Schatten unter den Bäumen hervorbrechen und wie unsere Verluste stetig steigen. Aber es gibt noch etwas anderes, das mich bedrückt, etwas, das ich nicht genau zu bestimmen weiss."
"Hat deine Sorge etwas mit diesen fremden Kämpfern zu tun, welche die Lukher unterstützen?" fragte sie und richtete ihre blauen Augen auf den toten Barbarenführer.
"Ich bin mir nicht sicher", erwiderte Joran. "Diese Wilden mit ihren altertümlichen Waffen tragen bestimmt einen Teil zu meinem seltsamen Gefühl bei, doch ihre unerklärliche Anwesenheit ist nicht der einzige Grund, der mir Unbehagen bereitet. Das Verhalten der Lukher an sich erscheint mir ungewöhnlich. Ich habe bisher nirgendwo einen Kriegsfürsten ausmachen können, der sie leitet, und ohne ihn sollten sie eigentlich wie ängstliche Tiere in alle Richtungen fliehen und sich sicher nicht mit diesem Kampfeswillen gegen uns stellen.“ Er seufzte.
“Mir sind diese seltsamen Barbaren jedenfalls gar nicht geheuer. Wenn ich sie mir jetzt so anschaue, habe ich fast das Gefühl, ich hätte sie schon einmal gesehen, wenn auch nicht hier“, sagte Talina, nun auch etwas beklommen.
“So ergeht es mir ebenfalls. Nur bin ich mir nicht einmal sicher, ob ich sie überhaupt lebend zu Gesicht bekommen habe“, brummte Joran und verfiel anschliessend für einen Moment in Schweigen. “Woher mögen sie wohl kommen, und was haben sie mit den Lukhern zu schaffen? Alles erscheint mir einfach seltsam, fast beängstigend.“
Nun schwiegen beide, der Ritter und die Kriegerin, starrten vor sich in die zertrampelte, blutdurchtränkte Schneedecke. Der Wind strich kalt, aber schwach über sie hinweg, säuselte leise durchs verschneite Geäst der grossen Tannen. Es war ruhig geworden, und selbst aus der Entfernung drangen nur noch wenige Kampfgeräusche zu ihnen herüber. Die Lukher und ihre unbekannten Verbündeten waren einmal mehr geschlagen, auch wenn die sepharischen Streitkräfte diesen Sieg sehr teuer hatten bezahlen müssen.
Erst das erregte Schnauben Aldarams riss die beiden in die Gegenwart zurück. Joran beugte sich vor und klopfte ihm den gepanzerten Hals. Auch Talina trat auf den stolzen Hengst zu, der in der Kriegstracht, Rüstung und Wappentuch, einen richtig bedrohlichen Eindruck machte. Sanft streichelte sie seine Nase.
Dann, als sie die Blicke wieder hoben, sahen sie, dass ein Wolfsritter in vollem Lauf auf sie zustürmte. Das grosse Raubtier bewegte sich trotz Reiter und schwerem Gepäck schnell und sehr gewandt, denn es sank nicht so tief in den Schnee ein wie Aldaram und die anderen Pferde. Als er näher herangekommen war, erkannten Joran und Talina den Riesenwolf an seinem grauweissen zottigen Fell, das auf geheimnisvolle Art im bleichen Sonnenlicht schimmerte. Es handelte sich um Silbersturm, das erfahrene Reittier Malik Lawlers. Sie begannen sich zu fragen, was den alten Major wohl zu solcher Eile trieb, denn er spornte seinen Wolf zu Höchstleistungen an.
Unmittelbar vor den beiden jungen Offizieren hielt Malik inne, und sein faltiges, gutherziges Gesicht verriet ihnen bereits, dass er keineswegs mit erfreulichen Nachrichten aufwartete. In seinen blaugrauen Augen stand tiefes Entsetzen geschrieben.
“Joran, Talina, ich habe äusserst schlechte Kunde zu vermelden. Ihr müsst mir folgen, allen voran du, Joran. General Harkland ist etwas zugestossen.“
Kapitel 3
General Eodol Harkland sass fest in seinem golden glänzenden Sattel und sah mit grimmigem Blick auf die Leiber herab, die reglos im Schnee lagen. Sein grosses Pferd schnaubte und schüttelte stolz sein Haupt, während er sich überhaupt nicht rührte. In der rechten Hand hielt er seine Lanze, die nun gebrochen und unbrauchbar war. Mit ihr hatte er die Lukher gefällt, die jetzt tot zu seinen Füssen lagen. Den letzten dieser riesigen Kerle hatte er regelrecht aufgespiesst und seinen gewaltigen Leib mehrere Meter weit auf seiner Lanze getragen, bevor dessen Gewicht das Holz zersplittern liess.
Eine feurige Wut kochte in seinem Herzen, die noch nicht abgeklungen war. Er hatte diese sechs Lukher beinahe im Alleingang getötet und ihnen keine Schonung zukommen lassen. Wie ein erzürnter Gott hatte er gewütet, hell schimmernd in seiner goldenen Rüstung, denn sie hatten aus dem Hinterhalt einen seiner Leibwächter überfallen und ihn wie ein Tier abgeschlachtet. Aus Rache hatte er jeden Einzelnen von ihnen in die Niederhöllen geschickt, gnadenlos und ohne Mitleid. Diese Wilden haben kein besseres Schicksal verdient, sagte er sich in Gedanken.
Und nun waren sie tot, durchbohrt von seiner Lanze, oder von seinem mächtigen Pferd niedergeritten. Aber er fühlte sich keineswegs besser. Seine Leibwächter bedeuteten ihm viel, denn sie waren nicht nur Untergebene, die zu seinem Schutz abbestellt waren, sondern längst zu alten Freunden geworden, die treu und unerschütterlich an seiner Seite schon durch viele Schlachten gezogen waren. Er vertraute ihnen, mehr als allen anderen Soldaten, die ind der gewaltigen Streitmacht der Königsstadt Sepharis Dienst taten. Sie waren ihm wie Brüder, und er achtete sie höher als die Mitglieder seiner adeligen Familie.
Als die drei anderen sich um ihn sammelten, ebenfalls bekümmert und wütend über den Verlust ihres Freundes, hob der General seinen behelmten Kopf und entliess einen Seufzer. Er wollte ihnen etwas sagen, doch es fehlten ihm die passenden Worte. Er sah sie an, drei gepanzerte Ritter auf kräftigen Pferden, gebeugt in ihren Sätteln sitzend, keineswegs stolz und mächtig im Augenblick der Trauer.
Nach einer gewissen Zeit liess Harkland seine gebrochene Lanze aus der Hand gleiten und richtete sich auf. Seine Leibwächter wandten ihm ihre Blicke zu, sahen, wie er wieder zum edlen General heranwuchs, der sein langes Schwert zum Kampf aus der Scheide zog.
“Lasst uns später trauern, Freunde. Noch ist die Schlacht nicht geschlagen, noch kämpft der Feind mit allem Vermögen, stemmt sich gegen unsere Truppen. Seht, dort wehren sich zwei Soldaten verzweifelt gegen eine Übermacht dieser Unholde. Lasst uns ihnen helfen, bevor es zu spät ist. Rächen wir uns gemeinsam an den Barbaren, auch wenn ihr Tod denjenigen unseres Freundes nicht ungeschehen machen kann. Die Trauer wird uns dennoch bleiben und in unseren Herzen brennen“, sprach Harkland mit kräftiger Stimme, und den Rittern schien es, als leuchte die Sonne für einen kurzen Moment in sommerlicher Kraft auf und liesse damit die prächtige Rüstung des Generals in hellem Glanz erstrahlen. Sie überwanden ihren Kummer und folgten ihrem Anführer in den Kampf.
Gleich einem heraufziehenden Gewitter donnerten die vier Ritter auf den Waldrand zu, wohin einige brüllende Lukher sich flüchteten, die gerade eben einen Trupp Infanteristen mit ihren riesigen Keulen und Äxten erschlagen hatten. Schwertschwingend preschten sie an den beiden einzigen überlebenden Fusskämpfern vorüber und liessen ihre scharfen Klingen auf die rennenden Barbaren niedergehen. Einer nach dem anderen wurde von den Schneiden tödlich getroffen, schrie laut auf, taumelte und stürzte in den Schnee.
Die letzten drei jedoch erreichten sicher den Saum des mächtigen Tannenwaldes von Tiizla. Dort, unter den Schatten der ersten Bäume, die wie erstarrte Titanen hoch in den blassen Himmel schossen und im Windhauch düster flüsterten, blieben sie stehen und beschimpften die herannahenden Ritter in ihrer grässlichen Sprache, die sich wie das düstere Brüllen wilder Tiere anhörte.
Harkland und seine Mannen bremsten ihre Pferde vor dem Waldrand ab, da keiner auch nur einen Fuss hineinsetzen wollte. Selbst hier konnten sie bereits seine finstere und boshafte Kraft spüren, und ihre Rosse scheuten wiehernd vor dem lauernden Dunkel unter den hohen Wipfeln. Es war bedeutend klüger einige Lukher am Leben zu lassen, als sich der Bedrohung auszusetzen, die den Wald wie einen teuflischen Fluch erfüllte und schon an seinem Saum eine ungeheure Wirkung entfaltete.
Harkland blickte die brüllenden und lachenden Lukher finster an, erhob sein blutiges Schwert und schrie zurück. “Versteckt euch nur wie Hasen in eurem Wald, ihr Vasallen des Bösen! Keine Chance lassen euch die Streitkräfte Sepharis’ im ehrlichen, Khisarh gefälligen Kampf! Verschwindet aus meinem Angesicht, und lasst euch nie wieder in unserem Königreich blicken, oder ihr seid des Todes!“
Nun verstummten die Lukher, und es wurde unheimlich still. Eine grosse Frau mit grauem Haar und finsterem Gesicht, bewaffnet mit einem schweren Hammer, trat einen Schritt vor und funkelte den General aus dunklen Augen an. Dann begann sie schallend zu lachen und erhob ihre Arme. Und auf einmal tauchte hinter den drei Wildlingen eine Schar seltsamer Barbaren auf. Sie waren kleiner und schmächtiger als die riesenhaften und grobknochigen Lukher und doch von wildem und furchteinflössendem Anblick, geschmückt mit Knochen und Zähnen erlegter Tiere. Sie besassen andere Waffen, altertümliche Schwerter, Speere und Keulen, die jedoch von einer eleganteren Machart waren als die grobschlächtigen Äxte und Streitkolben der Lukher. Auch sie trugen Felle, doch waren diese zu ordentlichen Hosen, Hemden und Jacken verarbeitet, die gewisse Fertigkeiten und eine nötige Kenntnis erahnen liessen. Und manche von ihnen hatten ihre Gesichter mit blauer Farbe bemalt.
Noch bevor Harkland und seine Leibwächter bemerkten, dass auch sie in einen Hinterhalt geraten waren, stürmten die Barbaren mit tierischem Gebrüll auf die Ritter zu. Die Vordersten warfen ihre kurzen Speere auf ihre Gegner und trafen das eine Pferd mit tödlicher Sicherheit. Die Rüstung vermochte zwar die meisten der spröden Eisenspitzen abzuwehren, doch trafen manche Geschosse dennoch mit verheerenden Folgen ihr Ziel, und das schreiende Tier ging mitsamt Reiter zu Boden.
Harkland und seine beiden übrigen Wächter ritten ihrem Gefährten zu Hilfe, der unter seinem toten Pferd begraben war. Sie schlugen ihre Schwerter in kräftigen Hieben in die heranstürmende Schar, fällten die Barbaren wie junge Bäume. Und doch blieb die Übermacht der Wilden erdrückend, denn zu zahlreich waren sie.
Harkland sah inmitten des heftigen Gefechtes, wie einige Barbaren ihren Klingen entkamen, sich auf den hilflosen Ritter stürzten und diesen massakrierten. Dies liess neue Wut in ihm entflammen, und noch stürmischer schwang er sein Schwert durch die Luft und schmetterte es in die Leiber der Angreifer.
Die Wilden, welche den bereits gestürzten Ritter mit ihren Speeren erstochen hatten, sprangen tollkühn von hinten auf das Pferd des nächsten Panzerreiters, der sich zu nahe herangewagt hatte. In gnadenloser Mordlust stiessen sie ihre Dolche mehrmals durch Lücken in seinem Stahlpanzer, noch bevor er merkte, wie ihm geschah.
Um den dritten Reiter aus seinem Sattel zu holen, griffen sie sein Ross an, brachten es mit grausamen Attacken zu Fall und stürzten sich dann wie ein Rudel Wölfe auf den Sepharier, dessen verzweifelte Abwehr bald erschlaffte. Zum Schluss blieb nur noch der goldene Ritter übrig, der wie ein blutiger Orkan tobte. Vor ihm fürchteten sich die seltsamen Barbaren ein wenig, denn er war stark und mächtig.
Harkland verlor im Gemetzel allmählich die Kontrolle über seinen Geist. Er sah nur noch Wildlinge um sich, wohin er seinen Blick auch wandte. Er fühlte sich verlassen, denn seine Leibwächter waren einer nach dem anderen gefallen. Sein Zorn stieg ins Unermessliche, und allein der Gedanke an blutige Rache erfüllte seinen benebelten Verstand. Keiner dieser Hunde darf mir entkommen. Ich werde sie alle dafür büssen lassen, dass sie mir meine Brüder nahmen. Er hob und senkte sein Schwert blind in die Menge, ohne den Schmerz zu spüren, der sich in seinem erschöpften Arm ausbreitete.
Und dann, er hatte das Gefühl, schon seit vielen Jahren gegen diese Übermacht ankämpfen zu müssen, zogen sich die Barbaren unter die schützenden Arme der verschneiten Tannen zurück, wo sie verharrten und ihn beobachteten. Harkland erwachte wie aus einem Alptraum und sah sich von ungezählten Leichen umgeben. Dutzende Wilde waren ihm zum Opfer gefallen, aber auch seine drei Leibwächter lagen tot im blutdurchtränkten Schnee. Er selbst war nicht unverletzt geblieben, doch erst jetzt bemerkte er seine Wunden. Er fühlte sich alt und schwach, hatte Mühe, sich im Sattel zu halten. Die Verletzungen waren nicht schlimm, dennoch verlor er Blut, das an verschiedenen Stellen in kleinen Rinnsalen über die goldene Rüstung lief. Dieser Verlust und die Erschöpfung beschworen starke Schwindelgefühle, die ihn taumeln liessen.