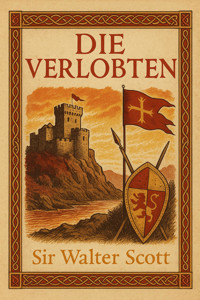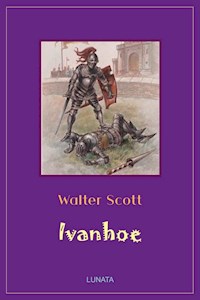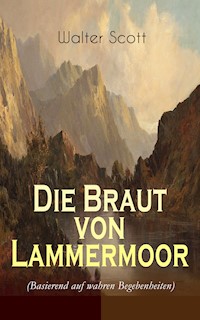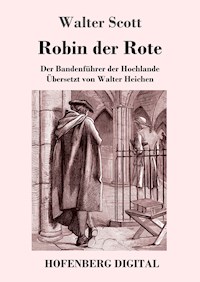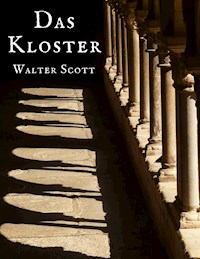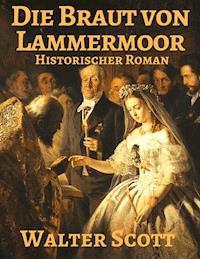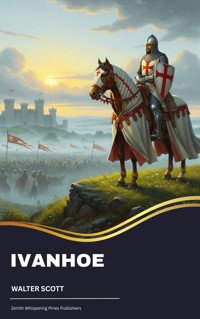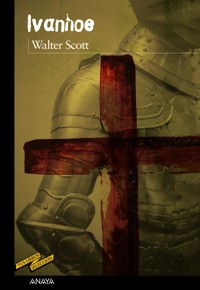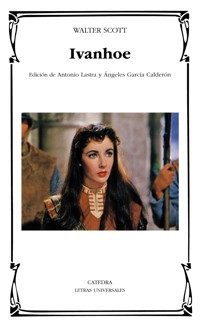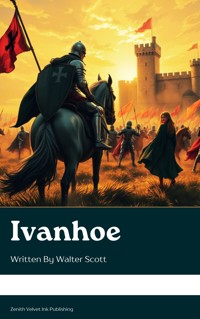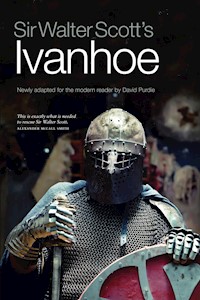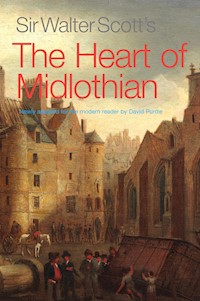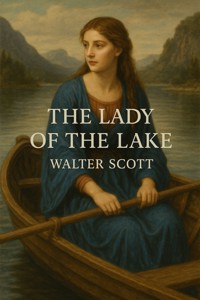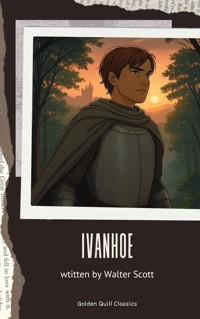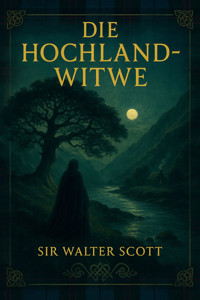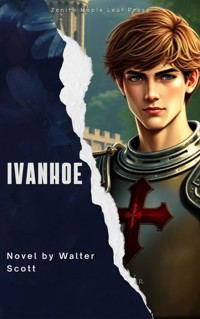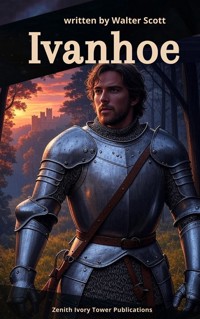Die Verlobten
Sir Walter Scott
Impressum © 2025 Michael Pick
Alle Rechte vorbehaltenDie in diesem Buch dargestellten Figuren und Ereignisse sind fiktiv. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder toten realen Personen ist zufällig und nicht vom Autor beabsichtigt.Kein Teil dieses Buches darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Herausgebers reproduziert oder in einem Abrufsystem gespeichert oder in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise elektronisch, mechanisch, fotokopiert, aufgezeichnet oder auf andere Weise übertragen werden.CopyrightMichael PickImkenrade 15g23898
[email protected]Die Verlobten
Sir Walter Scott
Übersetzung Michael Pick
Kapitel 1
In diesen Tagen flogen heiße Kriege über den Marches von Wales
Lewis History
Die Chroniken, aus denen diese Erzählung entnommen ist, versichert uns, dass während der langen Zeit, in der die walisischen Prinzen ihre Unabhängigkeit behaupteten, sich das Jahr 1187 besonders auszeichnete. Es herrschte Frieden zwischen ihnen und ihren kriegerischen Nachbarn, den Marcher Lords, die diese gewaltigen Burgen an den Grenzen der alten Briten bewohnten, auf deren Ruinen die Reisenden heute bewundernd starren. Dies war die Zeit, als Baldwin, Erzbischof von Canterbury, begleitet von dem erfahrenen Giraldus de Barri, dem späteren Bischof von Sankt David, von Burg zu Burg, von Stadt zu Stadt den Kreuzzug predigte, und die meisten Täler seiner Heimat Cambria mit dem Ruf zu Waffen für die Wiedererlangung der Heiligen Grabstätte widerhallten. Während er die Fehden und Kriege der Christen gegeneinander missbilligte, zog ein Zeitgeist von Ehrgeiz und Abenteuer ein, der die Gunst des Himmels ebenso wie weltlichen Ruhm als Lohn für den Erfolg versprach. Bisher besaßen die britischen Häuptlinge vielleicht die beste Entschuldigung, um den Ruf der Kreuzzüge abzulehnen. Das anglonormannische Geschick der Ritter, die ständig über die walisische Grenze drangen und die Eroberungen mit Burgen sicherten und verstärkten, wurde durch das heftige Eindringen der Briten gerächt, die, wie die Flut, mit Lärm, Wut und Verwüstung auf die Normannen rollte. Doch wurden sie regelmäßig zurückgeschlagen und mussten bei jedem Rückzug mehr von ihrem Boden preisgeben.
Eine Union zwischen den einheimischen Prinzen hätte eine starke Barriere gegen das Vordringen der Fremden bewirken können. Doch unglücklicherweise waren sie untereinander ebenso uneins wie mit den Normannen und lagen dauernd im Kleinkrieg miteinander, sehr zum Vorteil ihres gemeinsamen Feindes.Die Einladung zum Kreuzzug versprach etwas Neues für eine Nation, die eigentümlich leidenschaftlich in ihrem Temperament war. Viele schlossen sich dem Zug an, ungeachtet der Folgen, die dem Land drohten, wenn es schutzlos zurückgelassen wurde. Auch die meisten Feinde der Sachsen und Normannen legten ihre Feindschaft beiseite, um sich unter dem Banner der Kreuzzüge einzutragen.
Unter diesen befand sich Gwenwyn (oder richtiger: Gwenwynwen, obgleich wir die kürzere Bezeichnung beibehalten), ein britischer Prinz, der eine unsichere Oberherrschaft über solche Teile von Powysland ausübte, die nicht von den Mortimers, Guarines, Latimers, FitzAlans und anderen normannischen Edlen unterworfen waren. Diese hatten unter verschiedenen Vorwänden, bisweilen schon durch die bloße Schau ihrer überlegenen Macht, große Teile des einst unabhängigen Fürstentums an sich gebracht, welches, nach dem Tod von Roderick Mawr unglücklicherweise in drei Teile getrennt wurde und dem Gebiet seines jüngsten Sohnes Mervyn zufiel. Die unerschrockene Entschlossenheit und die hartnäckige Wildheit Gwenwyns, der von diesem Prinzen abstammte, machten ihn beliebt unter den „Hochmännern“ oder Meistern von Wales. Es gelang ihm, weniger kraft der natürlichen Stärke seines verfallenen Fürstentums als durch die Zahl der unter seinem Ruf versammelten Männer, das Vordringen der Engländer durch Einfälle in ihre Gebiete zurückzuschlagen.
Dennoch schien selbst Gwenwyn seine tiefe Abscheu gegen seine gefährlichen Nachbarn zu vergessen. Die „Fackel von Pengwern“ (so wurde Gwenwyn gerufen, da er die Provinz von Shrewsbury häufig in Brand steckte) schien nur noch wie eine dünne Kerze in der Hand einer Dame zu brennen; und der „Wolf von Plinlimmon“, ein anderer Name, mit dem die Barden Gwenwyn bezeichneten, schlief so friedlich wie des Schäfers Hund im Haus.
Doch es war nicht allein die Beredsamkeit von Baldwin oder von Giraldus, die den ruhelosen und wilden Geist besänftigte. Zwar hatte ihre Aufforderung mehr bewirkt, als Gwenwyns Anhänger für möglich gehalten hatten. Der Erzbischof hatte den britischen Häuptling dazu gebracht, „das Brot zu brechen“ und sich auf waldiger Jagd mit seinem nächsten und bisher entschiedensten Feind, dem alten normannischen Krieger Sir Raymond Berenger, zu treffen. Dieser Krieger hatte, bald besiegt, bald siegreich, doch niemals unterworfen, seine Burg Garde Doloureuse in den Marches von Wales trotz Gwenwyns heißester Angriffe behauptet. Es war ein Platz, von Natur stark und gut befestigt, den der walisische Prinz bisher weder durch offene Macht noch durch List zu erobern vermochte. Die Burg lag mit einer starken Besatzung in seinem Rücken und machte jeden Rückzug gefährlich. Gwenwyn von Powys hatte hundertmal den Tod Raymond Berengers und die Zerstörung seiner Burg geschworen. Aber die Politik des weisen, alten Kriegers und seine lange Erfahrung in allen kriegerischen Praktiken, mit Hilfe seiner mächtigeren Landsleute, ermöglichten ihm, den Versuchen seines feurigen Nachbarn zu widerstehen. Wenn es in ganz England einen Mann gab, den Gwenwyn am meisten hasste, so war es Raymond Berenger. Dennoch hatte der gute Erzbischof Baldwin den walisischen Prinzen überredet, Berenger wie einen Freund zu treffen und sich mit ihm für die Sache des Kreuzes zu verbünden. Er lud Raymond zu den Herbstfestlichkeiten in seinen walisischen Palast, wo der alte Ritter in aller ehrenvollen Höflichkeit mehr als eine Woche verweilte.
Um diese Gastfreundschaft zu vergelten, lud Raymond den Prinzen von Powys ein, mit einem auserwählten, doch kleinen Gefolge während der folgenden Weihnacht nach Garde Doloureuse zu kommen. Einige Altertumsforscher haben versucht, diese Burg mit dem Castle of Colune, am Fluss des gleichen Namens, zu identifizieren. Doch die Zeit und einige geographische Schwierigkeiten werfen Zweifel auf diese geniale Vermutung.
Als der Waliser die Zugbrücke überquerte, bemerkte sein treuer Barde ein unwillkürliches Schaudern. Cadwallon kannte den Charakter seines Meisters gut und zweifelte nicht, dass dieses Gefühl vom Wunsch herrührte, die starke Festung endlich zu ergreifen, die schon so lange Gegenstand seines Ehrgeizes gewesen war. Er fürchtete, der Kampf des Gewissens seines Herrn mit seinem Ehrgeiz möchte nicht zum Nachteil seines Ruhms enden. Daher flüsterte der Barde ihm in ihrer heimischen Sprache zu, dass „der Zahn härter beißt, wenn man nicht sichtbar ist“. Gwenwyn sah um sich, wurde sich bewusst, dass, obgleich nur unbewaffnete Knappen und Pagen im Hof erschienen, dennoch die Türme und Zinnen mit Bogenschützen und bewaffneten Männern besetzt waren.
Sie schritten zum Bankett, bei dem Gwenwyn zum ersten Mal Eveline Berenger erblickte, das einzige Kind des normannischen Burgherren, die Erbin seiner Ländereien und seines vermuteten Reichtums. Sie war soeben sechzehn Jahre alt geworden und das schönste junge Mädchen in den walisischen Marches. Viele Speere hatten bereits vor ihrem Charme gezittert, und der ritterliche Hugo de Lacy, Constable von Chester, einer der ehrfurchtsgebietenden Krieger seiner Zeit, hatte zu Evelines Füßen den Preis niedergelegt, den seine Tapferkeit in einem großen Turnier nahe dieser alten Stadt erworben hatte. Gwenwyn nahm diesen Triumph als eine weitere Empfehlung für Eveline. Ihre Schönheit war unbestreitbar. Sie war Erbin der Festung, deren Besitz er sich so sehr wünschte.
Doch der Hass, der zwischen den Briten und ihren sächsischen und normannischen Eindringlingen herrschte; seine lange und zerstörerische Fehde mit Raymond Berenger; eine allgemeine Erinnerung, dass Verbindungen zwischen Walisern und Engländern selten glücklich waren; und das Bewusstsein, dass die Maßnahme, über die er nachdachte, unter seinen Anhängern sehr unbeliebt wäre und als Verrat der Prinzipien, nach denen er bisher gehandelt hatte, gewertet würde, hielt ihn davon ab, seinen Wunsch offen an Raymond oder seine Tochter heranzutragen. An Zurückweisung dachte er keinen Augenblick. Er war überzeugt, er brauche nur seinen Wunsch zu äußern, und dass die Tochter eines normannischen Burgherrn, dessen Rang und Macht nicht zu den höchsten unter den Edlen der Grenze zählten, erfreut und geehrt sein müsse durch einen Vorschlag, sich mit seiner Familie und damit mit dem Herrn über hundert Berge zu verbinden.
Es gab tatsächlich noch einen anderen Einwand, der in späterer Zeit von beträchtlichem Gewicht sein sollte – Gwenwyn war bereits verheiratet. Doch Brengwain war eine kinderlose Gemahlin. Da Souveräne (und unter Souveränen betrachtete sich der walisische Prinz selbst) der Nachfolge wegen heiraten, und der Papst sich nicht allzu gewissenhaft zeigte, wenn es um einen Gefallen für einen Prinzen ging, der das Kreuz bereitwillig ergriffen hatte, mögen seine Gedanken auch mehr bei Garde Doloureuse als in Jerusalem geweilt haben. In der Zwischenzeit, sollte Raymond Berenger nicht frei genug in seinen Ansichten sein, Eveline den vorläufigen Rang einer Konkubine zuzugestehen – die Zwischenlösung, die Gwenwyn anzubieten gedachte –, musste er nur einige Monate warten und durch den Bischof von Saint Davids beim Hof von Rom Klage auf Scheidung erheben. Von diesen Gedanken aufgewühlt, verlängerte Gwenwyn seinen Aufenthalt in der Burg Berengers von Weihnachten bis zum Zwölften Tag. Er ertrug die Anwesenheit der normannischen Kavaliere in Raymonds festlichen Hallen, obgleich sie, selbst von niederem Rang, die lange Abstammung des walisischen Prinzen kaum gebührend berücksichtigten. In ihren Augen war er nur das Oberhaupt einer halbbarbarischen Provinz; während er sie als nicht besser als eine Art privilegierte Räuber erachtete. Er musste sich sehr beherrschen, sie nicht mit offenem Abscheu zu betrachten, wenn er sie in den Übungen der Ritterlichkeit beobachtete. Schließlich endete das Fest, und Ritter und Knappen verließen die Burg, die dann wieder zu einem einsamen Grenzfort wurde.
Aber der Prinz von Powysland fand auch auf der Jagd in seinen eigenen Bergen und Tälern nicht die Fülle des Vergnügens, die ihm durch die Befreiung von der Gesellschaft der normannischen Ritterschaft bereitet wurde, solange auch die schöne Gestalt Evelines von dem Gefolge seiner Jagdgesellschaft ausgeschlossen war.
Er zögerte nicht länger und vertraute sich seinem Kaplan an, einem fähigen und klugen Mann, der sich durch das Vertrauen seines Patrons geehrt fühlte. Er sah in dem vorgeschlagenen Plan einige Vorteile für sich selbst und auch für seinen Orden. Durch seinen Rat wurde Gwenwyn von Brengwain geschieden, und die unglückliche Brengwain wurde in ein Nonnenkloster gebracht, in dem sie möglicherweise eine heitere Unterkunft fand als in der einsamen Zurückgezogenheit, zu der sie ein vernachlässigtes Leben geführt hatte. Vater Einion verhandelte mit den Häuptlingen und Ältesten des Landes und stellte ihnen die Vorzüge dar, die sie durch den Besitz von Garde Doloureuse in künftigen Kriegen gewinnen würden. Die Burg hatte mehr als ein Jahrhundert ihr Vordringen erschwert und ihren Rückzug gefährlich gemacht; kurz, sie sperrte ihre Überfälle bis zu den Toren von Shrewsbury. Was die Vereinigung mit dem sächsischen jungen Mädchen betraf, so gab der gute Vater zu verstehen, dass die Fesseln dieser Verbindung nicht fester sein würden als jene der Vorgängerin Brengwain.
Diese Argumente, verbunden mit anderen Ansichten und Wünschen der verschiedenen Edlen, waren so überzeugend, dass der Kaplan im Verlauf einiger Wochen seinem fürstlichen Patron berichten konnte, dass die Heirat von den Ältesten und Edlen seines Herrschaftsreiches gebilligt wurde. Ein goldenes Armband, sechs Unzen schwer, war die unmittelbare Belohnung für des Geistlichen Geschick in den Verhandlungen, und er wurde von Gwenwyn beauftragt, ein Schreiben seines Antrags zu fertigen. Er zweifelte nicht daran, dass sein Plan die Burg Garde Doloureuse, ungeachtet ihres melancholischen Namens, in einen Ausbruch der Freude verwandeln würde.
Der Kaplan entschied, nach anfänglichem Zögern seines Patrons, in den Brief nichts über den vorläufigen Plan der Konkubinatlösung zu schreiben. Dies, so urteilte er weise, würde als Beleidigung für Eveline und ihren Vater gelten. Die Angelegenheit der Scheidung stellte er als beinahe vollzogen dar und beendete den Brief mit verschiedenen moralischen Anspielungen auf Vashti, Esther und Ahasver.
Nachdem er diesen Brief durch einen schnellen und vertrauten Boten versandt hatte, eröffnete der britische Prinz in aller Feierlichkeit das Ostermahl.
Um seine Männer und Vasallen günstig zu stimmen, lud er sie in großer Zahl ein, an der fürstlichen Festivität zu Castell-Coch, der Roten Burg, wie es damals genannt wurde, teilzunehmen – seitdem besser bekannt als Powis Castle und in jüngerer Zeit als fürstlicher Sitz des Duke of Beaufort. Die architektonische Schönheit dieses Adelssitzes ist von einer späteren Periode als die von Gwenwyn, dessen Palast zu jener Zeit ein niedriges, langbedachtes Gebäude aus roten Steinen war, wovon die Burg ihren Namen hatte, während ein Graben und Palisaden ihre wichtigste Verteidigung waren.
Kapitel 2
In Madoc`s Zelt der Fanfaren Klang,
Mit schnellen Klirren hastig fern;
Jeder Hügel und Tal die Note begrenzt,
Wann kehren die Söhne des Krieges zurück?
Du, geboren aus strenger Not,
Stumpfer Frieden! Das Tal beugt sich euch,
Unter deinem melancholischen Einfluss.
Walisisches Gedicht
Die Festgelage der alten britischen Prinzen pflegten üblicherweise all die raue Pracht und den freizügigen Genuss ihrer Gastfreundschaft zu entfalten. Gwenwyn war bei diesem Anlass zudem begierig, sich Beliebtheit durch einen ungewöhnlichen Beweis der Fülle zu erwerben. Er fühlte, dass der Bund, über den er nachdachte, zwar toleriert, aber nicht die volle Unterstützung seiner Untertanen und Anhänger fand.
Der folgende Vorfall, unbedeutend an sich, bestätigte seine Befürchtungen. Eines Abends, als es beinahe dunkel geworden war, hörte er durch das offene Fenster des Wachraumes, der gewöhnlich von einigen der besten Soldaten besetzt war, die sich in der Bewachung des Palastes ablösten, Morgan, einen Mann, ausgezeichnet durch seine Kraft, Mut und Wildheit. Morgan sagte zu einem Kameraden, mit dem er am Wachfeuer saß: „Gwenwyn ist zu einem Geistlichen oder einer Frau geworden! Wann hat je ein Anhänger von ihm das Fleisch vom Knochen abnagen müssen, wie ich heute?“
„Warte noch eine Weile“, antwortete sein Kamerad, „bis die normannische Heirat vollendet ist. Dann wird die Beute von den sächsischen Kerlen, die wir haben werden, so gering sein, dass wir froh sein werden, wenn wir Knochen zum Abnagen haben.“
Gwenwyn hörte nichts weiter von ihrer Unterhaltung. Aber dies war genug, um seinen Stolz als Soldat und seine Eifersucht als Prinz zu wecken. Er war klug genug zu wissen, dass die Leute, über die er herrschte, wechselhaft in ihrem Wesen waren, voller Hass gegen ihre Nachbarn und allzu ungeduldig für eine lange Ruhezeit. Beinahe fürchtete er die Folgen der Untätigkeit, die ein langer Waffenstillstand zwangsläufig nach sich zog. Dennoch war der Plan gefasst. Gwenwyn nahm an, dass er durch außergewöhnliche Pracht und Freizügigkeit den besten Weg beschritte, um die wankende Zuneigung seiner Untertanen zu festigen.
Ein Normanne hätte die barbarische Pracht seines Festes verachtet. Es bestand aus gebratenen Schafen, Ziegen- und Hirschfleisch, in den Häuten der Tiere selbst gekocht. Da die Normannen eher die Güte als die Menge ihrer Nahrung schätzten, machten sie sich über den derben Geschmack der Briten lustig, obwohl letztere mäßiger waren als die Sachsen. Auch die Ströme von Cwrw (Bier), die sich über die Gäste wie eine Sintflut ergossen, vermochten den Mangel an eleganteren und teuren Getränken, die man im Süden Europas kennen gelernt hatte, nicht zu ersetzen. Milch, auf verschiedene Weise zubereitet, war ein anderer Bestandteil eines britischen Festes, der ihre Zustimmung nicht finden konnte, obgleich sie eine Nahrung war, die bei gewöhnlichen Anlässen die alten Einwohner oft nährte – ein Land reich an Herden, aber arm an landwirtschaftlichen Erzeugnissen.
Das Bankett wurde in einer langen, niedrigen Halle ausgerichtet. Die Halle war aus grobem Holz gebaut, mit Schindeln gedeckt.
Die Miene und Erscheinung der versammelten Gesellschaft waren wild und beinahe furchterregend. Der Prinz selbst war von gigantischer Gestalt und flammenden Augen, geeignet, um einen widerspenstigen Menschen zu beeindrucken. Seine Freude war das Schlachtfeld. Die langen Schnurrbärte, die er und die meisten seiner Meister trugen, vergrößerten das barbarische Aussehen. Wie die meisten war Gwenwyn in einen einfachen Waffenrock aus weißem Leinen gekleidet, einem Überbleibsel der Kleidung, die die Römer in der Provinz Britannien eingeführt hatten. Er unterschied sich durch den Eudorchawg, eine Kette mit gewundenen Goldgliedern, mit der die keltischen Stämme ihre Häuptlinge schmückten. Die Kette stellte in ihrer Form die Verbundenheit der Kinder mit dem Land dar. Sie wurde auch Häuptlingen niederer Stände verliehen. Viele trugen sie von Geburt an oder hatten sie durch militärische Leistungen erworben. Ein goldener Reif, auf dem Haupt getragen, mischte sich mit Gwenwyns Haar – zumal er überdies den Rang eines dreifachen Prinzen von Wales beanspruchte. Seine Armringe und Fußketten aus dem gleichen Material zeichneten den Prinzen von Powys als einen unabhängigen Herrscher aus.
Zwei Männer von seiner Familie widmeten ihre ganze Aufmerksamkeit seinem Wohlbefinden. Sie standen hinter dem Prinzen. Zu seinen Füßen saß ein Page, dessen Pflicht es war, sie warm zu halten, indem er die Füße des Herrn in seinen Mantel hüllte. Dasselbe Souveränitätsrecht, das Gwenwyn zum Tragen einer goldenen Krone berechtigte, verlieh ihm auch das Recht auf einen Fußträger, der zu seinen Füßen lag und dessen Pflicht es war, des Prinzen Füße in seinem Schoß oder an seiner Brust zu wärmen.
Ungeachtet der kriegerischen Laune der Gäste und der Gefahr, die in ihren Fehden lag, trugen nur wenige der Teilnehmer des Festgelages Rüstung; ein Schild aus Ziegenleder hing hinter jedem Mannes Sitz. Auf der anderen Seite waren sie mit Angriffswaffen gut ausgestattet. Das breite, scharfe, kurze, zweischneidige Schwert war ein weiteres Vermächtnis der Römer; meist zusätzlich ein Jagdmesser oder Dolch, außerdem Speere, Wurfspieße, Bögen und Pfeile, Piken, dänische Äxte und walisische Haken. Sollte das Blut während des Banketts ins Kochen geraten, fehlte es an Waffen nicht, um die Gemüter abzukühlen. Doch obwohl die Art des Festmahls grob und derb war und die Feiernden die strengen Regeln der Ritterlichkeit nicht kannten, war das Osterbankett Gwenwyns eine Quelle des größten Vergnügens, in einem weit höheren Maße, als es der stolze Normanne kannte. Zwölf Barden waren zugegen. Zwar hatten die Normannen ihre Sänger, Männer, die zu Dichtern und Musikern ausgebildet wurden. Aber obwohl diese Künste sehr geehrt wurden und die einzelnen Künstler ein hohes Ansehen genossen, reichlich entlohnt und mit Auszeichnung behandelt wurden, blieb der Stand der Minnesänger als solcher in geringer Achtung. Dieser setzte sich meist aus wertlosen Vagabunden zusammen, die die Kunst ergriffen, um ehrlicher Arbeit zu entfliehen und ein unstetes Leben anzunehmen. Zuweilen jedoch ragten einige durch individuelle Vorzüglichkeit hervor und wurden in den sozialen Kreis aufgenommen. Anders war es mit den Barden von Wales. Sie folgten der Würde der Druiden, unter denen sie ursprünglich eine untergeordnete Zunft gebildet hatten. Sie besaßen viele Freiheiten, wurden in höchster Ehrfurcht und Wertschätzung gehalten und genossen großen Einfluss bei ihren Landsleuten. Ihre Macht über den öffentlichen Geist rivalisierte mit der der Priester, denen sie tatsächlich ähnlich waren. Sie trugen niemals Waffen, wurden durch mystische Feierlichkeiten in ihren Stand eingeführt und erhielten große Huldigung. Mit dieser Macht und Entschlossenheit nahmen die Barden ihre Privilegien wahr.
Dies war vielleicht der Fall mit Cadwallon, dem Hauptbarden Gwenwyns. Er ergoss üblicherweise eine Flut von Liedern in die Banketthalle seines Prinzen. Doch weder die bange, atemlose Erwartung der versammelten Häuptlinge und Herren – noch die tödliche Stille, die die Halle füllte, als seine Harfe ehrfürchtig von seinem Helfer vor ihn gestellt wurde – noch die Befehle oder Bitten des Prinzen selbst konnten Cadwallon mehr als ein kurzes, unterbrochenes Vorspiel entlocken. Die knappen Noten gingen wie von selbst in eine traurige Melodie über und erstarben nach kurzer Zeit vollkommen. Des Prinzen Stirn runzelte sich finster über den Barden, der selbst tief in trübsinnigen Gedanken verloren schien und weder Bedauern äußerte noch das Missfallen seines Herrn zu bemerken schien. Erneut berührte er eine wilde Note und hob den Kopf, als wollte er ein Lied beginnen, mit dem er wie üblich seine Hörer zu bezaubern pflegte. Doch der Versuch war vergeblich – er erklärte, dass seine rechte Hand kraftlos sei, und schob das Instrument von sich.
Ein Murmeln ging durch die Gesellschaft, und Gwenwyn las an ihren Mienen, dass sie die ungewöhnliche Stille Cadwallons bei diesem Anlass als böses Omen betrachteten. Er rief hastig einen jungen und ehrgeizigen Barden, namens Caradoc von Menwygent, dessen Ruhm wahrscheinlich allzu früh mit dem jenen Cadwallons wetteiferte, und ließ ihn singen, was den Applaus seines Souveräns und die Dankbarkeit der Gesellschaft hervorrief. Der junge Mann war ehrgeizig und verstand die Künste des Höflings. Er begann ein Gedicht, in welchem – obgleich unter einem vorgetäuschten Namen – er ein poetisches Bild von Eveline Berenger entwarf, das Gwenwyn verzückte. Während alle, die das schöne Original gesehen hatten, die Ähnlichkeit erkannten, glänzte in den Augen des Prinzen die Leidenschaft für die Dargestellte und seine Bewunderung für den Dichter. Die Figuren der keltischen Gedichte, gewöhnlich äußerst einfallsreich, reichten kaum aus für die Leidenschaft des ehrgeizigen Barden. Er sang ein Lob auf den Prinzen, durchwirkt mit jenem auf die normannische Schönheit. „Wie nur ein Löwe“, sagte der Dichter, „durch die Hand eines unschuldigen und wunderschönen Mädchens geführt werden kann, so kann ein Häuptling nur durch die Tugendhafteste, Lieblichste ihres Geschlechts im ganzen Reich gebunden werden. Wer fragt die Mittagssonne, in welcher Region der Welt sie geboren wurde? Wer wird bei ihren Reizen fragen, in welchem Land sie das Licht erblickte?“
Mit ihrer Begeisterung für Krieg sowie der Fantasie, die dem Ruf des Poeten willig folgt, waren die walisischen Häuptlinge und Führer in Beifallsrufen und Applaus vereint. Das Lied des Barden versöhnte sie mit der beabsichtigten Vereinigung des Prinzen. Gwenwyn selbst, in einer Regung der Freude, nahm eines seiner goldenen Armbänder, um es dem Barden zu schenken, dessen Lied einen so wünschenswerten Erfolg hervorgerufen hatte.
Er sagte, indem er zu dem stillen und verdrossenen Cadwallon blickte: „Die stumme Harfe wird niemals mit goldenen Saiten bezogen.“
„Prinz“, antwortete der Barde, dessen Stolz dem Gwenwyns mindestens ebenbürtig war, „ihr verdreht das Sprichwort Taliessins – es ist die schmeichelnde Harfe, die niemals Mangel an goldenen Saiten haben wird.“ Gwenwyn, sich streng zu ihm wendend, war im Begriff, eine zornige Antwort zu geben, als das plötzliche Erscheinen von Jorworth, dem Boten, den er zu Raymond Berenger gesandt hatte, seine Absicht verhinderte. Der rohe Gesandte trat in die Halle, barfuß bis auf die Sandalen aus Ziegenfell, einen Umhang aus demselben Fell über der Schulter und einen kurzen Speer in der Hand. Der Staub auf seinen Kleidern und die gerötete Stirn zeigten, mit welchem hastigen Eifer er seinen Auftrag erfüllt hatte. Gwenwyn fragte ihn begierig: „Welche Neuigkeiten von Garde Doloureuse, Jorworth ap Jevan?“
„Ich trage sie in meiner Brust“, sagte der Sohn Jevans; und mit großer Ehrfurcht überreichte er dem Prinzen ein Paket, mit Seide gebunden und gesiegelt mit dem Swanenwappen, dem alten Zeichen des Hauses Berenger. Da Gwenwyn selbst weder schreiben noch lesen konnte, brachte er in sehnsuchtsvoller Hast den Brief zu Cadwallon, der gewöhnlich als Sekretär diente, wenn der Kaplan abwesend war, wie es jetzt der Fall war. Cadwallon, einen Blick auf den Brief werfend, sagte kurz: „Ich lese kein Latein. Übel beraten der Normanne, der einen Prinzen von Powys in einer anderen Sprache anschreibt als der von Britannien! Und glücklich war die Stunde, da die edle Zunge allein von Tintagel bis Cairleoil gesprochen wurde!“ Gwenwyn antwortete ihm nur mit einem zornigen Blick. „Wo ist Vater Einion?“, sagte der ungeduldige Prinz. „Er dient in der Kirche“, antwortete einer seiner Begleiter, „denn es ist das Fest des Heiligen …“
„Wäre es das Fest des heiligen David“, sagte Gwenwyn, „und hielte er die Pyxis in den Händen, so muss er dennoch sofort zu mir kommen!“ Einer der Haupthandlanger sprang auf, um seine Anwesenheit zu befehlen, und in der Zwischenzeit starrte Gwenwyn auf den Brief, der das Geheimnis seines Schicksals barg, den jedoch ein Dolmetscher lesen musste, und das mit solcher Ungeduld, dass Caradoc, beflügelt von seinem früheren Erfolg, einige Töne anschlug, um, wenn möglich, die Stimmung seines Patrons währenddessen zu zerstreuen. Ein leichtes, lebhaftes Vorspiel, zögernd angeschlagen, wie die demütige Stimme eines Schwächeren, der fürchtet, die Gedanken seines Herrn zu unterbrechen, leitete eine oder zwei Strophen ein, die dem Anlass entsprachen.
„Und obgleich du, o Schriftrolle“, sagte er, auf den Brief weisend, der auf dem Tisch vor seinem Meister lag, „in der Zunge der Fremden sprichst – hat nicht der Kuckuck einen herben Ton, und kündet uns doch von grünen Knospen und aufgehenden Blumen? Und wenn deine Sprache die des enteigneten Priesters ist – ist es nicht dennoch dieselbe, die Herzen und Hände vor dem Altar bindet? Und selbst wenn du zögerst, deine Schätze zu enthüllen – ist nicht alle Freude süßer, wenn sie durch Erwartung gesteigert wird? Was wäre die Jagd, fiele der Hirsch in dem Augenblick zu unseren Füßen, da er aus der Deckung bricht – oder was wäre ein Mädchen in der Liebe wert, das nachgibt ohne sprödes Zögern?“
Das Lied des Barden wurde jäh unterbrochen durch den Eintritt des Priesters, der, eilig dem Ruf seines ungeduldigen Meisters gehorchend, nicht gezögert hatte, die Stola beiseitezulegen, die er im heiligen Dienst getragen hatte; und viele der Älteren hielten es für kein gutes Zeichen, dass ein Priester so gewohnheitsmäßig in einer festlichen Versammlung und mitten unter weltlichen Sängern erschien. Der Priester öffnete den Brief des normannischen Barons und, von Überraschung zu stiller Zufriedenheit getroffen, hob seine Augen.
„Lies!“ rief der wilde Gwenwyn.
„So bitt’ ich Euch“, antwortete der umsichtigere Kaplan, „eine kleinere Gesellschaft wäre ein geeigneteres Publikum.“
„Lies laut!“ wiederholte der Prinz in noch höherem Ton; „hier sitzt keiner, der die Ehre seines Fürsten nicht achtet oder seines Vertrauens nicht würdig ist. Lies, sage ich, laut! Und beim heiligen David, wenn Raymond der Normanne es gewagt hat …“ Er verstummte und lehnte sich auf seinen Sitz zurück, um eine Haltung der Aufmerksamkeit einzunehmen; doch es war seinen Anhängern leicht, den Rest seines Ausrufs zu ergänzen, den die Umsicht ihm verwehrt hatte, auszusprechen. Die Stimme des Kaplans war leise und unsicher, als er die folgende Epistel verlas:—
„Raymond Berenger, edler normannischer Ritter, Seneschall von Garde Doloureuse, an Gwenwyn, Prinzen von Powys (Friede sei zwischen uns!), entbietet Gesundheit.
Euer Schreiben, in dem ihr um die Hand unserer Tochter Eveline Berenger werbt, ist durch euren Diener Jorworth ap Jevan wohlbehalten zu uns gelangt, und wir danken euch herzlich für die darin ausgesprochene gute Meinung über uns und die Unseren. Doch haben wir, in uns erwogen, die Unterschiede von Blut und Abstammung, samt den Hindernissen und Anstößen, die sich in ähnlichen Fällen häufig erhoben haben. Daher halten wir es für angemessener, unsere Tochter unter den Unsrigen zu verheiraten—und dies keineswegs aus Geringschätzung gegen euch, sondern allein um eures, unseres und unserer gemeinsamen Anhänger Wohls willen, die so am sichersten vor Streit zwischen uns bewahrt werden, als wenn wir das Band unserer Vertrautheit fester zögen, als es zuträglich wäre. Die Schafe und Ziegen weiden friedlich auf denselben Triften, doch sie mischen nicht Blut noch Rasse miteinander.
Überdies ist unsere Tochter Eveline bereits von einem edlen und mächtigen Herrn der Marches, Hugo de Lacy, dem Constable von Chester, umworben; diesem ehrenvollen Antrag haben wir eine günstige Antwort erteilt. Es ist daher unmöglich, euch in dieser Sache den erbetenen Segen zu gewähren. Gleichwohl werdet ihr uns jederzeit in anderen Angelegenheiten willfährig finden. Hierzu rufen wir Gott, Unsere Liebe Frau und die heilige Maria Magdalena von Quatford zu Zeugen an; ihrer Hut empfehlen wir uns von Herzen.“
„Geschrieben nach unserem Befehl auf unserer Burg Garde Doloureuse in den walisischen Marches durch den Priester Vater Aldrovand, einen schwarzen Mönch aus dem Hause Wenlock; dem haben wir unser Siegel beigefügt am Vorabend des seligen Märtyrers heiligen Alphegius, zu dessen Ehre und Ruhm.“
Die Stimme Vater Einions stockte, und die Schriftrolle zitterte in seiner Hand, als er zum Schluss dieses Briefes gelangte; denn er kannte nur zu gut, dass Beleidigungen, geringer als jene, die Gwenwyn in jedem einzelnen Wort erkannte, hinreichten, jeden Tropfen seines britischen Blutes in den heftigsten Tumult zu versetzen. Und doch blieb dies nicht aus. Der Prinz richtete sich langsam aus der Haltung gesammelter Ruhe auf, in der er die Epistel hatte vernehmen wollen; und als sie endete, sprang er empor wie ein aufschießender Löwe und stieß den Fußträger, der sich ihm erhob, zur Seite, sodass dieser einige Schritte weit in die Halle rollte. „Priester“, sagte er, „hast du die verfluchte Schriftrolle vollständig gelesen? Denn wenn du ein Wort hinzugefügt oder fortgenommen hast, sollen deine Augen so zugerichtet werden, dass du nie wieder liest!“
Der Mönch antwortete, zitternd (da er wohl wusste, dass der heilige Stand unter den reizbaren Walisern nicht durchweg geachtet wurde): „Bei dem Schwur meines Ordens, mächtiger Prinz, ich habe Wort für Wort, Blatt für Blatt gelesen.“
Es trat eine kurze Pause ein, während Gwenwyns Zorn über diese unerwartete Beleidigung, ihm in Gegenwart all seiner Uchelwyr (adeliger Häuptlinge, wörtlich: Männer von hoher Gestalt) angetan, zu groß schien für jedes Wort—da unterbrachen einige Töne der bisher stummen Harfe Cadwallons die Stille. Der Prinz blickte zunächst unwillig auf die Störung, da er selbst zu reden gedachte; doch als er den Barden, über seine Harfe gebeugt, mit einer Miene der Eingebung sah und hörte, wie er mit unvergleichlichem Geschick die wildesten und erhabensten Klänge seiner Kunst mischte, wurde er selbst zum Hörer statt zum Sprecher. Cadwallon, nicht der Prinz, schien nun der Mittelpunkt der Versammlung, auf den alle Augen gerichtet und dem alle Ohren mit atemloser Spannung zugewandt waren, als harrten sie der Antwort eines Orakels.
„Wir heiraten nicht mit den Fremden“, so brach das Lied von den Lippen des Poeten. „Einst heirateten wir Fremde; da kamen sie nach Britannien—und ein Schwert über unsere Edlen, Blitz und Donner über ihre Paläste. Wir heiraten nicht den versklavten Sachsen—der freie, fürstliche Hirsch sucht seine Braut nicht bei der Färse, deren Hals das Joch getragen hat. Wir heiraten nicht den gierigen Normannen—der edle Hund verschmäht es, ein Weibchen aus der Herde des hungrigen Wolfs zu wählen.Ward je gehört, dass die Cymry, die Nachkommen des Brutus, die wahren Kinder des gerechten britischen Bodens, geplündert, unterdrückt, ihres Erbteils beraubt und selbst in ihrem letzten Zufluchtort geschmäht wurden—um dann die Hand den Fremden zu reichen und an ihre Brust die Tochter des Sachsen zu drücken?
Welches ist zu fürchten—das sommertrockene Bachbett oder der Hals-über-Kopf anschwollene Winterstrom? Ein Mädchen lächelt dem sommerlich geschrumpften Rinnsal zu, während es’s durchschreitet; doch Pferd und Reiter scheuen die winterliche Flut. Männer von Mathravel und Powys, fürchtet die Wasser der Wintersaat! Gwenwyn, Sohn Cyverliocks—könnte nicht deine Haube der Topmast auf ihren Wogen werden?“
Alle Gedanken an Frieden—ohnehin den Herzen der kriegerischen Briten fremd—verwehten vor Cadwallons Lied wie Staub im Wirbelwind, und der einstimmige Ruf der Versammlung erklärte den sofortigen Krieg. Der Prinz selbst sprach kein Wort; doch er maß die Runde mit stolzem Blick und warf die Arme hoch wie einer, der seine Anhänger zum Angriff anfächert. Der Priester hätte, wenn er gewagt hätte, Gwenwyn erinnern mögen, dass das Kreuz, das er auf der Schulter trug, seinen Arm dem Heiligen Krieg geweiht und ihn von jeder Beteiligung an bürgerlichem Streit abgehalten habe. Doch der Mut Vater Einions reichte für solch eine Aufgabe nicht, und er entwich aus der Halle in die Abgeschiedenheit seines Klosters. Caradoc, dessen kurze Stunde der Gunst vorüber war, zog sich ebenfalls zurück—mit bescheidenem, demütigem Wesen und nicht ohne einen Blick der Entrüstung auf seinen triumphierenden Rivalen, der so klug sein Meisterstück für das Thema Krieg aufgespart hatte, das beim Volk stets am beliebtesten war.
Die Häuptlinge nahmen ihre Sitze nicht wieder ein zum Zweck der Festlichkeit, sondern um in der eilfertigen Weise, wie sie diesen schlagbereiten Kriegern eigen war, festzulegen, wo sie ihre Streitmacht versammeln wollten—eine Streitmacht, die bei solcher Gelegenheit nahezu alle wehrhaften Männer des Landes umfasste; denn alle, bis auf Priester und Barden, waren Soldaten—und um die Ordnung ihrer Rotten für den bestimmten Marsch festzusetzen, auf dem sie durch allgemeine Rache kundtun wollten, wie tief sie die Beleidigung fühlten, die ihr Prinz durch die Zurückweisung seines Antrags erlitten hatte.
Kapitel 3
Der Sand ist gezählt, der macht auf mein Leben;
Hier muß ich bleiben und hier mein Leben muß enden.
Heinich VI. Akt 1, Szene IV.
Als Raymond Berenger seine Gesandtschaft zu dem Prinzen von Powys entsandt hatte, war er nicht ahnungslos, wenn auch gänzlich furchtlos, hinsichtlich des Ergebnisses. Er sandte Boten zu einigen Abteilungen, die ihre Lehen durch die Amtszeit von Cornage hielten, und warnte sie, bereit zu sein, damit er sofort Kunde vom Nahen des Feindes erhalte. Diese Vasallen, wie allgemein bekannt ist, bewohnten die zahlreichen Türme, welche—gleich so vielen Falkennestern—auf Punkten errichtet waren, die sich zur Verteidigung der Grenzen eigneten, und waren verpflichtet, bei jedem Einfall der Waliser durch Hornstöße Signal zu geben; deren Klang, von Turm zu Turm und von Posten zu Posten beantwortet, rief zum allgemeinen Zur Verteidigung. Doch obwohl Raymond diese Vorsichtsmaßnahmen als geboten erachtete—angesichts des unbeständigen und unsicheren Temperaments seiner Nachbarn und zur Wahrung seines eigenen Ansehens als Soldat—war er weit davon entfernt zu glauben, die Gefahr stehe so unmittelbar bevor. Denn die Vorbereitungen der Waliser—obgleich von weit größerem Umfang als gewöhnlich—waren so geheim getroffen, wie ihr Kriegsentschluss plötzlich gefasst worden war.
Es war am zweiten Morgen nach der denkwürdigen Festlichkeit von Castell-Coch, als das Unwetter über die normannische Grenze hereinbrach. Zuerst kündigte ein einziges, langes, starkes Hornsignal das Nahen des Feindes an; bald wurden die Alarmsignale von jeder Burg und jedem Turm an der Grenze von Shropshire aufgegriffen, wo nahezu jede Ansiedlung eine Festung war. Leuchtfeuer wurden auf Felsen und Höhen entzündet, die Glocken in Kirchen und Städten geläutet, und der allgemeine, ernste Ruf zu den Waffen verkündete eine Gefahr, wie selbst die Bewohner der unbesiedelten Landstriche sie bisher nicht erlebt hatten.
Mitten in diesem allgemeinen Alarm war Raymond Berenger damit beschäftigt, seine ritterlichen Anhänger und Gefolgsleute bereitzustellen, und nachdem er auf die ihm möglichen Arten Nachricht von Stärke und Bewegung des Gegners eingeholt hatte, stieg er bald darauf auf den Wachturm der Burg, um mit eigenen Augen das Umland zu beobachten, das stellenweise bereits von Rauchwolken verdunkelt war—untrügliche Zeichen für den Vormarsch und die Verwüstung der Eindringlinge. Rasch gesellte sich sein Lieblingsknappe zu ihm, dem die ungewohnte Schwere im Blick seines Herrn auffiel, war doch dieser bisher zur Stunde der Schlacht stets unbekümmert gewesen. Der Knappe hielt den Helm seines Herrn in der Hand, denn Sir Raymond war überall gerüstet, nur das Haupt war unbedeckt.
„Dennis Morolt“, sagte der Veteran, „stehen unsere Vasallen und Soldaten?“„Alle, edler Herr, außer den Flamen—sie sind noch nicht eingetroffen.“„Träge Hunde, warum zögern sie?“ sagte Raymond. „Schlechte Politik ist es, derart lahme Naturen in unser Grenzland zu setzen. Sie gleichen ihren Ochsen—tauglicher, den Pflug zu ziehen, als die Standhaftigkeit aufzubringen, die man hier braucht.“„Mit Verlaub,“ sagte Dennis, „die Schurken können dennoch guten Dienst tun. Wilkin Flammock of the Green kann zuschlagen wie der Hammer seiner eigenen Mühle.“„Er wird kämpfen, glaube ich, wenn er nicht anders kann,“ erwiderte Raymond; „aber er hat keinen Magen für solche Übungen und ist so langsam und störrisch wie ein Maultier.“„Eben darum,“ antwortete Dennis Morolt, „taugen seine Landsleute gegen die Waliser: Ihr festes, unbeugsames Naturell kann den feurigen, überstürzten Hang unserer gefährlichen Nachbarn trefflich vereiteln—wie ruhelose Wellen am besten von standhaften Felsen gebrochen werden. Horcht, Herr: Ich höre Wilkin Flammocks Schritt auf der Turmtreppe—so sicher, wie je ein Mönch zur Frühmette stieg.“
Schritt für Schritt kam der schwere Klang näher, bis die Gestalt des gewaltigen, großgewachsenen Flamen aus der Turmtür auf die Plattform trat, wo sie sprachen. Wilkin Flammock war in eine glänzende Rüstung von ungewöhnlichem Gewicht und Dickenmaß gekleidet, mit übergroßer Sorgfalt gereinigt, wie es die Sauberkeit seiner Nation bezeigt; doch, im Gegensatz zur Gewohnheit der Normannen, völlig schmucklos, ohne Schnitzwerk, Vergoldung oder irgendeine Zier. Die Stahlhaube hatte kein Visier und ließ ein breites Antlitz frei, mit schweren, starren Zügen, die den Charakter seines Temperaments und Verstandes verkündeten. In der Hand trug er eine schwere Streitkeule.
„Nun, Herr Flame,“ sagte der Burgherr, „Ihr wart, dünkt mich, nicht eben in Eile, zum Rendezvous zu kommen.“
„So bitt’ Euch,“ antwortete der Flame, „wir mussten zögern, um unsere Wagen mit Ballen von Tuch und anderem Eigentum zu beladen.“„Ha, Wagen? – Wie viele Wagen habt Ihr mitgebracht?“
„Sechs, edler Herr,“ erwiderte Wilkin.
„Und wie viele Männer?“ verlangte Raymond Berenger.
„Zwölf, tapferer Herr,“ entgegnete Flammock.
„Nur zwei Männer für jeden Gepäckwagen? Ich wundere mich, dass Ihr Euch so beladet,“ sagte Berenger.„Mit Verlaub, Herr, einmal mehr,“ erwiderte Wilkin ruhig, „es ist nur der Wert, den meine Gefährten und ich unseren Gütern beimessen, der uns nötigt, sie mit unserem Leib zu verteidigen. Hätten wir sie den plündernden Händen der dortigen Vagabunden preisgegeben, so wäre es schlechte Politik gewesen, hier zu verweilen und ihnen die Gelegenheit zu geben, Mord mit Raub zu verbinden. Gloucester war ohnehin mein erstes Ziel.“
Der normannische Ritter starrte den flämischen Handwerker—denn das war Wilkin Flammock—mit einer Mischung aus Überraschung, Geringschätzung und kaum verhohlener Entrüstung an.
„Ich habe vieles gehört,“ sagte er, „doch dies ist das erste Mal, dass ich einen bärtigen Mann sich selbst einen Kuhhirten nennen höre.“
„Und dennoch tut Ihr es nun,“ antwortete Flammock mit vollkommener Gelassenheit. „Ich bin stets bereit, für Leben und Besitz zu kämpfen; und dass ich in dieses Land gekommen bin, wo beides in steter Gefahr steht, beweist, dass es mir gleichgültig ist, wie oft ich es tun muss. Doch eine heile Haut ist mir allemal lieber als eine zerfetzte.“
„Gut,“ sagte Raymond Berenger, „kämpfe auf deine Weise, so du nur nicht nachlässt, mannhaft mit deinem langen Leibe zu fechten. Wir werden jede Hand brauchen, die wir einsetzen können. – Sahst du etwas von diesen verfluchten Walisern? Führen sie Gwenwyns Banner?“
„Ich sah es – mit dem weißen Drachen,“ antwortete Wilkin.
Raymond wurde ernst bei dieser Nachricht. Dennis Morolt, der nicht wollte, dass der Flame es bemerkte, lenkte hastig das Gespräch.
„Ich sage Euch, Wilkin,“ meinte er, „sobald der Constable von Chester mit seinen Lanzen zu uns stößt, werdet Ihr sehen, wie unser Handwerk den Drachen schneller heimwärts jagt, als je die Spulen beim Webstuhl flogen.“
„Er muss fliegen, bevor der Constable kommt,“ entgegnete Berenger düster, „sonst flattert er siegreich über unseren Leibern.“
„Im Namen Gottes und der heiligen Jungfrau!“ rief Dennis. „Was meint Ihr, edler Herr? – Doch nicht, dass wir uns den Walisern stellen, ehe der Constable uns erreicht?!“
Er hielt inne, sah den festen, wenn auch schwermütigen Blick seines Herrn und fuhr dann ernster fort:
„Ihr könnt es nicht meinen – Ihr könnt nicht wollen, dass wir dieses Schloss verlassen, das wir so oft erfolgreich gegen sie gehalten haben, und im offenen Feld mit zweihundert Mann gegen Tausende kämpfen! Bedenkt es besser, mein geliebter Herr, und setzt nicht die Unbesonnenheit alter Tage gegen den Ruf der Weisheit und Kriegskunst, die Euer früheres Leben so edel errungen hat.“
„Ich nehme Euch nicht übel, Dennis, dass Ihr meine Absicht tadelt,“ erwiderte der Normanne, „denn ich weiß, Ihr tut es aus Liebe zu mir und den Meinen. Doch dies muss geschehen – wir müssen die Waliser binnen drei Stunden schlagen, oder der Name Raymond Berengers wird befleckt sein in der Genealogie seines Hauses.“
„So sei es – wir werden kämpfen, mein edler Herr,“ sagte der Knappe. „Fürchtet kein kühles Wort von Dennis Morolt, wenn es um die Schlacht geht. Doch kämpfen wir unter den Mauern der Burg, mit redlichen Wilkin Flammock und seinen Armbrüsten auf den Wällen, um unsere Flanken zu decken und der Übermacht etwas entgegenzusetzen.“
„Nicht so, Dennis,“ erwiderte sein Herr. „Im offenen Feld müssen wir kämpfen – sonst gilt dein Herr nicht als ritterlich bewordener Mann. Wisse: Als ich zu Weihnachten Gastmahl hielt mit dem listigen Brutalen, und der Wein reichlich floss, da warf Gwenwyn mir ein Lob auf die Standhaftigkeit und Stärke meiner Burg hin – in einer Weise, die andeutete, dass allein diese Vorteile mich in früheren Kriegen vor Niederlage und Gefangenschaft bewahrt hätten. Ich aber antwortete – wo ich besser geschwiegen hätte. Denn was war meine müßige Prahlerei anderes als eine Fessel, die mich nun zu einer Tat bindet, die dem Wahnsinn gleicht? Ich sprach: Wenn je ein Prinz der Cymry feindlich vor Garde Doloureuse erscheint, so soll er sein Banner niederpflanzen in der Ebene bei der Brücke, und bei dem Wort eines guten Ritters und dem Glauben eines Christen wird Raymond Berenger ihm dort begegnen – ob er viele sei oder wenige – so gewiss, wie je ein Waliser im Kampf gestellt wurde!“
Dennis war sprachlos getroffen, als er von einem Versprechen hörte, so übereilt, so tödlich; doch keine Kasuistik konnte seinen Herrn von den Fesseln lösen, mit denen sein unvorsichtiges Vertrauen ihn gebunden hatte. Anders war es mit Wilkin Flammock. Er starrte—beinahe lachend, ungeachtet der Ehrfurcht, die dem Burgherrn gebührte, und trotz seiner eigenen Unempfänglichkeit für lächerliche Regungen. „Und das ist alles?“ sagte er. „Wenn Euer Ehren versprochen hätte, einem Juden oder Lombarden hundert Gulden zu zahlen, müsstet Ihr gewiss den Termin halten oder Euer Pfand verwirken; doch bestimmt ist ein Tag so gut wie der andere, um ein Kampfversprechen zu halten, und der beste ist jener, an dem das Versprechen am heißesten ist. Aber sagt, war dieses Gelöbnis am Ende über einer Weinflasche gemacht?“„Es bedeutet so viel, wie ein Versprechen nur bedeuten kann, wo es auch gegeben sei“, sagte Berenger. „Ein Versprechen tilgt nicht die Sünde des Wortbruchs, nur weil er im Rausch geschah.“
„Was die Sünde betrifft,“ sagte Dennis, „bin ich sicher, ehe Ihr eine solche Traurigkeitstat begehen solltet, würde der Abt von Glastonbury Euch für einen Gulden lossprechen.“
„Doch was wird die Schande auslöschen?“ verlangte Berenger. „Wie soll ich wagen, mich wieder unter Rittern zu zeigen, wenn ich mein Schlachtgelöbnis gebrochen habe—aus Furcht vor einem Waliser und seinen nackten Wilden? Nein, Dennis Morolt, kein weiteres Wort. Sei es zum Guten oder zum Schlechten, wir kämpfen heute—dort drüben auf dem Feld.“
„Es mag sein“, sagte Flammock, „dass Gwenwyn das Gelöbnis vergessen hat und daher nicht am verabredeten Ort erscheint; denn, wie wir hörten, hat Euer französischer Wein seine walisischen Sinne gründlich überflutet.“
„Er spielte am Morgen nach der Vereinbarung wieder darauf an“, sagte der Burgherr. „Vertraut mir, er wird nicht vergessen, was ihm die Chance gibt, mich für immer von seinem Pfad zu räumen.“
Während er sprach, sahen sie, dass große Staubwolken, die zuvor an verschiedenen Punkten der Landschaft erschienen waren, sich gegen die gegenüberliegende Seite des Flusses zogen, über den eine alte Brücke zum ernannten Kampfplatz führte. Die Ursache lag auf der Hand: Gwenwyn rief die Trupps zurück, die sich in teilweiser Verwüstung ergangen hatten, und drängte mit seiner ganzen Macht auf die Brücke und die Ebene dahinter.
„Hinab! Lasst uns die Passage sichern“, sagte Dennis Morolt. „Wir können mit diesen auf Augenhöhe verhandeln dank des Vorteils, die Brücke zu verteidigen. Euer Wort bindet Euch an die Ebene als Schlachtfeld, aber es verlangte nicht, auf den Vorteil der Brückenpassage zu verzichten. Unsere Männer, unsere Reiter sind bereit—lasst die Bogenschützen das Ufer nehmen, und ich verpfände mein Leben auf diesen Kampf.“
„Als ich versprach, ihn in der trüben Ebene zu treffen, meinte ich“, antwortete Raymond Berenger, „dem Waliser den vollen Vorteil gleichen Bodens zu geben. So meinte ich’s—so verstand er’s; und war je mein Wort im Wortlaut gehalten, wenn ich es im Geiste breche? Wir rühren uns nicht, bis der letzte Waliser die Brücke überschritten hat; und dann …“
„Und dann“, sagte Dennis, „ziehen wir in unseren Tod!—Gott vergebe uns unsere Sünden!—Aber …“
„Aber was?“, fragte Berenger. „Etwas klemmt dir im Sinn, das nicht unausgesprochen bleiben sollte.“
„Meine junge Herrin—Eure Tochter, Lady Eveline.“
„Ich habe es ihr gesagt. Sie bleibt in der Burg. Ich lasse einige auserwählte Veteranen zurück, mit dir, Dennis, zu ihrem Befehl. In vierundzwanzig Stunden wird die Belagerung gelindert sein, und wir haben sie schon länger mit geringerer Besatzung gehalten. Dann führt sie zu ihrer Tante, der Äbtissin der Benediktinerinnen—du, Dennis, sorgst dafür, dass sie dort ehrenvoll und sicher unterkommt, und meine Schwester wird für ihren weiteren Schutz sorgen, wie es ihre Klugheit bestimmt.“
„Ich euch verlassen—jetzt, in dieser Not?!“ rief Dennis Morolt, in Tränen ausbrechend. „Mich einsperren hinter Mauern, wenn mein Herr zur letzten Schlacht reitet? Knappe einer Dame will ich werden—selbst wenn es Lady Eveline ist—während er tot unter seinem Schild liegt?—Raymond Berenger, dafür habe ich so oft Eure Rüstung zugeschnallt?“
Die Tränen strömten aus den Augen des alten Kriegers, gleich denen eines Mädchens, das um seinen Liebsten weint; und Raymond, ihn freundlich bei der Hand nehmend, sprach in beruhigendem Ton:
„Glaube nicht, mein guter alter Diener, dass ich dich von meiner Seite treiben würde, wenn es Ehre zu gewinnen gibt. Doch dies ist eine wilde, unbedachte Tat, zu der mich Schicksal oder Torheit gebunden hat. Ich gehe in den Tod, um meinen Namen vor Schmach zu retten—aber leider! ich muss der Nachwelt die Anklage der Verwegenheit hinterlassen.“
„Lasst mich die Verwegenheit mit Euch teilen, mein geliebter Herr,“ entgegnete Dennis Morolt ernst, „denn der arme Knappe hat nicht das Recht, sich weiser zu dünken als sein Meister. In vielen Schlachten gewann meine Tapferkeit nur kleinen Ruhm, weil sie an Euren großen Taten teilhatte—bestreitet mir nun nicht das Recht, auch die Schande zu teilen, die Eure Kühnheit heraufbeschwören mag. Soll man sagen, die Tat sei so überstürzt gewesen, dass nicht einmal sein alter Knappe teilnehmen durfte? Ich bin ein Teil von Euch—jeden anderen Mann mit Euch zu nehmen und mich zurückzulassen, wäre Mord an mir!“
„Dennis,“ sagte Berenger, „du lässt mich den Irrsinn meiner Tat noch schwerer empfinden. Gern gewährte ich dir, was du erbittest—so traurig es ist. Doch meine Tochter …“
„Edler Ritter,“ fiel der Flame ein, der diesem Gespräch mit etwas mehr Aufmerksamkeit als gewöhnlich gelauscht hatte, „ich habe nicht die Absicht, heute die Burg zu verlassen. Wenn Ihr also meinem Treueschwur vertrauen wollt, so soll alles geschehen, was ein schlichter Mann tun kann, um Lady Eveline zu schützen …“
„Wie? Kerl,“ rief Raymond, „du gedenkst nicht, die Burg zu verlassen? Wer gibt dir das Recht, hier zu wollen oder nicht zu wollen, ehe mein Wille kund ist?“
„Es täte mir leid, mit Euch zu hadern, Herr Burgherr,“ erwiderte der unbewegte Flame, „doch halte ich hier, in diesem Bezirk, gewisse Mühlen, Pachthöfe, Tuchhallen und anderes, für die ich verpflichtet bin, Kriegsdienste zur Verteidigung von Garde Doloureuse zu leisten—und dazu bin ich bereit. Aber wenn Ihr mich zwingt, von hier zu marschieren, die Burg schutzlos zurücklassend und mein Leben in einer Schlacht preisgebend, die Ihr selbst für verzweifelt erklärt, dann bindet mich mein Lehnseid nicht zu gehorchen.“
„Elender Handwerker!“ fuhr Morolt auf, die Hand am Dolch, um dem Flamen zu drohen. Doch Raymond Berenger gebot mit Stimme und Hand:
„Nicht, Morolt—verletze ihn nicht und beschäme ihn nicht. Er kennt seine Pflicht, wenn auch nicht nach unserer Weise; und er und seine Landsleute werden besser hinter steinernen Mauern kämpfen. Sie sind, wie alle Flamen, durch Übung in ihrem eigenen Land erfahren in Angriff und Verteidigung ummauerter Städte und in der Kunst der Kriegsmaschinen. Einige seiner Leute sind hier in der Burg, neben seinen Gefolgsleuten. Diesen will ich zurücklassen, und sie werden ihm williger gehorchen als irgendeinem außer dir. Und du, Dennis—du würdest doch nicht aus missverstandener Ehre oder blinder Liebe zu mir diesen wichtigen Posten und Evelines Sicherheit zweifelhaften Händen überlassen?“
„Wilkin Flammock ist nur ein flämischer Hanswurst, edler Herr,“ erwiderte Dennis, überglücklich, als hätte er einen großen Vorteil errungen; „doch muss ich gestehen, er ist so stark und treu wie irgendeiner, dem Ihr vertrauen könntet. Und überdies—seine Klugheit allein wird ihn lehren, dass mehr zu gewinnen ist, wenn er eine Burg wie diese hält, als wenn er sie Fremden überlässt, die ihr Unterwerfungsversprechen nicht halten, sondern sie nur verraten würden.“
„So sei es,“ sprach Raymond Berenger. „Dann, Dennis, sollst du mit mir ziehen, und er bleibt zurück. – Wilkin Flammock,“ fuhr er fort, den Flamen ernst anblickend, „ich rede nicht zu dir in der Sprache der Ritterschaft, von der du nichts weißt; doch als ehrlicher Mann und treuer Christ beschwöre ich dich, für die Verteidigung dieser Burg einzustehen. Kein Versprechen des Feindes soll dich bewegen, auf einen niedrigeren Posten herabzusteigen—keine Drohung dich zur Übergabe zwingen. Bald wird Entsatz herannahen; erfüllst du treu dein Amt an mir und meiner Tochter, so wird Hugo de Lacy dich reich belohnen—versagst du, so wird er dich hart bestrafen.“
„Herr Ritter,“ sagte Flammock, „es erfreut mich, dass Ihr so viel Vertrauen in einen schlichten Handwerksmann setzt. Was die Waliser betrifft—ich stamme aus einem Land, das gezwungen war, mit dem Meer zu ringen; und wer die Wellen in ihrem Sturm bändigt, braucht die Wut eines ungeordneten Volkes nicht zu fürchten.“
„Eure Tochter soll mir so teuer sein wie die eigene,“ sprach der Flame, „und in dem Vertrauen könnt Ihr Euch bergen—wenn Ihr nicht, wie ein weiser Mann, lieber Tor und Fallgatter schließt und Eure Bogenschützen samt meinen Armbrustschützen auf die Mauern stellt, um den Schurken zu zeigen, dass Ihr nicht der Narr seid, für den sie Euch halten.“
„Guter Kerl, das darf nicht sein,“ erwiderte der Ritter. „Doch—ich höre die Stimme meiner Tochter,“ fügte er hastig hinzu. „Ich möchte sie noch einmal sehen, ehe ich sie aufs Neue verlasse. Euch, ehrlicher Flame, empfehle ich sie dem Himmel. Folge mir, Dennis Morolt!“
Der alte Kastellan eilte die Stufen des südlichen Turmes hinab, gerade als seine Tochter aus dem östlichen Turm trat, um sich ihm abermals zu Füßen zu werfen. Ihr folgten Vater Aldrovand, der Kaplan ihres Vaters, ein alter, fast invalider Jäger, dessen einst rege Dienste im Feld und in der Jagd sich seit einiger Zeit darauf beschränkten, die Hundezwinger zu beaufsichtigen und besonders die Lieblingshunde seines Herrn zu pflegen, sowie Rose Flammock, die Tochter Wilkins—ein blauäugiges flämisches Mädchen, rundlich, plump und schüchtern wie ein Rebhuhn, die seit einiger Zeit duldsam als Gespielin der hochgeborenen normannischen Jungfrau diente, in einer zweifelhaften Stellung zwischen demütiger Freundin und höherer Dienerin.
Eveline stürzte auf die Zinnen, das Haar zerzaust, die Augen in Tränen ertränkt, und verlangte mit leidenschaftlicher Hast von dem Flamen, wo ihr Vater sei. Flammock verbeugte sich unbeholfen und suchte eine Antwort, doch die Stimme versagte ihm. Ohne weitere Umstände wandte er Eveline den Rücken, missachtete völlig die drängenden Fragen des Jägers und des Kaplans, und sprach hastig zu seiner Tochter in seiner eigenen Sprache: „Schlimmes Werk, schlimmes Werk! Kümmere dich um das arme Fräulein, Roschen—der alte Herr ist tollkühn geworden.“
Ohne weiteres Wort ging er die Treppen hinab und hielt nicht eher an, als bis er die Butterei erreichte. Dort rief er laut wie ein Löwe nach dem Verwalter dieses Bereichs, der unter den verschiedenen Namen von Kämmerer, Kellermeister und so fort gerufen wurde. Der alte Reinold, ein normannischer Knappe, reagierte erst, als der Flame sich glücklicherweise des anglonormannischen Titels „Butler“ erinnerte. Dies, der eigentliche Name seines Amtes, war der Schlüssel zur Luke der Butterei, und der alte Mann erschien sogleich: in grauer Soutane, die Hosen hoch aufgeschlagen, ein schweres Schlüsselbund an einer silbernen Kette über dem breiten Ledergürtel, den er, der Not der Zeit eingedenk, auf der linken Seite mit einem gewaltigen Schwert ausbalancierte—einem Schwert, das seinem alten Arm wohl zu schwer war.
„Was begehrt Ihr, Meister Flammock? Oder welche Befehle bringt Ihr, da es meines Herrn Wille ist, dass Ihr für eine Zeit über mich verfügen sollt?“„Nur einen Becher Wein, guter Meister Kellermeister—Butler, meine ich.“
„Ich bin froh, dass Ihr den Namen meines Amtes im Gedächtnis habt,“ erwiderte Reinold mit dem kleinlichen Groll eines verwöhnten Dieners, der es übelnimmt, wenn ein Fremder unrechtmäßig über ihn gesetzt wird.
„Eine Flasche Rheinwein, wenn Ihr so gütig seid,“ erwiderte der Flame, „denn mein Herz ist gedrückt und schwach, und ich muss vom Besten trinken.“
„Und trinken sollt Ihr,“ sagte Reinold, „wenn Trinken Euch jenen Mut gibt, der Euch vielleicht noch fehlt.“
Er stieg hinunter zu den geheimen Gruften, deren Hüter er war, und kehrte mit einem silbernen Krug zurück, der wohl ein Quart fasste. „Hier ist ein Wein“, sagte Reinold, „wie ihr ihn selten **gekostet habt“ – und war im Begriff, ihn in einen Becher zu gießen.„Nein, den Krug selbst – den Krug, Freund Reinold; ich liebe einen tiefen, ernsten Schluck, wenn das Geschäft schwer ist“, sagte Wilkin. Er ergriff den Weinkrug, nahm einen ersten Schluck, hielt inne, als wolle er Stärke und Geschmack des kräftigen Likörs abwägen. Offenbar war er mit beidem zufrieden, denn er nickte dem Butler zustimmend zu und hob den Krug abermals an den Mund; langsam, stetig brachte er den Boden des Gefäßes bis nahe an die Decke des Zimmers, ohne einen Tropfen entkommen zu lassen.„Das hat gemundet, Herr Kellermeister“, sagte er, keuchend und den Atem in Intervallen zurückholend nach so langer Atemspannung; „doch bei allem Respekt – es ist nicht der beste, den ich je probiert habe! Ihr kennt wenig die Keller von Gent und Ypern.“
„Und mich kümmern sie nicht“, sagte Reinold; „Leute sanften normannischen Blutes halten den Wein von Gascogne und Frankreich – reich, leicht, herzhaft – für all den sauren Kram vom Rhein und Neckar wert.“
„Alles eine Frage des Geschmacks“, sagte der Flame, „doch horcht – ist mehr von diesem Wein im Keller?“
„Sollte er eurem feinen Gaumen nicht zusagen?“ sagte Reinold.
„Nein, nein, mein Freund“, sprach Wilkin, „ich sagte, er habe gemundet – besser hätt’ ich trinken können – aber er ist recht gut, wo’s keinen besseren gibt. Nochmals: Wie viel habt ihr davon?“
„Das ganze Fass, Mann“, antwortete der Butler; „ich habe soeben ein frisches Spundloch für euch geschlagen.“
„Gut“, erwiderte Flammock, „nimm die Quartkanne ehrlichen Maßes; schaffe das Fass in deine Butterei und lass jeden Soldaten dieser Burg einen Becher wie den meinen erhalten. Ich spüre, es hat mir gutgetan – mein Herz sank, als ich den schwarzen Rauch über meiner eigenen Mühle aufsteigen sah. Jeder Mann, sage ich, soll eine volle Quartkanne haben – Burgen verteidigt man nicht mit dünnem Trank.“
„Ich muss tun, wie ihr wollt, guter Flammock“, sagte der Butler; „doch bitt’ ich euch, bedenkt: Nicht alle Männer sind gleich. Was euer flämisches Herz wärmt, setzt in normannischen Köpfen Lauffeuer; und was eure Landsleute ermutigt, die Wälle zu halten, treibt die Unseren vielleicht über die Zinnen.“
„Gut – ihr kennt die Konstitution eurer Landsleute am besten; schenkt ihnen Wein nach Maß und Mäßigung eurer Wahl – nur lass jedem Flamen eine ehrwürdige Quart Rheinwein zukommen. – Doch was tun wir für die englischen Kerle? Von denen ist eine treffliche Zahl bei uns geblieben.“
Der alte Butler hielt inne und rieb die Stirn. „Da wird’s eine sonderbare Verschwendung an Likör“, sagte er; „und doch kann ich nicht leugnen, dass die Not den Aufwand rechtfertigt. Was die Engländer betrifft – sie sind, wie ihr wisst, ein Mischvolk: viel von eurer deutschen Schwerblütigkeit, dazu eine reiche Beimischung der hitzigen walisischen Heftigkeit. Leichter Wein reizt sie nicht; kräftige Züge machten sie toll. Wie steht’s mit Ale – ein deftiger, stärkender Trunk, der das Herz wärmt, ohne das Hirn zu entzünden?“„Ale!“ sagte der Flame. „Brumm – ha! Ist euer Ale machtvoll, Herr Butler – ist’s Doppel-Ale?“
„Zweifelt ihr an meinem Handwerk?“ sagte der Butler. „März und Oktober haben mich, seit vierzig Jahren, je mit der besten Gerste Shropshires beschäftigt. – Ihr sollt richten.“
Er füllte aus einem großen Fass in der Ecke der Butterei den Krug, den der Flame soeben geleert hatte; kaum war er gefüllt, leerte Wilkin ihn von Neuem bis auf den Grund.
„Gute Ware“, sprach er, „Meister Butler – feurig und stark. Die englischen Kerle werden wie Teufel darum kämpfen – gebt ihnen gewaltiges Ale zu Rindfleisch und braunem Brot. Und nun, da ich euch eure Ordre gegeben habe, Meister Reinold, ist’s Zeit, nach dem Meinen zu sehen.“
Wilkin Flammock verließ die Butterei und, mit Miene und Schritt so unbeirrt, wie es tiefe Überlegung nur sein kann, unergriffen auch von den mannigfachen Gerüchten draußen, machte er die Runde durch Burg und Außenwerke, mustete die kleine Garnison und setzte jeden auf seinen Posten; seinen Landsleuten überließ er die Führung der Armbrüste und der Kriegsmaschinen, die von den stolzen Normannen ersonnen und den unwissenden Engländern – richtiger: Angelsachsen jener Tage – gänzlich unverständlich waren, während seine gewandteren Landsleute sie mit großer Fertigkeit bedienten. Die Missgunst, die sowohl Normannen als auch Engländer gegen die vorläufige Anordnung hegten, einen Flamen an die Spitze zu stellen, wich allmählich seiner militärischen wie handwerklichen Tüchtigkeit – und dem Gefühl der Not, das mit jedem Augenblick wuchs.
Kapitel 4
neben jener Brücke aus über jene brennen,
Wo das Wasser streitet hell und glänzend
Wird viele eine fallenden Verlauf verschmähen,
Und Ritter werden sterben in Schlacht eifrig.
Prophezeihung von Thomas the Rhymer
Die Tochter Raymond Berengers, mit den Begleitern, die wir bereits genannt haben, fuhr fort, auf den Zinnen von Garde Doloureuse zu verweilen, trotz der Aufforderung des Priesters, sie möge den Ausgang dieser furchtbaren Zwischenzeit in der Kapelle und unter den Riten der Religion erwarten. Er merkte schließlich, dass sie vor Kummer und Furcht nicht imstande war, seinen Rat aufzunehmen oder zu verstehen, und setzte sich an ihre Seite, während der Jägersmann und Rose Flammock beistanden und trachteten, Trost zu spenden, den sie selbst kaum empfanden.
„Dies ist nur ein Ausbruch Eures edlen Vaters,“ sagte er, „und obschon er große Gefahr zu bergen scheint—wer hätte je Sir Raymond Berengers Kriegsplan in Zweifel gezogen? Er ist verschlossen und geheim in seinen Absichten. Ich wette, er ist nicht hinausgeritten, ohne zu wissen, dass der edle Earl of Arundel oder der mächtige Constable von Chester in der Nähe sind.“
„Seid Ihr sicher, guter Vater?—Geh, Raoul—geh, meine liebe Rose—sieh nach Osten—schau, ob du Banner oder Staubwolken erspähen kannst. Horch—horch—hörst du keine Trompeten von dort?“
„Leider, meine Lady,“ sagte Raoul, „der Donner des Himmels wäre kaum zu hören im Geheul der walisischen Wölfe.“
Eveline wandte sich bei diesen Worten der Brücke zu—und ein entsetzliches Schauspiel bot sich ihren Augen. Der Fluss, dessen Wasser an drei Seiten den Fuß der stolzen Anhöhe umspülten, auf der die Burg stand, bog westwärts von Festung und Vorort ab, und die Hügel sanken zu einer weiten Ebene hinunter, hoch genug, um ihre angeschwemmte Herkunft anzuzeigen. Tiefer unten, an der Niederung dieser Ebene, wo das Ufer den Fluss wieder eng umfasste, lagen die Handwerkerhäuser der kräftigen Flamen—und standen nun in hellen Flammen. Die Brücke, hoch und schmal, aus Jochbögen auf ungleichen Pfeilern gefügt, lag etwa eine halbe Meile von der Burg entfernt, im genauen Zentrum der Ebene. Der Fluss selbst, in einem tiefen, felsigen Bett, war oft unfurtbar und zu allen Zeiten schwer zu passieren—ein erheblicher Vorteil für die Verteidiger der Burg, die bei früheren Gelegenheiten manchen Blutstropfen vergossen hatten, um diesen Übergang zu halten—einen Übergang, den Raymond Berengers seltsame Skrupel nun preiszugeben schienen.
Die Waliser ergriffen den Vorteil mit der Gier, mit der Menschen eine unverhoffte Gelegenheit packen: Schon drängten sie scharenweise über die steilen, abfallenden Bögen; neue Banden, aus verschiedenen Punkten des jenseitigen Ufers herbeiströmend, verstärkten den stetigen Zufluss an Kriegern, die, gemächlich und ungehindert setzend, ihre Schlachtordnung auf der Ebene gegenüber der Burg bildeten. Zunächst sah Vater Aldrovand ihre Bewegungen ohne Sorge, ja mit dem verächtlichen Lächeln dessen, der einen Feind beobachtet, wie er in eine für ihn ausgelegte Falle tappt. Raymond Berenger hatte mit seinem kleinen Trupp Infanterie und Reiterei Stellung genommen auf dem sanften Rücken zwischen Burg und Ebene, der von der ersteren zur letzteren abfiel; und dem Dominikaner, der im Kloster seine alten militärischen Erfahrungen nicht ganz vergessen hatte, schien klar, dass der Ritter beabsichtigte, den ungeordneten Feind anzufallen, sobald eine hinreichende Zahl den Fluss überschritten hatte, während die anderen teils drüben, teils noch im langsamen, gefährlichen Übergang begriffen waren.
Als jedoch große Haufen der weißmänteligen Waliser ungehindert diejenige Aufstellung nehmen durften, die ihre Kampfgewohnheit empfahl, nahm das Antlitz des Mönchs—obgleich er noch versuchte, die erschrockene Eveline zu ermutigen—einen anderen, ängstlicheren Ausdruck an; und seine eingeübte Zurückhaltung rang heftig mit der alten kriegerischen Glut.
„Hab Geduld,“ sagte er, „mein Kind, fasse guten Mut; deine Augen werden die Bestürzung der barbarischen Feinde schauen. Lass eine Minute vergehen—und du wirst sehen, wie sie zerstreut werden wie Staub. Heiliger Georg!—jetzt werden sie gewiss deinen Namen rufen, oder nie!“
Des Mönchs Rosenkranzperlen glitten inzwischen rasch durch seine Finger, doch mancher Ausdruck militärischer Ungeduld mischte sich unter seine Gebete.
---ENDE DER LESEPROBE---