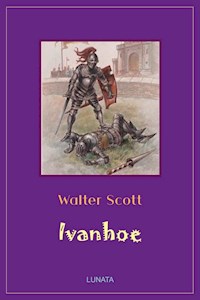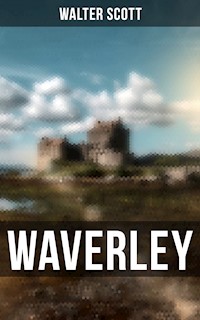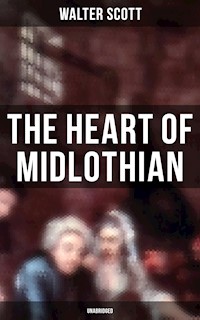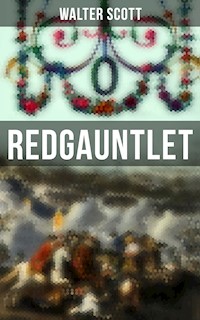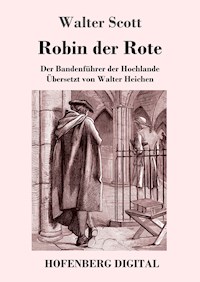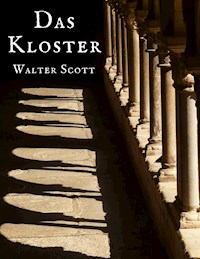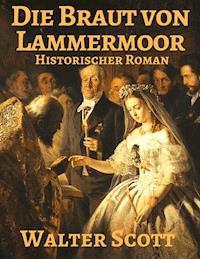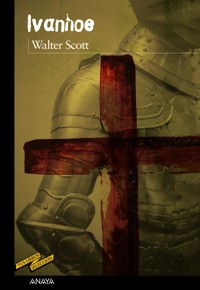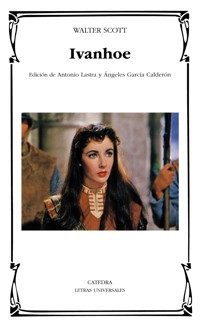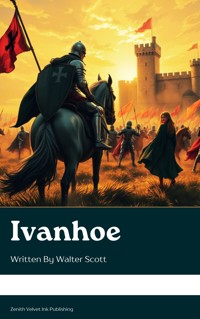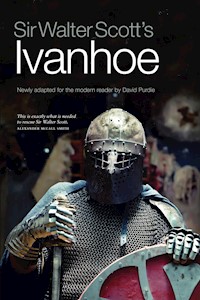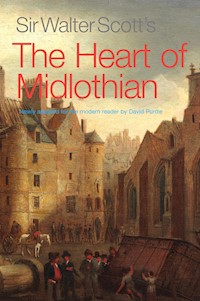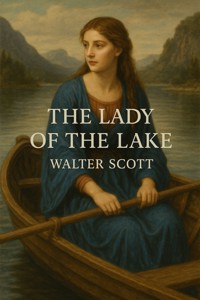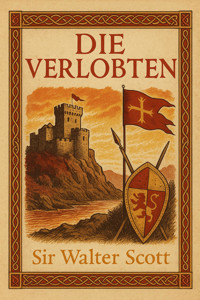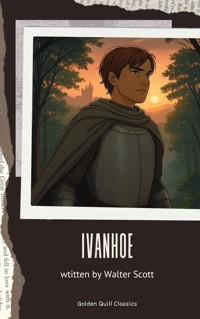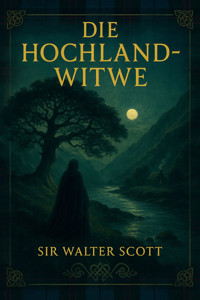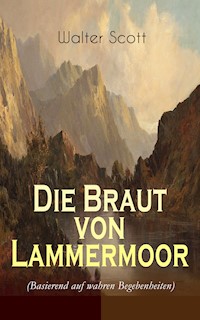
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Die Braut von Lammermoor (Basierend auf wahren Begebenheiten)" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Der Geschichte ist basiert auf wahren Begebenheiten. Walter Scott nimmt keine großen Veränderungen von der wahren Begebenheit in seinem Roman vor. Die Tochter von Lord Stair gibt, ohne das Wissen ihrer Eltern, ihr Versprechen Lord Rutherford. Ihr Verlobter hätte aufgrund seiner politischen Überzeugungen und seines fehlenden Vermögens niemals das Wohlwollen ihrer Eltern erhalten.... Sir Walter Scott (1771-1832) war ein schottischer Dichter und Schriftsteller. Er war einer der - nicht nur in Europa - meistgelesenen Autoren seiner Zeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 605
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Braut von Lammermoor (Basierend auf wahren Begebenheiten)
INHALTSVERZEICHNIS
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Eilftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechszehntes Kapitel
Siebenzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Vierundzwanzigstes Kapitel
Fünfundzwanzigstes Kapitel
Sechsundzwanzigstes Kapitel
Siebenundzwanzigstes Kapitel
Achtundzwanzigstes Kapitel
Neunundzwanzigstes Kapitel
Dreißigstes Kapitel
Einunddreißigstes Kapitel
Zweiunddreißigstes Kapitel
Dreiunddreißigstes Kapitel
Vierunddreißigstes Kapitel
Fünfunddreißigstes Kapitel
EINLEITUNG
Inhaltsverzeichnis
Bei einer früheren Gelegenheit1 hat es der Verfasser vermieden, die wahre Quelle anzugeben, woraus er den tragischen Stoff dieser Geschichte gezogen habe, weil dies, obwohl die Geschichte einer entlegenen Zeit angehört, vielleicht den Nachkommen der Partieen unangenehm hätte sein können. Da er aber eine Erklärung der Umstände in den Noten zu Law’s Denkwürdigkeiten2 von seinem geistreichen Freunde Charles Kirkpatrick Sharpe, Esq., und ebenfalls in den neugedruckten Gedichten des würdigen Mr. Symson, als Anhang zu der Beschreibung von Galloway, der Quelle der Braut von Lammermoor, vorfindet, so glaubt der Verfasser, nun die Freiheit zu haben, die Geschichte so zu erzählen, wie sie ihm von Bekannten, die jener Zeit nahe lebten, und die Familie der Braut genau kannten, mitgetheilt worden ist.
Es ist wohl bekannt, daß die Familie Dalrymple, die im Laufe zweier Jahrhunderte so viele Männer von Talent im Civil- und Militärfache und von Auszeichnung in der Literatur, der Politik und Industrie wie kein anderes Haus in Schottland hervorgebracht hat, ihren ersten Aufschwung nahm in der Person von James Dalrymple, einem der größten Rechtsgelehrten, die je gelebt haben, obwohl die Anstrengungen seines mächtigen Geistes leider an einen so beschränkten Gegenstand wie schottisches Recht verwandt wurden, über welches er ein bewunderungswürdiges Werk verfaßte.
Er heirathete die Tochter von Roß von Baleiel, Margaretha, die ihm beträchtliche Güter zubrachte. Sie war ein fähiges, politisches und stolzes Weib, und in Allem, was sie unternahm, so glücklich, daß das Volk, welches keineswegs zu Gunsten ihres Gemahls und ihrer Familie redete, ihr Glück der Zauberei zuschrieb. In Uebereinstimmung mit dem Volksglauben erkaufte die Dame Margaretha dies zeitliche Glück ihrer Familie von dem Meister, dem sie diente, durch eine seltsame Bedingung, die von dem Geschichtschreiber ihres Enkels, des großen Earls von Stair, also angegeben wird: »Sie lebte bis in’s hohe Alter, und verlangte, daß man sie nach ihrem Tode nicht unter die Erde bringen, sondern daß man ihren Sarg aufrecht stellen sollte, indem sie versicherte, daß, so lange sie in dieser Stellung bliebe, die Familie Dalrymple glücklich sein würde. Aus was für einem Grunde die alte Dame diese Forderung gethan haben möge, und ob sie wirklich ein solches Versprechen abgelegt habe, Beides kann ich nicht entscheiden; aber es ist gewiß, daß ihr Sarg in dem Chorgang der Kirche von Kirkliston, dem Begräbnißplatz der Familie, aufrecht steht3.« Die Talente dieser ausgezeichneten Familie reichen hin, die Würden zu erklären, zu welchen einige Glieder derselben gelangten, ohne daß man nach übernatürlichen Mitteln zu suchen braucht. Doch dies außerordentliche Glück wurde von einigen eben so sonderbaren Unglücksfällen begleitet, und das Unglück, das ihre älteste Tochter betraf, war eben so sonderbar als traurig.
Miß Janet Dalrymple, Tochter des ersten Lords Stair und der Dame Margareth Roß, hatte sich ohne Kenntniß ihrer Aeltern dem Lord Rutherford verlobt, der denselben wegen seiner politischen Grundsätze und wegen seines Mangels an Vermögen mißfiel. Das junge Paar zerbrach zusammen ein Goldstück, und gelobte sich die feierlichste Treue, und, wie es heißt, verwünschte sich die junge Lady dem schrecklichsten Unglück, wenn sie die gelobte Treue brechen sollte. Kurz darauf machte ein Freier, der von Lord Stair und noch mehr von dessen Gemahlin begünstigt war, der Miß Dalrymple den Hof. Die junge Lady lehnte den Antrag ab, und bekannte, als man in sie drang, ihre geheime Verlobung. Lady Stair, ein Weib, das allgemeine Unterhaltung heischte (denn selbst ihr Gemahl wagte es nicht, ihr zu widersprechen), betrachtete diesen Einwand als eine Kinderei, und bestand darauf, daß ihre Tochter ihre Einwilligung erkläre, den neuen Freier, David Dunbar, Sohn und Erben von David Dunbar von Baldoon in Wigtonshire, zu heirathen. Der erste Liebhaber, ein Mann von sehr stolzem Sinne, trat nun durch einen Brief in’s Mittel, und bestand auf seinem Rechte, das er durch sein Treuegelöbniß mit der jungen Lady erlangt habe. Lady Stair antwortete ihm hierauf, daß ihre Tochter, das Pflichtvergessene ihrer Verlobung ohne Genehmigung ihrer Eltern einsehend, ihr widergesetzliches Gelübde bereue und sich weigere, ihr ihm gelobtes Versprechen zu erfüllen.
Der Liebhaber seinerseits weigerte sich nachdrücklich, eine solche Antwort von irgend Jemanden als von seiner Geliebten in Person anzunehmen, und da man es mit einem Manne zu thun hatte, dessen Charakter zu entschieden und dessen Rang zu hoch war, als daß man mit ihm hätte scherzen können; so fand sich Lady Stair gezwungen, in eine Zusammenkunft Lord Rutherfords und ihrer Tochter zu willigen. Doch trug sie Sorge, in Person dabei zu sein, und sie bestritt den getäuschten und erzürnten Liebhaber mit einer Beharrlichkeit, die der seinigen nicht wich. Besonders bestand sie auf dem levitischen Gesetz, welches erklärt, daß ein Weib eines Gelübdes ledig sein soll, mit dem ihre Eltern nicht übereinstimmen. Die Stelle der Schrift, die sie anführte, ist diese:
»Wenn ein Mann ein Gelübde thut vor dem Herrn, oder einen Eid schwört, seine Seele mit einem Band zu binden; so soll er sein Wort nicht brechen, er soll thun danach, wie es aus seinem Munde kam.
»Auch wenn ein Weib ein Gelübde thut vor dem Herrn, und sich durch ein Band bindet, so lange sie in ihres Vaters Hause ist in ihrer Jugend;
»Und ihr Vater hört ihr Gelübde und ihr Band, womit sie ihre Seele gebunden hat, und ihr Vater hält Frieden mit ihr: dann soll sie ihrem Gelübde stehen, und jeglichem Bande, womit sie ihre Seele gebunden hat, soll sie stehen.
»Wenn aber ihr Vater ihr wehret an dem Tage, wo er es höret; keins ihrer Gelübde und keins ihrer Bande, womit sie ihre Seele gebunden, soll dann bestehen, und der Herr wird ihr vergeben, weil ihr Vater ihr gewehret.« – 4. Mos. XXX. 2, 3, 4, 5.
Während die Mutter also ihre Beweise führte, beschwor der Liebhaber vergebens die Tochter, ihre eigene Ansicht und Meinung zu sagen. Sie blieb völlig betäubt, wie es schien, stumm, blaß und starr wie ein Standbild. Nur auf den streng geäußerten Befehl ihrer Mutter sammelte sie so viel Kraft, ihrem verlobten Freier das zerbrochene Goldstück zurückzugeben, welches das Sinnbild ihrer Treue war. Hierauf gerieth der Liebhaber in eine fürchterliche Wuth, nahm von der Mutter unter Verwünschungen Abschied, und als er das Gemach verließ, kehrte er sich nach seiner schwachen, wenn nicht wankelmüthigen Verlobten um, und sprach: »Ihr, Madam, sollt ein Weltwunder werden« – ein Ausdruck, wodurch ein hoher Grad von Unglück gewöhnlich bezeichnet wird. Er ging fort, und kehrte nicht wieder. Wenn der letzte Lord Rutherford der unglückliche Liebhaber war, muß es der dritte gewesen sein, der diesen Titel führte, und der 1685 starb.
Die Heirath zwischen Janet Dalrymple und David Dunbar von Baldoon ging nun vorwärts, indem die Braut keinen Widerstand zeigte, und sich völlig leidend in Allem, was ihre Mutter befahl oder angab, verhielt. Am Vermählungstage, der, wie es damals üblich war, durch eine große Versammlung von Freunden und Verwandten gefeiert wurde, war sie eben so stumm, traurig und, wie es schien, in ihr Schicksal ergeben. Eine Dame, die mit der Familie in naher Verbindung stand, hat dem Verfasser erzählt, daß sie über diesen Gegenstand eine Unterhaltung mit einem Bruder der Braut, zu der Zeit ein junger Bursche, der vor seiner Schwester zur Kirche ritt, gehabt habe. Er erzählte, daß ihre Hand, während sie ihn umarmt gehalten hätte, kalt und schwer wie Marmor auf ihm gelegen habe. Doch da er voll war von seinem neuen Anzuge und von der Rolle, die er bei dem Kirchgang zu spielen hatte, so machte dieser Umstand, dessen Andenken ihm später so bitter und so beißend war, damals keinen Eindruck auf ihn.
Nach dem Brautfeste wurde getanzt; Braut und Bräutigam hatten sich, wie’s bräuchlich war, zurückgezogen, als man auf einmal ein furchtbares, durchdringendes Geschrei von der Brautkammer hörte. Es war damals Sitte, zur Verhütung roher Spässe, wie sie in alten Zeiten vielleicht erlaubt gewesen waren, den Schlüssel der Brautkammer dem Brautführer anzuvertrauen. Dieser wurde gerufen, doch er weigerte sich zuerst, einen Schritt zu thun, bis das Geschrei so schrecklich wurde, daß er gezwungen mit Andern davon eilte, die Ursache kennen zu lernen. Als man die Thüre geöffnet hatte, fand man den Bräutigam, fürchterlich verwundet und von Blut strömend, über der Schwelle liegen. Man suchte hierauf die Braut; sie wurde in einer Ecke des weiten Kamins gefunden, und hatte keine andere Bedeckung als ihr Hemd, das mit Blut besudelt war. Daselbst saß sie, die Zähne bleckend und Gesichter schneidend, kurz gänzlich von Sinnen. Sie sagte nichts als die Worte: Hebt euren hübschen Bräutigam auf. Sie überlebte nicht lange diese erschütternde Scene; am 24. August 1669 war sie verheirathet worden, und sie starb am 12. September desselben Jahres.
Der unglückliche Baldoon genas von seinen Wunden; aber er verbat sich streng alle Erkundigung, wie er dieselben erhalten habe. Wenn ihn eine Dame, sagte er, über diesen Gegenstand befragen würde, so würde er ihr keine Antwort geben und in seinem Leben nicht mehr mit ihr sprechen; wenn aber ein Herr, so würde er es als die gröbste Beleidigung betrachten, und hiernach eine Genugtuung fordern. Er überlebte nicht sehr lange den fürchterlichen Unglücksfall; auf einem Ritt zwischen Leith und Holyroodshouse stürzte er vom Pferde, und starb in Folge dieses Sturzes den folgenden Tag, den 28. März 1682. So waren in wenigen Jahren die Hauptpersonen dieses entsetzlichen Trauerspiels verschwunden.
Verschiedenartige Berichte kamen über diesen Vorfall in Umlauf; einige davon sind sehr ungenau, obwohl man sie schwerlich übertrieben nennen kann. Es war damals schwierig, mit der Geschichte vornehmer schottischer Familien vertraut zu werden, und es fielen oft sonderbare Dinge in denselben vor, um die sich selbst das Gesetz nicht viel bekümmerte.
Der gläubige Mr. Law sagt im Allgemeinen, daß der Lord Präsident Stair eine Tochter gehabt habe, welche, nachdem sie verheirathet worden, in der Brautnacht ihrem Bräutigam entrissen, und durch das Haus geschleift worden sei (von bösen Geistern, wie zu verstehen gegeben wird), und daß sie bald darauf gestorben sei. Noch eine andere Tochter, sagt er, war von einem bösen Geist besessen.
Mein Freund, Mr. Sharpe, gibt einen andern Bericht von dem Ereigniß. Nach ihm war es der Bräutigam, der die Braut verwundete. Die Heirath war dieser Erzählungsweise gemäß gegen die Neigung der Mutter gewesen, die ihre Einwilligung in den bedeutungsvollen Worten gab: Du magst ihn heirathen, aber bald wird es dich reuen.
Ich finde noch einen andern Bericht, dunkel angegeben, in einigen höchst gemeinen und pöbelhaften Versen, von deren Original ich eine Abschrift habe. Die Ueberschrift sagt, daß diese Verse gemacht worden seien »auf den letzten Vicomte Stair und seine Familie von Sir William Hamilton von Whitelaw. Die Randglossen von William Dunlop, Schreiber in Edinburg, Sohn des Lairds von Househill und Neffe des genannten Sir William Hamilton.« Zwischen dem Verfasser dieser Schmähschrift und dem Lord Präsident Stair herrschte bitterer persönlicher Streit und Eifersucht, und das Pasquill, das mit weit mehr Bosheit als Kunst geschrieben ist, führt folgendes Motto:
Stairs Hals, Herz, Weib, Söhn’, Enkel und was dessen –
Sind schief, falsch, Hexe, Bälg’, Mörder und besessen.
Dieser boshafte Pasquillschreiber, der alle Unglücksfälle der Familie aufdeckt, vergißt nicht die verhängnißvolle Hochzeit von Baldoon. Er scheint, obwohl seine Verse eben so dunkel, als unpoetisch sind, anzudeuten, daß die dem Bräutigam zugefügte Gewalt dem bösen Feinde beizumessen sei, dem sich die junge Lady zu ergeben entschlossen gewesen sei, wenn sie das ihrem ersten Liebhaber gegebene Versprechen bräche. Dieser Umstand widerstreitet dem in der Note über Law’s Denkwürdigkeiten gegebenen Bericht, aber er verträgt sich wohl mit der Familienüberlieferung.
Bei allen Stairs ist kein Unterschied.
Wie man an ihren Frau’n und Männern sieht.
So gab er, wie ein Unterthan so gern,
Die Hand der Tochter an Glenluce’s Herrn.
Er wußte es, wozu sie sich verhieß.
Wenn ihre Treu’ von Rutherford je ließ’.
Was kümmerte den Teufel Baldoons Recht!
Er nahm die Braut: sein Anspruch war nicht schlecht.
Was er auch ihr gesagt hab’ und gethan;
Er packte erst den Bräutigam an,
Und keilte ihn in das Kamin hinein;
Der Fall4 erst heilte sein zerquetscht Gebein.
Eine der von William Dunlope beigefügten Randglossen bemerkt zu obigen Versen: »Sie hatte sich dem Lord Rutherford unter fürchterlichen Verheißungen verlobt, und sie heirathete später Baldoon, den Neffen desselben, und ihre Mutter war die Ursache ihres Treubruchs.«
Auf das nämliche Trauerspiel wird in der folgenden Stelle und der dazu gehörigen Note angespielt:
Unheil verfolget diese schlechte Brut,
Als Oheims Braut der Neffe heimführen thut.
Die Note zu dem Wort Oheim erklärt: »Rutherford, der die Lady Baldoon heirathen sollte, war der Oheim von Baldoon.« Diese Satyre auf Lord Stair und seine Familie wurde, wie schon bemerkt worden ist, von Sir William Hamilton von Whitelaw, einem Nebenbuhler von Lord Stair für die Präsidentenstelle an dem Court of Session, geschrieben; es war dies eine jenem großen Rechtsgelehrten weit nachstehende Person, und er wurde von der verläumderischen oder gerechten Satyre seiner Zeitgenossen eben so hart mitgenommen, als er ein ungerechter und parteiischer Richter war. Einige von den Noten sind von dem wißbegierigen und fleißigen Robert Milne, der als ein eifriger Jakobite, gerne die Hand bot, die Familie von Stair anzuschwärzen5.
Ein anderer Poet dieser Periode hat in einer ganz andern Absicht eine Elegie hinterlassen, worin er das Schicksal der unglücklichen jungen Person, deren außerordentliches Unglück einem Whitelaw, Dunlope und Milne ein würdiger Gegenstand für Posten und Zoten schien, mit Schmerz andeutet und betrauert. Dieser Barde von milderer Gesinnung war Andreas Symson, vor der Revolution Pfarrer von Kirkinner in Galloway, und nach seiner Vertreibung als episcopalischer bescheidener Buchdrucker in Edinburg. Er machte für die Familie von Baldoon, mit welcher er, wie’s scheint, wohl bekannt war, eine Elegie auf das traurige Familienereigniß. In diesem Gedichte behandelt er die Veranlassung von dem Tode der Braut mit einem feierlichen Geheimthun.
Die Verse führen den Titel: »Auf den unerwarteten Tod der tugendsamen Lady Mrs. Janet Dalrymple, Lady Baldoon, der jüngeren«, und liefern uns die genauen Data der Katastrophe, die man sonst nicht leicht finden könnte. » Nupta, August 12. Domum ducta August 24. Obiit September 12. Sepulta, September 30, 1669.« Die Form der Elegie ist ein Gespräch zwischen einem Reisenden und einem Diener des Hauses. Der erste erinnert sich, daß er bei seiner letzten Reise Alles unter einem Anschein von Lust und Fröhlichkeit gefunden habe, und ist begierig zu erfahren, wodurch die Freude in Trauer verwandelt worden sei. Wir geben die Antwort des Dieners als eine Probe von Mr. Symsons Versen, die nicht von der besten Gattung sind:
– – – Sir, was Ihr sagt, ist wahr.
Wir waren voller Lust; doch währt’s nicht lang,
Da ward das Freudenlied ein Klaggesang.
Ein tugendsames Weib, erst jüngst noch Braut,
Ward einem edlen Erben angetraut.
Und hier in’s Haus gebracht. Wir war’n voll Freud’
Um ihretwillen. Traurig sind wir heut:
Denn auf die kurze Lust kam langes Leid.
Ach! sie verwelkte in der Blüthenzeit,
Und Atropos zerschnitt mit scharfem Stahl
Den Faden ihr und ’s Leben auf einmal, u. s. w.6
Mr. Symson strömt seine elegischen Ergüsse auch über das Schicksal des verwittweten Bräutigams aus, bei welcher Gelegenheit der Dichter nach einer langen, klagenden Abschweifung auf den gesunden Schluß kommt, daß, wenn Baldoon zu Fuße gegangen wäre, was, wie es scheint, seine Gewohnheit war, er dem Schicksal entgangen sein würde, an einem Sturze vom Pferde zu sterben. Da das Werk, worin die Elegie vorkommt, so selten ist, daß man es einzig nennen könnte, und da es uns den vollständigsten Bericht über eine Hauptperson der tragischen Geschichte, die wir mitgetheilt haben, gibt, so wollen wir auf die Gefahr, langweilig zu werden, einige kurze Proben von der Poesie des Mr. Symsons beifügen. Der Titel ist:
»Eine Grabelegie, veranlaßt durch den traurigen und höchst kläglichen Tod des nach Werth geschätzten und höchst gebildeten Herrn David Dunbar von Baldoon des jüngeren, einzigen Sohnes und Erben des hochzuverehrenden Sir David Dunbar von Baldoon, Ritter Baronet. Er verließ dies Leben den 28. März 1682, nachdem er durch einen Sturz eine Quetschung erhalten, als er den Tag zuvor zwischen Leith und Holyroodhouse ritt; und er wurde mit Ehren beigesetzt in der Kirche der Abtei von Holyroodhouse, den 4. April 1682.«
Man würde mich mit Recht des Undanks zeihen
Und zwar des schwärzesten, sollt’ ich nicht weihen
Dem Trauerfall ein Wort, und trät’ nicht auch
Mir eine Schmerzensthräne in das Aug’.
’ne Thräne; sagt’ ich? ach! an diesem Grabe
War’ das ’ne arme, kleine, schlechte Gabe –
Zu klein, zu schlecht, in Wahrheit ist’s gesagt
Von mir, der an dem Grab des Freundes klagt –
Weint’ ich ein Glas mit salz’gen Thränen voll,
Es wär’ für ihn noch ein geringer Zoll.
Der Dichter fährt dann fort, sein vertrautes Verhältniß mit dem Verstorbenen darzuthun, und die Beständigkeit zu schildern, womit der junge Mann dem öffentlichen Gottesdienst beiwohnte, was er regelmäßig that, und wodurch er für zwei oder drei Andere ein wirksames, gutes Beispiel wurde. Dann beschreibt er das Aeußere und den Charakter des Verstorbenen, woraus erhellet, daß von einem vollkommenen jungen Edelmanne in alten Zeiten mehr verlangt wurde, als in den jetzigen:
Sein Leib, der nicht sehr breit war oder schmal.
War leicht, gelenksam und voll Kraft zumal,
Sein Temp’rament war Blut gemischt mit Galle,
Und das ist mehr werth, als die andern alle.
In Haltung, Sprache, Umgang, Anmuth wies
Er das, was lobend jeder Weise pries
Und immer anempfahl – die gute Mittelstraße,
Die sich entfernt hält von dem Uebermaße,
Und so war er in jeglichem Bezug
Ein Musterbild, das man schätzt nie genug.
Sparsam und doch kein Filz, ein reicher Spender
Und doch nicht ein unzeitiger Verschwender,
Weil er gar wohl die schwere Kunst verstand
Zu öffnen und zu schließen seine Hand.
Er war bescheiden, doch wenn’s galt zu wagen,
Hat er sich nie dem guten Zweck entschlagen –
Vertraulich stets im Umgang, nicht gemein,
Wußt’ er gehörig fern’ und nah’ zu sein.
Er liebte es, zu Fuß sich zu ergehen;
O! hätte man ihn nie zu Pferd gesehen,
Des Hof’s Geschäfte kannte er durchaus;
Doch er vergaß darüber nicht sein Haus,
Er wußt’ vollkommen wohl, am Hof zu leben;
Doch mocht’ er selten sich dorthin begeben;
Er liebt’ das Land, und lernte so genau
Und gut die Viehzucht und den Ackerbau,
Mit Prüfen, Bessern, Trockenlegen, Graben
Und andern Dingen, die viel Vortheil haben,
Mit Pflanzen, Ebnen und mit manchem Plan
Zu allerlei Gebäuden war er dran,
Mit grad so vielem Nutzen als Gewinne
Die Grillen zu verjagen aus dem Sinne.
Im Handel und Geschäfte grad und schlicht,
Gerecht bei Theilung war er nie erpicht.
Der Rechtsverdreher Kunst sich zu bedienen:
Denn schlichte Schiedrichter ihm bester schienen,
Cosmographie, Arithmetik und
Neure Historie kannt’ er aus dem Grund,
Auch war er in der Baukunst wohl erfahren
Und andern Künsten, die geeignet waren
Für einen Edelmann; und wer sie nicht kennt
Und dennoch sich mit diesem Titel nennt.
Der hat den Namen nur und nicht die Sache,
Verdient nicht, daß man Rühmens von ihm mache.
In vierzig Tagen und ein wenig mehr
Lernt’ er Französisch – und das macht ihm Ehr’.
Hierauf kommt er zu dem vollen Ausbruch seiner Klage; aber statt selbst etwas zu sagen, berichtet uns der Poet, was die Alten bei einer solchen Gelegenheit würden gesagt haben.
Ein heidnischer Poet hält’ bei dem Fall
Laut aufgeschrieen voller Gift und Gall’,
Und angeklagt das Schicksal und die Sterne
Und feindlichen Planeten in der Ferne.
Er hätt’ gerast, gewüthet nicht genug –
Beladen hätt’ er wohl mit schwerem Fluch
Das Jahr, den Mond, den Tag. die Stund’, die Wette,
Die Rennbahn und die Reiter, ja er hätte
Verwünscht ein jeglich Spiel zum Zeitvertreib;
Befohlen hätte er bei Seel’ und Leib,
Daß Niemand sich soll künftig unterstehen
Je einmal anders als zu Fuß zu gehen;
Die Pferde hätt’ er tödten lassen all’,
Um vorzubeugen solchem Trauerfall.
Da wir voraussetzen, daß unsere Leser an den Versen des Mr. Symson genug haben, und da wir in dem Gedichte nichts weiter finden, was der Mittheilung werth wäre, so kehren wir zu der tragischen Geschichte zurück.
Es ist unnöthig, dem verständigen Leser zu bemerken, daß die Zauberei der Mutter nur in der Ueberlegenheit eines starken Gemüthes über ein zartes und hinbrütendes bestand, und daß die Härte, womit sie ihre Ueberlegenheit bei einem so zarten Verhältnisse geltend machte, ihre Tochter zur Verzweiflung und zum Wahnsinn trieb. Demgemäß hat sich der Verfasser bestrebt, seine tragische Erzählung auf diesen Grund zu bauen. Was auch für eine Aehnlichkeit zwischen der Lady Ashton und der berühmten Dame Margaretha Roß gefunden werden mag, der Leser darf darum nicht annehmen, als hätte das Bild des ersten Lord Stair in dem pfiffigen und gemeindenkenden Sir William Ashton gezeichnet werden sollen. Lord Stair war, welches auch seine moralischen Eigenschaften gewesen sein mögen, gewiß einer der ersten Staatsmänner und Rechtsgelehrten seiner Zeit.
Das erdichtete Schloß Wolfsorag ist von einem Liebhaber von Oertlichkeiten als einerlei mit Fast Castle ausgegeben worden. Der Verfasser ist nicht im Stande, über die Aehnlichkeit des wirklichen und des erdichteten Ortes zu entscheiden, da er Fast Castle nur von der See aus gesehen hat. Indeß Burgen, wie wir eine beschrieben haben, findet man, gleich Adlernestern, auf hervorspringenden Felsen und Vorgebirgen, in vielen Gegenden der östlichen Küste von Schottland, und die Lage von Fast Castle scheint der von Wolfsorag so gut als manche andere ähnlich zu sein, während die Nähe des Bergrückens von Lammermoor der Vergleichung einige Wahrscheinlichkeit gibt.
Wir haben nichts weiter mehr zu sagen, als daß der Tod des unglücklichen Bräutigams durch einen Sturz vom Pferde in der Novelle auf den nicht weniger unglücklichen Liebhaber übertragen worden ist.
1 S. Einleitung zu den Jahrbüchern von Canongate.
2 Law’s Memorials, p. 226.
3 Memoirs of John Earl of Stair, by an impartial hand. London, printed for C. Cobbet, p. 2
4 Der Fall vom Pferde, wodurch sein Tod veranlaßt wurde.
5 Ich habe die Satyre, die im ersten Theil der merkwürdigen kleinen Sammlung a Book of Scottish Pasquils vorkommt, mit der an Text vollständigeren und durch Noten reicheren verglichen, die ich in meinem Besitze habe. In dem zweiten Buche der Pasquille, p. 72, kommt eine höchst pöbelhafte Grabschrift auf Sir James Hamilton von Whitelaw vor.
6 Diese Elegie ist wieder gedruckt in einem Anhang zu einem topographischen Werke von demselben Verfasser, betitelt: a large Description of Galloway, by Andrew Symson, Minister of Kirkinnar, 80, Taits, Edinburgh, 1823. Die Elegieen des würdigen Herrn sind äußerst selten, auch sah der Verfasser nie eine Abschrift außer seiner eigenen, die mit dem Tripatriarchieon, einem religiösen Gedicht aus der biblischen Geschichte, von demselben Verfasser, zusammengebunden ist.
ERSTES KAPITEL
Inhaltsverzeichnis
Mit Kreuz und Qual sein Brod verdienen
Durch Schmiererei’n für alle Welt,
Das ist ein schönes Handwerk, gelt,
Das führet zu dem Bettelsacke.
Altes Lied.
Wenige waren in meinem Geheimniß, als ich diese Erzählungen sammelte; auch ist es nicht wahrscheinlich, daß sie je bei Lebzeiten ihres Verfassers veröffentlicht werden. Wäre dieß auch zu erwarten, so geize ich nicht nach der ausgezeichneten Ehre, digito monstrarier. Ich gestehe es, daß, wäre es überhaupt rathsam, solche Träume zu hegen, ich es vorziehe, ungesehen hinter dem Vorhang zu bleiben, wie der geistreiche Lenker des Hans Wurst’s seine Grethel, und mich an dem Staunen und den Vermuthungen meines Publicums zu erlustigen. Dann hörte ich vielleicht, daß die Erzeugnisse des schlichten Peter Pattiesen, die der Kenner bewundert und der Liebhaber anstaunt, die Jugend Hinreißen und selbst das Alter anziehen, während die Kritik den Ruhm derselben mit irgend einem in der Literatur glänzenden Namen verbindet, und während die Fragen, wann und von wem diese Erzählungen geschrieben worden, die Gesprächspausen in hundert Gesellschaften und Versammlungen ausfüllen. Diesen Genuß werde ich bei meinen Lebzeiten nie haben, und über diese hinaus wird mich, das weiß ich gewiß, meine Eitelkeit nicht verleiten, nach demselben zu streben.
Ich bin zu starr in meiner Gewohnheit und zu wenig geglättet im Umgang, als daß ich nach der Ehre trachten oder geizen sollte, die meinen literarischen Zeitgenossen angethan wird. Ich würde mich um keinen Zoll höher schätzen, wenn man mich würdig finden sollte, für einen Winter in der großen Metropolis als Löwe aufzutreten. Ich könnte mich nicht erheben, im Kreise bewegen, und alle meine Auszeichnungen darlegen von der zottigen Mähne bis zum buschigen Schweif, euch anbrüllen im Ton der Nachtigall, und so mich wieder niederstrecken als ein wohlgesittetes Schauthier, und das Alles für eine elende Tasse Caffee und ein waffeldünnes Butterbrod. Uebel würden mir die ekelhaften Schmeicheleien behagen, womit die Dame des Hauses bei einer solchen Gelegenheit ihre Schauthiere überschüttet, gerade wie sie ihre Papageien mit Zuckererbsen stopft, um sie vor der Gesellschaft schwatzen zu machen. Alle diese Ehrenbezeugungen können mich nicht verführen, den Gaukler zu machen, und lieber wollte ich, wäre keine andere Wahl, wie der gefangene Simson all mein Leben in der Mühle bleiben, und mein eigenes Brod mahlen, als den Herrn Philistern und ihren Damen zur Kurzweile dienen. Der Grund davon ist weder wahre noch verstellte Gehässigkeit gegen die Aristokraten dieser Reiche. Indeß sie haben ihren Platz, ich den meinen, und wie der eiserne und irdene Topf in der alten Fabel, so können wir nicht in Berührung kommen, ohne daß ich in jeder Rücksicht den Schaden zu tragen hätte. Anders ist es mit dem Buch, das ich hier schreibe. Man mag es öffnen und weglegen nach Belieben; belustigt es die Großen beim Lesen, so erregt dies keine trügerische Hoffnung; wird es von denselben vernachlässigt oder verurtheilt, so wird dadurch kein Leid zugefügt. Wie selten aber können die Großen Umgang haben mit denen, die für ihre Ergötzung sich anstrengten, ohne das Eine oder das Andere zu thun!
In einer besseren und weiseren Seelenstimmung, die Ovid in einem seiner Verse ausdrückt, um sie in dem folgenden zu verläugnen, kann ich auf das Titelblatt dieses Buches schreiben:
Parve, nec invideo, sine me, liber, ibis in urbem.
Ich theile keineswegs den Schmerz des berühmten Verbannten, daß er das Buch, welches er auf den Markt der Wissenschaften, Vergnügungen und Ausschweifungen sandte, nicht in Person begleiten konnte. Gäbe es nicht tausend ähnliche Anlässe zur Ueberlegung, das Schicksal meines armen Freundes und Schulkameraden Dick Tinto wäre hinreichend, mich zu warnen, das Glück in dem Ruhme zu suchen, der sich einem glücklichen Bearbeiter der schönen Künste verbindet.
Dick Tinto war, als er sich Künstler schrieb, gewohnt, seine Abkunft von dem alten Geschlecht der Tinto in Lanarkshire herzuleiten, und gelegentlich deutete er an, daß er seinem edlen Blute etwas vergeben habe, da er den Pinsel für sein Haupterwerbmittel gewählt. Wenn der Stammbaum Dicks richtig war, so müssen einige seiner Ahnen einen desto schwereren Fall gethan haben, sintemal der gute Mann, sein Vater, das nothwendige und gewiß löbliche, aber sicher nicht ausgezeichnete Amt eines Dorfschneiders zu Langdirdum im Westen versah. Unter dem niedern Dache desselben kam Richard zur Welt, und bei Zeiten wurde er, obwohl ganz gegen seine Neigung, zu dem gemeinen Handwerk seines Vaters angehalten. Der alte Meister Tinto hatte jedoch keinen Grund, sich zu rühmen, den jugendlichen Genius bezwungen, und den natürlichen Hang desselben verändert zu haben. Es erging ihm wie dem Schulknaben, der die Röhren eines Brunnens mit den Fingern stopfen wollte, während der Strahl des Wassers, über den Druck erzürnt, in tausend unerwarteten Schüssen spritzte, und ihn für seine Mühe über und über benetzte. Ebenso erging es dem alten Tinto, wann sein hoffnungsvoller Lehrling nicht allein alle Kreide verbrauchte, um Zeichnungen auf den Werktisch zu machen, sondern sogar verschiedene Spottbilder auf seines Vaters beste Kunden auszuführen, die sich laut über das harte Schicksal beklagten, daß ihre Personen nicht allein verunstaltet würden durch den Schnitt des Vaters, sondern zugleich lächerlich gemacht durch die Malerei des Sohnes. Dies führte zu Verruf und Verlust der Kunden, bis der alte Schneider, dem Verhängniß weichend und auf Bitten seines Sohnes, demselben erlaubte, sein Glück auf einem anderen Wege zu suchen.
Ungefähr um diese Zeit war im Dorfe Langdirdum ein wandernder Bruder vom Borstenpinsel, der seinen Beruf sub Jove frigido ausübte, die Bewunderung aller Bauernbuben und vorzüglich Dick Tinto’s. Das Zeitalter hatte noch nicht mit anderen unedlen Ersparnissen die knauserige Gewohnheit angenommen, durch Schriftzüge den Mangel bildlicher Darstellung zu ersetzen, und die Jünger der schönen Künste eines leichten Unterrichts- und Erwerbsmittels dadurch zu berauben. Es war noch nicht erlaubt, auf den getünchten Thürgang eines Bierhauses oder auf ein Wirthshausschild zu schreiben »Zur Alten Atzel« oder »Zum Türkenkopf«, und das lustige Bild des gefiederten Plappermauls, oder die gerunzelte Stirn des furchtbaren Turbanträgers durch kalte Namen zu ersetzen. Dies jugendliche und schlichtere Zeitalter schenkte eine gleiche Achtung den Bedürfnissen aller Stände, und malte in allgemein verständlichen Bildern die Erfordernisse des Magens in der richtigen Voraussetzung, daß ein Mann, der keine Silbe lesen könne, dennoch ein eben so guter Biertrinker sein möge, als seine gebildeten Nachbarn oder der Pfarrer selbst. Diesem gemeinnützigen Grundsatze gemäß hängten noch die Wirthe die Sinnbilder ihres Berufs heraus, und die Schildmaler, wenn sie auch selten schmausten, starben wenigstens nicht vor Hunger.
Zu einem Meister dieses herabgekommenen Gewerbes gesellte sich, wie gesagt, Dick Tinto, und begann, wie es bei den göttlichen Genies in diesem Feld der schönen Künste Gebrauch ist, zu malen, ehe er einen Begriff vom Zeichnen hatte.
Seine Beobachtungsgabe brachte ihn bald dahin, die Fehler seines Meisters zu verbessern, und sich über die Lehren desselben aufzuschwingen. Er glänzte vorzüglich in bunten Pferden, was ein Lieblingsbild in den schottischen Dörfern war, und bei der Untersuchung seiner Fortschritte bemerkte man mit Vergnügen, wie er den Rücken dieser edlen Thiere immer kürzer machte und die Beine immer länger, so daß sie endlich einem Krokodille unähnlicher wurden und einem Klepper ähnlicher. Die Verläumdung, welche das Verdienst immer mit Schritten verfolgt, die mit dem Voraussein desselben im Verhältniß sind, hat freilich behauptet, daß Dick einmal ein Pferd mit fünf Beinen gemalt habe, statt mit vieren. Ich könnte seine Vertheidigung auf die Freiheit gründen, die man diesem Zweige seiner Kunst einräumt, und die, wie sie andere seltsame und unpassende Zusammensetzungen erlaubt, so weit ausgedehnt werden dürfte, einem geliebten Geschöpf ein überzähliges Bein zuzueignen. Jedoch die Sache eines erblichenen Freundes ist heilig; und ich verschmähe es, dieselbe so oberflächlich zu behandeln. Ich habe das fragliche Schild besucht, das noch heute zu Langdirdum in den Lüften schwebt, und ich kann es mit einem Eid bekräftigen, daß, was man fälschlich oder mit Falschheit für das fünfte Bein des Pferdes angenommen hat, in der That der Schweif dieses vierfüßigen Thieres ist, der, wenn man ihn mit der Stellung vergleicht, worin das Thier gehalten worden, ein Umstand wird, der von einer großen und mächtigen, obwohl verwegenen Kunst zeugt. Der Klepper ist dargestellt in erhobener, springender Bäumung; der bis zur Erde reichende Schweif scheint eine point d’appui zu bilden, und gibt der Gestalt die Sicherheit eines Dreifußes, ohne welches es unmöglich wäre zu begreifen, wie der Renner, ohne rückwärts zu stürzen, in seiner Stellung Stand halten könne. Dieß kühne Erzeugnis ist zum Glück in die Hände eines Mannes gekommen, der es zu schätzen weiß, denn als Dick bei größerer Reife daran zu zweifeln begann, ob eine so starke Abweichung von den gewöhnlichen Kunstregeln zu billigen sei, und als er das Portrait des Wirthes selbst als Austausch gegen diesen jugendlichen Versuch ausführen wollte, wurde das großmüthige Anerbieten von dem klugen Besitzer abgelehnt, der, scheint’s, bemerkt hatte, daß, wenn sein Bier die Gäste nicht zufrieden stellte, ein Blick auf sein Schild sie sicher in gute Laune versetzte.
Es wäre meinem jetzigen Ziele fremd, die Fortschritte zu zeigen, die Dick Tinto im Malen machte, und wie er die Ausschweifung einer feurigen Einbildung durch die Regeln der Kunst verbesserte. Die Schuppen fielen ihm von den Augen, als er die Zeichnungen eines Zeitgenossen sah, des schottischen Teniers, wie man Wilkie mit Recht genannt hat. Er warf den Borstenpinsel zu Boden, ergriff das Bleistift, und verfolgte unter Hunger und Mühe, unter Sorgen und Ungewißheit den Weg seines Berufes unter besseren Auspicien als die seines ersten Meisters. Dennoch werden die ersten rohen Versuche seines Genies (gleich den Ammenliedern von Pope, würden sie wieder aufgefunden) den Jugendfreunden von Dick Tinto theuer bleiben. Ueber der Thüre eines geringen Wirthshauses im Barkwyed von Gandercleugh sieht man eine gemalte Trinkkanne und einen Bratrost – doch ich fühle, ich muß mich von diesem Gegenstand losreißen, oder zu lange dabei verharren.
Bei seinen Sorgen und Nöthen machte es Dick Tinto wie seine Zunftbrüder, indem er die Taxe von der menschlichen Eitelkeit erhob, die er dem Geschmack und der Freigebigkeit nicht abgewinnen konnte – mit einem Wort, er malte Portraits. Es war auf diesem höheren Standpunkt, als Dick sich bereits über sein erstes Handwerk, von dem er gar nicht reden hören wollte, erhoben hatte, daß wir nach jahrelanger Trennung in dem Dorfe Gandercleugh wieder zusammentrafen, ich in meiner jetzigen Stellung, und Dick als Kopist des menschlichen Ebenbildes Gottes, eine Guinee per Kopf. Das war ein geringer Preis, doch bei dem Geschäftsanfang für Dicks bescheidene Ansprüche mehr als hinreichend, so daß derselbe in Wallace Inn ein Zimmer bewohnte, ungestraft seine Possen selbst mit meinem Wirthe riß, und mit der Stubenmagd, dem Stallknecht und dem Kellner in allen Ehren lebte.
Diese Glückstage waren zu heiter, als daß sie hätten dauern können. Als S. Ehren der Laird von Gaudercleugh mit seinem Weibe und drei Töchtern, der Geistliche, der Aicher, mein geschätzter Patron Mr. Jedediah Cleishbotham und etwa ein Dutzend Pächter durch den Pinsel Tinto’s der Unsterblichkeit übergeben waren, begann die Kundschaft zu mangeln, und es war unmöglich, mehr als Kronen und halbe Kronen den harten Händen der Bauern abzuringen, welche die Eitelkeit zu Dicks Malerstube führte.
War nun der Himmel auch bewölkt, es erfolgte eine Zeit lang doch noch kein Sturm. Mein Wirth hatte christliche Nachsicht mit einem Miether, der, so lange er die Mittel hatte, immer ein guter Bezahler gewesen war. Auch das Portrait unseres Wirthes, von Weib und Töchtern umgeben, in der Manier von Rubens, das plötzlich in dem besten Saale zum Vorschein kam, machte es deutlich, daß Dick eine Art von Tauschhandel für die Lebensbedürfnisse gefunden hatte.
Nichts ist jedoch unsicherer, als dergleichen Nothmittel. Man bemerkte, daß nun Dick seinerseits der Wetzstein des Witzes unseres Wirthes wurde, ohne daß er es wagte, sich zu vertheidigen und zu erwidern; daß seine Staffelei in eine Dachstube gebracht wurde, wo sie kaum aufrecht stehen konnte, und daß er nicht mehr den Wochenclub besuchte, dessen Seele er sonst gewesen. Kurz, seine Freunde fürchteten, daß er es wie das Faulthier gemacht habe, das, nachdem es das letzte grüne Blatt von dem Baume, worauf es sich niedergelassen, gefressen hatte, herunterstürzte und Hungers starb. Ich wagte es, dies dem Dick zu bemerken, ich rieth ihm, sein schätzbares Talent an einem andern Orte geltend zu machen, und eine Gemeine zu verlassen, die er, wie man sagen könnte, rein aufgespeist habe.
»Ich bin verhindert, meinen Wohnplatz zu ändern,« sagte mein Freund mit einem feierlichen Ausdruck, indem er meine Hand faßte.
»Ich fürchte, eine Rechnung meinem Wirthe schuldig?« sagte ich mit herzlicher Theilnahme; »wenn irgend ein Beitrag meiner geringen Mittel in dieser Verlegenheit dienen kann –«
»Nein, bei der Seele von Sir Josua!« antwortete der brave Junge, »ich will nimmer meine Freunde in mein eigenes Mißgeschick verwickeln. Ich weiß ein Mittel, meine Freiheit wieder zu gewinnen, und besser ist’s, selbst durch eine Cloake zu kriechen, als im Gefängniß zu bleiben.«
Ich verstand es nicht völlig, was mein Freund meinte. Die Muse der Malerei hatte ihn stecken lassen, und welche andere Göttin er in seiner Noth anrufen konnte, war mir ein Geheimniß. Wir schieden jedoch ohne weitere Erklärung, und ich sah ihn erst nach drei Tagen wieder, als er mich einlud, dem Abschiedsschmause beizuwohnen, womit sein Wirth ihn vor seiner Abreise nach Edinburg beehren wolle.
Ich fand Dick sehr aufgeräumt; er pfiff, während er den kleinen Ranzen schnallte, der seine Farben, Pinsel, Palette und reine Wäsche enthielt. Daß er in dem besten Vernehmen mit meinem Wirthe schied, war an dem kalten Rindfleisch, das im kleinen Saal, in der Mitte zweier Kannen herrlichen, starken Bieres aufgetragen war, abzunehmen, und ich gestehe, daß ich begierig war, zu erfahren, durch welche Mittel die Verhältnisse meines Freundes so schnell eine verbesserte Gestalt gewonnen hätten. An ein Bündniß mit dem Bösen konnte ich bei Dick nicht denken, und durch welche irdischen Mittel er sich so glücklich geholfen, konnte ich mit allen meinen Muthmaßungen nicht finden.
Er bemerkte meine Neugier, und nahm mich bei der Hand. »Freund,« sagte er, »gern würde ich es sogar Euch verhehlen, welche Herabwürdigung ich mir gefallen lassen mußte, um von Gandercleugh mit Ehren fortzukommen. Doch was nützt es, das verbergen zu wollen, was sich nothwendig durch seine ausgezeichnete Größe verräth? Das ganze Dorf, das ganze Kirchspiel, die ganze Welt wird es bald erfahren, in welche Armuth Richard Tinto versunken ist.
Ein plötzlicher Einfall fuhr mir durch den Sinn. Ich hatte bemerkt, daß unser Wirth an jenem denkwürdigen Morgen ein Paar ganz neue Hosen von Velveteen trug, anstatt seiner alten von Thickset.
»Was,« sagte ich, indem ich meine rechte Hand mit aneinandergepreßtem Zeigefinger und Daumen flüchtig von der rechten Hüfte nach der linken Schulter bewegte, »Ihr habt eingewilligt, die Kunst Eures Vaters, für die Ihr zuerst bestimmt waret, wieder auszuüben, – lange Näthe, nicht wahr, Dick?«
Er wies diese unglückliche Vermuthung mit gerunzelter Stirne und einem Schnalzer ab, beides Zeichen tiefer Verachtung, und nachdem er mich in ein anderes Zimmer geführt, zeigte er mir das an die Wand gelehnte, majestätische Haupt von Sir William Wallace, gräßlich, wie vom Rumpfe getrennt auf Befehl des Verräthers Eduard.
Dies Gemälde war auf Brettern von ziemlicher Dicke ausgeführt, die oben mit Eisen verziert waren, um das ehrwürdige Bild auf eine Schildpfoste zu hängen.
»Hier, mein Freund,« sagte er, »steht der Ruhm Schottlands und meine Schande, doch nein, eher die Schande derer, die, statt die Kunst in ihrem Kreise zu begünstigen, sie zu diesen unwürdigen und verächtlichen Verirrungen verleiten.«
Ich versuchte den Unwillen meines entwürdigten und entrüsteten Freundes zu kühlen. Ich stellte ihm vor, daß er nicht, wie der Hirsch in der Fabel, die Eigenschaft verachten dürfe, die ihn aus der Verlegenheit gerettet, woraus ihn sein Talent als Portrait- und Landschaftsmaler nicht hätte ziehen können. Besonders pries ich Plan und Ausführung seines Gemäldes, und bemerkte ihm, daß er sich, anstatt sich zu schämen über die öffentliche Ausstellung eines so herrlichen Zeichens seines Talentes, vielmehr über die Vergrößerung seines Ruhmes, zu der diese öffentliche Ausstellung gewiß Gelegenheit geben müsse, Glück zu wünschen habe.
»Ihr habt Recht, mein Freund – Ihr habt Recht,« versetzte der arme Dick, und sein Auge funkelte vor Wonne, »warum sollte ich den Namen eines – eines (er suchte nach einem Wort) – eines Thür- und Thormalers scheuen? Hat sich nicht Hogarth selbst in diesem Charakter in einem seiner besten Stiche gezeigt? – Domenichino oder ein anderer in alten Zeiten – Moreland in der unsrigen – haben ihre Talente in diesem Fache geprüft. Und warum die Ausstellung von Kunstwerken, die auf alle Stände mächtig zu wirken im Stande sind, auf die Reichen und Vornehmen allein beschränken? Man errichtet Statuen unter freiem Himmel, warum sollte die Malerei in der Aufzeigung ihrer Meisterstücke karger thun als ihre Schwester, die Bildhauerkunst? Und doch, mein Freund, wir müssen uns sogleich trennen, in einer Stunde kommt der Zimmermann, um das – das Schild aufzuhängen; aber wahrhaftig, trotz meiner Philosophie und Eures tröstlichen Zuspruchs will ich lieber Gandercleugh verlassen, ehe die Operation beginnt.«
Wir wohnten dem Abschiedsschmause unseres lustigen Wirthes bei, und ich begleitete Dick auf seinen Weg nach Edinburg. Wir trennten uns über eine Weile vom Dorf, gerade als wir den Jubel der Buben vernahmen, der die Aufrichtung des neuen Wallace-Kopfes ankündigte. Dick Tinto stellte sich so, daß er nichts hören konnte – so wenig hatte ihn alte Uebung und neue Philosophie mit dem Stand eines Schildmalers befreundet.
In Edinburg wurden Dicks Talente entdeckt und anerkannt, und er erhielt Einladungen und Winke von verschiedenen Kennern der schönen Künste. Aber diese Herren theilten lieber ihre Kritik als ihr Geld mit, und Dick brauchte eher Geld als Kritik. Er suchte darum nach London zu kommen, dem großen Markt des Talents, wo, wie an allen solchen Plätzen, der Waarenvorrath in allen Gattungen größer ist als die Zahl der Käufer.
Dick, der im Ernste für ein großes Naturtalent in seinem Fache galt, und dessen eitles, feuriges Gemüth nie an einem endlichen Gelingen verzweifelte, stürzte sich blindlings unter die Menge, die um Ansehen und Vorzug rang. Er theilte Stöße aus, nahm Stöße ein, und erfocht sich kraft seiner Beharrlichkeit ein gewisses Ansehen: er malte um den Preis des Instituts, er stellte Gemälde aus in Somerset-Haus, und wünschte den Ausschuß zum Henker. Aber der arme Dick war bestimmt, das Feld, wo er so ritterlich focht, zu verlieren. In den schönen Künsten giebt’s keine andere Wahl, als gänzliches Gelingen oder völliges Verlieren, und da Dicks Eifer und Geschick das erste nicht erringen konnte, so mußte er in die üble Lage kommen, welche die natürliche Folge des zweiten war. Er wurde eine Zeitlang von einigen jener feinen Kenner begünstigt, die aus dem Seltsamen eine Tugend machen, und ihre Meinung in Geschmackssachen und Kunsturtheilen gegen die einer ganzen Welt behaupten. Aber diese wurden des armen Tinto’s bald müde, und ließen ihn als eine Last fallen, gerade wie ein verzärteltes Kind sein Spielzeug wegwirft. Mangel, fürcht’ ich, hat ihn hingerafft, und zu einem frühen Grabe begleitet, zu welchem man ihn hintrug aus einer finsteren Wohnung in Swallow-Street, wo ihn seine Wirthin um den Miethzins plagte von innen und Gerichtsdiener auf ihn fahndeten von außen, bis ihn der Tod von Allem erlöste. Ein Winkel in der Morning-Post bemerkte seinen Tod mit dem Zusatz, daß seine Manier ein großes Genie verrathen, obgleich sein Styl skizzenhaft gewesen sei, und bezog sich auf eine Anzeige, worin Mr. Varnish, ein bekannter Kunsthändler, ankündigte, daß er noch eine geringe Anzahl von Zeichnungen und Gemälden von Richard Tinto, Esquire, besitze, welche ohne Aufschub zu besichtigen, der Adel und die schöne Welt, wenn sie ihre Sammlungen mit neueren Kunstsachen vervollständigen wollten, eingeladen wurden. So endete Dick Tinto! ein trauriger Beweis der großen Wahrheit, daß Mittelmäßigkeit in den schönen Künsten nicht erlaubt ist, und daß der, welcher die höchste Staffel der Leiter nicht erreichen kann, am besten thut, den Fuß ganz und gar nicht darauf zu setzen.
Tinto’s Andenken ist mir theuer, wenn ich mich an die Unterhaltungen erinnere, die ich mit ihm hatte, die sich gewöhnlich um meinen gegenwärtigen Gegenstand drehten. Er freute sich über meinen Fortschritt, und sprach von einer verzierten Prachtausgabe mit Köpfen, Vignetten und culs de lampe, alle von seinem landsmann- und freundschaftlichen Pinsel. Ein alter, invalider Unteroffizier saß ihm zu dem Bilde von Bothwell, Leibwächter Karls II., und der Glöckner von Gandercleugh zu dem von David Deans. Doch während er so seine Kräfte mit den meinigen zur Verschönerung dieser Erzählungen vereinte, mischte er zu den Lobsprüchen, die ihm meine Arbeiten entrissen, manche Dosis einer heilsamen Kritik.
»Eure Personen,« sagte er, »mein lieber Pattieson, machen zu viel Gebrauch von ihrem Schnabel, sie klappern zu viel (gewählte Ausdrücke, die Dick als Theatermaler bei einer wandernden Bande aufgeschnappt hatte) – ganze Seiten sind voll Gewäsch und Gespräch.«
»Ein alter Weltweise,« versetzte ich, »pflegte zu sagen: sprich, damit ich dich erkennen lerne; und wie könnte ein Autor seine personas dramatis lebendiger und eindringlicher seinen Lesern vorführen, als gerade durch’s Gespräch, worin jeder seinen eigenthümlichen Charakter am besten schildert.«
»Das ist ein falscher Schluß,« sagte Tinto, »ich hasse ihn, Peter, gleich einer leeren Kanne. Ich gebe es zu, daß die Sprache in der Darstellung menschlicher Verhältnisse von Wichtigkeit ist, und ich will mich nicht bei dem Lehrsatze des pythagoreischen Schöpplers verweilen, welcher glaubte, daß Worte bei einer Flasche der Unterhaltung schadeten. Aber ich glaube es nicht, daß ein Künstler sein darzustellendes Gemälde in ein Gespräch einkleiden dürfe, in der Absicht, desto lebendiger und eindringlicher auf den Leser zu wirken. Im Gegentheil, die Mehrzahl Eurer Leser, Peter, – sollten je diese Erzählungen veröffentlich werden, – soll richten, ob Ihr nicht eine Seite voll Gespräch für jedes einfache Bild, das in ein paar Worten hätte dargestellt werden mögen, gegeben habt, während Stellung, Handlung und Vorfall, richtig gezeichnet und mit der angemessenen Färbung, alles Nöthige ausgedrückt haben würden, und uns mit den schleppenden sagte er und sagte sie verschont hätten, womit es Euch beliebt hat, Eure Seiten zu überladen.«
Ich antwortete, daß er die Arbeit des Pinsels und die der Feder für einerlei halte, daß die lichte und stille Kunst, wie einer unserer vornehmsten lebenden Dichter die Malerei nenne, nothwendig an das Auge sich wende, weil sie zu dem Ohre nicht sprechen könne, während die Poesie und jede ihr anverwandte Kunst gerade umgekehrt verfahren müsse, und sich an das Ohr wende, um die Theilnahme zu finden, die sie von dem Auge nicht erlangen könne.
Dick war durch meine Beweisführung nicht geschlagen, die, wie er behauptete, auf einer falschen Vorstellung beruht. Beschreibung, sagte er, wäre für einen Romanschreiber gerade das, was Zeichnung und Färbung für einen Maler wären; Worte wären seine Farben, und bei richtiger Anwendung könnten dieselben nicht verfehlen, das darzustellende Bild so lebhaft dem geistigen Auge anschaulich zu machen, wie es die Leinwand dem leiblichen Auge machte. Die nämlichen Regeln, behauptete er, seien beiden Künsten gemein, und zu häufiges Gespräch sei in der ersteren schwülstig und schleppend, und drohe die erzählende Kunst mit der dramatischen zu verwechseln, die doch von jener weit verschieden sei, weil das Wesen des Drama im Gespräch bestehe, angesehen Alles, ausgenommen das Gespräch, dem Auge durch die Kleidung, die Personen und die Handlung der Schauspieler versinnlicht würde. Aber so wie es, sagte Dick, nichts langweiligeres gibt, als eine lange Erzählung mitten in einem Drama, so ist, wo Ihr Euch durch Mittheilung langer Gespräche der dramatischen Dichtkunst genähert habt, der Lauf Eurer Gespräche frostig und gezwungen, und Ihr verliert die Gewalt, die Aufmerksamkeit zu fesseln und die Einbildung zu reizen, worin Ihr bei anderen Gelegenheiten so ziemlichen Erfolg gehabt habt.
Ich machte meinen Bückling für das Compliment, und erklärte mich geneigt, wenigstens den Versuch einer geraderen und kürzeren Darstellungsweise zu machen, nach welcher meine Personen mehr handeln und weniger sprechen sollten, als in meinen früheren Arbeiten der Fall gewesen. Dick nickte mir Beifall, und sagte, da er mich so gelehrig finde, so wolle er mir zum Besten meiner Muse einen Gegenstand mittheilen, den er mit Absicht auf seine eigene Kunst studirt habe.
»Der Volksglaube,« sagte er, »hält diese Geschichte für wahr; aber da mehr als ein Jahrhundert seitdem verlaufen ist, so kann man mit Recht einige Zweifel in die Richtigkeit der Einzelnheiten setzen.«
Als Dick Tinto so gesprochen, durchstöberte er sein Portefeuille, um die Skizze zu suchen, nach welcher er ein Gemälde von 14 Fuß Höhe und 8 Fuß Breite ausführen wollte. Die Skizze, die, einen angemessenen Ausdruck zu gebrauchen, sauber ausgeführt war, zeigte eine alterthümliche Halle, eingerichtet und verziert im Geschmack des Zeitalters der Königin Elisabeth. Das Licht fiel durch den oberen Theil eines hohen Fensters auf ein Frauengesicht von wunderbarer Schönheit, das mit dem Ausdruck des stummen Schreckens auf den Ausgang eines Gesprächs zwischen zwei anderen Personen zu warten schien. Die eine war ein junger Mann, in dem Vandyk’schen Kostüm des Zeitalters Karl I., der mit dem Ausdruck ungehaltenen Stolzes, wie die Hebung des Kopfes und die Ausstreckung des Armes zu erkennen gab, eher ein Recht als eine Gunst zu fordern schien von einer Lady, die ihrem Alter nach, und nach einer gewissen Aehnlichkeit der Züge, die Mutter der jungen Dame zu sein schien, die mit einem Ausdruck von Mißfallen und Aerger zuhörte.
Tinto brachte seine Skizze mit der Miene stillen Triumphs hervor, und betrachtete sie mit Blicken, wie ein eitler Vater sein hoffnungsvolles Kind betrachtet, während er sich den Stand vormalt, den dasselbe eines Tages in der Welt einnehmen, und die Höhe, zu welcher es den Ruhm der Familie steigern würde. Er hielt es auf Armslänge von mir, – er hielt es näher, – er legte es auf eine Commode, schloß die unteren Fensterladen, um ein herabfallendes, günstiges Licht zu erhalten, – er bedeckte sein Gesicht mit der Hand, um außer seinem geliebten Gegenstände nichts weiter zu sehen, – er verdarb endlich eines Kindes Schreibbuch, das er zusammenrollte, und als Sehrohr gebrauchte. Ich glaube, die Ausbrüche meines Entzückens waren nicht im Verhältniß mit denen des seinigen, denn er rief mit Heftigkeit aus: »Mr. Pattieson, ich habe die Meinung, Ihr hättet Augen im Kopf.«
Ich behauptete meinen Anspruch aus den natürlichen Besitz der Sehwerkzeuge.
»Bei meiner Ehre,« sagte Dick, »ich würde schwören, daß Ihr blind geboren seid, da Ihr den Sinn und die Bedeutung dieser Skizze nicht auf den ersten Blick errathen habt. Ich will mein eigenes Werk nicht preisen, das mögen Andere thun; ich erkenne meine Schwächen und ich weiß, daß meine Zeichnung und mein Colorit mit der Zeit, die ich der Kunst widmen werde, gewinnen sollen. Aber die Auffassung – der Ausdruck – die Stellung erzählen die Geschichte einem jeden, der die Skizze anblickt, und wenn ich das Gemälde vollenden kann, ohne die Urauffassung zu schwächen, dann soll der Name Tinto’s von keinen neidischen, falschen Nebeln länger verdunkelt bleiben.«
Ich versetzte, daß ich die Skizze ungemein bewundere, aber daß ich nothwendig von dem Gegenstand unterrichtet sein müsse, um ihren vollen Werth zu verstehen.
»Das ist es gerade, was ich bedaure,« antwortete Tinto, »Ihr habt Euch allzusehr an das allmälige Lichtwerden gewöhnt, daß Ihr unfähig geworden seid, bei jenem plötzlichen, hellleuchtenden Blitzstrahle zu sehen, der den Geist erleuchtet beim bloßen Anschauen eines guten, ausdrucksvollen Bildes, und der aus Stellung, Haltung und Ausdruck des Augenblicks nicht allein das vergangene Leben und die innigsten Verhältnisse der dargestellten Personen erklärt, sondern sogar den Schleier ihrer Zukunft durchbricht, und einen scharfen Blick auf ihre künftigen Schicksale gewährt.«
»In diesem Fall,« versetzte ich, »übertrifft die Malerei den Affen des berühmten Gines von Passamont, der nur die Gegenwart und Vergangenheit kannte, ja sie übertrifft die Natur selbst, welcher sie ihre Gegenstände abborgt, denn ich betheure Euch, Dick, daß, wäre es mir erlaubt, einen Blick in dieses Elisabethzimmer selbst zu werfen, und daselbst Eure skizzirten Personen in Fleisch und Blut zu sehen, ich würde um kein Haar ihre Verhältnisse näher kennen als jetzt, wo ich Eure Skizze betrachte. Nur der schmachtende Blick der jungen Lady und die Sorge, die Ihr angewandt habt, dem jungen Herrn recht schöngebildete Schenkel zu geben, läßt mich vermuthen, daß es sich von einer Liebessache zwischen Beiden handelt.«
»Habt Ihr wirklich eine so kühne Vermuthung?« sagte Tinto. »Und der ernste Unwillen, womit der Mann sein Gesuch anbringt – die stille, duldende Verzweiflung der jüngeren Dame – der strenge Ausdruck eines unbeugsamen Entschlusses in der ältern Frau, deren Blicke das Bewußtsein, unrecht zu handeln, und den festen Willen, auf dem eingeschlagenen Wege zu beharren, zugleich ausdrücken.«
»Wenn ihre Blicke das Alles ausdrücken, mein lieber Tinto,« unterbrach ich ihn, »dann erreicht Euer Pinsel die dramatische Kunst von Mr. Puff in der Kritik, der eine vollständig zusammengesetzte Phrase in das bedeutsame Kopfschütteln von Lord Burleigh setzte.«
»Mein lieber Freund Peter,« versetzte Tinto, »ich sehe, Ihr seid nicht zu bessern, jedoch ich bedaure Eure Verblendung, und will Euch des Vergnügens nicht berauben, mein Gemälde zu verstehen, und zu gleicher Zeit einen Stoff für Eure Feder zu gewinnen. Erfahret denn, daß ich letzten Sommer, während ich an der Küste von East-Lothian und Berwikshire Skizzen aufnahm, in die Berge von Lammermoor verlockt wurde, weil man mir von den dortigen Alterthümern gesprochen. Was mich am meisten dort in Erstaunen setzte, waren die Trümmer eines alten Schlosses, worin dieses Elisabethzimmer, wie Ihr es nennt, einst befindlich war. Ich blieb einige Tage in einem Pachthause in der Nähe, wo die betagte Hausfrau mit der Geschichte des Schlosses und den daselbst vorgefallenen Dingen wohl vertraut war. Eine von diesen Geschichten war so seltsam und anziehend, daß meine Aufmerksamkeit getheilt wurde durch den Wunsch, die alten Trümmer als Landschaft zu zeichnen, und die seltsamen Vorfälle, welche daselbst stattgefunden, in einem historischen Bilde darzustellen. Hier sind meine Notizen,« sagte der arme Dick, ein Päckchen loser Papiere haltend, die bald vom Pinsel beschmiert, bald von der Feder bekritzelt waren, so daß Spottbilder, kleine Thürmchen, Mühlen, alte Spitzdächer und Taubenschläge mit den geschriebenen Denkwürdigkeiten um den Platz stritten.
Ich unternahm es jedoch, das Wesentliche der Handschrift, so gut ich konnte, zu entziffern, und webte es in die folgende Erzählung, in welcher ich zum Theil, obwohl nicht ganz, den Rath meines Freundes Tinto zu befolgen suchte, mehr beschreibend als dramatisch zu sein. Meine Lieblingsneigung hat mich jedoch bisweilen überrascht, und meine Personen, gleich vielen andern in dieser Plauderwelt, sprechen dann und wann weit mehr als sie handeln.
ZWEITES KAPITEL
Inhaltsverzeichnis
Gut, Lords, wir haben dessen nicht Gewinn;
Daß jetzt die Feinde floh’n, ist nicht genug:
Denn so sich zeigen, ist nicht ihre Art.
Heinrich VI. Zweiter Theil.
Am Eingang einer Bergschlucht, die sich von der fruchtbaren Ebene von East Lothian erhebt, stand in alten Zeiten ein geräumiges Schloß, von dem man heute nur noch die Trümmer sieht. Die Besitzer desselben waren mächtige und streitbare Barone, die, wie das Schloß selbst, den Namen Ravenswood führten. Ihr Geschlecht reichte in’s graue Alterthum, und war verschwägert mit den Douglas, Hunie, Swinton, Hay und anderen mächtigen und edlen Familien des Landes. Ihre Geschichte vermischte sich oft mit der von Schottland, dessen Jahrbücher ihrer Thaten gedenken. Das Schloß Ravenswood, das einen Paß zwischen Berwickshire oder der Merse, wie die südöstlichste Provinz von Schottland genannt wird, und den Lothian besetzte, ja gewissermaßen beherrschte, war von Wichtigkeit, sowohl bei äußerem Krieg als bei innerer Zwietracht. Es wurde oft mit Nachdruck angegriffen, und mit Hartnäckigkeit vertheidigt, und mit der Zeit spielten seine Besitzer eine große Rolle in der Geschichte. Aber ihr Haus hatte seine Wechselfälle, wie alle Dinge unter der Sonne; es kam um die Mitte des siebenzehnten Jahrhunderts von seinem Glanze sehr herunter; und gegen die Zeiten der Revolution sah sich der letzte Besitzer des Schlosses Ravenswood gezwungen, seinen alten Familiensitz zu verlassen, und sich nach einem einsamen, vom Meer geschlagenen Thurme zurückzuziehen, der, auf dem traurigen Gestade zwischen Saint Abb’s Head, und dem Dorfe Eyemouth gelegen, auf das einsame und brausende, deutsche Meer hinaussah. Ein trauriger Bezirk von wildem Weideland umgab die neue Residenz, und bildete den Ueberrest des alten Besitzthums.
Lord Ravenswood, der Erbe des gesunkenen Geschlechtes, war weit genug davon entfernt, seinen Sinn nach seinen neuen Verhältnissen zu beugen. Im bürgerlichen Kriege 1689 war er auf Seiten der Besiegten, und obwohl er der Strafe an Leib und Land entging, so wurde sein Blut doch von ihr getroffen, und sein Titel vernichtet. Nur aus Höflichkeit nannte man ihn noch Lord Ravenswood.
Dieser entadelte Lord hatte allen Stolz und Hochmuth, obwohl nicht den Reichthum, seines Hauses geerbt, und da er den endlichen Verfall seiner Familie einer Person zuschrieb, so belud er dieselbe mit seinem ganzen Haß. Dies war der nämliche Mann, der nun durch Kauf Eigenthümer von Ravenswood und von allen Domänen, die der Erbe des Hauses verloren hatte, geworden war. Er stammte von einer Familie, die weit jünger war als die von Lord Ravenswood, und die sich erst während der bürgerlichen Kriege zu Macht und politischem Ansehen erhoben hatte. Er selbst war zum Staatsdienst erzogen worden, und hatte im Staate hohe Aemter bekleidet, doch immer die Rolle eines Mannes behauptet, der in dem trüben Wasser eines von Parteien zerrissenen, und von Stellvertretern beherrschten Staates geschickt zu fischen weiß, und der es versteht, große Summen in einem Lande aufzuhäufen, wo des Geldes nur wenig zu sammeln ist, und der eben so wohl den Werth des Reichtums und die Mittel, ihn zu vermehren, kennt, als es versteht, sich desselben als eines Werkzeugs zur Vergrößerung seiner Macht und seines Einflusses zu bedienen.
Mit diesen Eigenschaften und Gaben war er ein gefährlicher Feind für den stolzen, unbesonnenen Ravenswood. Ob er ihm eine gültige Ursache für den Haß gegeben habe, womit der Baron ihn betrachtete, darüber sprachen die Leute verschieden. Einige sagten, die Feindschaft habe ihren alleinigen Grund in der Eifersucht und dem Neide von Lord Ravenswood, der gutwillig keinen Anderen, wäre es auch durch ehrlichen Kauf, Besitzer der Güter und des Schlosses seiner Vorfahren werden sehen könne. Aber die meisten, gewohnt, den abwesenden Reichen zu verunglimpfen, wie dem anwesenden zu schmeicheln, behaupteten eine weniger liebreiche Meinung. Sie sagten, daß der Lord Keeper (denn zu dieser Höhe war Sir William Ashton aufgestiegen) vor dem Kaufabschluß der Herrschaft von Ravenswood mit dem letzten Besitzer derselben in bedeutenden Geldgeschäften betheiligt gewesen sei, und indem sie mehr Andeutungen als klare Auskunft über ihre Vermuthung gaben, fragten sie, welcher der Betheiligten wahrscheinlich im Vortheil gewesen sei bei Aufstellung und Begründung der aus diesen verwickelten Geschäften entspringenden Forderungen, und dann machten sie es mehr als bemerklich, welche Vortheile der kalte Rechtsgelehrte, der geschickte Staatsmann nothwendig vor dem hitzigen und unbesonnenen Manne voraus habe, den er in juristische Netze und finanzielle Stricke verwickelt.
Der Geist jener Zeiten bestärkte dergleichen Argwohn. In diesen Tagen war kein König in Israel. Seit Jakob VI. abgereist war, die reichere und mächtigere Krone von England aufzusetzen, gab es in Schottland streitende Parteien unter dem Adel, von denen abwechselnd die eine oder die andere die oberherrliche Gewalt ausübte, je nachdem die Ränke der einen oder der anderen am Hofe von St. James den Sieg erhielten. Die Uebel, welche dies Regierungssystem begleiteten, gleichen denen, welche die Pachter irischer Güter, des Eigenthums eines Abwesenden, niederdrücken. Es gab keine höchste Gewalt, die ein gemeinschaftliches Interesse mit der großen Gesammtheit forderte und besaß, an die sich der Unterdrückte hätte wenden mögen, um Recht oder Schutz zu finden gegen untergeordnete Tyrannei. Ein Monarch, sei er noch so stumpf, noch so selbstsüchtig, noch so sehr geneigt zur unumschränkten Herrschaft, muß in einem freien Lande, wo sein Interesse so gänzlich mit dem der Gesammtheit verknüpft ist, und wo sich die üblen Folgen eines entgegengesetzten Betragens so nah’ und so mächtig zeigen, durch gewöhnliche Politik sowohl, als durch gewöhnliches Gefühl zur Erkenntniß gelangen, daß das Recht gleichmäßig ausgetheilt, und daß der Thron auf Gerechtigkeit gegründet werden müsse. Selbst anerkannte Despoten und Tyrannen sind in ihrer Rechtspflege zwischen ihren Unterthanen streng gewesen, wenn in der Sache ihre eigene Macht und ihre Leidenschaften nicht im Spiele waren.
Ein anderes ist es, wenn die oberherrliche Gewalt durch das Haupt einer von einem Nebenbuhler beständig angefeindeten aristokratischen Partei ausgeübt wird. Die wenig dauernde und unsichere Gewalt muß hier angewandt werden zur Belohnung der Anhänger, zur Erweiterung des Einflusses, zur Unterdrückung und Vernichtung der Widersacher. Selbst Aban Hassan, der uneigennützigste aller Vicekönige, vergaß nicht, während seines eintägigen Caliphats, ein Geschenk von tausend Goldstücken an seinen eigenen Haushalt zu senden, und die schottischen Viceregenten, die ihre Macht der Anstrengung ihrer Anhänger verdankten, verfehlten es nicht, ähnliche Belohnungen zu spenden.
Die Rechtspflege namentlich wurde durch die größte Parteilichkeit geschändet. Kaum gab es einen bedeutenden Rechtsstreit, wo nicht die Ritter Anlaß zur Parteilichkeit gefunden hätten, und sie waren so wenig fähig, der Versuchung zu widerstehen, daß das Sprüchwort – Zeige mir den Mann, so zeig’ ich dir das Recht, eben so gewöhnlich wurde, als es ärgerlich war. Das eine Verderbniß führte zu anderen, die gröber und schimpflicher waren. Der Richter, der sein Ansehen hergab, bald um einen Freund zu unterstützen, bald um einen Feind niederzuschlagen, und dessen Urtheile auf politische oder auf Familien-Verbindungen gegründet waren, konnte nicht als dem Eigennutze und der Selbstsucht unzugänglich angesehen werden; und man glaubte nur zu oft, daß die Börse des Reichen in der Wagschale die Sache des Armen überwogen habe. Die geringen Amtleute machten sich kein Gewissen daraus, Bestechungen zu nehmen. Silbergeschirr und Säcke voll Geld wurden als Geschenk an des Königs Räthe geschickt, um ihr Betragen zu bestimmen, und dies geschah mit so wenig Heimlichkeit, daß ein Zeitgenosse sagt, sie seien gleich Brennholz auf die Hausfluren abgeworfen worden.
In einer solchen Zeit war die Vermuthung, daß ein rechtsgeübter Staatsmann, ein mächtiges Glied einer siegenden Partei Vortheile über seinen weniger geschickten und weniger beglückten Gegner suchen und finden möchte, nicht allzu hartherzig; und hätte man auch das Gewissen des Sir William Ashton für zu bedenklich gehalten, um solche Vortheile zu benutzen, so glaubte man doch, daß sein Ehrgeiz, sein Streben nach Vergrößerung von Reichthum und Einfluß einen mächtigen Sporn in den Ermunterungen seines Weibes fänden, wie ihn einst Macbeth bei seinem Wagstücke fand.