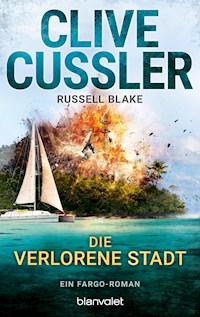
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Fargo-Abenteuer
- Sprache: Deutsch
Indiana Jones der Neuzeit: rasante Action und unglaubliche Abenteuer
Die Salomon-Inseln sind berüchtigt. Immer wieder wird von Gräueltaten wie Entführungen durch Riesenkannibalen berichtet. Zahlreiche Reisende sind spurlos verschwunden. Die Salomonen sind verflucht, so heißt es. Doch andere sagen, der Schatz des König Salomo sei hier begraben. Da zieht eine versunkene Stadt die Schatzjäger Sam und Remi Fargo in ihren Bann. Die Suche der Fargos führt sie von den Salomonen über Australien bis nach Japan, und was sie schließlich entdecken ist wundervoll – und voller tödlichem Schrecken.
Archäologie, Action und Humor für Indiana-Jones-Fans! Verpassen Sie kein Abenteuer des Schatzjäger-Ehepaars Sam und Remi Fargo. Alle Romane sind einzeln lesbar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 650
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Autoren
Seit er 1973 seinen ersten Helden Dirk Pitt erfand, ist jeder Roman von Clive Cussler ein »New-York-Times«-Bestseller. Auch auf der deutschen SPIEGEL-Bestsellerliste ist jeder seiner Romane vertreten. 1979 gründete er die reale NUMA, um das maritime Erbe durch die Entdeckung, Erforschung und Konservierung von Schiffswracks zu bewahren. Er lebt in der Wüste von Arizona und in den Bergen Colorados.
Russel Blake ist der Autor von zahlreichen gefeierten Thrillern. Er lebt an der Pazifikküste von Mexiko.
Die Fargo-Romane bei Blanvalet
1. Das Gold von Sparta
2. Das Erbe der Azteken
3. Das Geheimnis von Shangri La
4. Das fünfte Grab des Königs
5. Das Vermächtnis der Maya
6. Der Schwur der Wikinger
7. Die verlorene Stadt
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvaletund www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Clive Cussler& Russel Blake
DIE VERLORENE STADT
Ein Fargo-Roman
Deutsch von Michael Kubiak
PROLOG
Guadalcanal, Salomon-Inseln, vor einer Woche
Aldo brach durch dichtes Gestrüpp und wühlte sich schwankend einen Weg durch eine nahezu unüberwindbare Mauer aus wild wucherndem Urwalddickicht. Er rannte um sein Leben. Sein Atem rasselte, während er Schlingpflanzen aus dem Weg räumte. Schweiß rann ihm in breiten Rinnsalen über das Gesicht, seine Augen suchten nach Hinweisen auf einen Pfad durch den Dschungel. Äste peitschten ihm entgegen und rissen blutende Wunden. Er ignorierte die Schmerzen, trieb sich zu größerer Eile an und lauschte auf Geräusche, die ihm anzeigten, dass die Verfolger zu ihm aufgerückt waren.
Am Rand eines gewundenen Flüsschens blieb er stehen und ließ den gehetzten Blick über die von dem reflektierten Mondlicht orangefarben schimmernde Oberfläche gleiten. Er überlegte, ob er den Bach überqueren und tiefer in den Regenwald eindringen oder seinem Lauf bis zum Meer folgen sollte.
Dann hörte er sie.
Hunde.
Sie waren nicht mehr weit entfernt.
Er musste in Bewegung bleiben. Wenn ihn seine Verfolger einholten, drohte ihm ein schlimmeres Schicksal als der Tod.
Aldos nackte Füße platschten ins Wasser, als er sich entschloss, dem Bach zu folgen. Ein scharfkantiger Stein schnitt in seine Fußsohle. Blut quoll hervor. Er ignorierte den Schmerz, hielt sich dicht am gegenüberliegenden Ufer und lief abwechselnd über festes Land und durch den Bachlauf, um die Hunde von seiner Fährte abzulenken.
Diese Taktik entsprang dem reinen Instinkt. Aldo war gerade erst siebzehn geworden, aber wenn sie ihn fingen, würde er sterben wie ein Erwachsener.
Nur ein einziger Gedanke trieb ihn an: Entweder schüttelte er sie ab, oder sein Ende wäre besiegelt. Eine dritte Möglichkeit bestand nicht.
Gerade gab er sich einen Ruck, um seine Flucht fortzusetzen, da vernahm er hinter sich das Knacken von Ästen. Nur einen Herzschlag weit entfernt. Er hetzte weiter und ließ jetzt jegliche Vorsicht fahren, angetrieben von dem Bedürfnis, so viel Vorsprung wie möglich vor seinen Häschern zu gewinnen, um sich eine winzige Überlebenschance zu erkaufen.
Auf Guadalcanal geboren und aufgewachsen, hatte Aldo diesen Teil der Insel bisher gar nicht betreten – das hatte niemand –, daher war ihm die Gegend vollkommen fremd, und er kannte keinerlei Schleichwege, die ihm einen Vorteil vor seinen Verfolgern hätten verschaffen können. Das Einzige, was ihm zur Verfügung stand, war seine von Panik gespeiste Energie und der Instinkt und Kampfeswillen einer in die Enge getriebenen Ratte.
Er hörte, wie sie näher kamen.
Wie war er nur in diesen Alptraum hineingeraten? Es erschien zwar vollkommen widersinnig, aber es war tatsächlich tiefe Nacht, und sein Leben hing an einem seidenen Faden. Ein Bambusdickicht wuchs ihm auf der rechten Seite aus der Dunkelheit entgegen, und er dachte einen Moment lang daran, sich darin zu verstecken, zumal ihn jeder rasselnde Atemzug daran erinnerte, wie erschöpft er war.
Aldo hatte heftige Seitenstiche, die sich anfühlten, als wühle eine Lanze unterhalb des Brustkorbs in seinen Eingeweiden, aber er verdrängte den lähmenden Schmerz. Er musste in Bewegung bleiben.
Doch wohin? Falls er seinen Verfolgern entkäme, wohin sollte er sich wenden? Wo wäre er in Sicherheit vor ihnen? Die Insel war klein – zwar war es die größte der Salomon-Inseln, aber auch nur ein winziger Fleck im Pazifik. Er könnte nach Hause zurückkehren und hoffen, dass alles nicht mehr als ein schlimmer Traum war. Aber sie würden ihn einholen, ehe er jemanden informieren könnte, und dann würde er einfach verschwinden.
Genauso wie die anderen.
Donner grollte über seinem Kopf. Vom Himmel ergoss sich eine Flut warmen Regens, und Aldo musste unwillkürlich lächeln, als sein Blick über die Büsche und Sträucher schweifte. Möglich, dass der Regen die Hunde von seiner Spur ablenkte.
Ein Blitz zuckte über das Firmament und tauchte seine Umgebung für Sekundenbruchteile in grelles Licht. Er entdeckte einen Wildpfad im Dickicht zu seiner Linken und traf eine spontane Entscheidung. Der Untergrund war nach dem Wolkenbruch so vollgesogen wie ein Schwamm und dazu glitschig, als er die Uferböschung hinaufkletterte und einer Route parallel zum Wasserlauf folgte. Nun, da sie auf sämtliche Bemühungen, sich nicht bemerkbar zu machen, verzichteten, konnte Aldo die Hunde, die ihm auf der Fährte waren, deutlich hören.
Jede Hoffnung, sie abgeschüttelt zu haben, zerstob, als er hinter sich das hektische Trappeln von Hundepfoten auf dem Waldboden hörte, gefolgt von den stampfenden Schritten ihrer menschlichen Begleiter. Aldo trieb sich zu höherem Tempo an, rannte nun vollkommen blind durch den Dschungel und ließ sich durch die von Dornen und scharfkantigen Steinen zerfetzte Haut an seinen blutenden Füßen nicht aufhalten.
Und dann geriet er ins Stolpern und stürzte rücklings auf eine dicke Schicht nassen Laubes, auf der er, der Schwerkraft ausgeliefert, unaufhaltsam hinabrutschte – auf den Grund des Grabens zu, der neben dem Wildpfad verlief. Er wurde unsanft gestoppt, als er gegen einen Baumstumpf prallte und dort ein oder zwei Sekunden lang benommen liegen blieb. Als er seinen Kopf mit einer Hand abtastete, spürte er zwischen den Fingern die Nässe von Blut. Wie ein Ertrinkender nach Luft ringend, kämpfte er gegen den Schleier an, der sich auf sein Bewusstsein legte, und versuchte, sich zu orientieren.
Mühsam kämpfte Aldo sich auf die Füße. Stechende Schmerzen strahlten von den Rippen und dem linken Arm in seinen Körper aus, und er wusste sofort, dass Knochen gebrochen waren. Zum Glück aber keine, die er zum Rennen brauchte – doch die Schmerzattacke machte ihm klar, dass er dieses unwegsame Gelände kaum würde überwinden können, wenn nicht ein Wunder geschähe. Er schaute sich in der nahezu vollständigen Dunkelheit um, seine Sicht war nach dem Sturz noch immer ein wenig verschwommen, und er gewahrte eine einladende Lücke im dichten Buschwerk. Er gelangte zu der Öffnung und stieß auf einen weiteren Wildpfad.
Der Pulsschlag dröhnte in seinen Ohren, während er seine letzten Energiereserven aktivierte. Er wusste, dass er an die Grenzen seines Durchhaltevermögens stieß. Die angebrochenen Rippen jagten bei jedem Atemzug glühende Schmerzwogen durch seine Brust. Die Geräusche seiner Verfolger wurden leiser, während er seine Schritte beschleunigte, so gut er es noch vermochte. Aber zum ersten Mal, seitdem er die Gelegenheit zur Flucht ergriffen hatte, wagte er zu hoffen. Er könnte es schaffen.
Da geriet ein Fuß unter einen frei liegenden Wurzelstrang, blieb hängen, und Aldo verlor das Gleichgewicht. Er stieß einen erstickten Schrei aus, als er vorwärts aufs Gesicht stürzte und das Knacken hörte. Sein Knöchel hielt der Belastung nicht stand und brach. Wut und Schmerz wallten in ihm auf und trieben ihm die Tränen in die Augen, und dann versank für ihn die Welt ringsum. Er hatte das Bewusstsein verloren.
Als er wenige Minuten später wieder zu sich kam, sah Aldo eine zähnefletschende Hundeschnauze vor sich. Er schloss mit seinem Schicksal ab, noch ehe die verhasste Stimme seines Verfolgers wie durch Nebelschwaden gedämpft an seine Ohren drang – dies waren die letzten Worte, die er je hören würde, dessen war er sich sicher.
»Ist dir nicht klar, dass du auf einer Insel niemals entkommen kannst?«
Eine Stiefelspitze krachte gegen seine Schläfe, ehe sein Mund den Befehlen seines Gehirns gehorchen konnte, um zu protestieren oder zu fluchen oder um Gnade zu bitten. Eine Sternenwolke explodierte in seinem Kopf; die Pein war unerträglich. Er wollte sich schützen, sich verteidigen, aber seine Arme und Beine waren wie Blei.
Aldos letzter Gedanke war, dass er Opfer eines Irrtums, eines Missverständnisses geworden war, was sonst? Und dann traf der Stiefel erneut, diesmal brutaler, härter. Sein Genick gab mit einem Knirschen nach, und das Letzte, was Aldo spürte, waren die warmen Regentropfen, die auf seinem Gesicht zerplatzten. Danach glitt er stumm in eine andere Welt hinüber.
1
Guadalcanal, Salomon-Inseln, 1170 n. Chr.
Das Morgenrot verlieh dem nahezu spiegelglatten Ozean einen unwirklichen Schimmer, während eine Gruppe von Inselbewohnern auf einem Dschungelpfad zur Küste wanderte. Ihr Ziel war die neue Stadt, die, wie man ihnen versichert hatte, auf dem Meer errichtet worden war.
Angeführt wurde die Gruppe von dem Oberpriester, der trotz der allgegenwärtigen Hitze mit einem farbenprächtigen Mantel bekleidet war. Seine Haut hatte die rötliche Farbe von Dörrfleisch, und ein glänzender Schweißfilm bedeckte sein Gesicht. Als einer der wenigen, die die Pilgerfahrt zu dem soeben erst fertig gestellten Palast an der westlichen Spitze von Guadalcanal bereits unternommen hatten, führte er seine Schutzbefohlenen dorthin. Er drehte sich um und ließ einen zufriedenen Blick über die Prozession schweifen – sie bestand aus den wichtigsten Männern des Königreichs, die er zu dieser Reise zusammengerufen hatte. Viele von ihnen stammten von den Inseln in der Umgebung und hatten sich erst vor kurzem anlässlich der Zeremonie und der anschließenden Festlichkeiten, die noch den ganzen Rest der Woche andauerten, eingefunden.
Vereinzelte Sonnenstrahlen drangen durch das dichte Laubdach der Urwaldbäume, während die Gruppe dem Wildpfad folgte, der nur undeutlich zu erkennen war und auf beiden Seiten von dichtem Unterholz gesäumt wurde. Obgleich von den Nachkommen melanesischer Seefahrer bewohnt, die bereits lange vor Christus den Archipel entdeckt und betreten hatten, waren die Inseln so gut wie unerschlossen geblieben. Die meisten auf Guadalcanal ansässigen Stämme lebten in Dörfern, die zumeist kaum einhundert Meter von den Stränden entfernt waren, und mieden die weiter landeinwärts gelegenen Gebiete, in denen es von wirklichen wie eingebildeten Raubtieren wimmelte. Legenden berichteten von riesigen, wilden Kreaturen, mehr als doppelt so groß wie jene Menschen, die in unterirdischen Höhlen und Tunneln hausten und ihre Gier nach menschlichem Blut stillten, indem sie die Unachtsamen und Sorglosen angriffen. Außerdem gab es keinen Grund, sich in unbekannte Gefilde im Innern der Insel vorzuwagen, solange man sich jederzeit ausgiebig von dem bedienen konnte, was der Ozean an Nahrung lieferte, und zwar im Übermaß.
Der Schamane blieb auf dem Gipfel einer Anhöhe stehen. Das Wunder in der Bucht war für alle zu sehen – Bauwerke, die aus dem Wasser ragten und von Wellen umspült wurden. Er deutete mit einer ausholenden Geste auf das unglaubliche Spektakel, das mit kunstvollen Reliefdarstellungen zahlreicher Gottheiten verziert war, und murmelte den Namen des Königs in einem Tonfall, der sonst nur für andächtige Gebete zu den Göttern reserviert war. Tatsächlich erschien der König auch wie ein vom Himmel herabgestiegenes Wesen und war den gewöhnlichen Menschen so weit entrückt, dass sich bereits zu Lebzeiten Sagen und Legenden um seinen Namen und sein Wirken rankten.
Dieses Bauwerk – König Locs bislang prächtigste Errungenschaft – stellte seine sämtlichen bisherigen Werke in den Schatten. Locs Vision von einem System künstlich angelegter Inseln war in der halbmondförmigen Bucht verwirklicht worden. Nach dem Abschluss der Feierlichkeiten sollten die Gebäude als königliche Residenz Verwendung finden.
In Anerkennung von König Locs göttlicher Erhabenheit betrachteten die Priester der Insel die Anlage als heilig. Ihre Erbauer hatten zehn Jahre gebraucht, um sie zu errichten. Zu Tausenden hatten Arbeiter in einem eigens zu diesem Zweck im Landesinnern angelegten Steinbruch geschuftet und das benötigte Baumaterial zur Küste transportiert. Nichts dergleichen war jemals geschaffen worden, nie hatte eines Menschen Auge auch nur etwas Ähnliches erblickt, und der König hatte seinen Beratern versichert, dass mit seiner Vollendung ein neues Zeitalter anbräche.
Niemand bezweifelte seine Worte – schließlich war Loc ein Herrscher, der seine Insel von einer bescheidenen Handelsstation in ein bedeutendes Königreich umgewandelt hatte, eine Inselnation, einzigartig im gesamten Archipel und mit sagenhaften Schätzen gesegnet. Indem er erste Bergbauversuche zur Förderung von Gold und Edelsteinen anregte, hatte er der Insel zu großem Reichtum verholfen. Was zuvor nicht mehr als ein unbedeutender Haltepunkt auf einer kaum frequentierten Handelsroute gewesen war, hatte sich inzwischen zu einem pulsierenden Geschäftszentrum entwickelt, dessen Ruf sich bis zu den fernsten Gestaden verbreitete.
Im Laufe der Jahre hatten die Inselbewohner die Möglichkeiten zu nutzen gelernt, die ihr Herrscher geschaffen hatte. Händler von anderen Inseln und sogar aus Japan fanden sich ein, um Waren gegen die Schätze zu tauschen, die die Eingeborenen aus der Erde holten. Gold war besonders wertvoll, und mittlerweile betrieben in den Bergen ganze Stammesgemeinschaften die systematische Goldförderung. Auf diese Weise waren sie, ermutigt und beschützt von ihrem mildtätigen Herrscher, zu einem ansehnlichen Wohlstand gelangt.
Der Schamane und seine Begleiter drängten sich heran, füllten die Lichtung auf der Hügelkuppe und umringten den Oberpriester unter ehrfürchtigem und ungläubigem Gemurmel. Ein Häuptling mit stämmiger Statur, der von der großen Insel im Süden herübergekommen war, trat neben den Schamanen und deutete auf eine erhöhte Rampe auf der kleinen Insel, die dem Ufer am nächsten lag. Dort traten gerade eben einige Gestalten aus einem mit kunstvollen Verzierungen geschmückten steinernen Tempel.
»Ist das Loc?«, fragte er und betrachtete mit zusammengekniffenen Augen den größten der Männer, dessen mit Edelsteinen und goldenem Schmuck besetzter Mantel im hellen Schein der Sonne funkelte.
Der heilige Mann nickte. »Ja, das ist er.«
»Der Tempel ist eine Pracht«, sagte der Häuptling. »Er symbolisiert auf angemessene Weise den Beginn der tausendjährigen Blütezeit, die uns in der Prophezeiung angekündigt wurde.«
Die Eingeborenen lebten in dem Glauben, dass Locs Regentschaft den Anfang einer goldenen Epoche für die Inseln markierte, eine Zeit, in der das Königreich zum Machtzentrum der Region aufstieg, von allen verehrt wurde und die der Weissagung zufolge zwanzig Generationen andauern würde. Die mündlichen Überlieferungen berichteten außerdem von einem mächtigen Zauber, der mit dem Erscheinen des »Auserwählten« einherging, einer Inkarnation himmlischer Macht. Dieses Wesen sollte Loc sein. Der riesige Goldschatz, den er hatte zusammentragen lassen, stärkte seine Stellung, als bestätige die Erde seine Vorherrschaft, indem sie dem neuen Meister gestattete, sich ihrer Reichtümer zu bedienen.
Der Häuptling nickte. Wer konnte bestreiten, dass dies kein gewöhnlicher Mensch war, wenn man seinen Weg seit dem Besteigen des Throns verfolgte. Sämtliche Zweifel, die der Häuptling gehegt haben könnte, verflogen angesichts des Anblicks, der sich seinen Augen bot. Wenn er auf seine Insel zurückkehrte, würde er den Angehörigen seines Stammes wunderbare Neuigkeiten berichten können.
Ein Vogelschwarm stieg unter heftigem Flügelschlagen in den Himmel hinauf. Schrilles Geschrei zerschnitt die morgendliche Stille und erfüllte den Regenwald. Der Schamane wandte sich mit verwirrter Miene zu der Versammlung um, und dann begann der Grund unter ihren Füßen zu zittern. Das Zittern wurde von einem dumpfen Grollen begleitet. Ihm stockte der Atem, als das Zittern weiter zunahm, und dann begann die Erde zu schaukeln wie das Deck eines Schiffes, das so sehr im Sturm hin und her geworfen wurde, dass er sich an einem Baumast festhalten musste, um nicht zu stürzen.
Ein Mann stieß einen Schrei aus, als das Erdreich unter ihm aufbrach und er in einem Spalt verschwand, aus dem eine Dampfwolke aufstieg. Seine Gefährten stoben auseinander, weitere Risse klafften in der Erdkruste. Die Welt schwankte, und der Schamane sank auf die Knie, während das Stoßgebot auf seinen Lippen einfror, als er dorthin blickte, wo eben noch die neue Stadt gestanden hatte.
Die kleine Insel und der Tempel, den Loc gerade verlassen hatte, waren verschwunden. Das Wasser hatte sich vom Ufer zurückgezogen, als wolle es jeden Hinweis auf die kümmerlichen Versuche des vermessenen Königs, die Natur zu beherrschen, aufs Meer hinausspülen. Was zehn Jahre in Anspruch genommen hatte, um errichtet zu werden, wurde in einem kurzen Moment ausgelöscht, als das Erdbeben seine größte Kraft entwickelte, und der gesamte Uferstreifen stürzte ins Nichts, indem der Grund der Bucht absackte.
Das nackte Grauen flackerte in den Augen des heiligen Mannes, während der Ozean heranrauschte, um den tiefen Schlund, der einst eine seichte Bucht gewesen war, zu füllen. Und dann war der Alptraum genauso schnell vorüber, wie er begonnen hatte. Die Insel kam zur Ruhe. Das Zischen der Dampfschwaden, die aus den frischen Spalten in der Erdkruste aufstiegen, war nun neben dem Stöhnen und Jammern der verwundeten und entsetzten Stammesvertreter das einzige Geräusch. Die Überlebenden kauerten auf den Knien und schauten Hilfe und Rat suchend zu dem heiligen Mann auf. Sein ungläubiger Blick schweifte über den Ozean, dann gab sich der Priester einen Ruck und zwang sich aufzustehen.
»Rennt. Sucht höher gelegenes Gelände auf. Beeilt euch«, rief er und eilte den Wildpfad so schnell hinauf, wie seine wackligen Beine ihn trugen. Er hatte von den Alten Geschichten von mächtigen Wänden aus Wasser gehört, als die Götter der Erde und der See um die Vorherrschaft gestritten hatten, und in irgendeinem Bereich seines Gehirns schlummerte die Erkenntnis, dass wenn der Ozean zurückkehrte – hineingesogen in dieses neue Becken –, er dies mit Macht tun würde.
Die Männer, verwirrt und zu keinem vernünftigen Gedanken fähig, ergriffen die Flucht und rannten planlos bergauf. Aber nur wenige schafften es. Als der Tsunami die Insel erreichte, war die Welle dreißig Meter hoch. Sie ergoss sich, als sie mit ohrenbetäubendem Krachen auf das Hindernis auf ihrem Weg traf, fast einen Kilometer weit aufs Festland und fegte alles wie mit einer lässigen Handbewegung des Meeresgottes hinweg.
In dieser Nacht drängten sich der Schamane und eine Handvoll Überlebender um ein Lagerfeuer, weit genug vom Meeresufer entfernt, nun da sie den Ozean nicht länger als ihren Wohltäter betrachten konnten.
»Dies ist das Ende der Zeit«, sagte der heilige Mann im Brustton der Überzeugung eines wahren Gläubigen. »Unser Herrscher hat die alten Götter erzürnt. Es gibt keine andere Erklärung für das, was wir erlebt haben. Wir wurden für unsere Überheblichkeit bestraft, und wir können nichts anderes tun, als um Vergebung zu bitten und weiterhin ein Leben in Bescheidenheit und Demut zu führen.«
Die Männer nickten zustimmend. Der König hatte sich mit den erhabenen Göttern auf eine Stufe gestellt und war für seinen unerträglichen Hochmut bestraft worden. Seine Tempel und sein Palast waren verschwunden, und er mit ihnen, so vollständig ausgelöscht, als habe er nie existiert.
Während der folgenden Tage versammelten sich die Überlebenden und wagten nur mit leisen Stimmen über den Tag zu sprechen, an dem die Götter sie mit unbarmherziger Strenge bestraft hatten. Der Oberpriester rief die Stammesführer zusammen, und nach drei Tagen verließen sie den heiligen Wald, um den Inselbewohnern das Ergebnis ihrer Beratung mitzuteilen. Der Name des Königs dürfe nicht mehr öffentlich ausgesprochen werden. Jeder Hinweis auf seine Regentschaft habe zu unterbleiben. Die Tempel, die er errichtet hatte, um seine Macht zu demonstrieren, sollten dem kollektiven Vergessen anheimfallen. Man könne nur hoffen, dass seine Verbannung aus der Geschichte der Insel die Götter besänftigte und sie den Inselbewohnern ihr frevelhaftes Verhalten verziehen.
Der Küstenabschnitt, auf dem die Stadt errichtet worden war, wurde fortan von den Überlebenden der Katastrophe als verfluchtes Terrain gemieden. Im Laufe der Zeit legte sich der Schleier des Vergessens über das Geschehen, das die Epoche des Wohlstands der Insel beendete, und die Ereignisse, die dazu geführt hatten. Schließlich diente der Wald, der die Anhöhe am Rand der friedlichen Bucht bedeckte, nur noch den Kranken und Sterbenden als letzte Zuflucht. Er wurde zu einem Ort des Leidens und der Not, ein Ruf, der jedoch über die Jahre an Bedeutung verlor und am Ende aus dem Gedächtnis der Menschen verschwand.
Gelegentlich war der Name des Königs noch als gemurmelter Fluch zu hören, ansonsten aber versank die Erinnerung an die von ihm verheißenen tausend goldenen Jahre im Strom der Zeit, und schon nach wenigen Generationen tauchte Loc nur noch in verbotenen Geschichten auf, die die Aufmüpfigen einander im Flüsterton heimlich erzählten. Die Sage von seinem göttlichen Palast und den Reichtümern wurde von Generation zu Generation immer seltener erwähnt, bis sie zu einem Teil der Inselfolklore wurde. Die Jungen, die sich nicht für die unheimlichen Geschichten aus grauer Vorzeit interessierten, ignorierten sie.
2
Salomonensee, 8. Februar 1943
Peitschende Sturmböen verwandelten die schweren Seen in weiße Gischtwalzen, während der japanische Zerstörer Konami südöstlich der Insel Bougainville seinem Kurs folgte. Im frühen Morgengrauen kämpfte sich das Schiff stampfend und ohne Beleuchtung durch die mächtigen Wellenberge. Die Maschinen wurden bis an ihre Leistungsgrenzen beansprucht, wenn zehn bis fünfzehn Meter hohe Brecher gegen den Schiffsbug krachten.
Die Bedingungen an Bord waren erbärmlich. Das Schiff rollte bedrohlich, während es einem Kurs weit entfernt von den ruhigen Wasserstraßen im Westen folgte, wo die Kriegsflotte, die die letzten auf Guadalcanal stationierten Soldaten evakuierte, durch die sanfte Dünung eines idyllisch ruhigen Ozeans dampfte.
Der Zerstörer der Yữgumo-Klasse mit seiner langen Wasserlinie und den schlanken Decksaufbauten schaffte auf offener See fünfunddreißig Knoten. Aber in diesem Moment schlich er mit weniger als einem Drittel dieser Geschwindigkeit dahin, und die Antriebsaggregate pulsierten stetig im Bauch des Schiffes, während das Wetter sein Vorwärtskommen fast bis zum Stillstand abbremste.
Der Sturm hatte sie vollkommen unerwartet überfallen, und die erschöpften und ausgezehrten Soldaten, die im Begriff waren, nach Hause gebracht zu werden, hatten Mühe, ihre mageren Reisrationen bei sich zu behalten. Sogar den verwitterten Mienen der altgedienten Seeleute war anzusehen, wie heftig der Ansturm der Naturgewalten ihrer Widerstandskraft zusetzte. Einer der Matrosen ging an den Kojen entlang und verteilte Wasser an die Soldaten, um ihnen zu einem Minimum an Komfort zu verhelfen. Ihre Uniformen waren kaum mehr als zerfetzte Lumpen, und die Männer selbst befanden sich nahezu ausnahmslos im letzten Stadium des Verhungerns.
Auf der Kommandobrücke verfolgte Kapitän Hashimoto, wie der Rudergänger sich bemühte, stets mit dem Bug in die Wellen einzutauchen, um ihre Wucht so gut es ging zu dämpfen. Die Brecher rollten aus allen Richtungen und ohne einen erkennbaren Rhythmus gegen das Schiff an, das Mühe hatte, seinen Kurs beizubehalten. Er hatte für einen kurzen Moment in Erwägung gezogen, in ruhigere Gewässer auszuweichen, hatte sich dann jedoch entschieden, die Fahrt in Richtung Norden nach Japan fortzusetzen. Sein Fahrplan erlaubte keinerlei Umwege, ganz gleich aus welchem Grund.
Der Zerstörer befand sich auf einer im Schutz der Dunkelheit auszuführenden streng geheimen Mission und machte sich dabei die allgemeine Verwirrung zunutze, die durch die von den Japanern in Angriff genommene endgültige Evakuierung der Insel hervorgerufen wurde. Der Offizier, den sie an Bord genommen hatten, galt als zu wichtig für den weiteren Kriegsverlauf, um ihn den Gefahren der Rückzugs-Operation auszusetzen. Daher waren er und sein engster Stab heimlich an Bord der Konami gebracht worden, die daraufhin einen nördlichen Kurs eingeschlagen hatte, während der Rest der Flotte sich weiter westlich hielt und der üblichen Route von Guadalcanal nach Bougainville folgte.
Hashimoto hatte keine Ahnung, was an dem Armeeoffizier so besonders war, dass ein Zerstörer für seinen Transport bereitgestellt wurde. Im Grunde war es ihm auch gleichgültig. Er war es gewohnt, Befehle zu befolgen, die dem gesunden Menschenverstand häufig widersprachen. Seine Funktion als Kommandant eines japanischen Zerstörers bestand nicht darin, die Entscheidungen des Oberkommandos in Zweifel zu ziehen – wenn die Heeresleitung in Tokio verlangte, dass er mit seiner Mannschaft eine Fahrt in die Hölle und zurück unternahm, dann würde er höchstens fragen, wann er dazu in See stechen solle.
Ein Monstrum von einer Welle türmte sich wie aus dem Nichts kommend an Backbord auf und überrollte das Schiff mit einer derartigen Wucht, dass es bis in seine Schweißnähte erzitterte und Hashimoto für einen kurzen Moment das Gleichgewicht verlor. Er hielt sich an der Steuerkonsole fest, und der Rudergänger sah ihn besorgt an. Hashimotos finstere Miene entsprach der Heftigkeit des Unwetters, während er sich fragte, ob er den verhassten Befehl geben sollte oder nicht. Er seufzte und knurrte wütend, als eine weitere Wasserwalze heranrollte.
»Fahrt bis auf zehn Knoten drosseln«, brummte er, während sich die Falten seines Gesichts tiefer eingruben.
»Aye, aye, Sir«, erwiderte der Rudergänger.
Beide Männer beobachteten, wie die nächste Wasserwand aus der Nacht heranstürmte, auf den Bug traf und ihn für einen Moment vollständig überspülte, ehe sie über die gesamte Länge des Schiffs hinweglief. Das Schiff neigte sich gefährlich weit nach steuerbord, richtete sich jedoch wieder auf, während es der tobenden See weiterhin Paroli bot.
Kapitän Hashimoto war raues Wetter keineswegs fremd, hatte er doch sein Schiff durch einige der heftigsten Stürme gelenkt, die die Ozeane ihm seit seinem Stapellauf und seiner Taufe gut ein Jahr zuvor entgegengeworfen hatten. Er hatte zwei Taifune erlebt, sich mit allen denkbaren Widrigkeiten herumgeschlagen und war dennoch am Leben geblieben. Aber der Sturm in dieser Nacht sprengte die Grenzen der Manövrierfähigkeit seines Schiffes, und das wusste er.
Wenn der Morgen anbräche, drohte ihm eine noch größere Gefahr – die Möglichkeit, von einem Trägerflugzeug der Alliierten, mit einem Torpedo bewaffnet, entdeckt und angegriffen zu werden. Die Nacht war sein Schutzmantel und seine Freundin, mit dem Tageslicht dagegen wurde er verwundbar, und ihm drohte außerdem das Ende seiner bisherigen Glückssträhne, die ihm zu seiner kurzen, aber erfolgreichen Karriere verholfen hatte.
Hashimoto war sich darüber im Klaren, dass irgendwann sein letztes Stündlein schlagen würde, aber nicht in dieser Nacht – und nicht wegen eines kleinen Windes und ein paar hoher Wellen. Hatten sie möglicherweise den Krieg verloren, nun da ihre Besetzung Guadalcanals beendet war? Wenn ja, dann würde er seine Pflicht bis zum Ende tun und einen tapferen Tod sterben, der seinem Rang und dem Namen seiner Familie gerecht wurde. Das war selbstverständlich. Und er würde den letzten Weg wie so viele seiner Mitstreiter in der besten Samurai-Tradition gehen.
Der Armeeoffizier, den sie von der Insel gerettet hatten, kam die Treppe zur Kommandobrücke herauf und trat ein. Sein Gesicht war bleich und ausgezehrt, aber seine Haltung wirkte so kerzengerade wie ein Ladestock. Er begrüßte Hashimoto mit einem knappen Kopfnicken und blickte durch die Windschutzscheibe auf die tobende See hinaus.
»Sind wir langsamer geworden?«, fragte er, seine Sandpapierstimme war nicht mehr als ein leises Rascheln.
»Ja. Es ist besser, sich bei diesem Wetter behutsam vorwärtszutasten, anstatt mit voller Kraft auf dem Meeresgrund zu landen.«
Der Mann knurrte, als sei er anderer Meinung, und studierte die leuchtenden Instrumente. »Ist auf dem Radar irgendwas zu sehen?«
Hashimoto schüttelte den Kopf und wappnete sich für einen weiteren heftigen Stoß, als die nächste mächtige Welle aus der Dunkelheit heranrollte und mit enormer Wucht gegen den Bug brandete. Er warf einen verstohlenen Blick auf das Gesicht des Armeeoffiziers, sah dort jedoch nichts außer Entschlossenheit und Erschöpfung – und noch etwas anderes, das tief in seinen Augen lauerte. Etwas Düsteres, das Hashimoto in einem Anflug von Furcht erschauern ließ, eine Reaktion, die für den kampferprobten Veteranen vollkommen ungewohnt erschien. Die Augen des Mannes sahen wie die der klassischen Darstellung eines oni aus, eines Dämons, wie er in den Geschichten seiner Kindheit vorkam. Der Gedanke ging ihm unvermittelt durch den Kopf, und er verdrängte ihn sofort. Er war kein siebenjähriges Kind mehr und war auch genug realen Teufeln begegnet, seit der Krieg im Gange war. Er hatte keinen Bedarf an mythischen Phantasiewesen.
Gerade wandte er sich um und wollte den Offizier fragen, ob er einen Wunsch habe, als ein Ruck durch das Schiff ging, als ob es auf Grund gelaufen sei, und dann wurden auf der Kommandobrücke entsetzte Rufe laut, während Alarmsirenen erklangen.
»Was ist los?«, wollte der Offizier wissen.
»Keine Ahnung.« Der Kapitän wollte seine schlimmsten Befürchtungen nicht laut aussprechen.
»Sind wir mit irgendetwas kollidiert?«
Hashimoto zögerte. »Hier gibt es nichts, womit man kollidieren kann. Unter uns befinden sich dreitausend Meter Wasser.« Er hielt inne, als ein jüngerer Offizier mit bleicher Miene hereinkam und mit ernster und gefasster Stimme Bericht erstattete. Hashimoto nickte und gab ihm eine knappe Anweisung, danach drehte er sich wieder zu dem Angehörigen der Armee um. »Ich fürchte, wir haben uns auf eine unangenehme Entwicklung vorzubereiten. Ich muss Sie bitten, die Kommandobrücke zu verlassen und den Anweisungen für den Notfall Folge zu leisten.«
»Wie bitte?«
Hashimoto seufzte. »Es sieht so aus, als ob ein reparierter Bereich des Schiffsrumpfs aufgerissen ist. Wir tun zwar, was wir können, aber es ist nicht sicher, ob die Pumpen mit dem Wassereinbruch Schritt halten können. Wenn nicht, müssen wir das Schiff aufgeben.«
Das Gesicht des Offiziers wurde fahlweiß. »Bei diesem Unwetter?« Er blickte durch die Windschutzscheibe in den Sturm.
»Das werden wir schon bald wissen. Hoffentlich können wir den Schaden unter Kontrolle halten.« Er wandte sich ab. »Und jetzt lassen Sie mich bitte meinen Dienst tun.«
Der Armeeoffizier nickte mit grimmiger Miene. Dann machte er kehrt, ging zur Treppe und konnte sich kaum auf den Füßen halten, als ein weiterer Brecher gegen die Backbordseite des Bugs krachte und das Schiff abermals auf die Seite drückte.
Hashimoto reagierte vollkommen automatisch und wies seine Mannschaft an, sämtliche zur Verfügung stehenden Maßnahmen zur Abdichtung des Lecks zu ergreifen, während der Rudergänger sich bemühte, das Schiff aufzurichten und gegen die auflaufenden Brecher in Position zu bringen. Aber am Ende erwies sich der sturmgepeitschte Ozean doch als stärker. Während die Wassermassen ihre ständigen Attacken fortsetzten, die letzte Lichtquelle auf der Kommandobrücke flackernd erlosch und der stählerne Rumpf des Schiffes wie ein Anker in die Tiefe gezogen wurde, wanderten seine Gedanken zu seiner Frau, Yuki, und seinem einjährigen Sohn – dem Sohn, mit dem er während seines letzten Landurlaubs nur wenige Stunden hatte verbringen können und den er nie zum Mann heranwachsen sehen würde.
Aber nicht einmal diese Vision konnte die Scham, bei seiner Mission versagt zu haben, verdrängen. Er schwor sich, dass er mit Würde sterben und mit seinem Schiff untergehen würde, anstatt wie ein Feigling um sein Leben zu kämpfen.
Drei Stunden später beruhigte sich die See, nachdem das Unwetter weiter nach Norden gewandert war. Der Ozean hatte das einhundertdreißig Meter lange Schiff verschlungen. Da keinerlei Aufzeichnungen über seine Fahrt existierten und sich weder ein Begleitschiff noch andere Schiffe in Funkweite befanden, blieb sein Untergang unbemerkt. Es verschwand aus den amtlichen Verzeichnissen und nahm sein Geheimnis mit hinab auf den Meeresgrund.
Nur vier Überlebende wurden schließlich von einem Schiff der Alliierten gerettet; der Sturm und die Haifische besiegelten das Schicksal der restlichen Mannschaft. Das Oberkommando der Alliierten zeigte keinerlei Interesse daran, in Erfahrung zu bringen, was ein japanisches Schiff so weit entfernt von den üblichen Schifffahrtslinien zu suchen hatte, und die Männer, die aus dem Meer gefischt wurden, hatten zur Aufklärung des Unglücks nichts weiter beizutragen als beharrliches Schweigen. Für sie war der Krieg beendet, ihre Schande bedeutete ein Schicksal, schlimmer als der Tod.
3
Guadalcanal, Salomon-Inseln, Gegenwart
Drei leichte Glasfaserboote zerrten an den Bugleinen, mit denen sie an Palmen festgebunden waren, während sie auf dem kobaltblauen Wasser schaukelten, das die Strahlen der Nachmittagssonne funkelnd reflektierte. Sam und Remi saßen im Schatten einer der Palmen, deren sichelförmige Blätter von der leichten Brise sanft bewegt wurden. Remi schirmte die Augen mit einer manikürten Hand vor dem grellen Licht ab und beobachtete die Taucher, deren Köpfe in der Nähe eines vierten Bootes, dreißig Meter vom Ufer entfernt, nacheinander durch die Wasseroberfläche brachen.
Sam streckte sich, fuhr sich mit den Fingern durch sein mittelbraunes Haar und blickte zu seiner Frau und Partnerin hinüber. Ebenmäßige Gesichtszüge, frei von jeglichem Make-up, wurden von kastanienbraunem Haar umrahmt, und ihre seidenglatte Haut schimmerte golden im warmen Licht der Sonne. Seine Blicke streichelten ihre sportliche Figur, und er streckte eine Hand nach ihr aus. Sie ergriff sie lächelnd und seufzte. Auch nach zahllosen Abenteuern, die sie auf der Suche nach archäologischen Schätzen in jeden Winkel der Welt geführt hatten, waren sie noch immer unzertrennlich, ein Zeugnis für die Kraft und Dauerhaftigkeit des Bandes, das sie zusammenhielt.
»Weißt du, Sam, ich könnte mich glatt daran gewöhnen, mein weiteres Leben an diesem Strand zu verbringen«, sagte sie und schloss genussvoll die Augen.
»Ich gebe zu, dieser Strand ist traumhaft«, pflichtete er ihr bei.
»Das Einzige, was fehlt, ist eine Filiale von Bloomingdale’s …«
»Oder ein gut bestückter Tauchladen.«
»Jedem das Seine.« Remi zog ihren Fuß aus einem Valentino-Flipflop und ließ die Sandale an der großen Zehe baumeln.
Als sie zugesagt hatten, nach Guadalcanal zu fliegen, hatten sie keine Vorstellung davon gehabt, was sie erwarten würde, und so landeten sie zu ihrer großen Erleichterung in einem tropischen Paradies mit angenehmen Wassertemperaturen und einem strahlend blauen Himmel.
Ein großer, schlaksiger Mann Mitte fünfzig kam vom Wasser durch den Sand auf sie zu, sein Gesicht von Sonnenbrand gerötet und auf der markanten Adlernase eine Nickelbrille, der man ihr Alter deutlich ansah. Seine abgewetzten Wanderschuhe schleuderten bei jedem Schritt eine Wolke puderzuckerfeinen weißen Sandes hoch. Eine Gruppe von Inselbewohnern lungerte in der Nähe herum, beobachtete die Taucher und würdigte ihre Bemühungen mit offenbar spöttischen Kommentaren, wie ihr lautes Gelächter vermuten ließ. Der Schatten des Mannes glitt grotesk verzerrt über den Sand, während er sich näherte. Sam schaute zu ihrem Besucher hoch, und ein Grinsen ließ sein auf robuste Art attraktives Gesicht aufleuchten.
»Nun, Leonid, was hältst du von alldem?«, fragte Sam.
»Es sieht definitiv völlig anders aus als alles andere auf der Insel«, sagte Leonid mit seinem leichten russischen Akzent. »Es sieht wie von Menschenhand geschaffen aus. Aber wie ich schon am Telefon meinte, das ist unmöglich. Es befindet sich in fast dreißig Metern Tiefe.«
»Vielleicht hast du Atlantis gefunden«, äußerte Remi fröhlich eine Vermutung und neckte Sams alten Freund. »Obgleich du dann um etwa fünftausend Meilen daneben liegen würdest, sofern man sich auf die alten Beschreibungen verlassen kann.«
Leonid verzog das Gesicht. Seine Miene drückte nichts anderes als sein übliches Missfallen über alles und jeden aus. Als Akademiker aus Moskau auf einem dreijährigen Studienurlaub war Leonid Vasjew ein unglücklicher Mann, auch wenn er den russischen Winter hatte hinter sich lassen dürfen, um die Welt auf der Suche nach untergegangenen Zivilisationen – das war seine Passion – zu bereisen, was ihm durch ein Stipendium der Fargo Foundation ermöglicht wurde.
Als sein Bericht über einen Fund bei den Salomon-Inseln Sam und Remi erreichte, hatten sie keinen Moment damit gezögert, eine Reise um die halbe Welt anzutreten, um ihm bei seiner Suche zu helfen. Sie waren erst an diesem Morgen gelandet, jedoch schon zu spät, um sich noch eine angemessene Tauchausrüstung für den nächsten Tag zu beschaffen. Dafür hatten sie sich mit der Lektüre der Hintergrundinformationen begnügt, die er für sie zusammengestellt hatte, während sie sich am Strand in der Sonne aalten und die Ruhe genossen.
Zwei Wochen zuvor hatte eine ratlose Schullehrerin auf Guadalcanal ihre ehemalige Professorin in Australien angerufen und ihr eine seltsame Geschichte erzählt. Ihrem Ehemann und ihrem Sohn seien ungewöhnliche Messungen ihres neuen Fischfinders aufgefallen, und darum hätten sie sie um Hilfe gebeten. Die Australierin war jedoch zu intensiv in den Vorlesungsbetrieb eingespannt, um mehr tun zu können, als sie an Leonid zu verweisen, einen Kollegen, von dem sie wusste, dass er ungebunden und finanziell abgesichert war.
Nach einigen Ferngesprächen von Kontinent zu Kontinent war der Russe, der sich anfangs wenig kooperationsbereit gezeigt hatte, schließlich eingeflogen, um persönlich in Augenschein zu nehmen, was die Lehrerin beschrieben hatte. Nach den letzten Tagen erschienen ihm die Formationen, von denen die Taucher erzählten, immer rätselhafter. Die Fischer hatten angenommen, dass die Unregelmäßigkeiten auf die Existenz eines Schiffswracks hinwiesen, aber sie irrten sich. Ihr Fischfinder, einer der ersten auf der Insel, hatte etwas Unerklärliches aufgespürt – allem Anschein nach künstliche Strukturen, die vom Meeresgrund aufragten.
An diesem Punkt entschied Leonid, fremde Unterstützung hinzuzuziehen. Er war Gelehrter, Akademiker, aber kein Tiefseetaucher, und er wusste, dass er Hilfe brauchte. Da er außerdem wusste, dass die Fargos seine Förderer und Freunde waren, beschloss er, den Stier bei den Hörnern zu packen, und nach einem einzigen Ferngespräch per Satellitentelefon versprachen sie, sich auf den Weg nach Guadalcanal zu machen.
»Deinen Unterwasserkameras würde eine Generalüberholung und Feinjustierung guttun«, sagte Sam, während er ein verschwommenes Foto betrachtete, das am Vortag aufgenommen worden war. »Und konntest du eigentlich kein anständiges Fotopapier besorgen? Das sieht ja aus wie Weinflecken auf einer Zeitung.«
»Du kannst froh sein, dass ich überhaupt einen Laden mit einem Fotodrucker gefunden habe. Falls es dir noch nicht aufgefallen sein sollte – Guadalcanal ist nicht La Jolla«, erwiderte Leonid trocken. Er deutete auf das Bild, das Sam studierte. »Na los. Was denkst du?«
»Es kann immer noch alles Mögliche sein. Wir müssen abwarten, bis ich eine Ausrüstung habe und selbst tauchen kann. Dies dort könnte trotz einiger Details ebenso gut ein Rorschach-Test sein.«
»Erkennst du nicht das wütende Gesicht deiner Mutter?«, fragte Remi unschuldig.
Leonid betrachtete sie, als seien sie Ungeziefer in einem Laborglas. »Wie ich sehe und höre, hat der berüchtigte Fargo’sche Humor in der Hitze nicht gelitten. Das erleichtert mich sehr.«
»Bleib ganz locker, Leonid. Wir sind hier im Paradies, und was wir hier haben, ist wahrscheinlich genau die Art von Geheimnis, die wir lieben. Wir werden der Sache auf den Grund gehen«, sagte Sam. »Auch wenn Mami auf diesem letzten Foto gar nicht so verärgert aussah.« Er blickte zu den Tauchern hinüber. »Bist du sicher, dass ich mir nicht von einem der Einheimischen eine Tauchausrüstung ausleihen kann?«
Leonid schüttelte den Kopf. »Ich hab schon gefragt. Sie sind mit ihrem Gerät ziemlich eigen. Tut mir leid. Sobald wir wieder in der Stadt sind, lassen wir etwas reservieren.« Aufgrund der begrenzten Anzahl von Ausrüstungen war der größte Teil der auf der Insel verfügbaren Tauchgeräte bereits an die örtlichen Tauchschulen vermietet worden.
»Das wird schon klappen«, sagte Sam.
»Ich werde mich mal erkundigen, was die Taucher diesmal gefunden haben«, sagte Leonid und wischte sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn.
Sie blickten ihm nach, wie er den Strand hinuntertrottete, unbeholfen wie ein Storch in seiner langen Khakihose und seinem langärmeligen Tropenhemd. Remi beugte sich zu Sam hinüber. »Was hältst du von der Sache?«
Sam schüttelte den Kopf. »Ich habe keinen Schimmer. Also warte ich mit einem Urteil, bis wir mehr wissen. Aber es ist auf jeden Fall interessant und spannend.«
»Was mich verblüfft, ist, wie so etwas in solcher Strandnähe unentdeckt bleiben konnte.«
Sam ließ den Blick über die einsame Bucht schweifen. »Nun ja, allzu viel scheint hier nicht los zu sein.«
Remi nickte. »Ich denke, darin waren wir uns schon länger einig.« Sie schüttelte ihr kastanienbraunes Haar auf, und Sam stellte fest, dass ihr Gesicht bereits leicht gebräunt war. Er betrachtete ihre schlanke Gestalt und rutschte näher zu ihr hin.
Sie verfolgte, wie Leonid den herumlungernden Inselbewohnern etwas zurief und diese sich widerstrebend erhoben und eines der Boote an den Strand zogen, damit er einsteigen konnte. Ein kleiner drahtiger Mann in einer Jeans mit abgeschnittenen Hosenbeinen und einem braunen T-Shirt watete zum Heck und schwang sich über den Rand ins Boot. Nach dreimaliger kräftiger Betätigung des Starterseils sprang der altersschwache Außenbordmotor an, und sie entfernten sich in Rückwärtsfahrt vom Strand, während sie direkten Kurs auf das Tauchboot nahmen.
Remi schaute den Strand hinunter – dorthin, wo mehrere Inselbewohner im Schatten eines Baums dösten. Und sie seufzte.
»Du musst zugeben, dieser Ort ist idyllisch. Ich finde, blauer Himmel, warmes Wasser, ein sanfter Passat … was will man mehr?«
Sam grinste. »Kaltes Bier?«
»Und wieder einmal tritt das einspurige Fargo-Gehirn zutage.«
»Nicht ganz einspurig«, widersprach Sam.
Remi lachte. »Die Spuren zwei und drei werden wir heute Abend ausprobieren.«
Leonids Boot kehrte einige Minuten später zurück, und als er ausstieg, hatten sich die Sorgenfalten noch tiefer in sein Gesicht gegraben. Er sandte den untätigen Insulanern einen zornigen Blick und kam zu den Fargos herüber. »Sie haben bestätigt, dass dort unten einige mit Muscheln und Wasserpflanzen bedeckte Erhebungen zu sehen sind. Ihrer Meinung nach sind es regelmäßige Strukturen.«
Remi kniff die Augen zusammen. »Strukturen? Welche Art von Strukturen?«
»Sie sind sich nicht sicher, aber anscheinend handelt es sich um die Ruinen von Bauwerken.«
Sams Blick wanderte zu den Sturmwolken, die als dunkle Linie am Horizont aufzogen. »Das wird ja immer seltsamer.«
»Diese Überreste müssen uralt sein«, sagte Leonid und fixierte kopfschüttelnd das Tauchboot. »Diese verdammten Einheimischen und ihr Aberglaube …«
Remi runzelte die Stirn. »Warum sagst du das?«
»Ach, der Chef des hiesigen Tauchteams macht Stress. Er meint, dass er nach diesem Fund an dieser Stelle nicht mehr tauchen will. Er erinnere sich daran, dass sein Urgroßvater erzählt habe, diese Bucht habe ein schlechtes juju oder irgend so einen Blödsinn.« Leonid gab einen wütenden Knurrlaut von sich und wischte sich mit einem schmuddeligen Halstuch über die Stirn. »Er will mir nur mehr Geld aus der Tasche ziehen, dieser Gauner. Von wegen alte Götter.«
»Was hast du ihm geantwortet?«
»Dass er, wenn er überhaupt Geld sehen will, die heutigen Tauchgänge gefälligst absolvieren soll, und dass ich, je nachdem, was er findet, dann erst entscheide, ob ich ihn weiter engagiere. Ich ließe mich nicht erpressen. Ich würde ihm bereits ein Spitzenhonorar zahlen. Das hat ihn zum Schweigen gebracht.«
Sam sah den Russen prüfend an. »Leonid, es wärmt mir zwar das Herz, erleben zu dürfen, wie sparsam du mit unserem Geld umgehst, aber soweit ich dich richtig verstanden habe, sind diese Männer die einzigen in der Stadt, die für den Job in Frage kommen, oder? Wenn du sie nicht mehr für dich arbeiten lässt, wie sieht Plan B aus?«
»Ich lasse meine eigenen Leute einfliegen.«
»Mit ihrer gesamten Ausrüstung?«, fragte Sam skeptisch.
»Klar«, antwortete Leonid, aber seine Miene verriet weniger Zuversicht als seine Worte.
»Falls dort unten tatsächlich Ruinen stehen, sollten wir dann nicht lieber versuchen, ein vollwertiges Forschungsschiff aufzutreiben? Etwas, das unabhängig und eigenständig und für lange Einsätze geeignet ist?«, fragte Remi. »Wen kennen wir denn in diesem Teil der Welt?«
Sam überlegte einige Sekunden. »Mir fällt niemand ein … dir vielleicht, Leonid?«
Der Russe schüttelte den Kopf. »Ich erkundige mich.«
»Wir rufen Selma an. Sie wird jemanden finden.«
Remi nickte. »Zu schade, dass kein Mobilfunksender in Reichweite ist.«
Sam lächelte selbstzufrieden. »Kein Problem. Ich hab das Satellitentelefon eingepackt«, sagte er, kramte in seinem Rucksack und holte ein altmodisches, aber zuverlässiges Iridium Extreme hervor, schaltete es ein und schaute auf die Uhr. »Sie müsste eigentlich im Büro sein.«
Leonid, offensichtlich übernervös, trat von einem Fuß auf den anderen. Sam ging zum Wasser hinunter, während er dem dudelnden Rufzeichen lauschte, und Leonid kehrte zur nächsten Gruppe von Einheimischen zurück. Nach mehreren Sekunden hob Selma ab, und ihre selbstbewusste Stimme war zu hören.
»Selma! Raten Sie mal«, sagte Sam.
»Das Inkassobüro?«
»Sehr lustig. Wie stehen die Dinge in San Diego?«
»Genauso wie vor zwei Tagen, als Sie abgereist sind. Außer dass Zoltán inzwischen weitere einhundert Pfund Steakfleisch verputzt hat. Und Lazlo lungert hier herum und treibt mich an den Rand des Wahnsinns.«
»Das klingt, als hätten Sie alle Hände voll zu tun. Hören Sie, wir haben im Verlauf vorbereitender Tauchgänge einige interessante Funde gemacht und möchten hier ein Mutterschiff in Position bringen, also eines mit allem technischen Pipapo: Sonar, Tauchgerät, Magnetometer, den gesamten Katalog. Meinen Sie, Sie könnten etwas Brauchbares finden?«
»Natürlich. Das ist lediglich eine Frage von Zeit und Geld. Wann brauchen Sie es und für wie lange?«
»Was die Dauer betrifft, die ist nicht abzusehen. Und wann? Am liebsten gestern.«
»Also der übliche geruhsame Zeitplan.«
»Bei uns ist es eben niemals langweilig, Selma.«
»In der Tat. Ich kümmere mich sofort darum. Wahrscheinlich werde ich in Australien oder Neuseeland fündig.«
Sam nickte unwillkürlich. »Das klingt erfolgversprechend. Und könnten Sie zusammensuchen, was es an Informationen über alte Zivilisationen in dieser Region gibt?«
»Natürlich. Ich schicke Ihnen alles, was ich finde, per E-Mail.«
»Das wäre perfekt, Selma. Viel Glück bei der Suche nach dem Schiff.«
»Gibt es ein Kosten-Limit?«
»Das übliche.« Also keins, natürlich innerhalb vernünftiger Grenzen. Die Fargo Foundation hatte mehr Geld zur Verfügung, als sie in zehn Leben hätte ausgeben können, und täglich kamen weitere Gelder in Form von Lizenzgebühren für die Nutzung von Sams zahlreichen technischen Patenten hinzu, daher war die Kostenfrage bei ihren eigenen Expeditionen bedeutungslos.
»Ich rufe an, wenn ich etwas Passendes gefunden habe.«
»Sehr schön. Danke, und geben Sie dem Bären eine ausgiebige Streicheleinheit von uns.« Zoltán war ein großer Deutscher Schäferhund, den Remi während eines Abenteuers in Ungarn adoptiert hatte und der eher einem Grizzly auf vier Beinen ähnelte.
»Das klingt wie eine einfache Methode, ein paar Finger loszuwerden, aber was tut man nicht alles, um den Boss glücklich zu machen«, frotzelte Selma. Zoltán liebte Selma und wich keine Sekunde von ihrer Seite, während die Fargos in der Weltgeschichte unterwegs waren. Was sie betraf, so sah sie in dem Hund am ehesten das Kind, das sie nie gehabt hatte, hätschelte ihn bei jeder Gelegenheit und verwöhnte ihn über alle Maßen.
Sam trennte die Verbindung und überprüfte den Ladestand des Akkus. Es waren noch reichlich Reserven vorhanden. Er kehrte zu Remi zurück und ließ sich in den Sand sinken. »Selma nimmt das Problem in Angriff«, berichtete er.
»Gut. Ich möchte Leonid nicht kritisieren, aber ein paar unzuverlässige Hobbytaucher und ein Ruderboot dürften kaum ausreichen, dieses Projekt erfolgreich in Angriff zu nehmen«, stellte Remi fest.
»Das ist richtig, aber ich finde, er hat nicht ganz Unrecht. Warum soll er die Kavallerie aufmarschieren lassen, bevor er genau weiß, ob er etwas gefunden hat, das den Aufwand lohnt? Es hätte genauso gut ein abgestürztes Flugzeug oder ein gesunkenes Landungsboot sein können. Vergiss nicht, dass Guadalcanal während des Zweiten Weltkriegs heiß umkämpft war. Rund um die Insel liegt jede Menge Kriegsschrott.«
Sie nickte. »Und einiges davon ist auch nach all den Jahren noch verdammt scharf und explosiv.«
»Genauso wie du.«
Remi ignorierte die Bemerkung und schaute zum Tauchboot hinüber. »Was meinst du, was da unten schlummert?«
»Ein von Menschen geschaffenes Bauwerk in dreißig Metern Tiefe? Frag mich was Leichteres.« Er streckte und reckte sich und sah Remi an. »Aber wir werden es bald wissen.«
Remi fuhr sich mit den Fingern durchs Haar und wollte etwas erwidern, als die Stille von einem Schrei zerrissen wurde, der das Blut in ihren Adern gefrieren ließ.
4
Sam sprang auf, gefolgt von Remi, und sie rannten zu der Baumgruppe am Wasser hinunter, wo sich die Schreie des Entsetzens in verzweifelte Schmerzlaute verwandelt hatten. Sam hielt seine Frau mit ausgestrecktem Arm zurück, als sie sich dem Dickicht näherten, aus dem ein langer grüner Reptilienschwanz herausragte und wild hin und her peitschte.
Ein gurgelnder Laut und mehrere dumpfe Schläge erklangen innerhalb des kleinen Wäldchens. Der Schwanz erstarrte und rührte sich nicht mehr. Leonids Schuhe stampften hinter ihnen durch den Sand, als er mit den anderen Inselbewohnern eintraf, von denen zwei mit einer Machete und einer mit einer Brandaxt bewaffnet waren.
Ein weiterer qualvoller Schrei ertönte. Sam suchte sich einen Weg durch den Pflanzenvorhang und stieß auf den massigen Kadaver eines männlichen Leistenkrokodils, getötet durch drei grässliche Axtwunden in seinem lang gestreckten Schädel. Vor ihm auf dem Waldboden wälzte sich ein Einheimischer, der die zerfleischten Reste seines rechten Unterschenkels umklammerte. Keine zwei Meter entfernt stand ein anderer Insulaner mit einer altertümlichen Axt in den zitternden Händen, die Augen vor Grauen und namenloser Angst weit aufgerissen.
Ein hellroter Strahl arteriellen Bluts pulsierte aus dem zerfetzten Bein des Verwundeten. Sam zog seinen Gürtel aus der Hose, während er neben dem Opfer auf die Knie hinunterging. Remi kam näher, als er den Ledergurt schon um den Oberschenkel des Mannes schlang und zuzog, um den Blutstrom zu stoppen.
Der verwundete Mann stöhnte und wurde ohnmächtig.
»Er wird kaum durchkommen, wenn er nicht schnellstens in ein Krankenhaus gebracht wird«, sagte Sam mit gepresster Stimme.
Remi schaute zu Leonid hoch. »Wir sollten ihn in einen der Geländewagen legen. Jede Sekunde zählt«, sagte sie.
Leonid starrte mit tellergoßen Augen auf das Krokodil. Er war wie versteinert, jegliche Farbe war aus seinem Gesicht gewichen.
»Leonid! Nun mach schon!«, drängte Remi mit harter Stimme.
Der Russe wandte sich zu den Inselbewohnern um, die sich mehrere Schritte hinter ihm furchtsam zusammendrängten, und befahl ihnen, ihren unglücklichen Gefährten zum Land Rover zu tragen. Niemand rührte sich. Sam schüttelte den Kopf und schob einen Arm unter den verwundeten Mann. »Aus dem Weg«, befahl er und richtete das Opfer auf. Remi kam ihm zu Hilfe, und gemeinsam schleppten sie ihn zu einem Fahrzeug, das neben dem Weg geparkt war, der zur Hauptstraße führte.
Innerhalb von Sekunden hatten sie ihn auf den Rücksitz gebettet, und Sam wandte sich an Leonid, der mit einem der Einheimischen am Wasser stand und diskutierte. »Wer ist der beste Fahrer?«, wollte er wissen, aber die Männer schüttelten die Köpfe.
Remi und Sam wechselten einen kurzen Blick, und Sam streckte die Hand aus. »Na schön. Her mit dem Schlüssel. Ich weiß nicht, was mit euch los ist, aber euer Freund hier stirbt gleich und braucht dringend Hilfe. Wer kann mir den Weg zum nächsten Krankenhaus zeigen?«
Leonid wühlte in seinen Taschen, während die Inselbewohner miteinander murmelten, und dann trat ein halbwüchsiger Junge vor. »Ich fahre mit. Das ist mein Onkel Benji«, sagte er in Pidgin-Englisch.
»Wie heißt du?«, fragte Remi, während sie sich in den Beifahrersitz schwang.
»Ricky.«
Sam rutschte hinter das Lenkrad. Leonid kam zur Tür und reichte ihm die Schlüssel. »Ich folge euch in dem orangefarbenen Wagen.«
»In Ordnung.« Sam gab Ricky ein Zeichen. »Setz dich nach hinten zu deinem Onkel und achte darauf, dass er nicht aus dem Sicherheitsgurt rutscht. Wie weit ist es bis zum Krankenhaus?«
»Etwa eine Dreiviertelstunde …«, antwortete Ricky unsicher.
Sam verzog das Gesicht. »Schnall dich an. Mal sehen, ob wir es in fünfzehn Minuten schaffen.«
Remi und Ricky legten die Sicherheitsgurte an, während Sam den Motor aufheulen ließ. Er legte den Gang ein, und sie starteten und rollten schwankend die Piste hinunter, die kaum mehr als ein schmaler Trampelpfad durch den dichten Dschungel war. Der starke Motor mühte sich auf dem weichen Untergrund ab, und so dauerte es eine gefühlte Ewigkeit, bis sie die nachlässig asphaltierte Küstenstraße erreichten, die rund um die Insel herumführte. Sobald er die solide Fahrbahn unter den Reifen spürte, gab Sam Vollgas, und das SUV machte einen Satz vorwärts. Den Blick wachsam geradeaus gerichtet und höchst konzentriert, nahm Sam die Kurven mit waghalsigem Tempo.
Remis Knöchel wurden weiß, als sie die Hand um die Armlehne krampfte. »Es wird ihm nicht viel helfen, wenn sie einen Krankenwagen schicken müssen, um uns von einem Felsen abzukratzen.«
»Keine Sorge. Ich hab früher mal einen Ferrari gefahren.«
Sie drifteten durch eine Kurve, wobei alle vier Reifen kreischend protestierten, als sie für einen Moment die Haftung verloren. Sam gab Gas und schaltete herunter, um den Wagen wieder unter Kontrolle zu bringen. Nach einem kurzen Blick zu Remi zuckte er die Achseln und drosselte das Tempo um einige Stundenmeilen, blieb jedoch immer noch an der Grenze dessen, was der schwere Wagen schaffte.
Remi drehte sich um und schaute nach dem verwundeten Mann, der mit Blut besudelt war und mühsam nach Luft rang. Ricky hielt den Gürtel stramm, das junge Gesicht angstverzerrt. Er fing Remis Blick auf und schluckte krampfhaft.
»Meinen Sie, dass er es schafft?«, fragte er.
»Wir tun alles Menschenmögliche, damit er am Leben bleibt. Wie ist das Krankenhaus? Ist es einigermaßen modern ausgerüstet?«, erkundigte sie sich.
Er schüttelte den Kopf. »Ich denke, es ist okay. Ich war noch nie woanders, darum weiß ich nicht, wie die anderen sind.«
»Werden dort oft Verletzungen behandelt?«
»Ich denke schon.« Er klang nicht sehr überzeugt.
Sam beschleunigte auf einem ziemlich langen geraden Straßenabschnitt und fragte über die Schulter: »Kommt es hier häufig zu Krokodilsattacken?«
Ein neuerliches Achselzucken. »Manchmal. Meistens verschwinden die Menschen einfach, sodass wir nicht genau wissen, ob sie von Krokodilen angefallen wurden.« Er sagte es in einem Tonfall, als rede er über das Wetter oder die alltäglichen Probleme des Altwerdens.
Remi musterte ihn vorwurfsvoll. »Warum hat ihm niemand geholfen?«
Ricky erwiderte mürrisch ihren Blick. »Sie sind abergläubisch. Sie haben so angeregt darüber gesprochen, dass dieses Gelände verflucht ist, dass niemand auf die Idee kam zu überlegen, was man in diesem Fall tun könnte. So geschieht es hier meistens, wenn in irgendeinem Punkt Uneinigkeit herrscht.«
»Verflucht?«, wiederholte Remi fragend.
»Einer der älteren Taucher meinte, es gibt Gerüchte, dass dort Gespenster ihr Unwesen treiben. Dass der Ort mit einem Fluch belegt ist. Wie ich schon sagte, das ist reiner Aberglaube.« Er betrachtete seinen Onkel. »Zumindest nehme ich es an.«
»Es war ein riesiges Krokodil. Mindestens zweitausend Pfund schwer«, sagte Sam. »Da kann von Aberglauben kaum die Rede sein, es handelt sich nur um ein hungriges Krokodil und ein paar Leute, die nicht aufgepasst haben, was um sie herum passiert.«
»Wird Leonid jetzt Schwierigkeiten haben, jemanden zu finden, der ihm hilft?«, fragte Remi.
Ricky senkte den Blick. »Nicht sehr viele Leute sind bereit, sich für ein paar Dollar pro Tag ins Jagdgebiet der Krokodile zu wagen«, erklärte er.
Sam fing Remis Gesichtsausdruck auf und warf einen Blick in den Rückspiegel.
»Nein, das glaube ich auch nicht.« Allen war klar, dass Leonids Projekt soeben auf ein Hindernis gestoßen war, wenn nicht sogar auf eine solide Mauer. »Ich kann nicht glauben, dass niemand ein Gewehr bei sich hat, wenn doch allgemein bekannt ist, dass in dieser Gegend Krokodile vorkommen.«
Ricky schüttelte den Kopf. »Gewehre sind hier verboten. Und zwar seit die australische Friedenstruppe das Kommando übernommen hat.«
»Das ist sicher ein großer Vorteil für die Krokodile«, sagte Remi mit einem Anflug von Spott in der Stimme.
Sie passierten den westlichsten Punkt der Insel und fuhren weiter nach Osten in Richtung der Hauptstadt Honiara, wo laut Ricky das einzige funktionsfähige Krankenhaus der Insel stand. Als sie vor dem Eingang zur Notaufnahme anhielten, waren sechsundzwanzig Minuten verstrichen, und Rickys Onkel befand sich in einem kritischen Zustand. Ricky sprang aus dem Wagen, um zu helfen, und wenige Sekunden später kamen zwei Insulaner, begleitet von einer Frau in einem grünen Arztkittel, mit einer fahrbaren Krankenbahre im Laufschritt aus dem Gebäude.
Remi fing den Blick der Frau auf, während sie sich dem Wagen näherte. Sie sah wie eine Inselbewohnerin aus, aber ihr Haar war ganz anders frisiert, als sie es bei den Einheimischen gesehen hatte, die ihr bisher begegnet waren, und ihr Auftreten erregte augenblicklich Aufmerksamkeit. Trotz ihrer beinahe mädchenhaften Erscheinung und der Tatsache, dass sie noch relativ jung war, hatte sie offenbar eine leitende Position inne. Als sie vor dem Land Rover stehen blieb, musterte sie Remi und Sam mit einem kurzen prüfenden Blick, ehe sie sich um die Verletzungen des Mannes auf dem Rücksitz kümmerte.
»Wann ist das passiert?«, fragte sie. Ihr Englisch hatte einen deutlichen australischen Akzent.
»Vor einer halben Stunde. Ein Krokodil auf der Ostseite der Insel«, erwiderte Remi.
Der Frau reichte offenbar ein Blick auf den blutenden Mann, um seinen Gesamtzustand einzuschätzen. Sie untersuchte flüchtig den zerfleischten Unterschenkel, ehe sie sich an ihre Helfer wandte und ihnen auf Pidgin-Englisch im Maschinengewehrtempo Anweisungen gab. Die Männer beugten sich in den Wagen und zogen Benjis reglose Gestalt behutsam heraus. Sie legten ihn auf die Krankenbahre, die aussah, als hätte sie schon die Besetzung der Insel durch die Japaner überlebt, und kontrollierten den behelfsmäßigen Druckverband. Sams und Remis Zweifel hinsichtlich der Behandlung, die ihm zuteilwürde, erahnend, schürzte die Frau die Lippen.
»Keine Sorge. Die Geräte im OP sind in einem besseren Zustand als dieses Altertümchen.« Sie streckte eine Hand aus. »Dr. Carol Vanya«, stellte sie sich vor. »Ich bin hier die leitende Ärztin.« Remi ergriff die Hand und schüttelte sie, dann folgte Sam ihrem Beispiel.
»Sam und Remi Fargo«, sagte er.
Dr. Vanya musterte sie einige Sekunden lang, dann machte sie kehrt, um den Sanitätern zu folgen, die Benji ins Krankenhaus schoben. »Wenn Sie mich entschuldigen, die Pflicht ruft. Sie können in der Notaufnahme warten. Dort finden Sie eine Sitzbank und eine zehn Jahre alte Ausgabe der Times. Ach ja, die Aderpresse ist richtig gut.«
Ehe die Fargos etwas erwidern konnten, war sie bereits im Gebäude verschwunden. Sam betrachtete den großen Blutfleck auf dem Autositz, dann schaute er an sich herab und bemerkte rostbraune Blutspritzer auf seiner Kleidung. Sie waren erst vor ein paar Stunden auf der Insel gelandet und hatten bereits tatkräftig geholfen, einen Mann zu retten, der in diesem Moment um sein Leben kämpfte.
Ein schlimmer Auftakt zu einem eigentlich harmlosen Unterwasserabenteuer und ein böses Omen für ihren weiteren Aufenthalt auf den Salomon-Inseln.
5
Einige Minuten später rollte Leonids Pick-up auf den Parkplatz und stoppte neben dem SUV. Leonid stieg aus und gab dem Fahrer mit der Hand ein Zeichen. Der Mann fuhr sofort an und kurvte in einer Abgaswolke zurück auf die Hauptstraße. Der Russe kam mit sorgenvoller Miene auf Sam zu.
»Hat er es geschafft?«, fragte er.
»So gerade noch«, sagte Sam. »Es wird auf jeden Fall eine ganz knappe Angelegenheit.«
»Der arme Kerl. Was für eine schreckliche Art zu sterben.«
»Ich kann nicht glauben, dass man euch nicht vor den Krokodilen gewarnt hat«, sagte Remi.
»Doch, das haben sie schon getan. Deshalb hatten sie auch die Macheten und die Äxte.«
Sam sah Leonid vielsagend an. »Ein paar Kalaschnikows wären besser gewesen.«
»Eins kannst du mir glauben, mein Freund, wenn es auf dieser Insel welche gäbe, dann hätte ich sie gehabt.«
»Wo ist deine Mannschaft?«, fragte Remi.
»Wieder in der Bucht. Sie sind gerade dabei, alles zusammenzupacken und mit den Booten und der Ausrüstung auf dem Wasserweg zurückzukehren. Niemand wollte mit mir fahren. Ich habe das Gefühl, dass sie mir aus irgendeinem Grund die Schuld am Schicksal ihres Freundes geben.« Er hielt für einen Moment inne. »Hast du die Ausmaße dieser Bestie gesehen? Sie war länger als der Wagen.«
»Und in dieser Gegend hat sie vielleicht noch ein paar Verwandte«, sagte Sam.
Remi nickte. »Und die sind sicher ziemlich sauer. Und nehmen die Tatsache, dass ihr Gefährte niedergemetzelt wurde, möglicherweise persönlich.«
Leonid riss erschrocken die Augen auf. »Ich habe nichts getan!«
Sam lächelte Remi traurig an. »Uns brauchst du das nicht zu erklären. Spar es dir für die Krokodile auf.«
Sie begaben sich in das Gebäude, das genauso armselig eingerichtet war, wie seine Fassade vermuten ließ. Der Warteraum der Notaufnahme war ein trister rechteckiger Raum mit mangelhafter Belüftung und einem guten Dutzend Kranker oder Leichtverletzter, die, auf mehrere ramponierte Bänke verteilt, darauf warteten, dass man sich ihrer annahm. Ricky hatte auf einer der hinteren Bänke einen freien Platz gefunden und starrte ins Leere. Sie gingen zu der Bank und ließen sich neben ihm nieder. An der Decke rotierten Ventilatoren träge in dem vergeblichen Bemühen, die stickige Luft zu kühlen. Nachdem sie ein paar Minuten lang in der Schwüle des Warteraums geschwitzt hatte, stand Remi wieder auf. »Ich warte draußen.«
Sam erhob sich ebenfalls, und Leonid folgte seinem Beispiel. »Wir leisten dir Gesellschaft.«
Remi wandte sich an Ricky. »Sagst du uns Bescheid, wenn du etwas erfährst?«
»Ja.« Ricky war nicht anzumerken, dass ihm die Hitze etwas ausmachte. »Dr. Vanya ist die Beste, die wir haben. Er ist in guten Händen.«
»Wenigstens in dieser Hinsicht hatte er Glück im Unglück«, sagte Remi und wischte sich mit einem Taschentuch die Stirn ab.
Ein alter Mann, der in der Nähe saß, wurde von einem heftigen Husten geschüttelt. Sam ergriff Remis Hand und ging mit ihr zum Ausgang. Draußen herrschte eine glühende Hitze, aber dank einer leichten Brise fühlte sich die Luft erfrischender an als im Warteraum, der dagegen die reinste Sauna war. An der Seitenfront des Gebäudes fanden sie ein schattiges Plätzchen, und Sam inspizierte sein Oberhemd.
»Ich glaube, es dürfte ganz sinnvoll sein, zum Hotel zu fahren, um frische Kleidung anzuziehen.« Er sah zu Remi hinüber, deren Bluse und Hose ebenfalls mit eingetrockneten Blutspritzern übersät waren. »Sollen wir den kleinen Abstecher machen?«
Remi betrachtete den Land Rover. »Wenn wir außerdem noch an einer Autowaschanlage vorbeifahren, bin ich dabei.«
Leonid nickte. »Ich fahre euch. Es hat keinen Sinn, hier in der Hitze zu schmoren.«
Sie stiegen ins SUV, und Leonid übernahm das Lenkrad. Nach der Höllenfahrt von der Bucht landeinwärts kam es ihnen bei der gemäßigten Fahrweise des Russen vor, als kämen sie nicht vom Fleck. Leonid hatte das Gesicht verzogen, als hätte er eine Flasche Essig intus, während er den Land Rover über Straßen navigierte, auf denen überraschend dichter Verkehr herrschte.





























